[1]Einleitung
I. Der wissenschaftsgeschichtliche Hintergrund, S. 3. – 1. Der Herrschaftsbegriff, S. 4. – 2. Herrschaftsverbände, S. 16. – 3. Herrschaftsformen, S. 23. – 4. Herrschaft und Legitimität, S. 42. – II. Die „Herrschaftssoziologie“ im Werk Max Webers, S. 49. – 1. Die ältere Fassung, S. 49. – 2. Die „Herrschaftssoziologie“ im Kontext der älteren Fassung von „Wirtschaft und Gesellschaft“, S. 75. – 3. Die Weiterentwicklung nach 1914 – Schritte zur jüngeren Fassung, S. 84.
Dieser Band umfaßt die nachgelassenen Texte Max Webers zur „Herrschaft“, die er in den Jahren vor dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges niedergeschrieben hat.
1
Zu seinen Lebzeiten hat er das umfangreiche Manuskript nicht in den Druck gegeben. Erst nach seinem Tod fand Marianne Weber das Teilkonvolut zu dem großen Beitrag „Wirtschaft und Gesellschaft“ und hat es postum in der vierten und letzten Lieferung dieses Werks veröffentlicht.[1] Gemeint sind folgende Kapitel des dritten Teils von „Wirtschaft und Gesellschaft“: „I. Herrschaft“, in: WuG1, S. 603–612, „V. Legitimität“, ebd., S. 642–649, „VI. Bürokratie“, ebd., S. 650–678, „VII. Patrimonialismus“, ebd., S. 679–723, „VIII. Wirkungen des Patriarchalismus und des Feudalismus. Feudalismus“, ebd., S. 724–752, „IX. Charismatismus“, ebd., S. 753–757, „X. Umbildung des Charisma“, ebd., S. 758–778, „XI. Staat und Hierokratie“, ebd., S. 779–817.
2
Im Erstdruck umfassen die Ausführungen zur Herrschaft ungefähr zweihundert Druckseiten. Die vollständige Druckvorlage ist nicht überliefert, jedoch konnten im Verlauf der Editionsarbeiten einige handschriftlich verfaßte Seiten des Originalmanuskripts aufgefunden werden. Die vierte Lieferung von „Wirtschaft und Gesellschaft“ erschien im September 1922 (vgl. dazu unten, S. 92). Die zugehörige Bereichsüberschrift „Typen der Herrschaft“ wurde von den Erstherausgebern eingefügt und umschloß den Textbestand WuG1, S. 601-817 (vgl. dazu unten, S. 109 f.).
3
Diese vermitteln einen Eindruck von der Arbeitsweise Max Webers und den Herausforderungen, die diese Vorlage an die Erstherausgeber und Setzer gestellt hat. Mehrfache Textüberarbeitungen lassen sich daran ablesen. Vgl. den Manuskripteinschub zum Text „Staat und Hierokratie“, unten, S. 587–609, sowie die entsprechenden Erläuterungen im Editorischen Bericht, unten, S. 572–578.
[2]Ιn den uns überlieferten und von Marianne Weber in Zusammenarbeit mit Melchior Palyi veröffentlichten Abschnitten behandelt Max Weber – unter Rückgriff auf sein breites universalhistorisches Wissen – die Grundformen der Herrschaft: Bürokratismus, Patrimonialismus, Feudalismus und Charismatismus sowie das Verhältnis von politischer und hierokratischer Herrschaft. Ein kurzer einleitender Abschnitt präzisiert den Herrschaftsbegriff, stellt das Thema in den Zusammenhang des Handbuchbeitrags „Wirtschaft und Gesellschaft“ und legt die konzeptionelle Basis für die später weiterentwickelte Typologie der Herrschaft. Obwohl die Vorkriegsfassung der Herrschaftssoziologie von Max Weber selbst nicht als veröffentlichungsreif angesehen worden ist und ihr eine abschließende Bearbeitung für die Drucklegung fehlt, ist sie werkbiographisch von großer Bedeutung. Sie dokumentiert erstmals im Werk die Konzeption einer Herrschaftssoziologie und die damit verbundene Begründung eines neuen Forschungsschwerpunkts, den Max Weber bis zu seinem Tod verfolgt und weiterentwickelt hat. Das Thema wird in anderen Werkzusammenhängen fortgeführt, beispielsweise im Anhang zur Einleitung in die „Wirtschaftsethik der Weltreligionen“,
4
in den Vorträgen „Probleme der Staatssoziologie“ (Wien, 1917)[2] Weber, Einleitung, S. 28–30 (MWG I/19, S. 119–127); die Einleitung war zuerst im Oktober 1915 erschienen.
5
und „Politik als Beruf“ (München, 1919), Der namentlich nicht gekennzeichnete Bericht über Weber, Probleme der Staatssoziologie, erschien am 26. Oktober 1917 in der Wiener „Neuen Freien Presse“. Vgl. dazu unten, S. 745–756.
6
aber auch in der letzten Münchener Vorlesung „Allgemeine Staatslehre und Politik (Staatssoziologie)“. Weber, Politik als Beruf, MWG I/17, S. 157–191.
7
Ihre systematisch und definitorisch vollendete Form findet die Herrschaftssoziologie in dem Kapitel „Die Typen der Herrschaft“, das Max Weber als Teil der ersten Lieferung von „Wirtschaft und Gesellschaft“ kurz vor seinem Tod in den Druck gegeben hat. Da diese jüngere Fassung von Weber autorisiert ist, hat sie einen anderen Status und erscheint in Band I/23 der Max Weber-Gesamtausgabe. Zu der Vorlesung „Staatssoziologie“ im Sommersemester 1920 sind eine eigenhändige Vorlesungsankündigung Max Webers sowie zwei Mit- bzw. Nachschriften (MWG III/7) erhalten, vgl. dazu unten, S. 91.
8
Weber, Max, Die Typen der Herrschaft, WuG1, S. 122–176 (MWG I/23).
Der hier vorgelegte Band präsentiert hingegen die frühe Fassung der Herrschaftssoziologie als eigenständigen Textkorpus und fügt ihr den ebenfalls postum veröffentlichten Text „Die drei reinen Typen der legitimen [3]Herrschaft“
9
sowie einen Bericht über den Wiener Vortrag „Probleme der Staatssoziologie“ bei.[3] Weber, Die drei reinen Typen, unten, S. 717–742, waren im Januar 1922 zuerst in den „Preußischen Jahrbüchern“ erschienen.
10
Beide Texte bilden entscheidende Zwischenglieder zwischen der älteren und jüngeren Fassung der Herrschaftssoziologie. Die Edition bietet damit die Möglichkeit, die werkbiographische Genese der Herrschaftssoziologie vollständig zu betrachten. Weber, Probleme der Staatssoziologie, unten, S. 745–756.
Für die ältere Fassung der Herrschaftssoziologie ist kein Originaltitel überliefert. Die neue Bandüberschrift „Herrschaft“ charakterisiert den hier edierten Textbestand gegenüber den anderen nachgelassenen Teilbeständen zu „Wirtschaft und Gesellschaft“ und weist zugleich auf das Unabgeschlossene der vorliegenden Textfassung hin. Die in der Forschung übliche Bezeichnung „Herrschaftssoziologie“ konnte nicht als Bandtitel übernommen werden, da es sich hierbei nicht um einen von Max Weber verwendeten Titel, sondern lediglich um eine Zuschreibung handelt, die er erst im Zuge der Neufassung von „Wirtschaft und Gesellschaft“ vorgenommen hat.
11
Die Vorkriegsfassung umschrieb Weber zum Zeitpunkt ihrer Entstehung als „Analyse der ‚Herrschaft‘“ oder „Kasuistik der Herrschaftsformen“, Vgl. die Textverweise auf die „Herrschafts- und Rechtssoziologie“ bzw. auf die „Soziologie der Herrschaft“ in: Weber, Max, Soziologische Grundbegriffe, WuG1, S. 1–30 (MWG I/23), Zitate: S. 19, 27.
12
aber auch als seine „soziologische Staats- und Herrschafts-Lehre“. Vgl. z. B. Weber, Hausgemeinschaften, MWG I/22-1, S. 151; ders., Recht § 5, S. 4 (WuG1, S. 486) und ders., Religiöse Gemeinschaften, Abschnitt 5, MWG I/22-2, S. 194, 199; vgl. auch die Tabellarische Übersicht über die Pauschalverweise auf die „Herrschaftssoziologie“, unten, S. 83 f.
13
Wenn in dieser Einleitung dennoch von Max Webers „Herrschaftssoziologie“ gesprochen wird, so stellt dies die inhaltliche Verbindung zwischen den beiden, im Kontext des Beitrags „Wirtschaft und Gesellschaft“ entstandenen Textfassungen her. Vgl. den Brief Max Webers an Paul Siebeck vom 30. Dez. 1913, MWG II/8, S. 448–450, hier: S. 450.
I. Der wissenschaftsgeschichtliche Hintergrund
Im gesamten Briefwerk Max Webers gibt es kaum eine zweite Stelle, in der er so überzeugt und enthusiastisch eine eigene Arbeit angekündigt hat wie Ende 1913 in einem Brief an seinen Verleger Paul Siebeck: „Da Bücher ja – ‚Entwicklungsstufen‘ – ganz unzulänglich ist, habe ich eine [4]geschlossene soziologische Theorie und Darstellung ausgearbeitet, welche alle großen Gemeinschaftsformen zur Wirtschaft in Beziehung setzt: von der Familie und Hausgemeinschaft zum ‚Betrieb‘, zur Sippe, zur ethnischen Gemeinschaft, zur Religion […], endlich eine umfassende soziologische Staats- und Herrschafts-Lehre. Ich darf behaupten, daß es noch nichts dergleichen giebt, auch kein ,Vorbild‘.“
14
Es ist sicherlich nicht vermessen, die Aussage Max Webers, daß er etwas völlig Neues und Exzeptionelles geschaffen habe, gerade auf die letztgenannte „Staats- und Herrschafts-Lehre“ zu beziehen, zumal sie in diesem Brief das erste Mal namentlich erwähnt wird. Worin bestand das spezifisch Neue der von Weber angekündigten soziologischen Herrschaftslehre? Wodurch unterschied sie sich von anderen Ansätzen und Entwürfen? Ein Blick auf die zeitgenössische wissenschaftliche Diskussion soll Anhaltspunkte zur Beantwortung dieser Frage liefern und stärker sichtbar machen, wodurch sich die „Herrschaftssoziologie“ in ihrer Konzeption und den ihr zugrundeliegenden Begriffsbestimmungen auszeichnete. Zugleich soll aber auch an ausgewählten und herrschaftssoziologisch relevanten Begriffen der wissenschaftshistorische Kontext beleuchtet werden, in dem Max Webers Herrschaftslehre entstanden ist. Dazu wurden allgemein bekannte Standardwerke der rechts-, sozial- und geisteswissenschaftlichen Disziplinen der Jahrhundertwende sowie von Weber nachweislich benutzte Schriften herangezogen. [4] Brief Max Webers an Paul Siebeck vom 30. Dez. 1913, MWG II/8, S. 449 f.
1. Der Herrschaftsbegriff
Der Sache nach einverstanden, aber trotzdem nicht ganz zufrieden, äußerte sich Max Weber Ende 1910 zu dem gerade erschienenen Buch von Robert Michels, das die oligarchischen Tendenzen im modernen Parteienleben behandelt hatte und dem „lieben Freunde Max Weber“ gewidmet war.
15
Am Ende seines Briefes an Michels kehrte Weber zu seinem Hauptkritikpunkt zurück: „Alles in Allem: der Begriff ,Herrschaft‘ ist nicht eindeutig. Er ist fabelhaft dehnbar. Jede menschliche[,] auch gänzlich individuel[5]le, Beziehung enthält Herrschafts-Elemente, vielleicht gegenseitige (dies ist sogar die Regel, so. z. B. in der Ehe). In gewissem Sinn herrscht der Schuster über mich, in gewissem andren ich über ihn – trotz seiner Unentbehrlichkeit u. alleinigen Competenz. Ihr Schema ist zu einfach. Aber Ihr Buch fördert die Sache sehr.“ Vgl. Michels, Robert, Zur Soziologie des Parteiwesens in der modernen Demokratie. Untersuchungen über die oligarchischen Tendenzen des Gruppenlebens. – Leipzig: Werner Klinkhardt 1911 (hinfort: Michels, Parteiensoziologie). Die Widmung lautete: „Seinem lieben Freunde Max Weber in Heidelberg, dem Geraden, der, insofern es das Interesse der Wissenschaft erheischt, vor keiner Vivisektion zurückscheut, mit seelenverwandtschaftlichem Gruße gewidmet“, ebd., S. lII.
16
Obwohl Robert Michels die Führungs- und Herrschaftsstrukturen der modernen Parteien untersucht hatte, stand der Herrschaftsbegriff dennoch nicht – wie man aufgrund der Kritik Max Webers vermuten könnte – im Mittelpunkt seiner sozialpsychologisch ausgerichteten Analyse. Es ging Michels vorrangig um das Phänomen der Oligarchisierung und der Bürokratisierung in den modernen Arbeiterparteien. Auch wenn Max Weber seinen Unmut an dem jüngeren Kollegen ausließ, weist seine Kritik auf einen allgemeineren Mangel hin: das Fehlen eines präzisen sozialwissenschaftlichen Herrschaftsbegriffs. [5] Brief Max Webers an Robert Michels vom 21. Dez. 1910, MWG II/6, S. 754–761, Zitat: S. 761; vgl. dazu auch die Anspielung im Text „Herrschaft“, unten, S. 136 f. mit Anm. 24.
Einen exakten und quasi kanonisierten Herrschaftsbegriff gab es hingegen in der Jurisprudenz der Jahrhundertwende. In Anlehnung an Georg Friedrich von Gerber hatte Paul Laband den Staat durch seine Herrschaftsfunktion definiert: „der Staat allein herrscht über Menschen. Es ist dies sein specifisches Vorrecht, das er mit Niemandem theilt“, denn „Herrschen ist das Recht, freien Personen (und Vereinigungen von solchen) Handlungen, Unterlassungen und Leistungen zu befehlen und sie zur Befolgung derselben zu zwingen.“
17
Paul Laband galt als einer der wichtigsten Staatsrechtslehrer des Deutschen Kaiserreichs; mit seinem mehrbändigen Handbuch „Staatsrecht des Deutschen Reiches“, das in erster Auflage zwischen 1876 und 1882 erschienen war, verband er auch den Anspruch, die Reichsverfassung von 1871 wissenschaftlich zu fundieren. Laband, Paul, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, Band 1, 4. Aufl. – Tübingen, Leipzig: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) 1901, S. 64 (hinfort: Laband, Staatsrecht I4).
18
Methodisch fühlte er sich einer strengen juristischen Dogmatik und einer „logische[n] Beherrschung“ des „positiven Rechtsstoffes“ durch exakte Begriffsbildung verpflichtet. Vgl. Laband, Vorwort zur 1. Aufl., ebd., S. VI.
19
Bis zum Erscheinen der „Allgemeinen Staatslehre“ von Georg Jellinek im Jahre 1900 galt sein Handbuch als das Standardwerk zum deutschen Staatsrecht. Paul Laband präzisierte den Herrschaftsbegriff um die Vollstreckungs- und Strafgewalt, da es entscheidend sei, den Gehorsam bzw. die „Befolgung von Befehlen“ notfalls durch „die Anwendung physischer Gewalt zu erzwingen“. Laband, Vorwort zur 2. Aufl., ebd., S. IX.
20
Ei[6]gens wies Laband darauf hin, daß der überwiegende Teil der staatlichen Tätigkeit sich ohne die Ausübung von Herrschaftsrechten vollziehe, Vgl. ebd., S. 67.
21
daß aber die durch die Rechtsordnung vorgesehene Möglichkeit der Androhung und Anwendung von Gewalt das Hauptmerkmal seiner begrifflichen Erfassung darstelle. Die Herrschaftsgewalt stehe nur dem Staat, und das hieß: weder Vereinigungen noch Privatleuten, zu. Entgegen anderer Forschungsmeinungen behauptete Laband, daß das Privatrecht, insbesondere das Schuldrecht, keinerlei Herrschaftsrechte begründen könne.[6] Vgl. ebd., S. 65.
22
Auch in einer Kernfrage des öffentlichen Rechts vertrat Laband – wohl auch aus sehr praktischen verfassungsrechtlichen Gründen – die Ansicht, daß das Kriterium der Souveränität im Vergleich zur Herrschaftsfunktion des Staates zu vernachlässigen sei. Vgl. ebd., S. 62–64; hier richtete sich Laband namentlich gegen Rosin, Heinrich, Souveränetät, Staat, Gemeinde, Selbstverwaltung. Kritische Begriffsstudien, in: Annalen des Deutschen Reichs für Gesetzgebung, Verwaltung und Statistik, Jg. 1883, S. 265–322, der die „Herrschaftsrechte als Rechte aus eigener Macht des Berechtigten“ definiert und damit die Grenzen von öffentlichen Herrschafts- und privaten Forderungsrechten verwischt habe (Laband, Staatsrecht I4 (wie oben, S. 5, Anm. 17), S. 62). Vgl. zu der Frage auch den Beitrag von Sohm, Rudolph, Der Begriff des Forderungsrechts, in: Zeitschrift für das Privat- und Öffentliche Recht der Gegenwart, Band 4, 1877, S. 457–474.
23
In seiner begriffslogisch angelegten Staatslehre wurde die Funktion des Staates zu herrschen allen anderen Bestimmungsgründen konsequent vorangestellt. Aus diesem Grund erteilte er bereits im Vorwort seines Handbuchs „alle[n] historischen, politischen und philosophischen Betrachtungen“ eine Absage. Diese Klassifikation der „Souveränität“ bot die theoretische Grundlage dafür, daß die deutschen Einzelstaaten trotz des Zusammenschlusses im Deutschen Reich ihre Staatlichkeit bewahren konnten.
24
Dies handelte ihm, wie später zu zeigen sein wird, den Protest all derer ein, die älteren ethisch-philosophischen Theorien, romantischen oder organischen Staatsvorstellungen anhingen. Ebenso stieß er die Richtung der Staatszwecklehre mit einer knappen Bemerkung zurück: „Die Zwecke, zu welchen die Staatsgewalt Verwendung findet, unterliegen einem stetigen Wechsel und sind nicht durch einen Rechtsbegriff zu bestimmen“. Laband, Staatsrecht I4 (wie oben, S. 5, Anm. 17), Vorwort zur 2. Aufl., S. IX.
25
Außerdem grenzte sich Laband von denjenigen ab, die den Staat zwar durch den Herrschaftsbegriff bestimmten, damit aber politisch rückwärtsgewandte Verfassungszustände herbeiführen wollten, wie z. B. Max von Seydel und Conrad Bornhak mit der von ihnen vertretenen „Herr[7]schertheorie“ oder Carl Ludwig von Haller mit der von ihm entwickelten „Patrimonialtheorie“. Ebd., S. 67.
26
Laband beanspruchte nicht, die Entstehung des Staates zu erklären oder ihn philosophisch zu begründen, sondern widmete sich mit bestechender Konsequenz der gestellten Aufgabe, den Staat ausschließlich durch juristische Kategorien zu bestimmen. [7] Zur „Herrschertheorie“ vgl. Jellinek, Georg, System der subjektiven öffentlichen Rechte, 2. Aufl. – Tübingen: J.C.B, Mohr (Paul Siebeck) 1905, S. 35 (hinfort: Jellinek, System2); sowie zur „Patrimonialtheorie“ ders., Allgemeine Staatslehre, 2. Aufl. – Berlin: O. Häring 1905, S. 192 f. (hinfort: Jellinek, Staatslehre2). Vgl. dazu auch den Überblicksartikel von Loening, Edgar, Der Staat (Allgemeine Staatslehre), in: HdStW3, Band 7, 1911, S. 692–727, hier: S. 694–697.
Georg Jellinek, der bezüglich seiner Begriffsstringenz dem staatsrechtlichen Positivismus der Gerber-Laband-Richtung, in erkenntnistheoretischer Hinsicht aber dem Neukantianismus zuzurechnen ist, sprach von der „Herrschaft“ ebenfalls als dem „spezifische[n] Machtmittel des Staates“
27
und dem „Imperium“ als der „Herrschafts- und Zwangsgewalt“. Jellinek, Staatslehre2 (wie oben, Anm. 26), S. 119.
28
„Herrschen heißt unbedingt befehlen und Erfüllungszwang üben können. Jeder Macht kann der Unterworfene sich entziehen, nur der Herrschermacht nicht. […] Die mit solcher Macht ausgerüstete Gewalt ist Herrschergewalt und damit Staatsgewalt.“ Ebd., S. 213.
29
Jellinek weitete die Staatsbestimmung jedoch auf andere Kriterien aus, von denen später die Rede sein soll. Zusammengefaßt läßt sich der Herrschaftsbegriff nach der positivistischen Lehrmeinung durch ein unbedingtes Befehl-Gehorsam-Verhältnis charakterisieren, das durch die Rechtsordnung begründet ist und dem ein Zwangsmoment innewohnt, das notfalls mit Gewalt vollstreckt wird. Eine solche umfangreiche Machtbefugnis stehe nur dem Staat, aber keiner privaten Person oder Vereinigung zu. Ebd., S. 415 f.
Max Weber entschied sich gleich zu Beginn der älteren Fassung der „Herrschaftssoziologie“, den Herrschaftsbegriff auf die „Herrschaft kraft Autorität“
30
zuzuspitzen. Alle seine Herrschaftsdefinitionen bis hin zur jüngeren Fassung von 1919/20 enthalten im Kern das Element von Befehl und Gehorsam, Vgl. unten, S. 129.
31
und selbst freiwillig eingegangene Gefolgschaftsverhältnisse sind danach Autoritätsverhältnisse – Gehorsam ist Pflicht. Vgl. die Definitionen in dem Text „Herrschaft“, unten, S. 135, und in dem Text „Die drei reinen Typen“, unten, S. 726, aber auch in: Weber, Kategorien, S. 278, und Weber, Max, Die Typen der Herrschaft, in: WuG1, S. 122 (MWG I/23).
32
Max [8]Weber stellte das Zwangs- und Rechtsmoment der Herrschaftsausübung in einen entwicklungshistorischen Zusammenhang und beschrieb es mit der griffigen Formel der „Monopolisierung der legitimen Gewaltsamkeit“ durch den politischen Verband bzw. den Staat. Vgl. den Text „Charismatismus“, unten, S. 462 f.
33
Daß im modernen Verfassungsstaat die Ausübung der Herrschaftsrechte ausschließlich den Staatsorganen zustehe, läßt sich aus einer ironischen Nebenbemerkung zu Beginn der „Herrschaftssoziologie“ ablesen.[8] Vgl. Weber, Politische Gemeinschaften, MWG I/22-1, S. 209.
34
Dort spielt Max Weber auf die unter Juristen heftig debattierte Streitfrage an, ob es privatrechtlich begründete Herrschaftsansprüche, z. B. des Gläubigers gegen den Schuldner, geben könne. Hätte der Einzelne Befehlsgewalt, dann wäre das staatliche Gewaltmonopol hinfällig und somit könnte man, wie Weber schrieb, „den gesamten Kosmos des modernen Privatrechts als eine Dezentralisation der Herrschaft in den Händen der kraft Gesetzes ,Berechtigten‘ auffassen,“ Vgl. unten, S. 128 f.
35
Wie kompliziert die Frage war, machen auch die Studien von Gerhard Alexander Leist zum Vereinsrecht deutlich. Vgl. unten, S. 128. Max Weber folgt hier wohl der Darstellung von Laband, vgl. dazu die Ausführungen oben, S. 6 mit Anm. 22.
36
Das neue Bürgerliche Gesetzbuch behandelte die Vereine als privatrechtliche Einrichtungen, konnte aber nicht verhindern, daß diese in der Praxis in einem hohen Maße „Herrschaft“ über ihre Mitglieder ausübten, vor allem wenn es sich um Vereine mit Vermögenseinlagen handelte. Vgl. Leist, Alexander, Vereinsherrschaft und Vereinsfreiheit im künftigen Reichsrecht. – Jena: Gustav Fischer 1899; ders., Untersuchungen zum inneren Vereinsrecht, mit Beiträgen zum Recht der Aktiengesellschaften, Gesellschaften mit beschränkter Haftung und Genossenschaften. – Jena: Gustav Fischer 1904 (hinfort: Leist, Untersuchungen); ders., Das Vereinswesen und seine Bedeutung. Vortrag gehalten in der Gehe-Stiftung zu Dresden am 16. Januar 1909, in: Vorträge der Gehe-Stiftung zu Dresden, Band 1. – Leipzig, Dresden: B. G. Teubner 1909, S. 1–24 (= S. 135–156).
Wie eng der Herrschaftsbegriff auch bei Max Weber mit dem Staatsbegriff verknüpft ist, spiegelt sich in der Charakterisierung seiner „Herrschaftssoziologie“ als „Staats- und Herrschafts-Lehre“,
37
aber auch in seiner späten, ausgereiften Staatsdefinition wider. In „Politik als Beruf“ heißt es, daß der moderne Staat „ein anstaltsmäßiger Herrschaftsverband ist, der innerhalb eines Gebietes die legitime physische Gewaltsamkeit als Mittel der Herrschaft zu monopolisieren mit Erfolg getrachtet hat und zu diesem Zweck die sachlichen Betriebsmittel in der Hand seiner Leiter vereinigt“. Brief Max Webers an Paul Siebeck vom 30, Dez, 1913, MWG II/8, S. 450.
38
In dieser Art der nüchternen, funktionalistischen und sehr präzi[9]sen Begriffsbestimmung ist Webers Prägung durch die Begriffsjurisprudenz der Laband-Richtung besonders greifbar. Mehrfach bedauerte er, daß die Soziologie, solange ihr kein eigener ausgearbeiteter Begriffsapparat zur Verfügung stehe, auf die exakte Begrifflichkeit der Jurisprudenz angewiesen sei. Weber, Politik als Beruf, MWG I/17, S. 166 f.
39
Vergleichbar mit Labands Ansatz ist auch die Grundsatzentscheidung Max Webers, außer der Herrschaftsfunktion des Staates alle anderen Bestimmungsgründe zu vernachlässigen. Aus diesem Grund wird man in der „Herrschaftssoziologie“ jede Form von „Staatsmetaphysik“[9] Vgl. unten, S. 138, sowie Weber, Probleme der Staatssoziologie, unten, S. 752.
40
oder die Behandlung von Souveränitäts- und Vertragstheorien vergeblich suchen, Weber, Objektivität, S. 74, und (ironisch unterlegt) unten, S. 529.
41
und selbst die Klassiker der politischen Theorie treten, wenn überhaupt, lediglich marginal in Erscheinung. Vgl. die Erwähnung der „Volkssouveränität“ (nicht auf China anwendbar), unten, S. 463, und der „Gemeindesouveränität“ von Sekten, unten, S. 671. Die klassischen Vertragstheorien nach Hobbes und Locke werden nicht erwähnt; eine intensivere Auseinandersetzung mit den dafür bedeutsamen Naturrechtslehren findet sich in der „Rechtssoziologie“ (vgl. Weber, Recht § 7; WuG1, S. 495–502).
42
– Und doch umreißt das bisher Angeführte nur Teilaspekte des Herrschaftsbegriffs bei Max Weber. So Montesquieu und Rousseau, vgl. unten, S. 404 und 678 f.
Die zeitgenössischen Verfassungshistoriker, Nationalökonomen, Politikwissenschaftler und Soziologen verfolgten andere Erkenntnisinteressen als die durch den rein juristischen Herrschaftsbegriff abgedeckten und formulierten diese teilweise schon in der Kritik zu Laband recht deutlich. Die grundsätzlichste Auseinandersetzung mit dem „Staatsrecht“ von Laband erfolgte durch Otto von Gierke, der als letzter großer Gelehrter der deutschen Rechtsschule galt oder – wie Max Weber es formulierte – als Vertreter der „,organische[n] Staatslehre‘“.
43
Gierke richtete sich insbesondere gegen die „logisch-formalistische Methode“, die ebenso wie die aufklärerisch-mechanistische Staatsauffassung ohne „Seele“, „Idee“ und „idealen Gehalt“ wäre. Weber, Roscher und Knies I, S. 35 (= S. 1215), Fn. 1.
44
Der Staat sei nicht nur ein „bloßer Herrschaftsapparat“ Gierke, Otto, Labands Staatsrecht und die deutsche Rechtswissenschaft [= Rez. zu Laband, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, 3 Bände], in: Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirthschaft im Deutschen Reich, N. F., 7. Jg., Heft 4, 1883, S. 1097–1195, Zitate: S. 1190, 1192 f. (hinfort: Gierke, Laband-Kritik).
45
oder ein reines Herrschaftsverhältnis „dieser Individuen über jene Individuen“, Ebd., S. 1181.
46
sondern ein „natürlicher und geistig-sittlicher Gesell[10]schaftsorganismus“. Ebd., S. 1129.
47
Zur Untersuchung des Staatslebens und des Rechtsbewußtseins reiche daher die formale Logik alleine nicht aus, sondern es bedürfe der philosophischen Betrachtung, der historischen Methode und der genetischen Erklärung, da das Recht in einem „Kausalitätsverhältnisse“ zu den „übrigen Manifestationen des sozialen Lebens“, d. h. den politischen Zuständen, religiösen und ethischen Anschauungen, wirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen, stehe.[10] Ebd., S. 1149.
48
Eine tief vom römischen Rechtsgedanken geprägte Auffassung wie die Labands sei ohnehin nicht in der Lage, germanisches Rechtsdenken, wie z. B. die Einheit von öffentlichem und privatem Recht, zu begreifen. Ebd., S. 1113 f.
49
Damit sprach Gierke der Labandschen Richtung zugleich jede verfassungshistorische Kompetenz ab. Auch von anderer Seite wurde bemängelt, daß man mit dem modernen staatsrechtlichen Begriffsapparat nicht in der Lage sei, vormoderne Zustände adäquat zu beschreiben. Ebd., S. 1121, 1123.
50
Vgl. z. B. Menzel, Adolf, Begriff und Wesen des Staates, in: Handbuch der Politik, Band 1, 1. Aufl. – Berlin, Leipzig: Walther Rothschild 1912, S. 35–45, hier: S. 41; vgl. dazu auch Jellinek, Staatslehre2 (wie oben, S. 7, Anm. 26), S. 417, und Weber, Feudalismus, unten, S. 410 f.
Otto von Gierke hatte mit seiner Kritik einen fundamentalen Punkt getroffen, der bei allen praktischen Wissenschaften eine große Rolle spielte und die unterschiedlichen erkenntnisleitenden Interessen der verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen widerspiegelte: Wie war eine Erkenntnis der sozialen Wirklichkeit möglich, wenn sie durch die juristische Konstruktion beherrscht wurde? Der Soziologe Ludwig Gumplowicz bäumte sich nicht nur gegen den juristischen Dominanzanspruch auf, sondern fand auch eine anschauliche Metapher, um die Situation zu beschreiben: Die Jurisprudenz verglich er mit der Architektur eines sehr stattlichen und mehrfach erweiterten Schlosses; in diesem würde sich der Jurist in allen Seitengängen und Stockwerken perfekt auskennen, während er bei Verlassen des Gebäudes schon in der näheren Umgebung Orientierungsschwierigkeiten bekäme und sich nicht mehr zurechtfinden könne.
51
Robert Piloty, der in seiner Funktion als Staatsrechtslehrer auch „wissenschaftliche Politik“ lehrte, bemängelte, daß Verfassungsanspruch und Verfassungswirklichkeit oft nicht identisch seien und sich im Rahmen einer gegebenen Verfassung die tatsächlichen Herrschaftsverhältnisse [11]häufig verschieben würden. Vgl. Gumplowicz, Ludwig, Die sociologische Staatsidee, 2. Aufl. – Innsbruck: Wagner 1902, S. 27–30.
52
Nach Webers Ansicht bildete diese Fragestellung – vollzieht sich der Verfassungswandel durch „Rechts-Änderung“ oder durch „politische Wandlung“? – den eigentlichen Ausgangspunkt zu jeder „wissenschaftlichen Behandlung der ,Politik‘‘“.[11] Vgl. Piloty, Robert, Autorität und Staatsgewalt, in: Jahrbuch der Internationalen Vereinigung für vergleichende Rechtswissenschaft und Volkswirtschaftslehre, Band 6 und 7, 1904, S. 551–576, bes. S. 568 (hinfort: Piloty, Autorität und Staatsgewalt).
53
Auch die Nationalökonomie war weniger an abstrakten Staatsdefinitionen interessiert als an der praktischen Bedeutung des Staates für die Volkswirtschaft und die einzelnen Wirtschaftssubjekte. Welche Rahmenbedingungen schuf der Staat für das wirtschaftliche Handeln, und wie verhielt er sich selbst als Wirtschaftssubjekt? Brief Max Webers an Georg Jellinek vorn 27. Aug. 1906, MWG II/5, S. 149.
54
Die historische Schule der Nationalökonomie entwickelte daher keinen eigenen Herrschafts- oder Staatsbegriff, sondern bemühte sich – auch als Antwort auf die marxistische Überbauthese –, den Zusammenhang von Staats- und Wirtschaftsordnung durch entwicklungshistorische Stufenmodelle zu erfassen. Vgl. Scheel, Hans von, Die Politische Ökonomie als Wissenschaft, in: Handbuch der Politischen Ökonomie, hg. von Gustav von Schönberg, Band 1, 4. Aufl. – Tübingen: H. Laupp 1896, S. 77–118, bes. S. 78–80.
55
Zu nennen sind insbes. die unterschiedlichen Ansätze bei Bruno Hildebrand, Karl Bücher und Gustav Schmoller (vgl. dazu den Überblick bei: Below, Georg von, Art. Wirtschaftsstufen, in: Wörterbuch der Volkswirtschaft in zwei Bänden, hg. von Ludwig Elster, Band 2, 3. Aufl. – Jena: Gustav Fischer 1911, S. 1382–84, und Philippovich, Eugen von, Grundriß der Politischen Ökonomie, Band 1, 9. Aufl. – Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) 1911, S. 5 ff.). Karl Bücher war wegen seiner Stufentheorie (vgl. Bücher, Karl, Die Entstehung der Volkswirtschaft. Vorträge und Versuche, 2. Aufl. – Tübingen: H. Laupp 1898, bes., S. 58 ff. (hinfort: Bücher, Volkswirtschaft), mit An- und Unterstreichungen im Handexemplar Max Webers, Arbeitsstelle der Max Weber-Gesamtausgabe, BAdW München) um die Jahrhundertwende besonders scharf angegriffen worden und sollte für das „Handbuch der politischen Ökonomie“ (dem späteren GdS) den einleitenden Beitrag über „Wirtschaftsstufen“ schreiben (vgl. unten, S. 63 und 373).
Georg Jellinek und einige seiner Schüler versuchten, die Spannung zwischen juristischer Begriffsbildung und einer Erfassung der sozialen Wirklichkeit zu lösen. Theodor Kistiakowski behandelte in seiner 1899 erschienenen Studie „Gesellschaft und Einzelwesen“ den Staats- zum Gesellschaftsbegriff unter juristischer und sozialer Perspektive.
56
Jellinek selbst teilte seine „Allgemeine Staatslehre“, die ein Jahr später erschien, in die beiden Bereiche „Allgemeine Staatsrechtslehre“ und „Allgemeine [12]Soziallehre des Staates“ ein. Kistiakowski, Theodor, Gesellschaft und Einzelwesen. Eine methodologische Studie. – Berlin: Otto Liebmann 1899, S. 56–87, bes. S. 72. Kistiakowski studierte zwischen 1901 und 1905 mit Unterbrechungen in Heidelberg und stand seit Anfang 1905 auch in engem Kontakt zu Max Weber (vgl. dazu MWG II/6, S. 796).
57
Vor dem Hintergrund der neukantianischen Scheidung von Sein und Sollen wies er die Rechtswissenschaft als eine Normwissenschaft der Sphäre des Sollens, die Behandlung der historischen Realität und der realen Bedeutung des Rechts hingegen der Sphäre des Seins zu. Diese zu untersuchen sei Aufgabe der Kausalwissenschaften und speziell der sozialen Staatslehre. Im Gegensatz zu seinem Schüler Hans Kelsen ließ Jellinek die beiden Bereiche aber nicht unverbunden nebeneinander stehen, sondern suchte nach methodischen Wegen, sie zu vermitteln. Er entwickelte den „empirischen Typus“ als ein heuristisches Mittel, das es ermöglichen sollte, die typischen Elemente in den staatlichen Erscheinungen und ihren gegenseitigen Beziehungen zu erfassen.[12] So die beiden Überschriften zum zweiten und dritten Buch von Jellinek, Staatslehre2 (wie oben, S. 7, Anm. 26); Hervorhebungen d. Hg.
58
Das Bemühen, Brücken zu schlagen, läßt sich am Aufbau der „Allgemeinen Staatslehre“ ablesen: Staatsrecht und Soziallehre des Staates werden komplementär zueinander behandelt und der „Staat“ in zweifacher Hinsicht definiert. Juristisch gefaßt ist er „die mit ursprünglicher Herrschermacht ausgerüstete Körperschaft eines seßhaften Volkes“, Ebd., S. 32–40.
59
und – in sozialer Hinsicht – besteht er in „Willensverhältnisse[n] Herrschender und Beherrschter, die beide in zeitlicher, in der Regel auch (bei zusammenhängendem Staatsgebiete) in räumlicher Kontinuität stehen“. Ebd., S.176, s. a. S. 420.
60
Ebd., S. 169.
Hans Kelsen, der als Begründer der „reinen Rechtslehre“ gilt, brach – von gleichen Denkvoraussetzungen ausgehend – die Brücken zwischen „normativen“ und „explikativen Disziplinen“ ab.
61
In einem Vortrag, den er im Winter 1911 vor der „Soziologischen Gesellschaft“ in Wien hielt, zog er schärfere Grenzen zwischen juristischer und soziologischer Methode und machte damit die spezifischen Erkenntnisinteressen, aber auch die begrenzten Möglichkeiten des jeweiligen Fachs deutlich. Kelsen, Hans, Hauptprobleme der Staatsrechtslehre, entwickelt aus der Lehre vom Rechtssatze. – Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) 1911, S. VI f. (hinfort: Kelsen, Staatsrechtslehre).
62
Er definierte den Staat unter rein juristischem Aspekt als „Person, das heißt Subjekt von Rechten und Pflichten“, das zu anderen Rechtssubjekten in einem [13]Rechtsverhältnis stehe. Mit dieser Ansicht sei es „aber ganz unvereinbar, das Verhältnis des Staates zu den übrigen Subjekten als ein Herrschaftsverhältnis […] gelten zu lassen.“ Daraus folgerte er streng logisch, daß jedes Herrschafts-, Macht- oder Gewaltverhältnis „rein faktischer Natur“ und insofern „mit den Mitteln juristischer Formalistik nicht ausdrückbar“ sei. Vgl. Kelsen, Hans, Über Grenzen zwischen juristischer und soziologischer Methode. Vortrag, gehalten in der Soziologischen Gesellschaft zu Wien. – Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) 1911; der Vortrag gab die wichtigsten Thesen des umfangreicheren Buches „Hauptprobleme der Staatsrechtslehre“ wieder.
63
Die Behandlung dieser Gewaltverhältnisse verwies er an die explikativen Disziplinen, insbesondere die Soziologie. [13] Kelsen, Staatsrechtslehre (wie oben, S. 12, Anm. 61), S. 226.
Dies entsprach, wie Max Weber in der Korrespondenz mit Georg Jellinek im Sommer 1909 mehrfach bekundete, seiner eigenen Absicht, sich vom Juristischen zu lösen zugunsten einer „Soziallehre des Staates und der politischen Bildungen“.
64
Die zeitgenössische Soziologie bot jedoch nicht viel, was Max Weber bei der Konzeption seiner „Herrschaftssoziologie“ hätte behilflich sein können. Für die organisch ausgerichtete Soziologie um Albert Schäffle stand der Herrschaftsbegriff nicht im Fokus des Interesses und der systematischen Klärung, sondern der Machtbegriff. Brief Max Webers an Georg Jellinek vom 15. Juli 1909, MWG II/6, S. 180; vgl. dazu auch die Ausführungen zur Werkbiographie, unten, S. 50 f.
65
In seinem Spätwerk widmete sich Schäffle der Präzisierung des Machtbegriffs als „streng soziologische[m] Begriff“, was für ihn zunächst bedeutete, ihn aus der engen Verklammerung mit dem Staats- und Gewaltbegriff herauszulösen. Bekannt und angefeindet war Schäffle wegen seines Werks „Bau und Leben des socialen Körpers“, das zwischen 1875 und 1878 zuerst in vier Bänden erschienen war. Max Weber, Vorlesungs-Grundriß, S. 7, wies hingegen auf die zwei-bändige Auflage des Werkes hin: Schäffle, Albert, Bau und Leben des Socialen Körpers, 2 Bände, 2. Aufl. – Tübingen: H. Laupp 1896; der erste Band umfaßte die „Allgemeine“, der zweite die „Specielle Sociologie“. Im ersten Band fand sich ein Kapitel über „Macht“ (vgl. ebd., S. 433–445).
66
„Macht ist die Fähigkeit“, so seine Definition, „in der Gesellschaft etwas zu bewirken, soziale Widerstände tätig zu bewältigen“. Vgl. Schäffle, Albert, Die Notwendigkeit exakt entwickelungsgeschichtlicher Erklärung und exakt entwickelungsgesetzlicher Behandlung unserer Landwirtschaftsbedrängnis, 3. Teil, in: Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft, 59. Jg., 1903, S. 255–340, Zitat: S. 337 (hinfort: Schäffle, Notwendigkeit); ders., Neue Beiträge zur Grundlegung der Soziologie“, ebd., 60. Jg., 1904, S. 103–204, bes. S. 118 ff.
67
Die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Machtverhältnisse betrachtete der Soziologe Alfred Vierkandt vom ethisch-idealistischen Standpunkt und wies deshalb die naturalistische, gewaltbezogene Machttheorie zurück. Schäffle, Notwendigkeit (wie oben, Anm. 66), S. 337.
68
Demgegenüber hatte der aus Krakau stammende und in Graz leh[14]rende Ludwig Gumplowicz die Menschheitsgeschichte als einen „ewigen Kampf um Herrschaft“ aufgefaßt. Vgl. Vierkandt, Alfred, Machtverhältnis und Machtmoral (Philosophische Vorträge der Kantgesellschaft, Nr. 13). – Berlin: Reuther & Reichard 1916.
69
Der Staat war bei ihm ein Herrschaftsverhältnis, das auf der Vormacht einer herrschenden Minderheit über eine unterworfene Mehrheit beruhe; die Minderheit trachte danach, die Unterworfenen wirtschaftlich auszubeuten und das System durch die Rechtsordnung zu legitimieren.[14] Gumplowicz, Ludwig, Grundriß der Sociologie. – Wien: Manz 1885, S. 123 (hinfort: Gumplowicz, Grundriß).
70
Die Anlehnungen an die Klassenkampftheorie waren offensichtlich, aber im Gegensatz dazu beruhte der gesellschaftliche Antagonismus bei Gumplowicz nicht auf sozio-ökonomischen, sondern auf von ihm behaupteten ethnischen Unterschieden, weshalb sein bekanntestes Werk auch den Titel „Der Rassenkampf“ trug. Ebd., S. 112, 115 f., 120 u.ö.
71
Sein Ansatz war zutiefst pessimistisch und darwinistisch: Es gibt keinen friedlichen Endzustand, keine Auflösung der Kampfsituation. In der deutschen Soziologie lehnte sich Franz Oppenheimer am stärksten an die „soziologische Staatsidee“ von Gumplowicz an. Max Weber kannte die Werke beider Autoren, von denen Oppenheimers kleine Studie „Der Staat“ als durchgearbeitetes Handexemplar überliefert ist. Gumplowicz, Ludwig, Der Rassenkampf. Sociologische Untersuchungen, 1. Aufl. – Innsbruck: Wagner 1883, S. 218–240 (hinfort: Gumplowicz, Rassenkampf).
72
Anders als Gumplowicz begründete Gaetano Mosca den Gegensatz von herrschender Minderheit und beherrschter Mehrheit in seinen „Elementi di scienza politica“. Max Weber hatte Gumplowicz, Grundriß, und ders., Rassenkampf bereits 1898 in seiner Handreichung zur Vorlesung „Allgemeine (,theoretische‘) Nationalökonomie“ angeführt, vgl. Weber, Vorlesungs-Grundriß, S. 6 f. Zu Oppenheimer, Franz, Der Staat (Die Gesellschaft, hg. von Martin Buber, Band 14/15). – Frankfurt a. M.: Rütten & Loening 1907 (hinfort: Oppenheimer, Staat) vgl. das Handexemplar Max Webers in der Arbeitsstelle der Max Weber-Gesamtausgabe, BAdW München.
73
Von ihm und Georg Simmels „Philosophie der Herrschaft“ Das Werk von Mosca war in zwei Teilen 1896 und 1923 erschienen: Mosca, Gaetano, Elementi di scienza politica, 1. Aufl. – Rom, Florenz, Turin, Mailand: Fratelli Bocca 1896 (hinfort: Mosca, Elementi I), und ders., Scritti politici, hg. von Sola, Giorgio, Vol. 2: Elementi di scienza politica. – Turin: Unione Tipografico-Editrice Torinese 1982 (hinfort: Mosca, Elementi II). Zur deutschen Übersetzung beider Teile vgl. Mosca, Gaetano, Die herrschende Klasse. Grundlagen der politischen Wissenschaft. Mit einem Geleitwort von Benedetto Croce. – Bern: A. Francke 1950 (hinfort: Mosca, Herrschende Klasse); zur Ablehnung der Rassenkampftheorie von Gumplowicz vgl. ebd., S. 25 f., 69 et passim.
74
soll später die Rede sein. Simmel, Georg, Zur Philosophie der Herrschaft. Bruchstück aus einer Soziologie, in: Jahrbuch für Gesetzgebung und Verwaltung im Deutschen Reich, N. F. 31. Jg., 1907, S. 439–471 (hinfort: Simmel, Philosophie der Herrschaft).
[15]Hier ist kurz darzulegen, inwieweit Max Weber in Bezug auf den Machtbegriff auf den zeitgenössischen soziologischen Diskurs einging. Zu Beginn der „Herrschaftssoziologie“ ordnete Weber den Herrschaftsbegriff dem weiteren soziologischen Machtbegriff zu und präzisierte ihn in Abgrenzung zu sozialen und ökonomischen Machtverhältnissen ohne Befehlsgewalt.
75
Dabei legte er den von ihm selbst im Text „,Klassen‘, ‚Stände‘ und ‚Parteien‘“ eingeführten Begriff zugrunde: „Unter ‚Macht‘ wollen wir […] die Chance eines Menschen oder einer Mehrzahl solcher verstehen, den eigenen Willen in einem Gemeinschaftshandeln auch gegen den Widerstand anderer daran Beteiligter durchzusetzen“.[15] Vgl. unten, S. 127–135.
76
Geht es in der soziologischen Analyse um Machtverteilung innerhalb einer Gemeinschaft, um Prozesse der Machtaneignung und -behauptung, der Machtmonopolisierung, um Machtinteressen und Machtprestige, aber auch um Machtverlust, so betrifft dies alle Bereiche des menschlichen Zusammenlebens, d. h. den wirtschaftlichen, sozialen und politischen Bereich. In der Politik, insbesondere in der Außenpolitik, kommt jedoch das Element von körperlicher Gewaltandrohung hinzu, so daß ein Zwangsapparat bzw. eine verbandliche Organisation vorausgesetzt werden muß. Weber. „Klassen“, „Stände“ und „Parteien“, MWG I/22-1, S. 252.
77
Max Weber entwickelte den Herrschaftsbegriff, da Macht soziologisch diffus sei, als präziseren Begriff einer Teilmenge von Macht. „Herrschaft“ ist daher, worin Max Weber mit der zeitgenössischen Soziologie nicht konform ging, Zum politisch akzentuierten Machtbegriff vgl. insbes. Weber, Machtprestige und Nationalgefühl, MWG I/22-1, S. 222 f., sowie die Referenz auf Ranke bzgl. der politischen Mächte in: Weber, Wirtschaftliche Beziehungen der Gemeinschaften im allgemeinen, MWG I/22-1, S. 107.
78
als ein „Sonderfall von Macht“ zu betrachten. Begriffsverwirrung gab es insbes. bei Oppenheimer, der Webers Begriff der „Herrschaft“ mit dem „Machtbegriff“ der Soziologie gleichsetzte, die Begriffe also entgegengesetzt akzentuierte. Vgl. dazu Oppenheimer, Franz, System der Soziologie, Band 1: Allgemeine Soziologie, 1. Halbband: Grundlegung. – Jena: Gustav Fischer 1922, bes. S. 377 f. und 383 (hinfort: Oppenheimer, Soziologie), sowie ders., Machtverhältnis, in: Handwörterbuch der Soziologie, hg. von Alfred Vierkandt. – Stuttgart: Ferdinand Enke 1931, S. 338–348, bes. S. 338, 340, 347.
79
Letztere bleibt bei Weber – weit entfernt von den idealistischen Visionen Alfred Vierkandts – mit Kampf verbunden. Vgl. unten, S. 127.
80
Im Gegensatz zu den stabilisierenden „gesellschaftlichen [16]Ordnungen“ Vgl. dazu Hübinger, Gangolf, Politische Wissenschaft um 1900 und Max Webers soziologischer Grundbegriff des „Kampfes“, in: Hanke/Mommsen, S. 101–120, bes. S. 101–104, 118 f.
81
stellt „Macht“ ein dynamisches, mitunter auch unberechenbares, und geradezu urwüchsiges Element in der Geschichte menschlicher Verbände dar. [16] Vgl. den 1914 für Max Webers Grundriß-Beitrag eingeführten Titel „Die Wirtschaft und die gesellschaftlichen Ordnungen und Mächte“, in: GdS1, Abt. I, 1914, S. X (MWG I/22-6). [[MWG I/24, S. 168]]
2. Herrschaftsverbände
Mit seinem Hauptwerk „Das deutsche Genossenschaftsrecht“ hatte Otto von Gierke eine der geschlossensten Darstellungen zur deutschen Verfassungsgeschichte vorgelegt und zugleich das Gegensatzpaar „Herrschaft und Genossenschaft“ geprägt.
1
Wer „Herrschaft“ sagte, dachte automatisch an „Genossenschaft“, und noch Jahrzehnte nach dem Erscheinen des ersten Bandes des „Genossenschaftsrechts“ im Jahre 1868 war Gierkes Begriffsbesetzung so präsent, daß sogar seine Gegner Ausführungen zum Herrschaftsbegriff mit der Aussage begannen, daß „Herrschaft natürlich nicht als Gegensatz zu Genossenschaft gebraucht“ werde. Gierke, Otto, Das deutsche Genossenschaftsrecht, Band 1: Rechtsgeschichte der deutschen Genossenschaft. – Berlin: Weidmann 1868; Band 2: Geschichte des deutschen Körperschaftsbegriffs, ebd. 1873; Band 3: Die Staats- und Korporationslehre des Alterthums und des Mittelalters und ihre Aufnahme in Deutschland, ebd. 1881; Band 4: Die Staats- und Korporationslehre der Neuzeit. Durchgeführt bis zur Mitte des siebzehnten, für das Naturrecht bis zum Beginn des neunzehnten Jahrhunderts, ebd. 1913 (hinfort: Gierke, Genossenschaftsrecht I–IV). – Max Weber arbeitet bereits in seinen frühen Vorlesungen mit der Dichotomie und spricht von genossenschaftlicher und herrschaftlicher Organisation der Arbeit. Vgl. Weber, Vorlesungs-Grundriß, S. 26, 29.
2
Herrschaft und Genossenschaft sind bei Otto von Gierke die beiden großen Prinzipien, die die deutsche Geschichte von den germanischen Stämmen bis hin zum Gegenwartsstaat des Kaiserreichs durchwalten. In dialektischer Weise sind sie aufeinander bezogen: In bestimmten Phasen der Geschichte habe das Herrschaftsprinzip und mit ihm die Idee der Einheit überwogen, in anderen Phasen wiederum das Prinzip der Genossenschaft zusammen mit der Idee der Freiheit, bis sie beide – ganz hegelianisch gedacht – in der Gegenwart zu einem Ausgleich gekommen seien. In der Verfassung des Deutschen Kaiserreichs sah Gierke monarchischen Herrschaftsanspruch und liberal-bürgerliche Selbstverwaltungsideen harmonisch miteinander vereint. So bei Thoma, Richard, Art. Staat (Allgemeine Staatslehre), in: HdStW4, Band 17, 1926, S. 724–756, Zitat: S. 744, oder bei Oppenheimer, Soziologie (wie oben, S. 15, Anm. 78), S. 367.
[17]Gierkes Ansatz diente nicht nur der systematischen Periodisierung der deutschen Verfassungsgeschichte, sondern auch der Darstellung der Genese deutscher Rechtsvorstellungen und leistete damit einen gewichtigen Beitrag zur Verbandslehre. Die Wurzeln von Herrschaft und Genossenschaft finden sich nach Gierke in der Familie als dem Ausgangspunkt aller Verbandsbildung und entwickeln sich von hier aus in unterschiedliche Richtungen. Mit dem genossenschaftlichen Prinzip verknüpfte Gierke verschiedene Ideenkreise: die Idee der Freiheit und des persönlichen Rechts, die Vorstellung von der Gesamtgewalt des Verbandes, in politischer Hinsicht das Volkskönigtum und in wirtschaftlicher Hinsicht die genossenschaftliche Landnahme. Spiegelbildlich steht ihm das Herrschaftsprinzip gegenüber: Es repräsentiert die Idee der Einheit und des Dienstes und ist mit der Vorstellung eines dinglichen Rechts und der Einzelgewalt des Verbandes verbunden sowie in praktischer Hinsicht mit Gebietskönigtum und Grundherrschaft.
3
Aufgrund dieser Systematik fällt es nicht schwer, mit Gierke die germanische Frühzeit der Geschlechts-, Stammes- und Volksverbände als die charakteristische Periode der Wirksamkeit des Genossenschaftsprinzips zu betrachten. Daneben, bis in die Zeit des Hochmittelalters hinein, habe sich das herrschaftliche Prinzip in Form der patriarchalen Herrschaftsverbände und als „patrimontale[s] und feudale[s] Verfassungsprincip“ ausgebreitet.[17] Vgl. dazu Gierke, Genossenschaftsrecht I (wie oben, S. 16, Anm. 1), bes. S. 8 ff., 48–51, 126–129.
4
Ebd., S. 9.
Im gesamten deutschen Verfassungsleben spielen die Verbände nach Gierke eine zentrale Rolle. Sie bilden die entscheidende Klammer von der mittelalterlichen zur modernen Verfassungsentwicklung, auch wenn sich die mit ihnen verbundenen Grundvorstellungen – wie später zu zeigen – entscheidend verändern. Bleiben wir zunächst bei „Genossenschaft“ und „Herrschaftsverband“ als den beiden „Grundformen aller germanischen Verbände“.
5
Den herrschaftlichen Verband kennzeichnet Gierke – im Gegensatz zum genossenschaftlichen – durch die Vorrangstellung eines Einzelnen: „der Herr […] stellt in sich die gesammte rechtliche Einheit des Verbandes dar“. Gierke, Genossenschaftsrecht II (wie oben, S. 16, Anm. 1), S. 42.
6
„Friede, Recht und Gewalt in der Gemeinschaft gehen von ihm aus“. Gierke, Genossenschaftsrecht I (wie oben, S. 16, Anm. 1), S. 89.
7
Erst durch seine Person und seinen Willen werden die Verbandszugehörigen zu einem rechtlichen Ganzen, so daß die Existenz des Verbandes von der Präsenz des Herrn, aber nicht von der seiner Mitglie[18]der abhängig war. Alle Verbandsrechte hatte „der Herr in seiner konkreten menschlichen Erscheinung“, Ebd., S. 89.
8
eine Scheidung von privaten und öffentlichen Rechten gab es nicht. Aus der ursprünglichen Hausherrschaft wurde im Laufe der Entwicklung ein „Verband von Herren und Dienern“,[18] Gierke, Genossenschaftsrecht II (wie oben, S. 16, Anm. 1), S. 43.
9
der durch die Verknüpfung mit der Grundherrschaft eine „dingliche“ (materielle) Komponente erhielt. Gierke, Genossenschaftsrecht I (wie oben, S. 16, Anm. 1), S. 99–121, Zitat: S. 121.
10
Die Ungleichheit von Macht und Besitz verfestigte sich zu einer Ungleichheit von Rechten und Pflichten, und die Herrschaft wurde nun als ein Vermögensrecht betrachtet. Die Frühzeit und das Mittelalter waren – wie man es mit dem Mediävisten Paul Sander beschreiben könnte – durch eine bunte Vielheit von Verbänden geprägt, die z. T. öffentliche Funktionen wahrnahmen und um diese konkurrierten. Vgl. dazu ebd., S. 124–126.
11
Die moderne juristische Begrifflichkeit von privat- und öffentlich-rechtlich oder von staatlich und nicht-staatlich verfehlte daher nach Gierkes Ansicht eine realitätsnahe Erfassung der historischen Rechtszustände. Vgl. Sander, Paul, Feudalstaat und Bürgerliche Verfassung. Ein Versuch über das Grundproblem der deutschen Verfassungsgeschichte. – Berlin: A. Bath 1906, bes. S. 48, 109 ff. Vgl. dazu auch Jellinek, System2 (wie oben, S. 7, Anm. 26), S. 283 ff. – Sohm, Rudolph, Die Altdeutsche Reichs- und Gerichtsverfassung, Band 1: Die Fränkische Reichs- und Gerichtsverfassung. – Weimar: Böhlau 1871 (hinfort: Sohm, Fränkische Reichs- und Gerichtsverfassung), hatte im Gegensatz zu Gierkes Darstellung die These vertreten, daß die Verbände bereits in fränkischer Zeit öffentliche Verbände und nicht nur privatrechtlich fundierte Genossenschafts- und Herrschaftsverbände gewesen seien. Zu der Sohm-Gierke-Kontroverse vgl. auch Sander, Feudalstaat, S. 6 f.
12
Vgl. dazu Gierke, Genossenschaftsrecht I (wie oben, S. 16. Anm. 1), S. 126. und dass. II, S. 43.
Mit der Konstituierung der mittelalterlichen Stadt als einer Körperschaft, die unabhängig von ihren Mitgliedern eigene Rechte und eigenes Vermögen hatte, kam jedoch, so Gierke, ein völlig neues Element in das Verfassungsleben hinein – das der juristischen Person.
13
Es vollzog sich – mit anderen Worten – die Ablösung von sinnlich wahrnehmbaren Verbänden hin zu abstrakten Rechtsformen. Während der Körperschaftsbegriff nach Gierkes Ansicht die logische Fortbildung des germanischen Genossenschaftsgedankens war, entwickelte sich auch die Rechtsvorstellung vom Herrschaftsverband unter kanonischem Rechtseinfluß zur Idee des Obrigkeits- und Anstaltsstaates weiter. Ebd., S. 831 f.
14
Die Auffassung der römisch-katholi[19]schen Kirche, daß die Kirche den abwesenden überweltlichen Herrn repräsentiere, sei in die weltliche Vorstellung vom Obrigkeitsstaat eingegangen. Der gesamte Staatsapparat verschmilzt nach dieser Vorstellung mit dem Herrn zu einer Einheit; alle von Dienern, Beamten und Soldaten ausgeübten Amtshandlungen werden als solche des Herren angesehen. Die herrschaftliche Organisation ist – dem „Typus des Herrschaftsverbandes“ entsprechend – durch „die Begriffe der im Haupte konzentrirten Einheit, der Über- und Unterordnung, der Befehlsgewalt und der Gehorsamspflicht“ charakterisiert. Ebd., S. 553–558 und 959–968.
15
Ihr Gegenteil ist die kollegiale Organisation. [19] Gierke, Laband-Kritik (wie oben, S. 9, Anm. 44), S. 1140.
Die Dichotomie von Herrschaft und Genossenschaft äußerte sich für Gierke in der Gegenwart in Form der Staatsanstalt einerseits, der Selbstverwaltungskörperschaften andererseits. Dabei galten herrschaftlich organisierte Anstalten, wie z. B. der zentralistische Staatsapparat Frankreichs ebenso wie die römisch-katholische Anstaltskirche, als fremde, dem römischen Rechtsdenken entsprungene Einrichtungen, während das englische Selfgovernment als Ausdruck des ursprünglichen germanischen Rechtsdenkens von Gierke und den deutschen Liberalen als das Modell einer bürgerlichen Selbstverwaltung gepriesen wurde. Die mittelalterliche Stadt galt als ihr großes historisches Vorbild. Für Gierke war sie die „höchste Körperschaft“ und „der älteste wahre und für sich bestehende deutsche Staat“,
16
für seinen politisch engagierten Schüler Hugo Preuß sogar „die Keimzelle moderner Staatsverfassung“. Gierke, Genossenschaftsrecht II (wie oben, S. 16, Anm. 1), S. 831.
17
In einem Vortrag vor der Gehe-Stiftung in Dresden im November 1908 brachte Preuß – in Anlehnung an die Terminologie Gierkes – die Unterschiede zwischen unfreier und freier Verfassung der Vergangenheit auf den Punkt: „In der Bürgergemeinde als einem Verbande freier Genossen tritt das genossenschaftliche Organisationsprinzip dem auf der Unfreiheit ruhenden Organisationsprinzip des agrarischen Herrschaftsverbandes gegenüber.“ Preuß, Hugo, Staat und Stadt. Vortrag, gehalten in der Gehe-Stiftung zu Dresden am 7. November 1908 (Vorträge der Gehe-Stiftung zu Dresden, Band 1). – Leipzig, Dresden: B. G. Teubner 1909, S. 37.
18
Bei ersterem gehe die Struktur „von unten nach oben“, beim herrschaftlichen „von oben nach unten“. Ebd., S. 14.
19
Schon der klassische deutsche Liberalismus hatte diesen Gegensatz als den von kollegialer und bürokratischer Verwaltung umschrieben. Ebd., S. 21.
20
Vgl. Welcker, Carl, Art. Collegium, Collegial- und büreaukratisches System der Verwaltung, in: Das Staats-Lexikon. Encyklopädie der sämmtlichen Staatswissenschaften [20]für alle Stände, hg. von Carl von Rotteck und Carl Welcker, Band 3, 2. Aufl. – Altona: Johann Friedrich Hammerich 1846, S. 264–268, und ders., Art. Staatsverfassung, ebd., 1848, S. 363–387, hier: S. 385.
[20]Wirft man nun mit der Gierkeschen Systematik einen Blick auf die ältere Fassung der „Herrschaftssoziologie“ Max Webers, dann wird deutlich, daß sie das Grobraster für die Erfassung der verschiedenen Herrschaftsformen abgibt. Dies gilt vornehmlich für die Formen der Vergangenheit – Patriarchalismus, Patrimonialismus und Feudalismus –, während ein Abschnitt über den modernen europäischen Anstaltsstaat nur angekündigt,
21
aber nicht überliefert ist. Teilweise folgt Weber sogar bis in die Einzelheiten den Zuordnungen von Gierke, so z. B. im Fall des Merowinger- und Karolingerreichs, das er als patrimonial einstuft. Vgl. Einteilung des Gesamtwerkes, in: GdS1, Abt. I, 1914, S. XI (MWG I/22-6) [[MWG I/24, S. 169]]: „Die Entwicklung des modernen Staates“; vgl. dazu auch unten, S. 68.
22
Entgegen der von Otto Gierke und Rudolf Gneist geprägten und jahrzehntelang herrschenden Forschungsmeinung behandelte Weber die Verbände der englischen Lokalverwaltung jedoch nicht als öffentlich-rechtliche Korporationen eigenen Rechts, sondern ordnet sie der Herrschaftsform des „Patrimonialismus“ zu. Vgl. dazu z. B. den Text „Patrimonialismus“, unten, S. 312, 317 und 338–340, sowie „Feudalismus“, unten, S.397 f.
23
Damit folgte er einer neueren Forschungsmeinung, die in England von Frederic William Maitland und im deutschsprachigen Raum von dem Jellinek-Schüler Julius Hatschek vertreten wurde. Vgl. dazu den Text „Patrimonialismus“, unten, S. 275–278, 281–284, bes. S. 351–361 (englische Friedensrichterverwaltung).
24
Danach seien die englischen Verbände keine eigenständigen Korporationen im Sinne des kontinental-europäischen Rechts gewesen, sondern Zwangsverbände, die vom König zur Aufbringung der öffentlichen Aufgaben herangezogen worden seien. Explizit ging Weber in der „Rechtssoziologie“ auf diese Streitfrage ein. Vgl. dazu insbes. die einleitenden Ausführungen von Hatschek, Julius, Englisches Staatsrecht mit Berücksichtigung der für Schottland und Irland geltenden Sonderheiten, Band 1: Die Verfassung. – Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) 1905, S. 35–94 (hinfort: Hatschek, Englisches Staatsrecht I), sowie Maitland, Frederic William, Township and Borough. The Ford Lectures 1897. – Cambridge: University Press 1898, der sich u. a. mit den Forschungstheorien von Gneist und Gierke auseinandergesetzt hatte (ebd., S. 11 ff. und 195 f.). Von diesem Buch ist ein Handexemplar Max Webers im Alfred Weber-Institut Heidelberg überliefert, das aber keine Bearbeitungsspuren aufweist.
25
Um das gleiche Kernproblem – Eigenständigkeit oder Abhängigkeit der Verbände – drehte sich auch der mediävistische Forschungsstreit über den Ursprung der Zünfte: Waren sie ein Zusammen[21]schluß von freien Handwerkern (sog. „Einungstheorie“)? Oder gingen sie aus der unfreien Handwerkerschaft der Fronhöfe hervor (sog. „Hofrechtstheorie“)? Oder wurden sie vom Stadtherrn ins Leben gerufen bzw. vereinnahmt und zu öffentlichen Aufgaben herangezogen (sog. „Ämtertheorie“)? Vgl. Weber, Recht § 2, S. 61–63 (WuG1, S. 447 f.), sowie Weber, Die Stadt, MWG I/22-5, S. 76 mit Anm. 40.
26
Den Terminus „Herrschaftsverband“ im Sinne Gierkes verwendete Weber in der älteren Fassung der „Herrschaftssoziologie“ nur an wenigen Stellen,[21] Vgl. dazu den Text „Patrimonialismus“, unten, S. 279 f. mit Anm. 79, sowie die Nippel, Wilfried, Einleitung zu Weber, Die Stadt, MWG I/22-5, S. 28–30.
27
während er ihm erst im Zuge der Neufassung der soziologischen Kategorienlehre einen zentralen Platz in der Verbandslehre zuwies. Dort heißt es: „Ein Verband soll insoweit, als seine Mitglieder als solche kraft geltender Ordnung Herrschaftsbeziehungen unterworfen sind, Herrschaftsverband heißen.“ Vgl. den Text „Patrimonialismus“, unten, S. 274 und 343.
28
Als Merkmale werden ihm ein erfolgreich befehlender Herr als auch die Existenz eines Verwaltungsstabes zugeschrieben. Vergleicht man diese Bestimmung mit den oben angeführten Umschreibungen bei Gierke, so wird daran ein Grundproblem deutlich: Die gesamte Verbandslehre von Gierke beruhte auf dessen Grundannahme, daß die Verbände „gleich dem Individuum eine leiblich-geistige Lebenseinheit“ darstellen; Vgl. Weber, Soziologische Grundbegriffe, WuG1 S. 29 (MWG I/23); vgl. dazu auch die Verwendung in: Weber, Die drei reinen Typen, unten, S. 726 f., 729, 734 und 739.
29
ebenso wie „Herrschaft und Genossenschaft“ in der Geschichte lebendige und wirksame Prinzipien waren und nicht heuristische Annahmen, die der Forscher an die Geschichte herantrug. Die Verbandslehre Gierkes mußte daher von Max Weber, um herrschaftssoziologisch relevant zu sein, von ihren organisch-philosophischen Denkvoraussetzungen befreit werden. Gierke, Otto, Das Wesen der menschlichen Verbände. Rede, bei Antritt des Rektorats am 15. Oktober 1902 gehalten. – Leipzig: Duncker & Humblot 1902, S. 12 – übrigens von Weber, Roscher und Knies I, S. 35 (= S. 1215), Fn. 1, zitiert.
30
Dies zum ersten Mal systematisch in: Weber, Kategorien, dort in Verbindung mit der Lehre vom Gemeinschafts- und Gesellschaftshandeln; vgl. dazu unten, S. 64.
Eine letzte Frage möchte man jedoch mit Gierkes Dichotomie von „Herrschaft und Genossenschaft“ an die Konzeption von Max Webers „Herrschaftssoziologie“ stellen: Wo ist der systematische Ort für die Behandlung derjenigen Formen von Verbänden, die man als „genossenschaftlich“ bezeichnen könnte, d. h. in denen die Verbandsleitung kollegial strukturiert ist und die Satzung nicht oktroyiert, sondern von den Verbandsmitgliedern vereinbart worden ist? Diese Formen sind nach Weber an sich in der Realität äußerst selten anzutreffen,
31
da sie die Identität von [22]Herrschenden und Beherrschten voraussetzen und daher nur in Vereinen und Verbänden mit einer überschaubaren Anzahl von räumlich miteinander verbundenen Personen zu finden sind. Weber nennt zu Beginn der älteren Fassung der „Herrschaftssoziologie“ als Beispiele für die unmittelbar-demokratische Verwaltung die antike Polis, die Schweizer Landgemeinden und die neuenglischen Townships sowie die sich selbstverwaltenden deutschen Universitäten, Vgl. Weber, Kategorien, S. 290 (betr. vereinbarte Satzungen).
32
später verweist er auf die Rechtsgenossenschaften als einem Interessenverbund sozial Gleichgestellter gegen den Herrn.[22] Vgl. den Text „Herrschaft“, unten, S. 139–145, bes. S. 139 f.
33
Kollegiale Verwaltung wird jedoch nur als eine Zwischenstufe auf dem Weg zur bürokratischen Verwaltung behandelt. Vgl. den Text „Patrimonialismus“, unten, S. 258, 288–290 und 314 f., interessanterweise sind dies sehr fragmentarisch wirkende Stellen.
34
Für den militärischen Bereich führt Weber in einem Gliederungsentwurf als Kriegergenossenschaften das sogenannte „Männerhaus“ und die germanischen Gemeinfreien an. Vgl. den Text „Bürokratismus“, unten, S. 221–228, im Text „Feudalismus“, unten, S. 416–418.
35
Das große Beispiel für einen durch freiwillige Vereinbarung zustandegekommenen politischen Verband ist jedoch die Stadt des okzidentalen Mittelalters. In ihren auf Einung beruhenden Anfängen stellt sie eine Verbandsform dar, die als herrschaftsfremd oder – mit Gierke gesprochen – „genossenschaftlich“ zu bezeichnen ist. Max Weber hat sie als Typus der „nichtlegitimen Herrschaft“ in seine Disposition zur „Herrschaftssoziologie“ aufgenommen. Vgl. Weber, Kriegerstände, MWG I/22-1, S. 280 f.; zum Männerhaus vgl. auch unten, S. 551 f., sowie die Erwähnung des stadtherrschaftlichen Feudalismus, unten, S. 385.
36
Die Stadt ist für ihn – wie aus dem Vortragsbericht von 1917 hervorgeht Vgl. Einteilung des Gesamtwerkes, in: GdS1 Abt. I, 1914, S. XI (MWG I/22-6) [[MWG I/24, S. 169]].
37
– ein Spezifikum der abendländischen Verfassungsgeschichte. Sie bringt einen neuen, den sogenannten vierten Legitimitätstypus der Herrschaft hervor, der auf dem Willen der Beherrschten beruht. Sie markiert zugleich die Geburtsstunde des modernen demokratischen Rechtsstaates, von dem sie aber noch weit entfernt ist. An diesem Punkt berührt sich die Auffassung Max Webers mit der politisch akzentuierten Einschätzung von Gierke und Preuß, daß die mittelalterliche Stadt an der Wiege der modernen Verfassungsentwicklung gestanden habe. Im Gegensatz zu ihnen sieht Weber aber die strukturelle Veränderung, der auch die ursprünglich „genossenschaftliche“ Stadtverfassung unterworfen ist, sobald diese auf eine größere An[23]zahl von Bürgern und ein ausgedehntes Territorium ausgeweitet wird. Von einem „genossenschaftlichen“ Verband wandelt sich die Stadt dann selber in einen „Herrschaftsverband“ im Sinne Max Webers. Vgl. Weber, Probleme der Staatssoziologie, unten, S. 755 f.
3. Herrschaftsformen
Das „Handbuch der Politik“, dessen erster Band im Jahre 1912 erschien und das eine Reihe namhafter Wissenschaftler des Kaiserreichs als Herausgeber auf dem Titelblatt führte, u. a. den Historiker Karl Lamprecht, die Nationalökonomen Adolf Wach und Adolf Wagner sowie die beiden zum Zeitpunkt des Erscheinens bereits verstorbenen Juristen Georg Jellinek und Paul Laband, behandelte im dritten Hauptstück die „Herrschaftsformen“ und deren Würdigung.
38
Der Autor Wilhelm van Calker, Professor der Rechte in Gießen, bot einen Überblick über „Die staatlichen Herrschaftsformen“ – eingeteilt nach dem Kriterium der Ein- und Mehrherrschaft – und damit trotz des vielversprechenden Titels nicht viel mehr als die bereits im zweiten Hauptstück vorgestellten Staatsformen. Beide Darlegungen könnte man unter dem Stichwort ‚vergleichende Verfassungs- und Regierungslehre‘ rubrizieren. Als Anhaltspunkt für die Einteilung der unterschiedlichen Verfassungsformen galt van Calker – ebenso wie dem Gros seiner Zeitgenossen – die seit der antiken Philosophie übliche Einteilung nach der Zahl der an der Spitze eines Gemeinwesens stehenden Inhaber der Regierungsgewalt: entweder nach dem klassisch-aristotelischen Modell als Monarchie, Aristokratie und Demokratie (richtiger: Politie) oder in der vereinfachten Form nach Machiavelli als Herrschaft des Fürsten oder der Republik klassifiziert.[23] Handbuch der Politik, hg. von Paul Laband, Georg Jellinek, Adolf Wach, Karl Lamprecht, Adolf Wagner, Franz von Liszt, Georg von Schanz, Fritz Berolzheimer, Band 1: Die Grundlagen der Politik, 1. Aufl. – Berlin, Leipzig: Walther Rothschild 1912 (hinfort: Handbuch der Politik I); darin: Calker, Wilhelm van, Die staatlichen Herrschaftsformen, ebd., S. 129–149, und Tecklenburg, Adolf, Allgemeine Würdigung der Herrschaftsformen, ebd., S. 150–168.
39
Auch Wilhelm Roscher folgte in seinem Standardwerk „Politik. Geschichtliche Naturlehre der Monarchie, Aristokratie und Demokratie“ dem aristotelischen Ansatz Vgl. Calker, Wilhelm van, Die staatlichen Herrschaftsformen, ebd., S. 133.
40
und beschrieb die abendländische Staatengeschichte als eine kreislaufartige Entwick[24]lung von sechs verschiedenen Staatsformen. Roscher, Wilhelm, Politik. Geschichtliche Naturlehre der Monarchie, Aristokratie und Demokratie, 3. Aufl. – Stuttgart, Berlin: J. G. Cotta Nachfolger 1908, S. III, 6 u.ö. (hinfort: Roscher, Politik3); vgl. dazu auch den Kommentar Max Webers in: Weber, Roscher und Knies I, S. 28 f. (= S. 1208 f.).
41
Zur Erfassung jüngerer Entwicklungen erweiterte er die klassische Einteilung um neu benannte Mischformen, die zumeist extreme oder „entartete“ Verfassungsprinzipien enthielten, so z. B. „Plutokratie und Proletariat“ sowie „Militärtyrannis“ und „Cäsarismus“, jeweils als Übersteigerungen von aristokratischer, monarchischer und demokratischer Herrschaft. Was aber besagte – könnte man mit Robert Piloty fragen – die Klassifikation als „Monarchie“ über die tatsächliche Verfassungsrealität z. B. des Merowingerreichs, des Kalifats oder Japans unter dem Shōgunat?[24] Vgl. dazu die systematische Übersicht bei Roscher, Politik3 (wie oben, S. 23, Anm. 40), S. 12 f.
42
In allen drei Fällen waren die eigentlichen Herrscher durch ihre ehemals abhängigen Diener, Hausmeier, Emire oder Shōgune, entmachtet und in der praktischen Herrschaftsausübung abgelöst worden. Die historischen Ereignisse vor dem Ersten Weltkrieg gaben in der Tat allen Anlaß zu der Frage nach den Transformationsprozessen, die sich innerhalb bestehender Herrschaftsordnungen abspielten: In Japan, Rußland und China wurden in den Jahren 1868, 1905 und 1911 mehrere hundert Jahre alte Regierungssysteme abgelöst, und der gleiche Prozeß kündigte sich seit 1908 auch für das jahrhundertealte Osmanische Reich an. Vgl. Piloty, Autorität und Staatsgewalt (wie oben, S. 11, Anm. 52), S. 559–564; vgl. dazu auch unten, S. 414 mit Anm. 86 und 87.
43
Wie konnten die tatsächlichen Herrschaftsverhältnisse eines Landes oder fremder Kulturen jenseits der verfassungsrechtlichen oder klassisch-aristotelischen Betrachtung analysiert werden? Erste Ansätze zu einem neu zu konzipierenden Fach ,vergleichende Politik‘ bzw. ,Soziologie‘ finden sich in der Korrespondenz Max Webers mit Georg Jellinek,Vgl. die entsprechenden Textstellen bei: Weber, Die drei reinen Typen, unten, S. 740 f. mit Anm. 32 oder unten, S. 518 f., Anm. 82 (Japan), S. 218 mit Anm. 20 (Rußland), S. 580 mit Anm. 4 (China) und S. 285 f. mit Anm. 2 (Türkei).
44
aber natürlich auch in der zeitgenössischen soziologischen und politikwissenschaftlichen Literatur. Brief Max Webers an Georg Jellinek, vor dem 12. Sept. 1909, MWG II/6, S. 258 f.
Kehren wir für einen kurzen Augenblick zum „Handbuch der Politik“ zurück, denn es eröffnet durch seinen Aufbau eine wichtige Perspektive: „Herrschaft und Verwaltung“ werden als Einheit behandelt und in der Systematik dem Anarchismus gegenübergestellt. Die „staatlichen Herrschaftsformen“ sind nach der Definition van Calkers „die Organisationsformen der Staatsgewalt“,
45
d. h. „Herrschaft“ wird zum Synonym für Organisation, Ordnung und geregelte Verhältnisse im Gegensatz zur Her[25]ren-, Ordnungs- und Regellosigkeit des Anarchismus. Diese Akzentuierung des Herrschaftsbegriffs findet sich auch in der späteren deutschen Ausgabe von Gaetano Moscas „Elementi di scienza politica“: Dort werden die „tipi di organizzazione politica“ als „Typen der Herrschaft“ übersetzt. Calker, Wilhelm van, Die staatlichen Herrschaftsformen, in: Handbuch der Politik I (wie oben, S. 23, Anm. 38), S. 130.
46
Berühmtheit erlangte Mosca mit der These, daß die Geschichte aller Gesellschaften stets durch das Gegenüberstehen einer organisierten, herrschenden Minderheit gegen eine unorganisierte, beherrschte Mehrheit geprägt sei.[25] Vgl. Mosca, Herrschende Klasse (wie oben, S. 14, Anm. 73), S. 278, sowie Mosca, Elementi II (wie oben, S. 14, Anm. 73), S. 941; der zweite Teil der „Elementi“ (Kapitel Xll–XVII) war erst nach Webers Tod im Jahre 1923 erschienen.
47
Mit dieser These stellte er sich nicht nur gegen die Vertreter demokratisch-repräsentativer Gedanken, sondern auch gegen die Zukunftshoffnungen der Sozialisten, es könne einen Staat oder Zustand geben, in dem die Mehrheit (das Proletariat) über die Minderheit (Adelige und Bürgerliche) herrschen werde. Mosca, Herrschende Klasse (wie oben, S. 14, Anm. 73), S. 53 ff.
48
Stets würde eine Minderheit das Gemeinwesen in politischer, wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht lenken. Dieses von ihm aufgestellte Grundgesetz menschlichen Zusammenlebens sah Mosca durch Erfahrung und historische Tatsachen als bestätigt an. Gleichzeitig ging er davon aus, daß ein einzelner Herrscher stets auf einen Kreis von Beratern oder Gehilfen angewiesen sei, so daß eine Monarchie de facto nie die Herrschaft eines Einzelnen, sondern stets die einer Clique sei. Von dem Zusammenspiel dieser Gruppe um den Herrscher und ihrer sittlichen Qualifikation hänge der Zustand des gesamten Gemeinwesens ab; herrsche unter den Führenden Korruption und Unverantwortlichkeit, übertrage sich dies auch auf die unteren Ebenen. Die von Gaetano Mosca und Vilfredo Pareto entwickelte Elitentheorie wurde von Robert Michels speziell auf die Organisation der modernen Arbeiterparteien angewendet und in ihrem Kern bestätigt. Michels wies mehrfach auf die Spannung zwischen theoretischem Anspruch der Arbeiterparteien und den organisatorischen Systemzwängen hin. Vgl. ebd., S. 134, 247.
49
Der österreichische Nationalökonom Friedrich von Wieser griff das Thema ebenfalls in einer Vortragsreihe auf, die er im Sommer 1909 in Salzburg hielt. Dort riet er den modernen Massenbewegungen, sich den „Vorteil der kleinen Zahl“ zunutze zu machen, um an politischem Einfluß zu gewinnen. Michels, Parteiensoziologie (wie oben, S. 4, Anm. 15), S. 343, 347, 352 f., 389.
50
Alle genannten Autoren gingen, mit anderen Worten, davon aus, daß Herrschaftsaus[26]übung in differenzierten Gesellschaften von dem Grad der „Organisiertheit“ Wieser, Friedrich von, Recht und Macht. 6 Vorträge. – Leipzig: Duncker & Humblot 1910, bes. S. 31 (hinfort: v. Wieser, Recht und Macht); vgl. auch den Editorischen Bericht zum Text „Herrschaft“, unten, S. 118, und S. 145 mit Anm. 40.
51
abhängig ist. Auf diesen Problemkreis bezog sich Max Weber in den einleitenden Ausführungen zur „Herrschaftssoziologie“.[26] Mosca, Herrschende Klasse (wie oben, S. 14, Anm. 73), S. 55.
52
Vgl. unten, S. 144–147.
In der Tat war der Staat für Gaetano Mosca nichts anderes als „die Organisation aller sozialen Kräfte von politischer Bedeutung“ oder – anders formuliert – „die Summe aller gesellschaftlichen Elemente, die zur Ausübung politischer Funktionen geeignet und bereit sind.“
53
Max Weber bemerkte zu den „Elementi di scienza politica“, deren ersten Band er gelesen hatte, daß Mosca das Wesen und das innere Getriebe des Staates verstanden habe. Mosca, Herrschende Klasse (wie oben, S. 14, Anm. 73), S. 138 (beide Zitate).
54
Mosca stellte einen inneren Zusammenhang von Staat und Gesellschaft her, was sich in seiner Einteilung der politischen Gebilde in einen „Stato feudale“ und einen „Stato burocratico“ widerspiegelt. Vgl. den Brief Max Webers an Robert Michels vom 9. Febr. 1909, MWG II/6, S. 51, der von diesem in italienisch wieder gegeben wurde: „Il Mosca ha capito dello Stato […] l'anima e l’ingranaggio“.
55
„Unter ‚Feudalstaat‘, heißt es in der deutschen Übersetzung, „verstehen wir denjenigen Typus politischer Organisation, in dem ein und dieselben Personen alle leitenden Funktionen der Gesellschaft, die wirtschaftlichen, richterlichen, verwaltenden und kriegerischen, gleichzeitig ausüben, während der Staat aus kleinen sozialen Gruppen besteht, deren jede alle Organe besitzt, deren sie zur Autarkie bedarf.“ Vgl. Mosca, Elementi I (wie oben, S. 14, Anm. 73), S. 97–100.
56
Dann folgen Beispiele aus der gesamten Weltgeschichte zum Beleg, daß auch Länder wie Ägypten und China eine feudale Phase durchlebt hätten und daß auch kleine politische Gebilde, die von Handel und Industrie lebten, sehr wohl als „feudal“ bezeichnet werden können. Mosca, Herrschende Klasse (wie oben, S. 14, Anm. 73), S. 76.
57
Die bürokratische Gesellschaftsordnung sei hingegen dadurch charakterisiert, „daß die Zentralgewalt einen erheblichen Teil des Nationaleinkommens als Steuern erhebt und für den Unterhalt des Heeres und des Verwaltungsapparates verwendet“. Ebd., S. 76 f.
58
Wieder benennt Mosca Entwicklungstendenzen, relativiert diese zugleich aber durch historische Beispiele. In der Kenntnis und Beherrschung der Universalgeschichte, der Einbeziehung wirtschaftlicher, militärischer und religiöser Verhältnisse ist Mosca im Verhältnis zu Max Weber durchaus als ein kongenialer Autor zu betrachten, allerdings in der Art der Darstellung wesentlich assoziativer und auch wertender. Im zweiten Teil [27]der „Elementi“, die aber erst nach Webers Tod erschienen sind, führt Mosca als zwei Grundtypen der politischen Organisation die orientalischen Großreiche und die antike Polis an; in dem einen wirke vorrangig das autokratische, in der anderen das liberale Prinzip. Ebd., S. 78.
59
Mosca wies noch auf andere Einteilungskriterien in der soziologischen Forschung hin, die ebenfalls bestrebt war, staatliche, gesellschaftliche, wirtschaftliche und ideelle Aspekte in einen systematischen Zusammenhang zu stellen: die Unterscheidung von militärischen und industriellen Staaten (Herbert Spencer), die auf Zwang bzw. Vertrag beruhen, und die Drei-Stadien-Theorie (Auguste Comte), nach der Militär-, Feudal- und Industriestaaten parallel zur geistigen Höherentwicklung – dem theologischen, metaphysischen und wissenschaftlich-positiven Zustand – auftreten. Mosca lehnte diese einseitigen Zuordnungen und ihre gesetzesmäßige Abfolge ab.[27] Ebd., S. 278–294, 321–336.
60
In gewisser Weise entsprach diesen Modellen das in der deutschen Nationalökonomie verbreitete Bedürfnis, politische und wirtschaftliche Ordnungen durch Stufenmodelle zu systematisieren und in eine logische Abfolge zu bringen. Ebd., S. 81–89.
Was Mosca im zweiten Teil der „Elementi“ als „tipi di organizzazione politica“ bezeichnet,
61
entspricht den „Formen der Herrschaft“ oder „Strukturformen der Herrschaft“ in Max Webers „Herrschaftssoziologie“, Vgl. dazu oben, S. 25, Anm. 46.
62
methodisch aber nicht den Idealtypen oder Typen der legitimen Herrschaft. Die ältere Fassung der „Herrschaftssoziologie“ ist an den Herrschaftsformen ausgerichtet und weist damit auf einen um 1900 geführten, kantianisch geprägten „Formen“-Diskurs hin. Max Weber hatte die Frage von „Form“ und „Inhalt“ insbesondere im Zusammenhang mit den Schriften von Rudolf Stammler und Georg Simmel beschäftigt. Stammler ging in seiner Kritik der materialistischen Geschichtsauffassung davon aus, daß die äußeren Regeln (Konventional- und Rechtsregeln) das allein konstitutive Merkmal allen sozialen Lebens seien, Vgl. z. B. unten, S. 234, 278 f., 483 und 485 f.
63
und stellte das Axiom auf, daß die Form der Gesellschaft identisch mit dem Gedanken der äußeren Re[28]gelung sei. Stammler, Rudolf, Wirtschaft und Recht nach der materialistischen Geschichtsauffassung. Eine sozialphilosophische Untersuchung, 2. Aufl. – Leipzig: Veit & Comp. 1906, S. 100 (hinfort: Stammler, Wirtschaft und Recht2). Im überlieferten Handexemplar Max Webers (Arbeitsstelle der Max Weber-Gesamtausgabe, BAdW München) finden sich – wie sonst kaum – durchgehend Anstreichungen, Unterstreichungen und Randbemerkungen, was darauf schließen läßt, daß Stammlers Arbeit Webers eigene Erkenntnisziele berührte und ihn zur scharfen Kritik herausforderte.
64
So war – wie Weber in seiner Stammler-Kritik bemerkte – der Formbegriff aber mit transzendentalen und apriorischen Annahmen durchsetzt und daher nicht mehr als erkenntniskritisches Mittel („,formales‘ Prinzip“) brauchbar.[28] Ebd., S. 112–115, sowie S. 477.
65
Einen anderen Weg hatte Georg Simmel – auch in Abgrenzung zum historischen Materialismus – beschritten und die Soziologie als „eine Erkenntnismethode“ charakterisiert. Weber, Max, R. Stammlers „Überwindung“ der materialistischen Geschichtsauffassung, in: AfSSp, Band 24, Heft 1, 1907, S. 94–151, hier: S. 116 (MWG I/7).
66
Ihr würde es um die „Formen der Vergesellschaftung“ oder – anders formuliert – um die Erkenntnis der Wechselwirkungen zwischen Menschen gehen, und dies bedeute zugleich eine Abstraktion von konkreten und materiellen Inhalten. Simmel, Georg, Das Problem der Sociologie, in: Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft im Deutschen Reich, 18. Jg., Heft 4, 1894, S. 271–277, Zitat: S. 272 (hinfort: Simmel, Problem); angeführt in: Weber, Vorlesungs-Grundriß, S. 7 (dort unter dem falschen Titel „Die Aufgaben der Soziologie“), und indirekt erwähnt in: Weber, Kategorien, S. 253, Fn. 1 („ältere Arbeiten (in Schmollers ,Jahrbuch‘ und Jaffés ,Archiv‘“), wobei unter der letztgenannte Angabe der Aufsatz „Soziologie der Über- und Unterordnung“ gemeint sein dürfte – vgl. dazu die nachfolgende Anm.).
67
Deren Behandlung verwies er in dem frühen Aufsatz „Problem der Sociologie“ an die Spezialdisziplinen. Vgl. Simmel, Georg, Soziologie der Über- und Unterordnung, in: AfSSp, Band 24, Heft 3, 1907, S. 477–546, S. 478 (hinfort: Simmel, Über- und Unterordnung).
68
Genau diesen Punkt kritisierte Max Weber in seinen Aufzeichnungen zu Simmels Monographie „Soziologie“, die 1908 erschien und zu großen Teilen auf dem Wiederabdruck älterer Aufsätze beruhte. Simmel, Problem (wie oben, Anm. 66), S. 272.
69
Bereits zu den einleitenden methodischen Ausführungen bemerkte Weber „Form u. Inhalt nicht zu trennen, weil historisch“ Simmel, Georg, Soziologie. Untersuchungen über die Formen der Vergesellschaftung. – Leipzig: Duncker & Humblot 1908 (hinfort: Simmel, Soziologie). Das Handexemplar Max Webers befindet sich in der Diözesanbibliothek Aachen, eine Teilkopie in der Arbeitsstelle der Max Weber-Gesamtausgabe, BAdW München. In die „Soziologie“ gingen teilweise die bereits genannten Aufsätze Simmels ein. Vgl. dazu den Editorischen Bericht, in: Georg Simmel-Gesamtausgabe, Band 11, hg. von Otthein Rammstedt. – Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1992, S. 877–905. Die beiden herrschaftssoziologischen Aufsätze, Simmel, Über- und Unterordnung (wie oben, Anm. 67) und Simmel, Philosophie der Herrschaft (wie oben, S. 14, Anm. 74), wurden nahezu unverändert in Simmel, Soziologie, wiederabgedruckt: der erstgenannte ebd., S. 134–186, 197–212, und der zweitgenannte ebd., S. 213–246. Sie bilden damit im wesentlichen das als „Über- und Unterordnung“ betitelte Kapitel III. von Simmel, Soziologie, S. 134–246.
70
und wiederholte diesen kritischen Einwand mehrfach als Kommentar zum [29]herrschaftssoziologischen Kapitel „Über- und Unterordnung“. Vgl. Weber, Max, [Exzerpt zu:] Simmel, Soziologie, Deponat Max Weber, BSB München, Ana 446, OM 5, S. 1 (Vorderseite) zu S. 15 der „Soziologie“ (hinfort: Weber, Simmel-Exzerpt) [[MWG I/12]].
71
„Form“ und „Strukturform“ dienten Max Weber als Erkenntnismittel, um empirische und historische Vielfalt an dem Grundmuster einer Form erfassen und verschiedene Formen miteinander vergleichen zu können. In der zeitgenössischen Literatur hatte sich der von Max Weber geschätzte Friedrich Gottl in einem Aufsatz „Zur sozialwissenschaftlichen Begriffsbildung“ mit der naturwissenschaftlichen Methode der Strukturbestimmung auseinandergesetzt und Ansatzpunkte geliefert, wie diese in eine das Individuelle beschreibende Begriffs- und Kategorienlehre zu überführen sei.[29] Ebd., S. 2 (Rückseite) zu S. 153 der „Soziologie“: „Die Inhalte entscheiden“; S. 3 (Vorderseite) zu S. 172 f.: „ferner: die Inhalte, nicht die Form entscheidet“; S. 3 (Rückseite) zu S. 219: Grund immer: 1) Ausschaltung der Inhalte 2) Ausschaltung des Rationalen“.
72
Auch wenn in der Realität die charakteristische Komponente „durch ganz andere Strukturprinzipien zurückgedrängt oder mit ihnen in den mannigfachsten Formen verschmolzen und verquickt“ sei, schrieb Weber, müsse es für die „theoretische Betrachtung“ möglich sein, diese ganz rein herauszupräparieren. Gottl, Friedrich, Zur sozialwissenschaftlichen Begriffsbildung. I. Umrisse einer Theorie des Individuellen, in: AfSSp, Band 23, 1906, S. 403–470, bes. S. 403–406 und 426–432.
73
Das Arbeiten mit „Strukturformen der Herrschaft“ ermöglichte es einerseits, vergleichbare Formen anderer Kulturkreise in die Analyse miteinzubeziehen, und schuf somit die methodische Voraussetzung für Max Webers universalhistorische Perspektive, und andererseits konnte durch die Aufstellung von Strukturmerkmalen eine systematische Brücke von der Behandlung der politischen und sozialen Formen der Herrschaft zu den Bereichen Wirtschaft, Recht und Kultur geschlagen werden. Vgl. unten, S. 489.
74
Mit dieser Methode hatte bereits Karl Marx die „ökonomische Struktur der Gesellschaft“ zu bestimmen versucht, allerdings in einseitiger Ableitung derselben von den Produktionsverhältnissen. Patriarchale und charismatische Herrschaft bezeichnet Weber explizit als „soziale Strukturformen der Herrschaft“ (vgl. unten, S. 483, 558 f. und 587 f.); zum Verhältnis von Herrschafts- und Wirtschaftsformen vgl. insbes. die Passage in dem einleitenden Text „Herrschaft“, unten, S. 127 f. und die systematische Behandlung am Beispiel der traditionalen Herrschaftsformen, unten, S. 418–453.
75
Marx, Karl, Zur Kritik der Politischen Ökonomie. – Berlin: Franz Duncker 1859, S. V: „Die Gesammtheit dieser Produktionsverhältnisse bildet die ökonomische Struktur der Gesellschaft, die reale Basis, worauf sich ein juristischer und politischer Überbau erhebt, und welcher bestimmte gesellschaftliche Bewußtseinsformen entsprechen.“
Zu Beginn der älteren Fassung der „Herrschaftssoziologie“ skizzierte Max Weber – ganz ähnlich wie Gaetano Mosca – seinen Ansatz, die Struktur der Herrschaft durch die „Beziehung des oder der Herren zu dem Apparat und beider zu den Beherrschten und weiterhin durch die ihr spezifi[30]schen Prinzipien der ‚Organisation‘“ zu erfassen.
76
Die bürokratische Herrschaftsform bestimmte er als den rationalsten Typus der Organisation und gewann damit einen Untersuchungsmaßstab für die Charakterisierung der anderen Strukturformen der Herrschaft,[30] Vgl. unten, S. 146.
77
so daß diese auch typologische Qualität erhielten, wie z. B. „Patrimonialismus“, „Feudalismus“ und „Charismatismus“. Werfen wir daher einen kurzen Blick auf die zeitgenössische Forschung speziell zu diesen „Formen der Herrschaft“. Vgl. dazu die ausführlichere Darstellung unten, S. 71–74.
Zum Bürokratismus gab es eine Vielzahl von Schriften, zumeist polemischer Natur, die über die mangelnde Effizienz der Beamten, die Absurditäten bürokratischer Vorgänge und das stete Anwachsen des Behördenapparates klagten.
1
„Bürokratismus“ galt in der Alltagssprache als Schimpfwort, Vgl. z. B. Olszewski, Josef, Bureaukratie. – Würzburg: A. Stubers (C. Kabitzsch) 1904; Geiger, Hans, Der Beamte als Mensch und Staatsbürger, in: Das Freie Wort, 12. Jg., Nr. 11, Sept. 1912, S. 420–425, oder die Broschüre von Hasse, Hermann, Die Bürokratie, was sie uns hilft und wie ihr geholfen werden kann (Kultur und Fortschritt, Nr. 400). – Gautzsch bei Leipzig: Felix Dietrich 1911.
2
mit dem die Auswüchse des Systems beschrieben wurden, die Verwendung als wissenschaftlicher Begriff war hingegen selten. Auf die beklagten Mißstände reagierte man in Preußen mit der Einsetzung einer amtlichen Kommission, die im Sommer 1909 erstmals zusammentrat und Vorschläge zur Reform der Verwaltung und des Beamtenrechts erarbeiten sollte. Vgl. dazu Kobler, Franz, Bürokratismus, in: Der Eintritt der erfahrungswissenschaftlichen Intelligenz in die Verwaltung (Schriften der Deutschen Gesellschaft für soziales Recht, Heft 5). – Stuttgart: Ferdinand Enke 1919, S. 34–47.
3
Was die wissenschaftliche Literatur betrifft, so beschäftigte sich ein Zweig der Jurisprudenz mit dem Beamtenrecht als einem Teilbereich des Verwaltungsrechts. Vgl. dazu die Ausführungen, unten, S. 52 f. mit Anm. 19.
4
Der Nationalökonom Gustav Schmoller, der sich insbesondere um die historische Erforschung der preußischen Bürokratie verdient gemacht und die Edition der „Acta Borussica“ ins Leben gerufen hatte, Vgl. bes. die Monographie von Brand, Arthur, Das Beamtenrecht. Die Rechtsverhältnisse der preußischen unmittelbaren und mittelbaren Staatsbeamten (Handbücher des preußischen Verwaltungsrechts, Band 5). – Berlin: Carl Heymanns 1914 (hinfort: Brand, Beamtenrecht).
5
trieb auch ihre sozialpolitisch akzentuierte Erforschung im [31]Verein für Sozialpolitik voran. Gustav Schmoller war der Begründer und Herausgeber der Acta Borussica, der ersten Großedition zur Verwaltungsgeschichte in Deutschland. Vgl. Acta Borussica. Denkmäler der Preußischen Staatsverwaltung im 18. Jahrhundert, hg. von der Königlichen Akademie der Wissenschaften, Reihe A: Die Behördenorganisation und die allgemeine Staatsverwaltung Preußens im 18. Jahrhundert, Band 1 ff. – Berlin: Paul Parey 1894 ff.
6
Sein Schüler Otto Hintze trat u. a. mit einer Studie über den „Beamtenstand“ hervor, in dem die Frühformen der bürokratischen Verwaltung, auch für andere europäische Staaten, vergleichend untersucht wurden.[31] Vgl. dazu unten, S. 52 f.
7
Die Erforschung der Bürokratie war auch in der Alten Geschichte nur ein Teilaspekt der Verwaltungsgeschichte und somit – wie in den anderen Wissenschaftsdisziplinen auch – nur ein „Nebenprodukt“, aber kein eigenständiger Forschungszweig. Dies gilt ebenfalls für die jüngeren Fächer, Soziologie und Politische Wissenschaft, obwohl sich bei Gaetano Mosca – wie schon erwähnt – eine soziologische und universalhistorisch vergleichende Perspektive fand. Hintze, Otto, Der Beamtenstand (Vorträge der Gehe-Stiftung zu Dresden, Band 3). – Leipzig, Dresden: B. G. Teubner 1911, S. 1–78 (= S. 95–170) (hinfort: Hintze, Beamtenstand).
8
Alfred Weber befaßte sich in einem Essay, der 1910 in der „Neuen Rundschau“ erschien, mit der modernen Bürokratie, legte den Schwerpunkt aber nicht – wie sein Bruder Max – auf die Darstellung der „Konstitution“ und „innere[n] Form“, sondern auf die Kulturbedeutung der Bürokratisierung. Vgl. oben, S. 26 f.
9
Sie sei eine Facette des allgemeinen Rationalisierungsprozesses der Moderne, der sich im wirtschaftlichen Bereich als Kapitalismus und im kulturellen Bereich als Intellektualisierung äußere.Weber, Alfred, Der Beamte, in: Die neue Rundschau, 21. Jg. der Freien Bühne, Band 4, 1910, S. 1321–1339, Zitat: S. 1322.
10
Unter anderen Vorzeichen stellte auch der Sozialist Karl Kautsky die staatliche Bürokratie in einen umfassenden historischen und gesellschaftspolitischen Zusammenhang. Bei ihm war die Entstehung des modernen Staates – streng marxistisch gedacht – die Folge der „kapitalistische[n] Produktionsweise“: Ebd., S. 1323 f.
11
Die moderne Staatsbürokratie zeichne sich, ebenso wie die kapitalistische Wirtschaftsordnung, durch die Konzentration der ökonomischen und militärischen Machtmittel, aber auch durch Arbeitsteilung und Fachausbildung aus. Die Zentralisation von Verwaltung, Rechtsprechung und Steuererhebung bedeute zugleich die Ausschaltung von Zwischengewalten, politisch selbständigen Gemeinden und Bezirken; sie alle würden, wie Kautsky schrieb, „nivellirt“. Kautsky, Karl, Die Soziale Revolution, 3. Aufl. – Berlin: Vorwärts 1911, S. 19.
12
Die herrschende Schicht werde zunehmend ökonomisch unabkömmlich, so daß sie die Staatsverwaltung an Beamte und Lohnarbeiter abgeben müsse (ein Gegenbeispiel dazu sei England, das zwar kapitalistisch, aber nicht bürokratisch regiert sei). Bei Max Weber findet sich eine vergleichbare Einschätzung der Entwicklung sowie dieselbe [32]prinzipielle Verknüpfung von kapitalistischer Wirtschaftsweise und bürokratischer Verwaltung. Auch Weber charakterisierte diese systematisch mit den bereits angeführten Strukturmerkmalen und fügte diesen weitere, wie Berechenbarkeit, Ebd., S. 19.
13
rationale Rechtsprechung („ohne Ansehen der Person“)[32] Vgl. unten, S. 186 f., 426, und Weber, Probleme der Staatssoziologie, unten, S. 775.
14
und die Trennung der sachlichen Betriebsmittel vom Angestellten bzw. Soldaten, hinzu. Vgl. unten, S. 186, 314, 517, und Weber, Die drei reinen Typen, unten, S. 727.
15
Vgl. unten, S. 406–408, 565 und Weber, Probleme der Staatssoziologie, unten, S. 753 f.
Zu den älteren Herrschaftsformen wurden in der zeitgenössischen Forschung die patriarchale Herrschaft – manchmal auch das Matriarchat –, der patrimoniale und der feudale Staat gezählt.
16
Zur Zeit Max Webers sprach man nicht von „Patrimonialismus“, sondern von der „Patrimonialtheorie“, und diese war – wie bereits erwähnt – im 19. Jahrhundert und darüber hinaus mit dem Namen Carl Ludwig von Hallers verknüpft. Wirksam hatte der Schweizer in seinem vierbändigen Werk „Restauration der Staatswissenschaft“ die patrimoniale Herrschaft in die politische Diskussion eingebracht. Sein Werk, das zu Beginn des 19. Jahrhunderts erschienen war, richtete sich insbesondere gegen die Französische Revolution und die mit ihr verbundenen demokratischen, natur- und vertragsrechtlichen Ideen. Vgl. Gumplowicz, Ludwig, Die ältesten Herrschaftsformen, in: Der arme Teufel, 1. Jg., Nr. 9 vom 12. Juli 1902, S. 2, der diese Klassifikation aber ablehnt.
17
Ausgehend von der Annahme einer natürlichen Ungleichheit der Menschen, stellte Haller das „Naturgesez“ von der Herrschaft der Mächtigeren auf Haller, Carl Ludwig von, Restauration der Staatswissenschaft oder Theorie des natürlich-geselligen Zustands der Chimäre der künstlich-bürgerlichen entgegengesetzt, 4 Bde., 2. Aufl. – Winterthur: Steiner 1820/21, vgl. insbes. das Vorwort, S. XVI ff. Die erste Auflage war seit 1816 in Paris erschienen.
18
und unterteilte die Staaten entsprechend der Provenienz des Herrschers in Patrimonial-, Militär- und geistliche Staaten. Ebd., Band 1, 1820, S. 355.
19
Die Patrimonialstaaten gingen bei ihm aus patriarchalen Verhältnissen hervor, wobei die Herrschaftsbasis auf dem Grundeigentum des Herrn beruhte. Das Privateigentum des Herrn an Grund und Boden ist hier also nicht die Folge der Staatsbildung, sondern deren Voraussetzung. Ebd., Band 2, 1820, S. 11–15.
20
Es bildet zugleich die materielle Grundlage der Herrschaftsausübung: Der Patrimonialherr ist in der Auswahl, Anstellung und Ausstattung seiner Diener, Beamten und Soldaten völlig frei, sollte sie aber auf eigene Kosten bezahlen und ausrüsten können. Eine Trennung von privaten Dienern und [33]öffentlichen Beamten gibt es ebenso wenig wie eine Trennung von privatem und öffentlichem Haushalt. Ebd., S. 57.
21
Die Domänen des Patrimonialfürsten müssen den Ertrag abwerfen, den er zur Finanzierung seines Apparates braucht. Der Erhalt seiner Herrschaft hängt daher auch davon ab, daß er stets mehr besitzt als die anderen Grundherren seines Herrschaftsbereiches. Rechtlich gesehen ist der Patrimonialfürst völlig unbeschränkt. Es gibt keine weltliche Gewalt, der er unterworfen ist; nur vor dem Sittengesetz und der göttlichen Instanz hat er sich persönlich zu verantworten. Hieraus leitet Haller auch den Grundsatz ab, daß alle Untertanen persönlich frei sind und deshalb auch nicht zum Kriegsdienst gezwungen werden dürfen.[33] Ebd., S. 144, 273.
22
Kriege zu führen ist die Aufgabe des Patrimonialherren, ebenso wie die Unterhaltung eines eigenen Heeres. Ebd., S. 85–87.
23
Vgl. dazu ebd., S. 80, 84 und 95.
Umstritten an Hallers Theorie, die vormoderne Zustände in glänzendem Licht darstellte, war vor allem die Herleitung der staatlichen Gewalt aus privatrechtlichen Eigentumsverhältnissen. Insbesondere Georg von Below bekämpfte diese Vermischung von privaten und öffentlichen Rechten in seinem Buch „Der deutsche Staat des Mittelalters“, das im März 1914 erschien,
24
und brachte somit Hallers Thesen zum „Patrimonialstaat“ kurz vor dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges wieder in die Diskussion. Below, Georg von, Der deutsche Staat des Mittelalters. Ein Grundriß der deutschen Verfassungsgeschichte, 1. Aufl. – Leipzig: Quelle & Meyer 1914 (hinfort: Below, Staat des Mittelalters1).
25
Die Beschäftigung mit patrimonialen Formen der Herrschaft war neben der mediävistischen, auch in der althistorischen Forschung beheimatet: „Patrimonium“, das väterliche Erbgut, war ein Begriff des römischen Erbrechts und hatte seine verwaltungspolitische Entsprechung in den sogenannten procuratorischen Provinzen des römischen Reiches. Diese waren nicht dem Senat, sondern dem Princeps direkt unterstellt und wurden deshalb als seine Domänen behandelt und von seinen eigenen Beamten verwaltet. Für sie taucht in der Forschung der Jahrhundertwende die Bezeichnung „Patrimonialbeamte“ auf. Vgl. dazu den Brief Max Webers an Georg von Below vom 21. Juni 1914, der unten, S. 238, ausführlich zitiert ist.
26
Ägypten war die größte und bekannteste procuratorische Provinz des römischen Reiches und wurde bei Max Weber neben China und Rußland als ein Beispiel für patrimonialbürokratisch regierte Reiche ausführlicher behandelt. Vgl. Rostowzew, Michail, Geschichte der Staatspacht in der römischen Kaiserzeit bis Diokletian, in: Philologus. Zeitschrift für das Classische Alterthum, Supplementband 9, Heft 3, 1904, S. 329–512, hier: S. 461.
[34]Max Weber benutzte – im Gegensatz zu den meisten seiner Fachkollegen – den Begriff „Feudalismus“ bereits in seinen frühen agrargeschichtlichen Studien und nationalökonomischen Vorlesungen.
27
Auch nach der Jahrhundertwende war „Feudalismus“ noch kein festumrissener und etablierter Forschungsbegriff in den Geistes-, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften. Historiker und Rechtshistoriker beschrieben das vielschichtige Phänomen des abendländischen Mittelalters vorrangig unter dem engeren Begriff „Lehnswesen“, aber auch als Benefizial- oder Feudalwesen.[34] Vgl. Weber, Vorlesungs-Grundriß, S. 8 (§ 8 „4. Die Entwicklung des Feudalismus und dessen Formen“) und S. 11 (§ 10 „2. Die Entwicklung der Grundherrschaft und des Feudalismus“); in den überlieferten Notizen zur Vorlesung „Allgemeine (,theoretische‘) Nationalökonomie“ findet sich unter § 8 bereits die systematische und universalhistorisch belegte Differenzierung in den Kasten- bzw. Stadtfeudalismus und den grundherrlichen Feudalismus sowie der militärische Erklärungsansatz als Basis des Feudalismusbegriffs (Deponat Max Weber, BSB München, Ana 446, OM 3, BI. 70, MWG III/1); ders., Praktische Nationalökonomie, GStA PK, Vl. HA, Nl. Max Weber, Nr. 31, Band 2 (MWG III/3 [[MWG III/2]]), insbes. Bl. 15 (Feudalismus als „Quelle wirtsch[afts]pol[itischer] Institutionen“); ders., Soziale Gründe, S. 77; ders., Agrarverhältnisse1, S. 1 f. und ders., Agrarverhältnisse2, S. 58 f., sowie ders., Feudalismus und Städtewirthschaft im Mittelalter [Vortrag am 27. Nov. 1897], in: MWG I/4, S. 847 f.
28
Stand hier die rechtliche Fixierung im Vordergrund, so bezog sich die marxistische Terminologie auf die wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse einer zu überwindenden Geschichtsepoche. Vgl. z. B. Brunner, Heinrich, Deutsche Rechtsgeschichte, Band 2, 1. Aufl. – Leipzig: Duncker & Humblot 1892, S. 242 ff. (hinfort: Brunner, Deutsche Rechtsgeschichte II), und Waitz, Georg, Lehnwesen, in: ders., Abhandlungen zur Deutschen Verfassungs- und Rechtsgeschichte, hg. von Karl Zeumer. – Göttingen: Dieterich 1896, S. 301–317, bes. S. 314 f.
29
Als politischer Kampfbegriff der Französischen Revolution ging der „Feudalismus“-Begriff in den deutschen Sprachgebrauch des 19. Jahrhunderts ein und wurde auch von Liberalen als Abwehrformel gegen ständisch-feudale Privilegien benutzt. Vgl. bes. Marx, Elend der Philosophie, S. 104 ff. (feudale Produktionsverhältnisse).
30
In den nationalökonomischen Lehrbüchern fehlt der Begriff; Vgl. dazu insbes. Wunder, Heide, Einleitung: Der Feudalismus-Begriff. Überlegungen zu Möglichkeiten der historischen Begriffsbildung, in: dies. (Hg.), Feudalismus. Zehn Aufsätze. – München: Nymphenburger Verlagshandlung 1974, S. 10–76, bes. S. 10–23, sowie Brunner, Otto, Feudalismus, feudal, in: Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, hg. von Otto Brunner, Werner Conze, Reinhart Koselleck, Band 2. – Stuttgart: Klett-Cotta 1979, S. 337–350.
31
hier wurden die Zustände des Mittelalters unter den Aspekten von Naturalwirtschaft, Grund- und Gutsherrschaft und bäuerlicher Abhängigkeit behandelt. Im „Handwörterbuch der Staatswissenschaften“ gab [35]es keinen Haupteintrag „Feudalismus“, allerdings weist das Register zur dritten Auflage auf dessen Behandlung in den Artikeln „Agrarverhältnisse im Altertum“ (Max Weber), Vgl. ebd., S. 348.
32
„Bauernbefreiung in Japan“ (Inazo Nitobe)[35] Der Hinweis führt auf Weber, Agrarverhältnisse3, S. 53.
33
und „Familie“ (Eberhard Gothein) Nitobe, Inazo, Die Bauernbefreiung in Japan, in: HdStW3, Band 2, 1909, S. 621–627, bes. S. 622 f.
34
hin. Eine Verständigung über die unter dem Begriff „Feudalismus“ zu subsumierenden vielfältigen Erscheinungen gab es aber noch nicht, was sich auch an Max Webers Bemerkungen in den wissenschaftstheoretischen Aufsätzen der Jahre 1904 und 1906 ablesen läßt. Gothein, Eberhard, Familie, in: HdStW3, Band 4, 1909, S. 21–41, bes. S. 32 f. (hinfort: Gothein, Familie).
35
Erst mit der typologischen Bestimmung in der „Herrschaftssoziologie“, die dem „Feudalismus“-Begriff die Charakteristika des fränkischen Lehnswesens zugrundelegte, Weber, Objektivität, S. 67, und ders., Kritische Studien, S. 179. Zum „Feudalismus“-Begriff bei Max Weber vgl. Kraus, Elisabeth, Feudalismus im Werk Max Webers. Zur Genese eines Typusbegriffs. – Tübingen: unveröffentlichte Magisterarbeit 1982.
36
schuf Max Weber eine methodisch zuverlässige Basis für den Vergleich mit fremden Kulturen. Er konnte dabei an zwei, in der zeitgenössischen Forschung bestehende Richtungen anknüpfen. Vgl. dazu den Editorischen Bericht zum Text „Feudalismus“, unten, S. 371, sowie Hintze, Otto, Max Webers Soziologie [= Rezension zur 2. Aufl. von „Wirtschaft und Gesellschaft“], in: Schmollers Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft im Deutschen Reich, 50. Jg., 1926, S. 83–95, hier: S. 93 (hinfort: Hintze, Webers Soziologie).
In der engeren fachspezifischen Diskussion, bei den historischen Disziplinen, stand die Frage nach der Herkunft des okzidentalen mittelalterlichen Feudalwesens im Vordergrund: Stammte es aus dem germanischen Gefolgschaftswesen?
37
War es militärischen Ursprungs, eingerichtet zur Versorgung von berittenen Soldaten? Vgl. zu dieser Streitfrage Brunner, Deutsche Rechtsgeschichte II (wie oben, S. 34, Anm. 28), S. 258 ff.
38
Inwieweit war es durch das kirchliche Pfründensystem beeinflußt? Vgl. Roth, Paul, Geschichte des Beneficialwesens von den ältesten Zeiten bis ins zehnte Jahrhundert. – Erlangen: J. J. Palm und Ernst Enke 1850, S. 313 ff. (hinfort: Roth, Beneficialwesen), sowie Brunner, Heinrich, Der Reiterdienst und die Anfänge des Lehnwesens, in: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Germanistische Abtheilung, Band 8, 1887, S. 1–38 (hinfort: Brunner, Reiterdienst).
39
Woher stammte der Gedanke eines kontraktlich fixierten Verhältnisses zwischen Lehnsherr und Vasall? Der Mediävist Georg von Below gehörte mit seinem 1914 erschienenen Buch [36]„Der deutsche Staat des Mittelalters“ zu den Historikern, die den „Feudalismus“-Begriff durchgehend verwendeten und einige Elemente zur Bestimmung der „Kategorie des Feudalismus“ (in Abgrenzung zur „Kategorie der Patrimonialität“) benannte. Stutz, Lehen und Pfründe, S. 214 f., verwies auf den Zusammenhang von Lehnswesen und kirchlichem Benefizialwesen, um dann aber die Unterschiede zwischen Pfründe und Lehen herauszustellen (ebd., S. 244 ff.).
40
Entsprechend seines verfassungsrechtlichen Standpunkts charakterisierte er den „Feudalstaat“ des Mittelalters durch die „Veräußerung von Hoheitsrechten“, wodurch es zu einer Stärkung der lokalen Gewalten und damit zu einer Dezentralisation der Staatsgewalt gekommen sei.[36] Below, Staat des Mittelalters1 (wie oben, S. 33, Anm. 24), S. 281, 313.
41
Eine Übertragung des „Feudalismus“-Begriffs auf andere Kulturen lehnte er aber wegen der Singularität der abendländischen Entwicklung ab. Ebd., insbes. S. 279–283.
42
Ebd., S. 332–334.
Allerdings wurden schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts in Arbeiten über nicht-europäische Kulturen analoge Erscheinungen mit der in Deutschland entwickelten rechtshistorischen Terminologie beschrieben, so übersetzte z. B. Joseph von Hammer in seinem 1815 erschienenen Werk über das Osmanische Reich „Sipahi“ (Reiter) als „Lehensmann“, „Berat“ als „Lehensdiplom“ und „Timar“ (Soldatengrundstück) als „kleines Lehen“ (heute als „Pfründe“ bezeichnet).
43
Von „Feudalismus“ und einem „Feudalstaat“ in Japan sprachen nicht nur Karl Rathgen, Vgl. Hammer, Joseph von, Des osmanischen Reichs Staatsverfassung und Staatsverwaltung, dargestellt aus den Quellen seiner Grundgesetze, 2 Bände. – Wien: Camesinasche Buchhandlung 1815, hier: Band 1, S. 338, 372 und Band 2, S. 274 f. (hinfort: v. Hammer, Osmanisches Reich I, II).
44
der acht Jahre in Tokio gelehrt hatte, sondern auch japanische Gelehrte, wie z. B. Tokuzo Fukuda und Sakuya Yoshida, Rathgen, Japans Volkswirtschaft, S. 20 f., datiert die Entstehung des Feudalstaates auf das 9. Jahrhundert und zieht Parallelen zum fränkischen Reich; die „Beseitigung des Feudalismus“ fällt bei ihm erst mit dem Ende der Tokugawa-Herrschaft 1867 zusammen (ebd., S. 74).
45
die beide in Deutschland studiert hatten. Feudale Züge fanden europäische Forscher außerdem im alten Persien, bei Azteken und Inkas, Während Yoshida, Sakuya, Geschichtliche Entwickelung der Staatsverfassung und des Lehnwesens von Japan. – Den Haag: Μ.Μ. Couvée o. J. [1890] (hinfort: Yoshida, Staatsverfassung), den Feudalismus ebenfalls vom 9. bis 19. Jahrhundert datiert, sieht Fukuda, Tokuzo, Die gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwickelung in Japan (Münchener Volkswirtschaftliche Studien, hg. von Lujo Brentano und Walther Lotz, Band 24). – Stuttgart: J. G. Cotta Nachfolger 1900 (hinfort: Fukuda, Japan), in der Geschichte der Tokugawa bereits den „Untergang des Feudalstaats“ (ebd., S. 116).
46
in China vor der Reichseini[37]gung, Vgl. dazu die Aufzählung bei Gothein, Familie (wie oben, S. 35, Anm. 34), S. 33; das Inkareich zählte Max Weber dazu, wie aus Weber, Vorlesungs-Grundriß, S. 8, hervorgeht.
47
im alten Ägypten (Übergang vom alten zum mittleren Reich),[37] Vgl. dazu z. B. Conrady, August, China, in: Geschichte des Orients (Weltgeschichte, hg. von J. Pflugk-Hartung, Band 3). – Berlin: Ullstein & Co. [1910], S. 547 f. (hinfort: Conrady, China), und Franke, Otto, Die Verfassung und Verwaltung Chinas, in: Allgemeine Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte (Kultur der Gegenwart, Teil II, Abt. II,1). – Leipzig, Berlin: B. G. Teubner 1911, S. 90 f. – Chou-Verfassung als „absolute[r] cäsaropapistische[r] Feudalstaat“ – (hinfort: Franke, China).
48
in der antiken Polis, Vgl. Meyer, Eduard, Geschichte des Altertums, Band 1,2: Die ältesten geschichtlichen Völker und Kulturen bis zum sechszehnten Jahrhundert, 2. Aufl. – Stuttgart, Berlin: J. G. Cotta Nachfolger 1909, S. 206 ff. (hinfort: Meyer, Geschichte des Altertums I,22).
49
in Indien, Weber verwendete hierfür bereits früh den Begriff „Stadtfeudalismus“, Weber, Agrarverhältnisse1, S. 2.
50
im sog. islamischen Mittelalter, aber auch in Polen und Rußland. Galt es zumeist, Fremdes durch den Vergleich mit europäischen Einrichtungen vertrauter zu machen, so benutzten die beiden Forscher Otto Hötzsch und Carl Heinrich Becker bei der Beschreibung polnischer und orientalischer Zustände die auf das fränkische Reich bezogenen Begriffe, wie Vasallität, Benefizium, Lehen und Allod, als eine Vergleichsfolie, um die Andersartigkeit der polnischen Adelsrepublik oder des islamischen Militärlehens herauszuarbeiten. Vgl. dazu Tischendorf, Paul Andreas von, Das Lehnswesen in den moslemischen Staaten insbesondere im Osmanischen Reiche. – Leipzig: Giesecke & Devrient 1872, S. 32 (hinfort: v. Tischendorf, Lehnswesen), sowie Tod, James, The Annals and Antiquities of Rjasthan or the Central and Western Rajpoot States, Vol. 1. – Calcutta: W. C. Samanta 1899, bes. S. 133–148 (hinfort: Tod, Rjasthan).
51
Vgl. Hötzsch, Otto, Adel und Lehnswesen in Rußland und Polen und ihr Verhältnis zur deutschen Entwicklung, in: HZ, Band 108, 1912, S. 541–592, bes. S. 579 (hinfort: Hötzsch, Adel und Lehnswesen), sowie Becker, Steuerpacht und Lehnswesen, bes. S. 86.
Charismatische Herrschaft als ein besonderes Herrschaftsverhältnis zwischen einem Kriegsführer und seiner Gefolgschaft, einem Propheten und seinen Jüngern oder einem Parteiführer und seinen Anhängern war der Sache nach bekannt, aber es gab dafür keinen gemeinsamen Oberbegriff. „Charisma“ war zur Zeit Max Webers kein Allgemeinbegriff, sondern ein Fachbegriff der Exegese, der als Bezeichnung einer Gnaden- oder Geistesgabe vor allem dem Apostel Paulus zugeschrieben wurde.
52
Der Theologe Karl Holl veranschaulichte in seiner Habilitationsschrift „Enthusiasmus und Bußgewalt“, die 1898 erschienen war, die Differenz zwischen römischer und griechischer Kirche an der unterschiedlichen Stellung des Mönchtums. In der griechischen Kirche habe sich der altchristliche Gedanke bewahrt, daß „ein Charisma die Fähigkeit zur Askese“ ver[38]leihe und daß die Mönche insofern auserwählte, charismatisch begnadete Menschen seien. Vgl. Cremer, Hermann, Art. Geistesgaben, Charismata, in: RE3, Band 6, 1899, S. 460–463, hier: S. 461 f.; vgl. dazu auch Lauterburg, Moritz, Der Begriff des Charisma und seine Bedeutung für die praktische Theologie. – Gütersloh: C. Bertelsmann 1898.
53
Ihnen allein stehe daher die Ausübung der Bußgewalt, d. h. die Vergebung der Sünden und die Festlegung von Art und Umfang der Buße, zu.[38] Holl, Karl, Enthusiasmus und Bußgewalt beim griechischen Mönchtum. Eine Studie zu Symeon dem neuen Theologen. – Leipzig: J. C. Hinrichs 1898, S. 148 (Zitat) und S. 151, 153 (hinfort: Holl, Enthusiasmus); Weber bezieht sich expressis verbis erst in der ersten Lieferung (WuG1, S. 124; MWG I/23) auf Holl, stützt sich aber schon früher indirekt auf dessen Studie, wie die Anspielungen in einem Vormanuskript zum „Antiken Judentum“, das auf das Jahr 1911/12 zu datieren ist, belegen. Vgl. dazu den Editorischen Bericht zum Text „Charismatismus“, unten, S. 455 f. Ein von Max Weber durchgearbeitetes Exemplar der Holl-Studie findet sich in der Universitätsbibliothek Heidelberg.
54
In der griechischen Kirche hätten ausschließlich die Mönche bis Mitte des 13. Jahrhunderts die Binde- und Lösegewalt innegehabt. Holl, Enthusiasmus (wie oben, Anm. 53), S. 266.
55
Der Jurist und Kirchenrechtler Rudolph Sohm hatte bereits im Jahre 1892 im ersten Band seines „Kirchenrechts“ eine später heftig umstrittene These zum Ursprung der römisch-katholischen Kirchenverfassung vorgelegt. Sie sei aus der urchristlichen Ekklesia hervorgegangen, die keine rechtliche, sondern eine „charismatische Organisation“ gewesen sei. Ebd., S. 325.
56
Hier fand sich der neuartige Gedanke, daß die Ämterorganisation der frühen Kirche auf dem Charisma beruht habe. Bei Sohm heißt es: „Die Christenheit ist organisiert durch die Verteilung der Gnadengaben (Charismen), welche die einzelnen Christen zu verschiedener Thätigkeit in der Christenheit zugleich befähigt und beruft.“ Vgl. Sohm, Kirchenrecht, S. 26.
57
Gott berufe die einzelnen Charismaträger, so daß nicht nur der Auserwählte zur Ausübung seiner Gabe, sondern auch die anderen Christen zur Anerkennung des Charismaträgers verpflichtet seien. Ebd., S. 26.
58
Die Anerkennung oder „Wahl“ durch die christliche Gemeinde sei nur eine Bestätigung der vorangegangenen Erwählung oder Begnadung, erzeuge diese aber nicht. Ebd., S. 27.
59
Im Gegenteil: Die Gemeindemitglieder sind, wie Sohm betonte, zum Gehorsam und zur Unterordnung unter die von Gott mit besonderen Gaben ausgestatteten und damit zum Amt bestellten Personen verpflichtet. Das Verhältnis zwischen Charisma- bzw. Amtsträger und den anderen Gläubigen ist daher als autoritär zu charakterisieren. Am Ende des ersten Jahrhunderts setze dann, [39]so Sohm, ein Prozeß der Verrechtlichung und Formalisierung ein, den er mit der Entstehung des Katholizismus gleichsetzte. Ebd., S. 58 f., vgl. dazu auch die noch prägnanteren Formulierungen in: Sohm, Rudolph, Wesen und Ursprung des Katholizismus (Abhandlungen der philologisch-historischen Klasse der Königlich Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften, Band 27, Nr. 10). – Leipzig: B. G. Teubner 1909, S. 335–390, hier: S. 375 f. (hinfort: Sohm, Katholizismus1).
60
Langsam verwandele sich das Amt, das ursprünglich auf persönlicher Gnadengabe beruht habe, in ein kraft „Rechtsatzes“ verliehenes Charisma um.[39] Sohm, Kirchenrecht, S. 158 ff.; Sohrn, Katholizismus1 (wie oben, S. 38, Anm. 59), S. 390, spricht davon, daß der Katholizismus das „Wesen der Christenheit im religiösen Sinne“ „vergesetzlicht und formalisiert“ habe.
61
Es wird, wie Sohm schrieb, ein „fiktives Charisma“. Sohm, Kirchenrecht, S. 216.
62
Die Vorstellung vom „Amtscharisma“ war damit in die Weit getreten; Ebd., S. 216.
63
dahinter stand die Vorstellung, daß dem Priester durch seine Weihe ein spezifisches Charisma verliehen werde. In der frühen Kirchengeschichte stellte diese Frage einen großen Streitpunkt dar: Durfte ein geweihter Priester, der sich persönlich schuldig gemacht hatte, einem anderen Menschen die Sünden vergeben? Oder war die Wirksamkeit der Sakramente von der persönlichen Qualität des Spenders abhängig? Im sogenannten Donatistenstreit entschied die Orthodoxie zugunsten des Amtsgedankens bzw. des Amtscharisma, d. h. für eine Trennung der amtlichen Qualifikation von der Person des Amtsausübenden, und nahm damit Abstand von der persönlichen Qualifikation des Priesters, wie dies die radikalen Richtungen gefordert hatten. Mit Webers Worten könnte man diesen gesamten Vorgang als eine „Versachlichung des Charisma“ beschreiben. Der Ausdruck „Amtscharisma“ geht wohl auf den katholischen Kirchenhistoriker Paul August Leder zurück, der ihn im Zuge der Auseinandersetzungen zwischen Harnack und Sohm 1911 verwendet hat. Vgl. Leder, Paul August, Das Problem der Entstehung des Katholizismus. Kritische Äußerungen zu Harnack und Sohm, in: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kanonistische Abteilung I, Band 32, 1911, S. 276–308, hier: S. 301, sowie den Hinweis darauf bei Kroll, Thomas, Max Webers tdealtypus der charismatischen Herrschaft und die zeitgenössische Charisma-Debatte, in: Hanke/Mommsen, S. 47–72, hier: S. 68 mit Anm. 139 (hinfort: Kroll, Charisma-Debatte).
64
Vgl. unten, S. 517.
Die von Rudolph Sohm erstmalig geäußerte These von einer „charismatischen Organisation“ der frühen Kirche, die in eine Rechtsform umgewandelt und damit katholisch geworden sei, löste eine heftige Debatte zwischen dem lutherischen und als konservativ eingeschätzten Kirchenrechtler Sohm und der liberalen protestantischen Theologie, insbesondere einem der führenden Vertreter des zeitgenössischen Kulturprotestantismus, Adolf Harnack, aus.
65
Theologiegeschichtlich gilt sie als eine der be[40]kanntesten Kontroversen des 20. Jahrhunderts. Zu der Auseinandersetzung vgl. Kroll, Charisma-Debatte (wie oben, Anm. 63), S. 55 ff.
66
Harnack ging – im Gegensatz zu Sohm – bereits für die Frühzeit der Kirche von einem doppelten Kirchenbegriff aus. Die Kirche sei von Anfang an eine pneumatisch-charismatische und eine rechtlich-amtliche Organisation gewesen.[40] Vgl. dazu Schmitz, Hermann-Josef, Frühkatholizismus bei Adolf Harnack, Rudolph Sohm und Ernst Käsemann. – Düsseldorf: Patmos 1977, S. 121.
67
Im Kern des Streites ging es darum, ob die frühe Kirchenverfassung bereits die Grundstruktur der späteren protestantischen Kirchenverfassung mit ihrer auch noch im Kaiserreich wirksamen Einheit von unsichtbarer und sichtbarer Kirche (Charisma- und Amtsgedanken) enthalten habe oder ob sie zunächst – wie Sohm behauptete – rein charismatisch geprägt gewesen sei. Harnack, Adolf, Entstehung und Entwicklung der Kirchenverfassung und des Kirchenrechts in den zwei ersten Jahrhunderten. Nebst einer Kritik der Abhandlung R. Sohm's: „Wesen und Ursprung des Katholizismus“ und Untersuchungen über „Evangelium“, „Wort Gottes“ und das trinitarische Bekenntnis. – Leipzig: J. C. Hinrichs 1910, S. 132 (hinfort: Harnack, Kirchenverfassung).
68
Der Streit entbrannte infolge einer kritischen Gegendarstellung Sohms zu einem Artikel Harnacks über die „Kirchliche Verfassung“, der 1908 in dem damaligen Standardnachschlagewerk für „protestantische Theologie und Kirche“ erschienen war, und zog sich über die darauffolgenden Jahre in wechselseitigen Polemiken hin. Dies nochmals sehr deutlich im Vorwort zu: Sohm, Rudolph, Wesen und Ursprung des Katholizismus, 2. Aufl. – Leipzig, Berlin: B. G. Teubner 1912, S. XX f. (hinfort: Sohm, Katholizismus2).
69
Da die „charismatische“ Organisation der frühen Kirche im Mittelpunkt der Auseinandersetzung stand, kann man auch von einer „Charisma-Debatte“ der Jahre 1909 bis 1912 sprechen. Vgl. Harnack, Adolf, Art. Verfassung, kirchliche, und kirchliches Recht im 1. und 2, Jahrhundert, in: RE3, Band 20, 1908, S. 508–546, vgl. dazu die erste Gegendarstellung von Sohm, Katholizismus1 (wie oben, S. 38. Anm. 59), dann die Replik von Harnack, Kirchenverfassung (wie oben, Anm. 67) und schließlich die erneute Reaktion darauf im Vorwort zu: Sohm, Katholizismus2 (wie oben, Anm. 68).
70
In seinen Ausführungen über das „Charisma“ berief sich Max Weber an mehreren Stellen explizit auf Rudolph Sohm, Vgl. dazu Kroll, Charisma-Debatte (wie oben, S. 39, Anm. 63), bes. S. 53 f.
71
der wohl entscheidend dazu beigetragen hat, das persönlich-charismatische Autoritätsverhältnis als eine Strukturform der Herrschaft zu begreifen. Sohm lehnte übrigens – ohne Karl Holl namentlich zu nennen – die Charakterisierung des Frühchristentums als „enthusiastisch“ ab, da hier nichts von „abnormer Erregung, von überspannter Begeisterung“ zu spüren, wohl aber die „Ordnung einer sichtbaren Menschengemeinschaft [41][…] nach Maßgabe einer religiösen Idee“ erkennbar gewesen sei. Vgl. unten, S. 462, Weber, Die drei reinen Typen, unten, S. 735, und ders., Probleme der Staatssoziologie, unten, S. 755.
72
Auch Max Weber betonte, daß die charismatische Herrschaft, obwohl sie in ihrer reinen und ursprünglichen Form einer geregelten Alltagsverwaltung und -organisation entbehrt habe, dennoch kein „Zustand amorpher Strukturlosigkeit“ gewesen sei, sondern eine „ausgeprägte soziale Strukturform mit persönlichen Organen und einem der Mission des Charismaträgers angepaßten Apparat von Leistungen und Sachgütern“.[41] Sohm, Katholizismus1 (wie oben, S. 38, Anm. 59), S. 378 f.
73
Im Gegensatz zu Sohm, der den frühen Zustand als rein charismatisch und nicht-rechtlich, teilweise sogar als „anarchistisch“, d. h. im Sinne der zeitgenössischen Sprachregelung: der äußeren Rechtsordnung entbehrend, bezeichnet hatte, Vgl. unten, S. 485.
74
entwickelte Weber die Vorstellung von einer eigenen Form der charismatischen Rechtsschöpfung und Rechtsprechung. Als Beispiele für die von ihm sogenannte „charismatische Justiz“ nannte er insbesondere die islamische „Kadi-Justiz“ sowie die prophetische Offenbarung von Rechtssätzen mit der revolutionierenden Formel: „ich aber sage euch“. Vgl. Sohm, Kirchenrecht, S. 22, 26, sowie Sohm, Katholizismus1 (wie oben, S. 38, Anm. 59), S. 379 (zur „anarchistischen ,charismatischen Organisation‘“).
75
Vgl. unten, bes. S. 468.
Jenseits der von Theologen geführten Charisma-Debatte gab es um die Jahrhundertwende ein markantes und unzeitgemäß wirkendes Beispiel für eine charismatisch strukturierte Gemeinschaft: den Kreis um den Dichter Stefan George.
76
Einige seiner Anhänger traten mit Beiträgen in die Öffentlichkeit und beschrieben sowohl das autoritäre Führer-Gefolgschaftsverhältnis als auch ihre eigene „rückhaltlose Hingabe“ an den Meister. Aufsätze von Friedrich Gundolf und Friedrich Wolters erschienen unter den programmatischen Titeln „Gefolgschaft und Jüngertum“ oder „Herrschaft und Dienst“. Direkt von Weber bei der Behandlung der „charismatischen Herrschaft“ genannt, in: WuG1, S. 142 (MWG I/23), indirekt unten, S. 465 mit Anm. 14.
77
Unter dem gleichnamigen Titel legte Wolters einen bibliophilen Band vor, der schon rein äußerlich mit religiösen Metaphern spielte und die Unterwerfung unter den Herrscher sowie das „geistige Reich“ für die Wenigen, vom Meister Auserwählten, verkündete. Gundolf, Friedrich, Gefolgschaft und Jüngertum, in: Blätter für die Kunst. Eine Auslese aus den Jahren 1904–1909. – Berlin: Georg Bondi 1909, S. 114–118, Zitat: S. 115, und Wolters, Friedrich, Herrschaft und Dienst, ebd., S. 156–159.
78
Jeder Kontakt zu George wurde strengstens von einem der engsten Anhänger, einer Art Majordomus, geregelt. So bot der Kreis für Max Weber, der Ste[42]fan George und einige seiner Anhänger persönlich kannte, Wolters, Friedrich, Herrschaft und Dienst. Mit Buchschmuck von Melchior Lechter. – Berlin: Einhorn-Presse im Verlag Otto von Holten 1909, Zitat: S. 13.
79
praktisches Anschauungsmaterial für den Umstand, daß gerade hochbegabte Wissenschaftler dem Charisma Stefan Georges völlig erlegen waren. Paul Honigsheim, als junger Wissenschaftler ein regelmäßiger Gast der Sonntagszusammenkünfte bei Max und Marianne Weber in der Ziegelhäuser Landstraße, erinnerte sich rückblickend, daß Weber „den Wert einer soziologischen Untersuchung des George-Kreises und analoger Erscheinungen“ betont habe.[42] Vgl. dazu unten, S. 54.
80
Honigsheim, Paul, Der Max-Weber-Kreis in Heidelberg. (Besprechung des zweiten Bandes der „Hauptprobleme der Soziologie“), in: Kölner Vierteljahrshefte für Soziologie, 5. Jg., 1925/26, S. 271–287, Zitat: S. 284.
4. Herrschaft und Legitimität
Keine Herrschaft kann ihren Bestand dauerhaft durch nackte Gewaltausübung oder reine Verwaltungstätigkeit sichern. Selbst das Römische Reich, „that eldest child of war and conquest, did not rest on force but on the consent and good-will of its subjects“.
1
Dies schrieb der Brite James Bryce, der durch sein Werk „The Holy Roman Empire“ bei den europäischen Gebildeten bekannt geworden war, und lieferte damit zugleich eine populäre Umschreibung dessen, was Max Weber später im Zusammenhang seiner Kategorienlehre als „Herrschafts-Einverständnis“ bezeichnet hat. Bryce, James, The American Commonwealth, Vol. II, 2. Aufl. – London, New York: Macmillan 1890, S. 248 (hinfort: Byrce, American Commonwealth II). Es wird hier und im folgenden nach der von Max Weber benutzten Ausgabe zitiert, von der sich das entsprechende Exemplar in der Universitätsbibliothek Heidelberg befindet.
2
In der von Max Weber sehr gelobten zweibändigen Darstellung des amerikanischen Verfassungslebens „The American Commonwealth“ Vgl. Weber, Kategorien, S. 279.
3
behandelte Bryce das Problem der Erduldung oder Zustimmung der Bevölkerung zur Regierungstätigkeit im Kapitel „Government by Public Opinion“. Vgl. den Brief Max Webers an Robert Michels vom 21. Dez. 1910, in dem Weber darauf hinwies, daß Michels die große, zweibändige Ausgabe hätte benutzen sollen (MWG II/6, S. 761, sowie die dort angeführten weiteren Briefstellen, ebd., S. 761, Hg.-Anm. 30).
4
In früheren Zeiten, unter einfachen gesellschaftlichen Bedingungen, sei die öffentliche Meinung passiver als in den demokratischen Staaten der Gegenwart gewesen, und die Menschen hätten sich im Glauben an die mythische, göttliche oder halbgöttliche Herkunft des Herrschers, aus religiösen Gründen oder einfach aus der Macht der Gewohnheit her[43]aus in die bestehende Herrschaftsordnung gefügt. Vgl. Bryce, American Commonwealth II (wie oben, Anm. 1), S. 247–254.
5
Auch Gaetano Mosca betonte am Beispiel der „alten Hebräer“ und der altorientalischen Reiche der Babylonier und Assyrer den engen Zusammenhang von Religion und Politik. [43] Ebd., S. 248; vgl. dazu auch Oppenheimer, Staat (wie oben, S. 14, Anm. 72), S. 48 (zur Herrschaft auf der Basis des Gewohnheitsrechts).
6
Für das klassische Altertum hatte der französische Althistoriker Numa Denis Fustel de Coulanges die vielbeachtete These von der grundlegend religiösen Prägung der antiken Polis aufgestellt. Mosca, Herrschende Klasse (wie oben, S. 14, Anm. 73), S. 70–72.
7
Mosca faßte seine Einzelbeobachtungen in dem generalisierenden Satz zusammen, daß alle herrschenden Gruppen oder „Klassen“ die Tendenz besäßen, „den faktischen Besitz der Macht auf ein allgemeines moralisches Prinzip zu gründen“, und bezeichnete dies als die „politische Formel“. Vgl. Fustel de Coulanges, Numa Denis, Der antike Staat, Studie über Kultus, Recht und Einrichtungen Griechenlands und Roms. – Berlin, Leipzig: Walther Rothschild 1907 (hinfort: Fustel de Coulanges, Der antike Staat); vgl. dazu auch die Relativierung der These durch Max Weber sowie die direkte Erwähnung im überlieferten Manuskript, unten, S. 587, mit textkritischer Anm. f und Anm. 23.
8
„Entsprechend der Kulturhöhe des betreffenden Volkes“, schrieb er, „beruht die politische Formel entweder auf einem Glauben an das Übernatürliche oder auf zumindest scheinbar rationalen Begriffen“. Mosca, Herrschende Klasse (wie oben, S. 14, Anm. 73), S. 62 und 68.
9
Diese Selbstrechtfertigungslehren der „politischen Klasse“ bezeichnete er jedoch nicht als „betrügerische Wundermittel“ oder „großen Aberglauben“, wie dies Spencer getan hatte, Ebd., S. 68.
10
sondern vielmehr als ein ernstzunehmendes, allgemein menschliches Bedürfnis der „herrschenden Klasse“, nicht nur „durch einfache materielle und intellektuelle Überlegenheit, sondern auf Grundlage eines moralischen Prinzips zu regieren und Gehorsam zu finden“. Ebd., S. 69.
11
Ebd., S. 69.
Georg Simmel hatte das Problem in den beiden Aufsätzen „Soziologie der Über- und Unterordnung“ und „Zur Philosophie der Herrschaft“ behandelt, die in das Kapitel „Über- und Unterordnung“ seiner 1908 erschienenen „Soziologie“ eingingen.
12
Er benannte drei Formtypen der Unterordnung: die Unterordnung unter einen Einzelnen, eine Mehrheit oder unter „ein unpersönliches, objektives Prinzip“. Vgl. dazu oben, S. 28, Anm. 69.
13
Die letztgenannte Form der Unterordnung unter die Herrschaft des Gesetzes bewertete er als mit der Würde eines freien Menschen am ehesten vereinbar, da sich in ihr die Herrschaft objektiviert habe. Simmel, Soziologie (wie oben, S. 28, Anm. 69), S. 197.
14
Im Gegensatz dazu sei die Abhängigkeit [44]von Personen immer durch persönliche und unsachliche Elemente bestimmt und daher von dem einzelnen Beherrschten schwerer zu ertragen. Jedoch könne der Unterworfene in Großreichen mit Einherrschaft auch seine Freiheit wahren, da er als Teil der Masse nur mit einem Teil seiner Persönlichkeit der Herrschaft unterworfen sei. Ebd., S. 199 f.
15
Damit ist der Kern von Simmels herrschaftssoziologischen Reflexionen berührt, denn sie rücken den individuellen bzw. individualpsychologischen Aspekt des Herrschaftsverhältnisses in den Mittelpunkt. Simmel wirft die allgemein philosophische Frage auf: Wie kann sich ein freier Mensch einer Herrschaft unterwerfen oder eine bestehende akzeptieren? Seit Thomas Hobbes und John Locke war dies die zentrale Frage aller modernen Staats- und Vertragstheorien, die mit ganz unterschiedlicher Akzentuierung von einer freiwilligen und vernunftgesteuerten Unterwerfung der Staatsbürger ausgingen und diese zu begründen suchten. Obwohl in Simmels Darlegungen das Grundbedürfnis des modernen aufgeklärten Menschen nach Selbstbestimmung und rational begründbarer Unterwerfung stets präsent ist, ging es ihm nicht um eine staatsrechtliche Behandlung des Themas. In seiner „Philosophie der Herrschaft“, wie der Titel zutreffend heißt, behandelte Simmel in der Hauptsache die Spannung von Freiheit und Herrschaft bzw. von Individualität und Zwang.[44] Ebd., S. 152 f.
16
Möglicherweise haben ähnliche philosophische und individualpsychologische Überlegungen die wohl früheste Definition des Herrschaftsbegriffs bei Max Weber bestimmt. Es klingt nach Kants kategorischem Imperativ, wenn Weber im Anfangsteil der älteren Fassung der „Herrschaftssoziologie“ das Handeln der Beherrschten dadurch erklärt, daß es so ablaufe, „als ob die Beherrschten den Inhalt des Befehls, um ihrer selbst willen, zur Maxime ihres Handelns gemacht hätten“. Vgl. Simmel, Philosophie der Herrschaft (wie oben, S. 14, Anm. 74), bes. S. 6–14 (= Simmel, Soziologie (wie oben, S. 28, Anm. 69), S. 217–226).
17
Simmel verfolgt in seiner „Philosophie der Herrschaft“ den Kampf um die Freiheit und erkennt in den historischen Auseinandersetzungen ein zunächst anachronistisch erscheinendes Grundmuster: „daß das Erstreben und Gewinnen von Freiheit […] sogleich das Erstreben und Gewinnen von Herrschaft zum Korrelat oder zur Folge“ habe. Vgl. unten, S. 135.
18
Die nach Freiheit drängenden Personen sind folglich in langer Perspektive auch die Herrschaftsausübenden, so daß die persönlichen Qualitäten der Herrschenden in der Philosophie Simmels eine gewichtige Rolle spielen und dadurch der antike Topos von der „Herrschaft der Besten“ in ge[45]wisser Weise wiederbelebt wird. Simmel, Soziologie (wie oben, S. 28, Anm. 69), S. 226.
19
Sein auf das Individuelle gerichteter Blick könnte auch ein Grund für sein scharfes Urteil sein, daß die Gruppe als solche „niedrig und führungsbedürftig“ sei.[45] Eine direkte Anspielung darauf findet sich ebd., S. 239.
20
Das Problem des „Nivellement der Masse“ hatte Simmel im Zusammenhang mit der sogenannten Einherrschaft angesprochen. Für einen Herrscher war es nach seiner Ansicht leichter, über eine große, „nivellierte Masse“ als über eine kleine Gruppe von differenzierten Individuen zu herrschen. Ebd., S. 244.
21
Ebd., S. 155; diese Aussage lehnte Weber rundweg ab, vgl. dazu seine Marginalie im Handexemplar: „Falsch. Der Grund liegt in der schweren Organisation von unten bei Großbezirk“, aber auch sein Kommentar in: Weber, Simmel-Exzerpt (wie oben, S. 28, Anm. 70), S. 2 (Rückseite): „Falsch der Grund für die größere Leichtigkeit u. Beherrschung großer Gebiete u. Kreise gegenüber kleinen.“
Im Gegensatz zu Georg Simmel rückten andere Soziologen und Politikwissenschaftler die massenpsychologische Betrachtung
22
in den Vordergrund und gingen damit speziell auf das Problem der Herrschaftslegitimierung in modernen Massengesellschaften ein. Bryce stellte die These auf, daß „belief in authority, and the love of established order“ zu den stärksten Gefühlen der menschlichen Natur gehöre. Vgl. dazu das Standardwerk von Le Bon, Gustave, Psychologie der Massen, 2. Aufl. – Leipzig: Werner Klinkhardt 1912, sowie Webers Anspielung darauf in „Soziologische Grundbegriffe“, WuG1, S. 11 (MWG I/23), aber auch Hellpach, Willy, Die geistigen Epidemien (Die Gesellschaft, hg. von Martin Buber, Band 11). – Frankfurt a.M.: Rütten & Loening 1906, von dem ein Handexemplar Max Webers überliefert ist (Arbeitsstelle der Max Weber-Gesamtausgabe, BAdW München), sowie die indirekte Erwähnung, unten, S. 136 mit Anm. 21.
23
Michels sprach in seiner „Parteiensoziologie“ von dem Führungsbedürfnis der Massen und einer „psychische[n] Prädisposition zur Unterordnung“. Bryce, American Commonwealth II (wie oben, S. 42, Anm. 1), S. 248.
24
In Ansätzen beschrieb er das Wechselspiel zwischen der Selbstrechtfertigung der Parteiführer und dem Führungsbedürfnis der Massen, das aber mit dem Anspruch auf inhaltliche Begründung und formale Zustimmungsmöglichkeit verbunden werde. Das Gefühl der Zustimmung und potentiellen Beteiligung an einem Herrschaftssystem erleichtere es den Beherrschten, sich unterzuordnen. Michels, Parteiensoziologie (wie oben, S. 4, Anm. 15), S. 54.
25
Michels sah im Bonapartismus, speziell im Cäsarismus Napoleons III., diese Elemente in überzeugender Weise verknüpft. Der Bonapartismus sei eine „Theorie der Herrschaft“, Ebd., S. 208 f.
26
die sich durch das Plebiszit die Bestätigung für die Selbstherrschaft des Staatsoberhauptes beschaffe und auf Basis dieser kollektiven Zustimmung einen absoluten [46]Gehorsam einfordere. Der Herrscher an der Spitze fühle und präsentiere sich als der „legitime Ausdruck des Massenwillens“. Ebd., S. 205.
27
Gerade im Zeitalter moderner Massendemokratien erhöhe sich der Druck auf die Regierenden, ihr Herrschaftssystem zu rechtfertigen, daher werde, schrieb Michels, die „Ethik eine Waffe“, mit der jede Regierung versuche, ihre tatsächliche Macht zu stützen.[46] Ebd., S. 209.
28
Ebd., S.16.
Der französische Bonapartismus stand unter einem doppelten Rechtfertigungsdruck: Er mußte sich einerseits gegen die demokratisch-parlamentarischen Überzeugungen der Franzosen seit der Französischen Revolution und andererseits gegenüber den traditionellen Herrscherhäusern Europas behaupten. Die Selbstrechtfertigungsabsichten des Systems traten, wie auch aus den Ausführungen von Robert Michels hervorgeht, relativ offen zutage.
29
In den Augen der Traditionalisten galten Napoleon I. und sein Neffe Napoleon III. als Usurpatoren oder illegitime Regenten, die durch Staatsstreiche an die Macht gekommen waren. Vgl. dazu auch Webers Bemerkung zur „offizielle[n] Theorie des französischen Cäsarismus“, unten, S. 499 mit Anm. 40.
30
Die Anhänger der Bourbonen, des abgelösten französischen Königshauses, nannten sich demgegenüber „Legitimisten“. Das sogenannte Legitimitätsprinzip wurde im Kontext des Wiener Kongresses, der die Restauration Europas nach dem Sturz Napoleons I. einleitete, insbesondere von Talleyrand und Fürst von Metternich vertreten. Sie verteidigten das ausschließliche Recht der erblichen Monarchien und begründeten dies gegen alle Theorien von der Volkssouveränität durch die Berufung auf das Gottesgnadentum. Anknüpfend an die mittelalterliche Lehre von der göttlichen Beauftragung des Herrschers wurde damit die Unabsetzbarkeit der erblichen Herrscherdynastien sowie die Unbeschränktheit ihrer Herrschergewalt behauptet. Vgl. dazu auch Webers Sprachwahl zur Charakterisierung des Cäsarismus bzw. Bonapartismus als nicht-legitim, unten, S. 205 f. und 507.
31
Der deutsche Kaiser Wilhelm II. galt Weber als ein zeitgenössisches Beispiel für das Festhalten an der veralteten Lehre des Gottesgnadentums. Bei Weber, Die drei reinen Typen, unten, S. 740 f., wird diese Entwicklung unter dem Begriff „Erbcharisma“ skizziert.
32
Die ironischen Zwischentöne bei ihm erklären sich daraus, daß er wie große Teile des liberalen Bürgertums der dritten großen, im 19. Jahrhundert wirksamen Legitimitätstheorie anhing: dem Konstitutionalismus. Alle Staatshandlungen sind danach durch die Verfassung geregelt, der alle Bürger unterworfen sind und die auch das Staatsoberhaupt in seiner [47]Machtausübung beschränkt. Der Gedanke der Legitimität einer gesatzen Ordnung war hier bereits angelegt, so daß in den Debatten des 19. Jahrhunderts insgesamt drei Legitimitätstypen vorgebildet waren: der traditionelle, konstitutionelle und der plebiszitäre. Vgl. dazu unten, S. 527 mit Anm. 18.
33
Vgl. dazu Boldt, Hans, „Den Staat ergänzen, ersetzen oder sich mit ihm versöhnen?“ Aspekte der Selbstverwaltungsdiskussion im 19. Jahrhundert, in: Hanke/Mommsen, S. 139–165, hier: S. 164, wo Boldt auf die in der Staatslehre bereits vorgebildeten Legitimitätstypen hinweist. Die Kategorisierung wurde hier in modifizierter Form übernommen.
Hatte Michels die ideologischen Prämissen des Bonapartismus offengelegt, so unternahmen Ludwig Gumplowicz und Franz Oppenheimer dies in marxistischer Sicht für die bürgerliche Gesellschafts- und Herrschaftsordnung. Sie hatten die Existenz des Staates, wie oben geschildert, aus dem Kampf zweier ungleicher Gruppen hervorgehen lassen, wobei die siegreiche Minderheit die unterworfene „Klasse“ auch wirtschaftlich zu ihrem eigenen Nutzen instrumentalisiert habe. Die gesamte Rechtsordnung diene deshalb einzig dem Zweck, die ursprünglichen Gewalt- und Ausbeutungsverhältnisse zu legitimieren.
34
Oppenheimer sprach in diesem Zusammenhang sogar von einer „Gruppentheorie des ,Legitimismus‘“. Vgl. Gumplowicz, Grundriß (wie oben, S. 14, Anm. 69), bes. S. 119 f., und Oppenheimer, Staat (wie oben, S. 14, Anm. 72), S. 54 ff.
35
Damit griff er nicht nur die eben erwähnten Vertreter des restaurativen Monarchismus und Ständetums an, sondern vor allem die Anhänger der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft. Ihre Existenz wäre ohne einen rechtlichen Schutz des Eigentums völlig undenkbar gewesen. Durch die marxistisch geprägte Sichtweise traten die Besonderheiten bürgerlicher Legitimitätsvorstellungen klar hervor, die ganz stark durch den Rechts- und Ordnungsgedanken bestimmt waren. Es konnte nicht ausbleiben, daß die Frage nach der Rolle der Wissenschaften aufgeworfen wurde: Welche Funktion spielten die Wissenschaften – besonders wenn sie durch eine gesellschaftliche Gruppe dominiert wurden – bei der Fixierung und Verbreitung von Legitimitätstheorien? Oppenheimer ging in einer späten Schrift, die erst nach Webers Tod erschien, so weit, „Macht“ und „Herrschaft“ überhaupt als „bürgerliche Kategorien“ zu deklarieren. Ebd., S. 55 f.
36
Dies hätte konsequenterweise zu einer radikalen Infragestellung einer auf die „Herrschaft“ konzentrierten Soziologie als solcher ge[48]führt oder aber die Offenlegung ihrer spezifisch bürgerlichen Denkvoraussetzungen erfordert. Mosca, der hinsichtlich seiner politischen Anschauungen sicherlich nicht als Radikaler zu bezeichnen ist, war sich der problematischen Stellung seiner eigenen Wissenschaftsdisziplin bewußt und räumte ein, daß die Wissenschaft der Politik vielfach nur eine „philosophische, theologische oder rationalistische Rechtfertigung bestimmter Staatsformen“ gewesen sei. Oppenheimer, Soziologie (wie oben, S. 15, Anm. 78), S. 386, sowie die Angriffe auf die „bürgerliche Soziologie“ (ebd., S. 373); in diesem Kontext findet sich auch seine kritische Auseinandersetzung mit dem Herrschaftsbegriff Max Webers (ebd., S. 369 f., 383 f.).
37
Faßt man alle genannten ideologiekritischen Bemerkungen zusammen, dann verweisen sie auf die Notwendigkeit, die den Herrschafts- und Gesellschaftsordnungen zugrundeliegenden Legitimitätsvorstellungen in ihrer Eigenart zu erkennen und diese auch klar zu benennen. Obwohl keiner der genannten Autoren Zweifel hatte, daß die Art der Legitimation die politische Realität eines Herrschaftssystems entscheidend bestimme,[48] Mosca, Herrschende Klasse (wie oben, S. 14, Anm. 73), S. 17.
38
benutzten sie diese Erkenntnis aber nicht systematisch zu einer Charakterisierung der verschiedenen Herrschaftsformen. Ebd., S. 69.
Es kann als der Durchbruch Max Webers angesehen werden, daß er die Legitimitätsvorstellungen, die einem Herrschaftsverhältnis zugrundeliegen – sei es in Form von Selbstrechtfertigungsabsichten der Herrschenden oder sei es in Form des Legitimitätsglaubens der Beherrschten – konstitutiv in die Bestimmung des Herrschaftsbegriffs einbezogen hat. Der Herrschaftsbegriff erhielt dadurch eine doppelte Perspektive: eine organisatorisch-institutionelle und eine die Legitimitätsgründe ideologiekritisch behandelnde – oder einfacher ausgedrückt: eine materielle und eine ideelle – Seite. Weber klassifizierte die Vielzahl der Legitimitätsvorstellungen als drei Grundtypen. Die Legitimitäts-„Geltung“ kann, schrieb Weber zu Beginn der älteren Fassung der „Herrschaftssoziologie“, „entweder in einem System gesatzter (paktierter oder oktroyierter) rationaler Regeln“ oder „auf persönlicher Autorität“ ruhen. Letztere könne ihre Grundlage entweder „in der Heiligkeit der Tradition“ oder „im Glauben an Charisma“ finden.
39
Den drei genannten Typen ordnete er dann die entsprechenden typischen Strukturformen der Herrschaft zu, im konkreten Fall: „Bürokratie“, „Patriarchalismus“ und „,charismatische‘ Herrschaftsgebilde“. Vgl. unten, S. 148.
40
Diese kurzen Bemerkungen zeigen, daß die eigentliche Herrschaftstypologie hier noch in den Anfängen steckte. Sie war noch nicht konstitutiv für die Anlage der älteren Fassung der „Herrschaftssoziologie“. Ebd.
41
Zur späteren Entwicklung vgl. unten, S. 49–75.
[49]II. Die „Herrschaftssoziologie“ im Werk Max Webers
1. Die ältere Fassung
„Herrschaft des ‚Kapitals‘“,
1
Herrschaft über den Boden, Herrschaft von Dynastien und Geschlechtern oder Herrschaft von Institutionen[49] Vgl. Weber, Max, Die Börse. I. Zweck und äußere Organisation der Börsen, MWG I/5, S. 148.
2
– alle diese Aspekte finden sich im Werk Max Webers, teilweise schon vor der Jahrhundertwende. Aber auch noch in der ersten Dekade des neuen Jahrhunderts fehlt eine systematische Behandlung des Herrschaftsbegriffs, die Ausschöpfung seines Potentials, das soziale, politische und wirtschaftliche Vorgänge umfaßt, Vgl. Weber, Max, Entwickelungstendenzen in der Lage der ostelbischen Landarbeiter, MWG I/4, S. 427 (Boden trägt „keine ‚Herrschaft‘ mehr“); ders., Agrarverhältnisse3, S. 58 (Herrschaft über Boden und Menschen); ders., Die Stadt, MWG I/22-5, S. 226 f. („Herrschaft der Visconti“ und „Geschlechterherrschaft“); ders., Protestantische Ethik I, S. 3 („Herrschaft der katholischen Kirche“).
3
und es fehlen Hinweise auf eine Konzeption einer soziologisch akzentuierten Herrschaftslehre. Auch in den ersten Gliederungsübersichten, die Max Weber nach der Übernahme des alten Schönbergs oder – wie es offiziell hieß – des „Handbuchs der politischen Ökonomie“ (des späteren „Grundriß der Sozialökonomik“) Vgl. dazu insbes. Weber, Max, Notizen zur Vorlesung „Allgemeine (‚theoretische‘) Nationalökonomie“, Deponat Max Weber, BSB München, Ana 446, OM 3, Bl. 48–51v (MWG III/1).
4
im Laufe des Jahres 1909/10 erstellte, Gemeint ist das von Gustav von Schönberg begründete und einschlägige „Handbuch der politischen Ökonomie“ (3 Bände, 4. Aufl. – Tübingen: H. Laupp 1896–1898). Max Weber zeigte sich erst nach dem Tod von Schönbergs (3. Januar 1908) bereit, über seine eigene Mitarbeit an der Neuauflage nachzudenken. Vgl. dazu die Korrespondenzen mit Paul Siebeck seit dem 19. September 1908 (MWG II/5, S. 659 ff.), sowie die Ausführungen in MWG I/22-6 [[MWG I/24]]. Das „Handbuch“ wurde zwischenzeitlich (1913/14) als „Handbuch der Sozialökonomik“ bezeichnet (vgl. z. B. den Brief Max Webers an Oskar Siebeck, vor dem 1. Juli 1913, MWG II/8, S. 259, oder die Karte an Paul Siebeck vom 8. März 1914, ebd., S. 547) und erst im April 1914 fiel – auf Vorschlag des Verlegers Paul Siebeck – die Entscheidung zugunsten des Titels „Grundriß der Sozialökonomik“ (Brief Max Webers an Paul Siebeck vom 16. Apr. 1914, MWG II/8, S. 625 mit Anm. 1).
5
findet sich kein Hinweis auf eine Herrschaftssoziologie. In dem Stoffverteilungsplan vom Mai 1910 hatte Max Weber neben vielen kleineren Beiträgen im ersten Buch „Wirtschaft und Wirtschaftswissen[50]schaft“ einen großen Abschnitt „Wirtschaft und Gesellschaft“ übernommen, der das Verhältnis zwischen der Wirtschaft und den Bereichen Recht, soziale Gruppen und Kultur untersuchen sollte. Die Stichworte zum zweiten Unterpunkt „Wirtschaft und soziale Gruppen“ lauteten: „Familien- und Gemeindeverband, Stände und Klassen, Staat“. Einen ersten, nicht überlieferten Plan gab es bereits im Mai 1909 (vgl. dazu die Briefe Max Webers an Paul Siebeck vom 23. und 31. Mai 1909, MWG II/6, S. 132, 136), der sich aber in vielen Punkten mit dem überlieferten Stoffverteilungsplan vom Mai 1910 überschnitten haben dürfte, vgl. dazu die Autorenübersicht des Verlages vom 12. November 1909 (wiedergegeben in: MWG II/6, S. 314, Anm. 12).
6
Eine Ausrichtung auf den Herrschaftsbegriff war hier noch nicht vorgesehen. Erst in seinem bereits zitierten Brief vom 30. Dezember 1913 an Paul Siebeck erwähnt Max Weber erstmalig seine „soziologische Staats- und Herrschafts-Lehre“.[50] Stoffverteilungsplan für das „Handbuch der politischen Ökonomie“ vom Mai 1910, VA Mohr/Siebeck, Deponat BSB München, Ana 446 (MWG I/22-6 [[MWG I/24]]), Abdruck (ohne Annotationen) in: MWG II/6, S. 766–774, hier: S. 768.
7
Eine detaillierte Inhaltsübersicht, auch zum Bereich Herrschaft, liegt uns aber erst im Juni 1914 vor, als der erste Band des „Grundriß der Sozialökonomik“ mit einer „Einteilung des Gesamtwerkes“ erschien. Die Konzeptionalisierung und Niederschrift der „Herrschaftssoziologie“ fällt somit in den Zeitraum zwischen dem Stoffverteilungsplan vom Mat 1910 und der „Grundriß“-Disposition vom Juni 1914. Die Genese und Entstehung der „Herrschaftssoziologie“ ist somit auf das Engste mit der wechselhaften Geschichte des Beitrags „Wirtschaft und Gesellschaft“ verwoben, zu dessen Kerntexten sie gehört. Vgl. dazu oben, S. 3 f. mit Anm. 13.
Das Jahr 1909/10 bringt einige Neuerungen thematischer und konzeptioneller Art mit sich. Durch die Korrespondenz Max Webers, vor allem mit seinem Heidelberger Kollegen Georg Jellinek, erfahren wir einiges über Webers Vorstellungen zu einer soziologischen Staatslehre oder politischen Soziologie. In den Sommermonaten 1909 entwickelte sich ein reger Briefverkehr zwischen den beiden Gelehrten, denn Georg Jellinek hatte Max Weber im Juli anläßlich der geplanten Gründung eines deutsch-amerikanischen Instituts, das von der Carnegie-Stiftung finanziert werden sollte, um Rat gebeten.
8
Ganz offen bekundet Weber sein Interesse an einer Behandlung der „Soziallehre des Staates und der politischen Bildungen“, die „natürlich auch die (ganz unentbehrliche) juristische Seite“ berücksichtigen, aber nicht traditionell juristisch und rechtsvergleichend verfahren solle. Vgl. die Editorische Vorbemerkung zum Brief Max Webers an Georg Jellinek vom 15. Juli 1909, MWG II/6, S. 179.
9
Bei seinen Vorschlägen zur Organisation des Instituts unterläßt es Weber nicht, auf die Einbeziehung der praktischen Disziplinen hinzuweisen. Es müsse „Praxis der Politik (,the constitution at work‘, wie Bryce das ausdrückt), politische Soziologie, neuere Geschichte, Litteratur“ gelehrt wer[51]den. Brief Max Webers an Georg Jellinek vom 15. Juli 1909, MWG II/6, S. 180.
10
Schließlich übermittelt Weber einen Textentwurf an Jellinek, in dem er die einzelnen Aufgaben und Zwecke des geplanten Instituts beschreibt: „Spezieller Zweck des Instituts müßte […] die Erforschung der rechtlichen, politischen, ökonomischen und durch allgemeine Kulturverhältnisse bedingten Gründe sein, welche die internationalen Beziehungen der modernen Völker bestimmen. […] Ihre Gestaltung hängt in hohem Maße auch ab von der inneren Struktur der einzelnen Staaten. Die Rolle[,] welche militärische, bürokratische und feudale oder industrielle, kommerzielle oder andere bürgerliche Schichten und der von jeder von ihnen gepflegte politische Geist in einem Staate spielen, die Art der politischen Machtverteilung unter ihnen, wie sie das öffentliche Recht, die Verwaltungsmaschine und ihre praktische Handhabung schafft, und die Art, wie alles dies auf die Bildung der öffentlichen Meinung eines Landes wirkt, bestimmt sein Verhalten zu anderen Nationen oft in ausschlaggebender Weise. Deshalb müßte mit der direkten Analyse der internationalen rechtlichen und politischen Beziehungen die international vergleichende Analyse der rechtlichen, politischen, ökonomischen und kulturlichen Struktur der einzelnen Länder und Staaten Hand in Hand gehen […].“[51] Brief Max Webers an Georg Jellinek vom 25. Juli 1909, MWG II/6, S. 200 f.
11
Brief Max Webers an Georg Jellinek, vor dem 12. Sept. 1909, MWG II/6, S. 258 f.
Wie sehr die Sache Max Weber beschäftigte, zeigen auch seine zeitlich parallel laufenden Bemühungen bei der neugegründeten Heidelberger Akademie der Wissenschaften, die ihn als korrespondierendes Mitglied kooptieren wollte. Gegenüber Leo Königsberger knüpft Max Weber die Annahme seiner Zuwahl – wohl etwas in Verkennung der Usancen – an eine Umgestaltung der Akademie zugunsten der ihn interessierenden „systematischen staats- und gesellschaftswissenschaftlichen Disziplinen“.
12
Er unterbreitet der Akademie den Vorschlag zu einer groß angelegten Enquete, die „das praktische Funktionieren der Rechts- und Verfassungsinstitutionen ebenso wie die Erforschung der entscheidenden gesellschaftlichen Grundlagen für die politische und ökonomische Kulturentfaltung der Völker“ betreiben könnte. Brief Max Webers an Leo Königsberger vom 7. Aug. 1909, MWG II/6, S. 215.
13
Hätte Max Webers Bestreben Erfolg gehabt, so wäre damit eine beträchtliche empirische Vorarbeit für seinen Beitrag „Wirtschaft und Gesellschaft“ geleistet worden. Gegenüber dem ein Jahr zuvor stark überarbeiteten Artikel „Agrarverhältnisse im Altertum“ für das „Handwörterbuch der Staatswissenschaften“ kündigen sich in der Korrespondenz einige Akzentverschiebungen an: von den Staatsbildungen der Vergangenheit hin zu den modernen Staaten, von den wirtschaft[52]lichen zu den politisch-staatlichen Verhältnissen. Außerdem betonte Weber nun die Einbeziehung einer international vergleichenden Komponente sowie die soziologisch formulierte Fragestellung zur Rolle der führenden Schichten für die „innere Struktur“ der Staaten. Ebd., S. 218.
Ein zweites, für die „Herrschattssoziologie“ relevantes Thema beschäftigte Max Weber im Sommer 1909 intensiv: die umfassende Bürokratisierung. Der zum Katholizismus konvertierten Frauenrechtlerin Elisabeth Gnauck-Kühne schilderte Weber am 15. Juli 1909 in düsteren Farben die Zukunftsentwicklung, in der „der Bureaukratismus im Staat und die virtuose Maschinerie der katholischen Kirche […] alles Andre unter die Füße“ bekommen würden.
14
Kämpferisch bekundet er, daß er es für ein Gebot seiner Menschenwürde halte, dagegen zu kämpfen, was er dann im September 1909 bei der Generalversammlung des Vereins für Sozialpolitik auch öffentlich tat.[52] Brief Max Webers an Elisabeth Gnauck-Kühne vom 15. Juli 1909, MWG II/6, S. 176.
15
Bereits ein Jahr zuvor, am 12. Oktober 1908, war Weber in den Unterausschuß des Vereins für Sozialpolitik, der „die Reorganisation der preußischen Verwaltung einschließlich der Vorbildung der Beamten beraten“ sollte, gewählt worden. Weber, Max, Die wirtschaftlichen Unternehmungen der Gemeinden. Diskussionsbeitrag auf der Generalversammlung des Vereins für Sozialpolitik am 28. September 1909, in: MWG I/8, S. 356–366 (hinfort: Weber, Diskussionsbeitrag 1909).
16
Dieser Unterausschuß tagte erstmals am 28. Dezember 1908 unter der Ägide von Gustav Schmoller, der abschließend die Aufgaben verteilte, aber Max Webers Vorschlag einer „Analyse des bureaukratischen Mechanismus und seiner Begleiterscheinungen“ einfach überging und stattdessen u. a. seinen Schüler Otto Hintze mit einem Abriß der preußischen Verwaltungsgeschichte betraute. Vgl. das gedruckte, dreiseitige Protokoll, Verein für Socialpolitik. Sitzung des Unterausschusses […]. Montag, den 28. Dezember 1908 im Landwirtschaftlichen Ministerium, British Library of Political & Economic Science, Nl. Ignaz Jastrow, Misc. 114, S. 1.
17
Hier dürfte der erste konkrete Anlaß für Max Weber bestanden haben, sich im Anschluß an die „Agrarverhältnisse im Altertum“ intensiver mit der modernen Bürokratie zu beschäftigen. Ebd., S. 2 f., Zitat: S. 2.
18
Die politischen Ereignisse des Jahres 1909 ließen das Thema noch brisanter erscheinen: Im April fand in Berlin der Erste Deutsche Beamtentag statt, im Juni trat auf königlichen Erlaß eine „Immediatkommission zur Vorbereitung der Verwaltungsreform“ zusammen. Der Beitrag für das „Handwörterbuch“ endete bereits mit einem Ausblick auf moderne Verhältnisse, speziell den Zusammenhang von Kapitalismus und Bürokratisierung. Vgl. Weber, Agrarverhältnisse3, S. 182.
19
Damit reagierte die preußische Regierung auf [53]die sich häufende öffentliche Kritik an der staatlichen Verwaltung. In der wissenschaftlichen Untersuchung moderner Bürokratien sah Weber ein großes Forschungsthema, das er wiederum Georg Jellinek für das projektierte deutsch-amerikanische Institut unterbreitete. Er schlug ihm am 12. September 1909 vor, die „Wirkung der bürokratischen Maschinerie auf die Art der Leitung der Staatspolitik“ zu untersuchen, da die Bürokratisierung eines „der wichtigsten Probleme der modernen Demokratien“ darstelle. Zu den Hintergründen vgl. Rejewski, Harro-Jürgen, Die Pflicht der politischen Treue im preußischen Beamtenrecht (1850–1918): Eine rechtshistorische Untersuchung an[53]hand von preußischen Ministerialakten aus dem Geheimen Staatsarchiv der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. – Berlin: Duncker & Humblot 1973, bes. S. 132 ff., sowie Süle, Tibor, Preußische Bürokratietradition. Zur Entwicklung von Verwaltung und Beamtenschaft in Deutschland 1871–1918. – Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1988, S. 45 ff., Zitat: S. 49.
20
Wenig später traten Max Weber und sein Bruder Alfred bei der Generalversammlung des Vereins für Sozialpolitik in Wien als leidenschaftliche Mahner und scharfe Kritiker der Bürokratisierung auf. Briefe Max Webers an Georg Jellinek, vor dem 12. Sept. 1909, und vom 12. Sept. 1909, MWG II/6, S. 259, 262.
21
Sie warnten eindringlich davor, die politischen und kulturellen Folgen dieses Prozesses zu unterschätzen. Max Weber sprach sich mit Vehemenz gegen die Mechanisierung, Rationalisierung und „Parzellierung der Seele“ aus, die mit der Bürokratisierung einhergehe, wobei er zugleich die ältere Generation des Vereins, allen voran Gustav Schmoller, wegen ihrer „kritiklosen Verherrlichung der Bureaukratisierung“ und der autoritären Verklärung des deutschen Beamtentums direkt angriff. Vgl. die Diskussionsbeiträge von Alfred und Max Weber am 28. September 1909, in: Verhandlungen des Vereins für Socialpolitik in Wien, 1909. – Leipzig: Duncker & Humblot 1910, S. 238–242, 282–287 und 309–312 (hinfort: Verhandlungen VfSp 1909).
22
Dies sei „Metaphysik der Bureaukratie“. Weber, Diskussionsbeitrag 1909 (wie oben, S. 52, Anm. 15), S. 363 und 365.
23
Der Auftritt der beiden Brüder glich einer Palastrevolution. In der Folge überließ Max Weber jedoch seinem Bruder die öffentliche Behandlung des Themas – im Jahr 1910 erschien dessen bereits zitierter Aufsatz „Der Beamte“ – und übergab ihm die Bearbeitung des entsprechenden Beitrags für das „Handbuch der politischen Ökonomie“, Diesen Ausdruck von Max Weber gab Alfred Weber in seinem zweiten Diskussionsbeitrag zum Thema wieder, vgl. Verhandlungen VfSp 1909 (wie oben, Anm. 21), S. 311.
24
wie der „Grundriß der Sozialökonomik“ damals noch hieß. Zum Aufsatz Alfred Webers vgl. oben, S. 31, Anm. 9, und zum Stoffverteilungsplan des „Handbuchs der politischen Ökonomie“ vgl. den Abdruck in: MWG II/6, S. 774; dort heißt es unter 5. Buch, IX. Abschnitt: „Die Tendenzen zur inneren Umbildung des Kapitalismus. (Monopolistische, gemeinwirtschaftliche und bureaukratisierende Entwicklungstendenzen in ihren gesellschaftlichen Rückwirkungen; das Rentnertum; die Tendenzen der gesellschaftlichen Umgliederung.) (Prof. Alfred und event. Max Weber.)“.
[54]Ein Jahr später erwähnt Max Weber in einem Brief an Dora Jellinek erstmals den Begriff des „Charisma“ zur Charakterisierung sozialer Beziehungen. In dem Brief vom 9. Juni 1910 heißt es: „Wenn der Stefan George’sche Kreis ohnedies alle Merkmale der Sekten-Bildung an sich trug – damit übrigens auch das spezifische Charisma einer solchen –, so ist die Art und Weise des Maximin-Cultus schlechthin absurd […].“
25
Max Weber stand – wie bereits ausgeführt – seit 1910 in persönlichem Kontakt zu Stefan George und einigen seiner Anhänger.[54] Brief Max Webers an Dora Jellinek vom 9. Juni 1910, MWG II/6, S. 560.
26
Die Relevanz einer soziologischen Untersuchung dieser Art von Sektenbildung betonte er im Rahmen seiner auf dem Ersten Deutschen Soziologentag unterbreiteten Vorschläge zu einer „Soziologie des Vereinswesens“. In seinem am 20. Oktober 1910 erstatteten Bericht stellt Weber die „künstlerischen oder literarischen Sekten“ in die Reihe der zu untersuchenden Vereinsgattungen, die „vom Kegelklub“ angefangen bis hin zu den politischen Parteien reichen. Vgl. Weber, Marianne, Lebensbild, S. 372, 462 ff.; Max und Marianne Weber wollten ihre Englandreise im Sommer 1910 zusammen mit den beiden George-Schülern Arthur Salz und Friedrich Gundolf unternehmen, vgl. Brief Max Webers an Arthur Salz vom 2. Aug. 1910, MWG II/6, S. 592.
27
In diesem Zusammenhang arbeitet er erstmals mit einem soziologisch akzentuierten Herrschaftsbegriff: „Jeder Verein, zu dem man gehört, stellt dar ein Herrschaftsverhältnis zwischen Menschen.“ Weber, Max, Geschäftsbericht, in: Verhandlungen DGS 1910, S. 39–62 (MWG I/13; hinfort: Weber, Geschäftsbericht), zur Vereinsenquete ebd., S. 52–60, Zitate: S. 52 f.
28
Nur vordergründig sei dies ein „Majoritätsherrschaftsverhältnis“, während „in Wirklichkeit die Herrschaft stets eine Minoritätsherrschaft“, so Weber, „zuweilen eine Diktatur Einzelner ist, die Herrschaft Eines oder einiger irgendwie im Wege der Auslese und Angepaßtheit an die Aufgaben der Leitung dazu befähigter Personen, in deren Händen die faktische Herrschaft innerhalb eines solchen Vereins liegt.“ Ebd., S. 55.
29
Daran schließt Max Weber zwei für die soziologische Erhebung entscheidende Fragen an: Wie erfolgt die Auslese der leitenden Personen und welcher Typ von Persönlichkeit bringt damit die Herrschaft an sich? Und schließlich: mit welchen Mitteln erzielen die leitenden Gruppen die Herrschaftssicherung gegenüber ihrer eigenen Anhängerschaft? Explizit geht Weber bei diesen Fragen auf die „Vorarbeiten“ von Gerhard Alexander Leist zum Vereinsrecht ein. Diese bereits erwähnten juristischen Studien gehen von dem Herrschaftsbegriff Labands aus, heben aber die möglichen nicht-rechtlichen Zwangsmechanismen und Sanktionsmethoden von Vereinen hervor. Ebd., S. 55 f.
30
In den Kontext [55]der Vereinssoziologie gehört auch die „Parteiensoziologie“ von Robert Michels, die Max Weber am 14. Dezember 1910, also wenige Wochen nach dem Soziologentag, erhielt. Vgl. Leist, Untersuchungen (wie oben, S. 8, Anm. 36), S. 177.
31
Michels hatte die Oligarchisierungstendenzen in den modernen Parteien, speziell den Arbeiterparteien, untersucht. Systematisch betrachtet ging es bei diesen Studien um Führungs- und Herrschaftsstrukturen in den Parteien, um ihre Tendenz zur Bürokratisierung und die damit verbundenen organisatorischen Zwänge. Wie bereits ausführlich dargestellt, drehten sich Max Webers Bemerkungen zu dem Buch von Michels hauptsächlich um den Herrschaftsbegriff.[55] Vgl. Michels, Parteiensoziologie (wie oben, S. 4, Anm. 15), sowie die Karte Max Webers an Robert Michels vom 14. Dez. 1910, MWG II/6, S. 726, mit der Empfangsbestätigung und Bitte um „8 Tage Schonzeit“.
32
Resümiert man, so ist in der zweiten Jahreshälfte 1910 der Begriff der Herrschaft von Max Weber als ein Instrument zur soziologischen Analyse von Vereinen, Sekten und Parteien nutzbar gemacht worden. Dies spiegelt sich insbesondere am Ende des zum älteren Bestand von „Wirtschaft und Gesellschaft“ gehörenden Kapitels „,Klassen‘, ‚Stände‘ und ‚Parteien‘“ wider, Vgl. dazu den Brief Max Webers an Robert Michels vom 21. Dez. 1910, MWG II/6, S. 754–761, sowie die Ausführungen, oben, S. 4 f.
33
so daß die Werkpassagen über die sozialen Strukturformen der Herrschaft zu den früh verfaßten gehören dürften. Mit dem Herrschaftsbegriff als solchem und seiner mangelhaften wissenschaftlichen Bestimmung zeigte sich Max Weber in dem Brief an Michels vom 21. Dezember 1910 noch sehr unzufrieden, was dafür spricht, daß er zu diesem Zeitpunkt selbst noch über keine Lösung verfügte. Vgl. Weber, „Klassen“, „Stände“ und „Parteien“, MWG I/22-1, S. 269–272.
Nach den Jahren 1909 und 1910, die insbesondere durch Webers Aktivitäten für die Gründung der Deutschen Gesellschaft für Soziologie und die Beschäftigung mit soziologischen Fragestellungen bestimmt waren, kommt „etwa um 1911“ ein weiterer wichtiger Aspekt für die „Herrschaftssoziologie“ hinzu.
34
Marianne Weber schreibt im „Lebensbild“, daß Max Weber damals wieder zu „seinen universalsoziologischen Studien“ zurückgekehrt sei und diese parallel für „Wirtschaft und Gesellschaft“ und die religionssoziologischen Studien, die schließlich ab 1915 unter dem Titel „Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen“ erschienen, betrieben habe. Weber, Marianne, Lebensbild, S. 346.
35
Zugleich gibt sie an, daß „Wirtschaft und Gesellschaft“ „,aus dem Kopf“ und deshalb ohne Anmerkungen geschrieben worden sei: „Material und Apparat bedurfte er [Max Weber] nicht dafür, er verfügte frei über [56]sein universales Wissen“. Ebd., S. 346 f.
36
Wirft man einen Blick auf die postum überlieferten Texte zur „Herrschaftssoziologie“, dann ist die Verwendung von universalhistorischem Wissen und die Einfügung von Detailbeispielen aus allen Epochen verschiedener Kulturkreise geradezu faszinierend und atemberaubend. Max Weber erläutert die alten Geschlechterverfassungen am Beispiel des nordamerikanischen Indianerstammes der Irokesen und der legendenumwobenen japanischen Frühgeschichte.[56] Ebd., S. 688.
37
Primitive Kriegervergesellschaftungen lernen wir am Beispiel Polynesiens und des zweiten Kalifen Omar kennen, Vgl. unten, S. 253 f. und 518 f.
38
kompliziertere Ausstattungsverfahren von Kriegern am Beispiel der islamischen Militärlehen oder der osmanischen Timare. Vgl. unten, S. 552 f. und 487.
39
Zur Illustration der Steuereintreibung in einfachen Patrimonialfürstentümern führt uns Weber an die Goldküste Afrikas, Vgl. unten, S. 392–394 und 389 mit Anm. 32.
40
während er die rein fronhofartige Organisation von Patrimonialreichen am Beispiel des Jesuitenstaates in Paraguay, Vgl. unten, S. 336 mit Anm. 39.
41
die komplexe und verfeinerte Struktur jedoch an den historischen Großreichen Ägypten, China und Rußland erläutert. Vgl. unten, S. 260.
42
Unterschiedliche Formen bürokratischer Verwaltung lernen wir im England der Normannenkönige, aber auch im modernen Persien kennen. Vgl. unten, S. 321–326, 326–338 und 362–367.
43
Man könnte diese Liste beliebig verlängern und doch stellt sich die Frage: Gehörte dieses umfangreiche universalhistorische Wissen zum Fundus Max Webers oder gab es doch Bereiche, für die er sich neu und speziell für die „Herrschaftssoziologie“ eingearbeitet hat? Letztlich wird man erst nach der Edition der Vorlesungsnotizen genau beurteilen können, inwieweit Max Weber schon vor der Jahrhundertwende universalhistorisch gearbeitet hat. Vgl. unten, S. 180 und 215.
Einige Hinweise bietet der gedruckte Vorlesungs-Grundriß aus dem Jahr 1898. Dort gibt Max Weber zu einzelnen Themenbereichen bereits Literatur zu außereuropäischen Ländern an.
44
In der ebenfalls 1898 erschienenen zweiten Auflage der „Agrarverhältnisse im Altertum“ geht Weber auf Unterschiede der europäischen im Gegensatz zur ostasiatischen [57]Bodenverteilung ein. Weber, Vorlesungs-Grundriß, S. 8, dort nennt Weber Cunow, Heinrich, Die soziale Verfassung des Inkareichs. Eine Untersuchung des altperuanischen Agrarkommunismus. – Stuttgart: J.H.W. Dietz 1896, und Rathgen, Japans Staatshaushalt, sowie dessen namentliche Erwähnung, unten, S. 289 und 438.
45
Hier wird auch dem Alten Orient ein neuer Abschnitt gewidmet,[57] Vgl. Weber, Agrarverhältnisse2, S. 57 f., sowie den Hinweis auf die universalhistorischen Anfänge bei Schmidt-Glintzer, Einleitung, in: MWG I/19, S. 13.
46
dessen Erforschung mit den alttestamentlichen Studien eng verbunden und daher Teil der abendländischen Kulturgeschichtsschreibung war. Die dritte Fassung der „Agrarverhältnisse im Altertum“, die im Winter 1907/08 auf der Basis der früheren Fassungen erheblich überarbeitet und erweitert wurde, Vgl. Weber, Agrarverhältnisse2, S. 59–66, sowie den Editorischen Bericht von Jürgen Deininger zu den „Agrarverhältnissen im Altertum (1. und 2. Fassung)“, MWG I/6.
47
steht den späteren universalhistorischen Arbeiten bereits sehr nahe. Dennoch läßt sich an einigen Beispielen zeigen, worin der „Sprung“ zur „Herrschaftssoziologie“ liegt: Ausführlich untersucht Weber in dem Artikel des „Handwörterbuchs“ die Verhältnisse in Ägypten vom Alten Reich bis hin zur römischen Herrschaft, und man kann an den entsprechenden Stellen der „Herrschaftssoziologie“ nachweisen, daß er auf dieses ältere Wissen zurückgreift. Vgl. dazu den Editorischen Bericht von Jürgen Deininger zu „Agrarverhältnisse im Altertum (3. Fassung)“, MWG I/6.
48
Die Bearbeitungsspuren in Webers Handexemplar der Neuausgabe von Eduard Meyers „Geschichte des Altertums“, Band l,2, der 1909 erschien, belegen jedoch, daß Weber sich auch nach dem Manuskriptabschluß der „Agrarverhältnisse im Altertum“ intensiv mit der ägyptischen Staatsorganisation beschäftigt hat. Vgl. z. B. unten, S. 172, Anm. 29, S. 173, Anm. 31, S. 263 f., Anm. 39, S. 320, Anm. 90, S. 322, Anm. 3 und 4, S. 323, Anm. 5 sowie weitere Stellen ebd., S. 323–326.
49
Diese neuerworbenen Sachkenntnisse finden in der „Herrschaftssoziologie“ einen Niederschlag. Vgl. Meyer, Geschichte des Altertums I,22 (wie oben, S. 37, Anm. 48); das Handexemplar Max Webers befindet sich in der Arbeitsstelle der Max Weber-Gesamtausgabe, BAdW München. Dort finden sich bei der Darstellung der altägyptischen Verwaltungsgeschichte An- und Unterstreichungen sowie teilweise Marginalien an folgenden Stellen: S. 56–65, 118–130, 142–159, 174–186 („Staat und Wirtschaft des Alten Reichs“), 206–212, 240–244, 247–256 („Organisation und innere Geschichte des [Mittleren] Reichs“).
50
Auch die Erwähnung einer verbesserten Neuübersetzung von Immunitätsprivilegien altägyptischer Tempel durch Kurt Sethe, die erst Ende 1912 vorlag, Vgl. z. B. unten, S. 182 mit Anm. 49, S. 184 mit Anm. 53, S. 263 mit Anm. 38, S. 323 mit Anm. 5, und S. 452 f. mit Anm. 74.
51
weist darauf hin, daß Max Weber sich nicht mit seinem alten Wissensstand zufrieden gab, sondern neue Erkenntnisse und Forschungsmeinungen in den Text miteinfließen ließ. Insofern ist die rückblickende Aussage Marianne Webers zu relativieren. Ein Weiteres läßt sich anhand des Vergleichs der „Herr[58]schaftssoziologie“ mit den „Agrarverhältnissen“ zeigen: Zwar werden in den „Agrarverhältnissen“ bei der Darstellung Ägyptens bereits die einzelnen Kriterien einer politischen patrimonialen Herrschaftsstruktur benannt, Vgl. dazu unten, S. 321 f. mit Anm. 1 und S. 347, Anm. 71.
52
doch erfolgt dies nicht unter dem Begriff des „Patrimonialismus“ oder vergleichbarer Begrifflichkeiten aus dem Wortfeld „patrimonial“. Erst im Kontext seiner Arbeiten zu „Wirtschaft und Gesellschaft“ macht sich Max Weber die in der zeitgenössischen Forschung teilweise schon verwendeten Begriffe zum Wortfeld „Patrimonialismus“ zu eigen,[58] Vgl. Weber, Agrarverhältnisse3, S. 81–91: grundherrliche Familien sind Dienstadel (S. 81), Fehlen von autonomen, städtischen Verwaltungskörperschaften (S. 82), Leiturgie- und Fronstaat (S. 82 f.), Amtspfründe und Amtslehen (S. 84), „große, bureaukratische nach staatlichem Muster mit Schreibern […] verwaltete Grundherrschaften“ (S. 84) sowie die zusammenfassende Charakterisierung des ägyptischen Staates als bürokratischen Leiturgiestaat (S. 90).
53
schärft ihren Bedeutungsgehalt, präzisiert sie durch adjektivische Zusätze und erweitert sie um eigene Wortbildungen, wie z. B. „extrapatrimonial“ oder „Patrimonialbürokratie“. Vgl. dazu oben, S. 32–34.
54
Vgl. dazu den Editorischen Bericht zum Text „Patrimonialismus“, unten, S. 240 f., zu „Patrimonialbürokratie“ als Neuschöpfung vgl. Weber, Einleitung, S. 29 (MWG I/19, S. 125 f.).
Mit ihren Bemerkungen im „Lebensbild“ zielte Marianne Weber aber insbesondere auf die innovative Leistung, die mit den religionssoziologischen Studien zu den großen Weltreligionen und der Erkenntnis des spezifisch okzidentalen Rationalismus verbunden ist. Es ziehe Max Weber – wie sie schreibt – „in den Orient: nach China, Japan und Indien, dann zum Judentum und Islam“.
55
Für die Darstellung der asiatischen Länder sei er, „der bisher alle Facharbeit auf sorgfältige Quellenforschung gestützt hat“, „auf übersetzte Quellen angewiesen“, Weber, Marianne, Lebensbild, S. 346.
56
In der „Herrschaftssoziologie“ werden die drei angeführten Länder behandelt: China insbesondere in Bezug auf seine Verwaltung durch konfuzianische Gelehrte, Ebd., S. 347.
57
Japan hinsichtlich seiner „feudalen“ Militär- und Ämterverfassung Vgl. unten, S. 326–344, aber auch unten, S. 170, 174–177 und 205.
58
und Indien nur ganz beiläufig bezüglich tradierter Vorrechte regionaler Geschlechter und bezüglich des Kastenwesens. Vgl. insbes. unten, S. 385–397.
59
Während die Geschichte Indiens noch weitgehend eine terra incognita zu sein scheint, stützt sich Weber für die [59]japanische Geschichte auf eine begrenzte Anzahl von Schriften, Vgl. unten, S. 387 und zum Kastenwesen, unten, S. 280, 584 f. und 669 f. (Brahmanismus).
60
namentlich auf die Monographie von Karl Rathgen über „Japans Volkswirtschaft und Staatshaushalt“ aus dem Jahre 1891.[59] Z. B. auf Rathgen, Karl, Staat und Kultur der Japaner (Monographien zur Weltgeschichte, Band 27). – Bielefeld, Leipzig: Velhagen & Klasing 1907 (hinfort: Rathgen, Staat der Japaner); Fukuda, Japan (wie oben, S. 36, Anm. 45) oder Yoshida, Staatsverfassung (wie oben, S. 36, Anm. 45).
61
Wesentlich spezieller ist hingegen seine Beschäftigung mit der chinesischen Staats-, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, die auf einer breiteren Literaturbasis steht. Hier benutzt Weber die ihm zur Verfügung stehenden Überblicksdarstellungen in Handbüchern, ältere Akademie-Schriften sowie die wenigen deutschsprachigen Spezialstudien. Zu Rathgen, Japans Volkswirtschaft, vgl. die explizite Erwähnung unten, S. 289 und 438, aber auch die indirekten Referenzen, so z. B. unten, S. 317 mit Anm. 78, S. 336 mit Anm. 41 und bes. S. 390 mit Anm. 34 und S. 391 mit Anm. 35–38. Zu diesem Buch Rathgens sind Exzerpte Max Webers überliefert (GStA PK, VI. HA, Nl. Max Weber, Nr. 31, Band 3, Bl. 105–108v).
62
Die Informationen waren rar, da in Deutschland erst seit 1909 Lehrstühle für das Fach Sinologie eingerichtet wurden, Vgl. z. B. Plath, Johann Heinrich, Über die Verfassung und Verwaltung China’s unter den ersten drei Dynastieen, in: Abhandlungen der philosophisch-philologischen Classe der Königlich Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Band 10, 2. Abt. – München: Verlag der K. Akademie 1865, S. 451–592 (hinfort: Plath, China unter den drei ersten Dynastieen) – zu dieser und einer weiteren Schrift Plaths sind Exzerpte Max Webers (GStA PK, Vl. HA, Nl. Max Weber, Nr. 31, Band 3, Bl. 78–78V) überliefert; Conrady, China (wie oben, S. 37, Anm. 47); Franke, Otto, Ostasiatische Neubildungen. Beiträge zum Verständnis der politischen und kulturellen Entwicklungs-Vorgänge im Fernen Osten. – Hamburg: C. Boysen 1911 (hinfort: Franke, Ostasiatische Neubildungen), und Franke, China (wie oben, S. 37, Anm. 47); Hermann, Heinrich, Chinesische Geschichte. – Stuttgart: D. Guntert 1912 – auf dem Titelblatt findet sich der Zusatz: Rheinische Mission – (hinfort: Hermann, Chinesische Geschichte); Richthofen, Ferdinand von, China. Ereignisse eigener Reisen und darauf gegründeter Studien, Band 3: Das südliche China, hg. von Ernst Tiessen. – Berlin: Dietrich Reimer (Ernst Vohsen) 1912 (hinfort: v. Richthofen, China) – zu dem Werk liegen Exzerpte Max Webers vor (GStA PK, VI. HA, Nl. Max Weber, Nr. 31, Band 3, Bl. 109–111); Singer, Isidor, Über sociale Verhältnisse in Ostasien. Vortrag im K.K. Handels-Museum zu Wien. – Leipzig, Wien: Franz Deuticke 1888 (hinfort: Singer, Ostasien).
63
so daß man vor allem auf ausländische Arbeiten angewiesen war. Hierbei spielte für Weber die französische Reihe der „Variétés Sinologiques“, in der Missionare und missionierte Chinesen die Geschichte des Landes in Form von Annalen dokumentierten und dabei auch Quellen übersetzten, Vgl. Schmidt-Glintzer, Helwig, Einleitung, in: MWG I/19, S. 14.
64
sowie die englischsprachige Ausgabe der Regierungsbul[60]letins in der „Peking Gazette“ Vgl. z. B. Gandar, Dominique, Le Canal Impérial. Étude historique et descriptive (Variétés Sinologiques, No. 4). – Shanghai: Imprimerie de la Mission Catholique 1894 (hinfort: Gandar, Canal Impérial); Hoang, Pierre, Mélanges sur l’administration (Variétés Sinologiques, No. 21), ebd. 1902 (hinfort: Hoang, L’administration); Zi, Etienne, Pratique des [60]Examens littéraires en Chine (Variétés Sinologiques, No. 5), ebd. 1894 (hinfort: Zi, Examens littéraires). Gandar (1829–1910) und Zi (1851–1932) waren beide Jesuiten, Gandar französischer Herkunft. Hoang (1830–1909) gehörte der katholischen Mission an.
65
eine wichtige Rolle zur Vermittlung von Basiswissen. In der „Herrschaftssoziologie“ schrieb Max Weber beispielsweise dem Reichseiniger Shih Huang-ti den Bruch mit dem Feudalismus, die Begründung der bürokratischen Verwaltung, aber auch den Bau der chinesischen Mauer zu. Vgl. dazu unten, S. 330, Anm. 26.
66
Diese Konzentrierung der Ereignisse auf die Regierungszeit Shih Huang-tis entsprach aber nicht deren tatsächlichem Verlauf, so daß Weber die Aussagen in der Konfuzianismus-Studie teilweise schon zurücknahm bzw. relativierte. Die Fehleinschätzung dürfte aber durch die anfänglich herangezogene Literatur zu erklären sein. Vgl. dazu unten, S. 170 und S. 334 mit Anm. 34.
67
Vgl. Weber, Konfuzianismus, MWG I/19, S. 210, sowie die entsprechende Bemerkung zu Webers sinologischen Literaturvorlagen bei Zingerle, Arnold, Max Webers Analyse des chinesischen Präbendalismus. Zu einigen Problemen der Verständigung zwischen Soziologie und Sinologie, in: Schluchter, Wolfgang (Hg.), Max Webers Studie Über Konfuzianismus und Taoismus. Interpretation und Kritik. – Frankfurt am Main: Suhrkamp 1983, S. 174–201, bes. S. 182.
Der Konfuzianismus selber kommt in der „Herrschaftssoziologie“ als Ethik der Selbstvervollkommnung, besonders aber als „Beamtenethik“ vor, die staatserhaltend wirke und dem Kapitalismus mißtrauisch gegenüberstehe.
68
Der Hinduismus wird nur an einer einzigen Stelle in der Aufzählung der asketischen Erlösungsreligionen erwähnt und zwar in dem überlieferten Manuskripteinschub zum Text „Staat und Hierokratie“. Vgl. dazu unten, S. 331–335, 453 und 534.
69
Dort finden sich auch – in konzentrierter Form – Max Webers Ausführungen zum buddhistischen Mönchswesen. Vgl. unten, S. 595.
70
Die überlieferten Notizen auf einer Rückseite des Originalmanuskripts basieren eindeutig auf der Lektüre von Albert Grünwedels Studien zum Buddhismus in Tibet und der Mongolei, d. h. seiner dort beheimateten Form: dem Lamaismus. Vgl. unten, S. 592–602, sowie einige weitere Stellen im Text „Staat und Hierokratie“, unten, S. 624, 626, 633, 638 und 646, und im Text „Umbildung des Charisma“, unten, S. 487 und 492 f.
71
Grünwedels Studien beruhten im wesentlichen auf den Sammlungen des russischen Fürsten Uchtomskij, der Material über diese schwer zugängliche und von der chinesischen Zentralregierung abgeschottete Region zusammengetragen hatte. Für die Darstellung des Buddhismus insgesamt waren wohl [61]Heinrich Hackmann, Hendrik Kern und Hermann Oldenberg in dieser Werkphase die wichtigsten Gewährsleute. Vgl. die Notizen zum Manuskript, unten, S. 710–712, und Grünwedel, Albert, Mythologie des Buddhismus in Tibet und der Mongolei. – Leipzig: F. A. Brockhaus 1900 (hinfort: Grünwedel, Buddhismus).
72
Sieht man sich im Gegensatz dazu die umfangreichen Verzeichnisse der von Max Weber zitierten Literatur in den beiden Bänden der Max Weber-Gesamtausgabe zum „Konfuzianismus und Taoismus“ und zum „Hinduismus und Buddhismus“ an,[61] Vgl. Hackmann, Heinrich, Der Ursprung des Buddhismus und die Geschichte seiner Ausbreitung, 3 Teile (Religionsgeschichtliche Volksbücher, hg. von Friedrich Michael Schiele, 3. Reihe, Hefte 4, 5 und 7). – Halle: Gebauer-Schwetschke 1905–1906 und Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) 1906 (hinfort: Hackmann, Buddhismus I–III); Kern, Heinrich, Der Buddhismus und seine Geschichte in Indien. Eine Darstellung der Lehren und Geschichte der buddhistischen Kirche, 2 Bände. – Leipzig: Otto Schulze 1882–1883 (hinfort: Kern, Buddhismus); und Oldenberg, Hermann, Buddhistische Studien, in: Zeitschrift der Morgenländischen Gesellschaft, Band 52, 1898, S. 613–694 (hinfort: Oldenberg, Buddhistische Studien).
73
dann wird deutlich, daß Max Weber hier – in der „Herrschaftssoziologie“ – am Anfang seiner Studien zu den Weltreligionen stand. Während das Judentum insbesondere als Gesetzesreligion und – in direkter Auseinandersetzung mit den Thesen von Werner Sombarts Monographie „Die Juden und das Wirtschaftsleben“ – in seiner Bedeutung für die Entstehung des Kapitalismus behandelt wird, Vgl. Weber, Konfuzianismus, MWG I/19, S. 557–568, und ders., Hinduismus, MWG I/20, S. 648–668.
74
wird der Islam vorrangig unter dem Aspekt einer Kriegerreligion dargestellt. Vgl. dazu bes. unten, S. 662–668 und 622 f. zur Gesetzesreligion.
75
Im Islam, der auch eine „Einheitskultur“ mit sich bringe, Vgl. dazu unten, S. 633–639 und 646–649.
76
gebe es keine strikte Trennung von weltlichen und geistlichen Ämtern, keine des religiösen vom säkularen Recht – die Rechtsprechung sei daher „Kadi-Justiz“ im eigentlichen Sinne des Wortes. Vgl. unten, S. 649.
77
Diese Begrenzung des islamischen Rechts kann sich, wie Weber an den Beispielen des geistlichen Gerichts in Tunis und des religiösen Stiftungswesens nachweist, Vgl. dazu unten, S. 430 und 468 f.
78
hinderlich für die Entwicklung des modernen Kapitalismus auswirken, muß es aber nicht, wie er am Gegenbeispiel der kaukasischen Tataren belegt. Vgl. unten, S. 194, 428 f. und 628.
79
Während sich Max Weber für die wirtschaftlichen Fragen im Islam stark auf die Arbeiten seines Heidelberger Kollegen Carl Heinrich Becker stützt, Vgl. unten, S. 427.
80
so gilt dies für die Darstellung der genuin religiösen Entwicklung des Islam insbesondere für Ignaz Goldziher. Vgl. Becker, Steuerpacht und Lehenswesen, mit der expliziten Erwähnung, unten, S. 392 mit Anm. 40, und ders., Zur Entstehung der Waqfinstitution, in: Der Islam, Band 2, Heft 4, Nov. 1911, S. 404 f. (hinfort: Becker, Waqfinstitution).
81
Vgl. Goldziher, Ignaz, Vorlesungen über den Islam. – Heidelberg: Carl Winter 1910 (hinfort: Goldziher, Vorlesungen).
[62]In der „Herrschaftssoziologie“ zeigen sich die ersten Ansätze zu den universalhistorisch angelegten Studien zu den Weltreligionen, teilweise schon explizit an der Fragestellung ausgerichtet, wie fern oder nahe die großen Religionen dem modernen Kapitalismus bzw. dem okzidentalen Rationalismus standen. Die Detailforschungen setzen hier auf noch begrenzter Literaturbasis und Sachkunde ein. Zugleich wird auch – wie gerade im Falle Chinas – deutlich, daß die Beschäftigung mit dem Land zunächst durch das Interesse an seiner Verwaltungsgeschichte geprägt war
82
und dann die religionssoziologische Fragestellung zu einer Erweiterung der Forschungen und einer Akzentverschiebung im Umgang mit dem Quellenmaterial geführt hat. Die politischen Umwälzungen in China, insbesondere seit der zweiten Jahreshälfte 1911, könnten sogar – vergleichbar der Russischen Revolution von 1905 – das Interesse Max Webers an diesem Land geweckt haben. Bereits 1913 trug Max Weber in kleinem Kreis seine Konfuzianismus-Studien vor,[62] Vgl. dazu die überlieferten Exzerpte, wo die Notizen über China und Japan zusammen abgelegt und die Literaturangaben noch ausschließlich auf die Agrar- und Verwaltungsgeschichte bezogen waren (GStA PK, VI. HA, Nl. Max Weber, Nr. 31, Band 3, BI. 104–111).
83
so daß die Erarbeitung der chinesischen Geschichte und Kultur wohl parallel zur Niederschrift der „Herrschaftssoziologie“ erfolgt sein dürfte. Dafür spricht auch, daß China von den asiatischen Ländern in der „Herrschaftssoziologie“ am stärksten berücksichtigt worden ist. Vgl. die Bemerkung Max Webers in: Weber, Einleitung, S. 1, Fn. 1 (MWG I/19, S. 83), und dazu Schmidt-Glintzer, Helwig, Einleitung, MWG I/19, S. 34 f.
Direkte Nachrichten zur Niederschrift von „Wirtschaft und Gesellschaft“ und speziell zur „Herrschaftssoziologie“ gibt es nur wenige, da sich Max Weber selber zumeist über seine aktuellen Arbeitsvorhaben ausschwieg. Einige Informationen lassen sich dennoch der Korrespondenz entnehmen, besonders aber den regelmäßigen Berichten von Marianne Weber an ihre Schwiegermutter. Danach arbeitet Max Weber in den Wintermonaten 1911/12 – zumeist mit Unterstützung eines Maschinenschreibers – an seinem Handbuch-Beitrag, im Mai und Juni 1912 wohl hauptsächlich an der Musiksoziologie,
1
und dann ab September wieder an der von ihm sogenannten „Terminarbeit“. Vgl. die Briefe Marianne Webers an Helene Weber vom 28. Dez. 1911, 12. Mai und 14. Juni 1912, Bestand Max Weber-Schäfer, Deponat BSB München, Ana 446, und den Editorischen Bericht zur „Musiksoziologie“, in: MWG I/14, S. 128 f.
2
Am 23. Januar 1913 erfolgt dann die erste Mit[63]teilung an den Verleger Paul Siebeck über den „großen“ Beitrag „Wirtschaft und Gesellschaft – incl. Staat und Recht“, der im Laufe des Frühjahrs fertig sein werde. Außerdem fügt Weber mit gewissem Stolz an: „Übrigens wird er [der Beitrag], hoffe ich, zu den besseren oder besten Sachen gehören, die ich schrieb. Er giebt eigentlich eine vollständige soziologische Staatslehre im Grundriß und hat heißen Schweiß gekostet, das kann ich wohl sagen.“ Vgl. z. B. den Brief Max Webers an die Teilnehmer der Leipziger Besprechung vom 15. Nov. 1912, MWG II/7, S. 757.
3
Drei Tage später trifft der lange erwartete Einleitungsbeitrag zum „Handbuch“ von Karl Bücher ein, von dem Weber allein schon wegen seines mageren Umfangs bitter enttäuscht ist. Er will „in diese Bresche springen“,[63] Brief Max Webers an Paul Siebeck vom 23. Jan. 1913, MWG II/8, S. 52.
4
ist aber dennoch zuversichtlich, bis zum Mai fertig zu sein. Diesen optimistischen Eindruck vermittelt auch Marianne Weber, die an ihre Schwiegermutter berichtet: „der Max arbeitet so intensiv wie lange nicht und hat täglich eine Tippmamsell.“ Brief Max Webers an Paul Siebeck vom 28. Jan. 1913, MWG II/8, S. 60.
5
Hat Max Weber, so darf man anhand des Januar-Briefs an Paul Siebeck vermuten, seine im Sommer 1909 skizzierten Vorstellungen eingelöst und eine „soziologische Staatslehre“ geschrieben? Brief Marianne Webers an Helene Weber vom 17. Febr. 1913, Bestand Max Weber-Schäfer, Deponat BSB München, Ana 446.
Max Weber arbeitet während des ganzen Jahres 1913 hart und nur unterbrochen durch einen Monat Frühjahrsurlaub in Ascona und einen Monat Herbsturlaub in Italien. Jedoch dürfte er einige Zeit mit der Überarbeitung des Aufsatzmanuskripts „Zur Methodik der verstehenden Soziologie“ zugebracht haben, das er Heinrich Rickert am 3. Juli 1913 zur Veröffentlichung in der Kulturzeitschrift „Logos“ anbot.
6
Die strenge Begriffskasuistik erscheint im Laufe des November 1913 unter dem Titel „Über einige Kategorien der verstehenden Soziologie“ und bietet zum ersten Mal greifbar eine umfassende und stringente Definition des Herrschaftsbegriffs: „Ebenso wie ‚Herrschaft‘ nicht bedeutet: daß eine stärkere Naturkraft sich, irgendwie, Bahn bricht, sondern: eine [sic!] sinnhaftes Bezogensein des Handelns der Einen (‚Befehl‘) auf das der Anderen (‚Gehorsam‘) und entsprechend umgekehrt, derart, daß im Durchschnitt auf das Eintreffen der Erwartungen, an welchen das Handeln beiderseits orientiert ist, gezählt werden darf.“ Brief Max Webers an Heinrich Rickert vom 3. Juli 1913, MWG II/8, S. 260.
7
Max Weber benennt hier den für alle seine Herr[64]schaftsdefinitionen entscheidenden Kerngedanken, daß Herrschaft auf einem Befehl-Gehorsam-Verhältnis, d. h. einem Autoritätsverhältnis, beruht. Zusätzlich erhält der Herrschaftsbegriff durch seine Positionierung innerhalb der soziologischen Kategorienlehre eine besondere Schärfe. Max Weber ordnet „Herrschaft“ und das von ihm sogenannte „Herrschafts-Einverständnis“ Weber, Kategorien, S. 278. – Zum Erscheinungstermin: Am 11. November 1913 erkundigt sich Max Weber beim Verleger, ob sein Beitrag im nächsten „Logos“-Heft erscheinen werde, da ihm „der Abdruck jetzt angenehm wäre, auch aus sachlichen Grün[64]den“ (vgl. Brief Max Webers an Paul Siebeck vom 11. Nov. 1913, MWG II/8, S. 375). Ende November 1913 kommentiert Weber den im selben „Logos“-Heft erschienenen Aufsatz von Heinrich Rickert (vgl. Brief Max Webers an Heinrich Rickert, ca. Ende Nov. 1913, ebd., S. 408–410).
8
der Kategorie des Einverständnishandelns, d. h. einer spezifizierten Form des Gemeinschaftshandelns, zu. Im Gegensatz zum Gesellschaftshandeln, das sich an zweckrational vereinbarten Ordnungen ausrichtet und typisch für das Anstaltshandeln ist, orientiert sich das Einverständnishandeln an „als ob“-Ordnungen und charakterisiert das Verbandshandeln. Weber, Kategorien, S. 279.
9
Der soziologisch gefaßte Herrschaftsbegriff wird folglich mit dem Verband und der für ihn typischen Art des Handelns, der Ordnung und Organisation verbunden. Mit dem Kategorienaufsatz überwindet Max Weber den Gierkeschen Ansatz, Ebd., S. 275.
10
indem er den Herrschafts- und Verbandsbegriff von dessen erkenntnistheoretischen Voraussetzungen befreit und so für eine empirisch verfahrende Soziologie brauchbar macht – „Herrschaft“ ist zu einer soziologischen Kategorie geworden und die Verbandslehre auf empirische Füße gestellt worden. Vgl. dazu oben, S. 16–23, bes. S. 21.
Folgt man Webers Kategorienlehre, so ist in politischen Verbänden, die noch nicht über eine gesatzte Ordnung verfügen und noch keine institutionalisierte Staatsanstalt sind, die Orientierung der Handelnden (der Herrschenden wie der Beherrschten) an der Geltung des Einverständnisses konstitutiv für das dauerhafte Bestehen und die Stabilität des Verbandes. Selten entstehe eine solche gesatzte Ordnung durch Übereinkunft, sondern beruhe zumeist auf Oktroyierung. „Der Sache nach aber beruht jegliche Oktroyierungsmacht auf einem spezifischen, in seinem Umfang und seiner Art jeweils wechselnden Einfluß – der ,Herrschaft‘– konkreter Menschen (Propheten, Könige, Patrimonialherren, Hausväter, Älteste oder anderer Honoratioren, Beamten, Partei- oder anderer ,Führer‘ von höchst wichtig verschiedenem soziologischem Charakter) auf das Verbandshandeln der Andern.“
11
Die Nennung der wichtigsten Herrschaftsträger verweist bereits auf die uns überlieferten älteren Texte zur „Herrschaftssoziologie“. Verstärkt wird die Verklammerung durch den explizi[65]ten Hinweis, daß die Behandlung der „Herrschaft als wichtigste Grundlage des Verbandshandelns […] notwendig ein Objekt gesonderter hier nicht zu erledigender Betrachtung“ sei, Weber, Kategorien, S. 291.
12
wie ja überhaupt der zweite Teil des Kategorienaufsatzes der methodischen Begründung der sachlichen Ausführungen in „Wirtschaft und Gesellschaft“ dienen sollte.[65] Ebd., S. 291.
13
Angesprochen ist an dieser Stelle bereits die weittragende Verknüpfung des „,Legitimitäts‘-Einverständnisses“ mit den unterschiedlichen Formen der Herrschaftsstruktur. Ebd., S. 253, Fn. 1
14
Ebd., S. 291.
Dies wirft die Frage nach dem Verhältnis von Kategorienaufsatz und „Herrschaftssoziologie“ auf.
15
Auffällig ist, daß die spezifischen Kategorien des zweiten (älteren) Teils des Kategorienaufsatzes zum Gemeinschafts- und Gesellschaftshandeln bzw. zum Verbands- und Anstaltshandeln in einigen Abschnitten der „Herrschaftssoziologie“, wie z. B. im abgebrochenen Text „Charismatismus“ und im Text „Staat und Hierokratie“, nicht vorkommen. Die Datierung des Kategorienaufsatzes wird in der Weber-Forschung noch kontrovers diskutiert. In einem Brief Max Webers an Heinrich Rickert vom 5. September 1913 heißt es über das Aufsatzmanuskript, daß es „fertig da liegt, in seinem ursprünglichen Teil schon seit 3/4 Jahren, jetzt durchgesehen und mit einigen ,methodischen‘ Bemerkungen eingeleitet“ (MWG II/8, S. 318). Naheliegend ist es, aufgrund dieser Briefstelle ein Dreivierteljahr zurückzurechnen, so daß der ältere Teil des Kategorienaufsatzes am Ende des Jahres 1912 niedergeschrieben worden wäre. Interpretiert man die Stelle hingegen als drei bis vier Jahre, so wären die Jahre 1909/10 als maßgeblicher Abfassungszeitraum anzusehen. Für die Einführung der Herrschaftskategorie ist dieser frühe Zeitpunkt eher unwahrscheinlich. In dem Brief an Rickert bot Max Weber wegen der Umfangüberschreitung – das Manuskript betrug statt der im Juli angekündigten 11/2 Boden (= 24 Druckseiten) nun 51–53 Maschinenseiten (= 40 Druckseiten) – verschiedene Publikationsoptionen an, legte dabei aber Wert auf den Druck des „ursprünglichen Teil[s]“ (ebd., S. 318). Dies bedeutet, daß ihm die Veröffentlichung der Kategorienlehre des älteren Teils im Sommer 1913 wichtig war, und die Kategorien damit noch nicht als überholt angesehen werden können. Außerdem berichtet Weber von einer Reihe von „Streichungen und Einschiebseln“ im Manuskript (ebd., S. 318), so daß er den Umfang nicht genau berechnen konnte. Diese Zusätze dürften sich wohl vor allem auf den älteren Teil beziehen, der damit – auch wenn er wesentlich früher abgefaßt gewesen sein sollte – aktualisiert worden ist.
16
In den anderen überlieferten Herrschaftstexten wird zwar an einzelnen Stellen mit der Terminologie des Kategorienaufsatzes gearbeitet, so in den Texten „Bürokratismus“, „Patrimonialismus“, „Feudalismus“, „Umbildung des Charisma“ und „Erhaltung des Charisma“, Vgl. dazu den Editorischen Bericht, unten, S. 567.
17
von [66]einer durchgehenden und stringenten Verwendung der Kategorien kann aber nicht gesprochen werden. Dies kann zweierlei bedeuten, zum einen, daß die Kategorien bei der Abfassung der Herrschaftstexte noch nicht entwickelt waren und dann nur partiell nachgetragen worden sind, oder aber, daß sie zum Zeitpunkt ihrer Niederschrift bereits veraltet waren und deshalb nicht mehr verwendet wurden. Die detaillierte Auflistung der einzelnen Herrschaftsträger in der oben ausführlich zitierten Stelle des Kategorienaufsatzes spricht dafür, daß weite Teile der „Herrschaftssoziologie“ bereits vorlagen, als diese Passage geschrieben worden ist. Auffällig an der Aufzählung der Herrschaftsträger ist deren entwicklungshistorische Anordnung, d. h. vom König und Propheten über den Patrimonialherren bis hin zum Beamten und Parteiführer. Ist dies Zufall? Oder folgte eine frühe Fassung der „soziologischen Staatslehre“ einem entwicklungshistorischen Verlaufsmodell? Immerhin ein Gedanke, den Marianne Weber bei der Auflistung der einzelnen Herrschaftskapitel zunächst verfolgt hatte.Vgl. den Text „Bürokratismus“, unten, S. 208–210; den Text „Patrimonialismus“, unten, S. 262–267, 274–276; den Text „Feudalismus“, unten, S. 410–413; den Text „Umbil[66]dung des Charisma“, unten, S. 491–493 und 502–505; sowie den Text „Erhaltung des Charisma“, unten, S. 542 f.
18
Wirft man einen Blick auf den einleitenden Text „Herrschaft“, der sich durch die intensive Verwendung der Begriffe des Kategorienaufsatzes – besonders in der Anfangs- und Schlußpassage – auszeichnet, „Bürokratie“ an 18. Stelle hinter „Staat und Hierokratie“, vgl. dazu den Abdruck der Auflistung des Manuskriptbestandes, unten, S. 100.
19
so scheinen die Bestimmungen des Kategorienaufsatzes vergleichsweise präziser zu sein. Dies betrifft die am Anfang entwickelte Herrschaftsdefinition, die im Text „Herrschaft“ nicht die Verbindung zum Verbands- und Einverständnishandeln herstellt, sondern den Herrschaftsbegriff aus dem noch weiteren Begriff der sozialen Macht entwickelt und – wie oben angeführt – Anleihen an Kants kategorischen Imperativ aufweist. Vgl. unten, Herrschaft, S. 126 f. und 147 f.
20
Eine direkte Anwendung der Legitimitätslehre auf den politischen Verband bietet hingegen der stark mit dem Vokabular des Kategorienaufsatzes arbeitende Text „Politische Gemeinschaften“, der im Teilband „Gemeinschaften“ ediert ist. Vgl. dazu oben, S. 44.
21
Aus den angeführten Beobachtungen ergibt sich eine nur partielle Vernetzung zwischen der soziologischen Kategorienlehre, wie sie im November 1913 erschienen ist, und der uns überlieferten älteren Fassung der „Herrschaftssoziologie“. Die Beispiele legen jedoch nahe, daß die Herrschaftstexte zu großen Teilen wohl vor der Fixierung der soziologischen Kategorien niedergeschrieben waren und diese dann nur punktuell eingearbeitet worden sind. Weber, Politische Gemeinschaften, MWG I/22-1, S. 200–217.
[67]Gegenüber Hermann Kantorowicz, der offensichtlich den Kategorienaufsatz gelesen und Verständnisschwierigkeiten mit dem Konstrukt „verstehende Soziologie“ hatte, erläuterte Max Weber seine Absichten: „Es ist der Versuch, alles ‚Organizistische‘, Stammlerische, Überempirische, ‚Geltende‘ (= Normhaft Geltende) zu beseitigen und die ‚soziologische Staatslehre‘ als Lehre vom rein empirischen typischen menschlichen Handeln aufzufassen […].“
22
Einen Tag später, am 30. Dezember 1913, skizziert Weber gegenüber dem Verleger Paul Siebeck die wichtigsten Punkte seines Beitrags „Wirtschaft und Gesellschaft“ und erwähnt am Ende der Auflistung die „umfassende soziologische Staats- und Herrschafts-Lehre“.[67] Brief Max Webers an Hermann Kantorowicz vom 29. Dez. 1913, MWG II/8, S. 442 f.
23
Der bereits mehrfach zitierte Brief klingt euphorisch und unterstreicht zusätzlich den Stellenwert der im Kategorienaufsatz dokumentierten Präzisierung des Herrschaftsbegriffs. Faßt man die Briefaussagen vom Beginn und Ende des Jahres 1913 zusammen, dann legen sie den Eindruck nahe, daß Max Weber im Laufe des Jahres 1913 der Durchbruch zu einer umfassenden Herrschaftssoziologie gelungen ist. Dies bedeutet zum einen, daß 1913 der Herrschaftsbegriff Brief Max Webers an Paul Siebeck vom 30. Dez. 1913, MWG II/8, S. 449 f.
24
in den Mittelpunkt gerückt und die soziologische Staatslehre um eine soziologische Herrschaftslehre erweitert worden ist. Dies hätte zur Folge, daß für alle Texte, die ohne die Herrschaftskategorie niedergeschrieben worden waren, ein Überarbeitungsbedarf bestand. Im „Bürokratismus“-Text läßt sich beispielsweise eine Passage ausmachen, die nicht nur an die Terminologie des Kategorienaufsatzes anknüpft, sondern zugleich die Bürokratie-Studie mit dem Herrschaftsthema verbindet. Indiz für die Fixierung des Herrschaftsbegriffs als soziologische Kategorie kann die Verwendung von Anführungszeichen sein; vgl. dazu unten, S. 82 mit Anm. 47 sowie die Tabelle mit den unterschiedlichen Verweisformulierungen, unten, S. 83 f.
25
Dies könnte ein Indiz dafür sein, daß der „Bürokratismus“-Text früh abgefaßt und im Jahr 1913 oder danach überarbeitet worden ist. Zum anderen scheint sich im Jahre 1913 der Fokus der politischen Soziologie vom Staats- auf den Herrschaftsbegriff verlagert zu haben, so daß der Staatsbegriff als solcher zur Darstellung der vormodernen und außereuropäischen politischen Geschichte in den Hintergrund tritt. Im überlieferten Textbestand zur „Herrschaftssoziologie“ gibt Max Weber an, daß der moderne Staatsbegriff zur Darstellung von frühen Organisationsformen des Gemeinschaftshandelns, die eben Verbände und noch keine (Anstalts-)Staaten sind, nicht anwendbar sei. Vgl. unten, S. 208–210.
26
Auch in dem Manuskripteinschub zum Text „Staat und Hierokratie“ korrigiert sich We[68]ber im Schreibfluß selbst: der Staatsbegriff wird durch pauschalere Ausdrücke wie „politische Gewalt“ u.ä. ersetzt. Vgl. unten, S. 410 f.
27
Außerdem spiegelt sich diese Abkehr in der neuen Überschrift zum Text „Staat und Hierokratie“ wider, die in der im Juni 1914 veröffentlichten Disposition „Politische und hierokratische Herrschaft“ heißt.[68] Vgl. dazu den Editorischen Bericht zum Text „Staat und Hierokratie“, unten, S. 576.
28
Vgl. Einteilung des Gesamtwerkes, in: GdS1 Abt. I, 1914, S. XI (MWG I/22-6) [[MWG I/24, S. 169]].
Doch Max Weber gab den Ende 1913 fulminant beschriebenen „Handbuch“-Beitrag nicht zum Druck. Er umfaßte nach seinem Bekunden zu Beginn des Jahres 1914 insgesamt 30 Bogen,
29
wovon die überlieferten Texte zur „Herrschaftssoziologie“ über ein Drittel (11,6 Bogen = 186 Druckseiten) ausmachen. Mitte März 1914 kündigt Weber eine erneute Umgestaltung an, weil der mittlerweile eingetroffene Beitrag Friedrich von Wiesers über „Theorie der gesellschaftlichen Wirtschaft“ wiederum nicht seinen Erwartungen entsprach. Vgl. die Briefe Max Webers an Paul Siebeck vom 16. und 19. Jan. 1914, MWG II/8, S. 468, 474.
30
Daß die Texte zur „Herrschaftssoziologie“ ebenfalls in diesem Zeitraum überarbeitet wurden, läßt sich an einigen Stellen der Texte „Patrimonialismus“ und „Feudalismus“ zeigen. Vgl. den Brief Max Webers an Paul Siebeck vom 15. März 1914, MWG II/8, S. 553.
31
Während der letzten redaktionellen Arbeiten am ersten Band des „Grundriß der Sozialökonomik“, wie das Handbuch seit April 1914 heißt, verschlechtert sich Webers Laune zunehmend: Sein Beitrag werde erst im Herbst in den Satz gehen können. Vgl. die Editorischen Berichte, unten, S. 238 f. und 372.
32
Der erste Band des „Grundrisses“ erscheint im Juni 1914 und bietet zugleich eine detaillierte Inhaltsübersicht über Max Webers eigenen großen Beitrag „Die Wirtschaft und die gesellschaftlichen Ordnungen und Mächte“. Unter dem abschließenden Punkt 8 sieht er eine umfassende Herrschaftslehre vor: Vgl. die Briefe Max Webers an Paul Siebeck vom 15., 16. und 21. Apr. 1914, MWG II/8, S. 623, 625 und 634.
„8. Die Herrschaft:
- a) Die drei Typen der legitimen Herrschaft.
- b) Politische und hierokratische Herrschaft.
- c) Die nichtlegitime Herrschaft. Typologie der Städte.
- d) Die Entwicklung des modernen Staates.
- e) Die modernen politischen Parteien.“33Vgl. Einteilung des Gesamtwerkes, in: GdS1 Abt. I, 1914, S. XI (MWG I/22-6) [[MWG I/24, S. 169]].
Anfang Juni berichtet Marianne Weber an die Schwiegermutter, daß sie nicht länger als drei Wochen in Urlaub gehen könnten, weil die Arbeit von Max noch „nicht völlig abgeschlossen“ sei und er sehr intensiv daran ar[69]beite.
34
Gegenüber dem Verleger wird Webers Ton zunehmend gereizter, er wolle nicht gedrängt werden und brauche Zeit bis zum nächsten Frühjahr. Plötzlich beschleichen ihn große Zweifel, daß er, da es sich um „die heikelsten und umstrittensten Dinge unsrer Disziplin und der Soziologie“ handeln würde, seinen guten Namen verlieren könne.[69] Brief Marianne Webers an Helene Weber vom 4. Juni 1914, Bestand Max Weber-Schäfer, Deponat BSB München, Ana 446.
35
Auch an Georg von Below schreibt er, daß seine „im Frühjahr erscheinende Darstellung“ niemand werde befriedigen können. Brief Max Webers an Paul Siebeck vom 27. Juli 1914, MWG II/8, S. 776.
36
Was ist – so darf man fragen – aus der von Weber Ende 1913 euphorisch beschriebenen „geschlossenen soziologischen Theorie und Darstellung“ geworden? Haben die mehrfachen Überarbeitungen die ursprüngliche Geschlossenheit zerstört oder sind Webers Briefaussagen vom Sommer 1914 Ausdruck depressiver Gestimmheit, die man nicht als zuverlässige Beschreibung des tatsächlich vorliegenden Manuskripts auffassen darf? Gibt es einen sachlichen Grund, weshalb er das 1914 angeblich nahezu fertige Manuskript nicht in den Druck gegeben hat? Brief Max Webers an Georg von Below vom 10. Juli 1914, MWG II/8, S. 750.
Vergleicht man die Gliederung zur „Herrschaftssoziologie“ vom Juni 1914 mit dem überlieferten Textbestand, so ergibt sich eine auffällige Diskrepanz. Von den in der „Grundriß“-Disposition genannten fünf Unterabschnitten zur „Herrschaftssoziologie“ läßt sich nur der zweite Abschnitt „Politische und hierokratische Herrschaft“ dem Text „Staat und Hierokratie“ und der dritte Abschnitt „Die nichtlegitime Herrschaft“ der Stadt-Studie zuordnen, wobei ihr Herausgeber Wilfried Nippel betont, daß der vorhandene Text weder den Anspruch einer „Typologie der Städte“ noch den einer Darstellung der „nichtlegitimen Herrschaft“ erfülle.
37
Von 11,6 Bogen überliefertem Textbestand zur „Herrschaftssoziologie“ haben ca. 9,2 Bogen, d. h. 147 Grundriß-Druckseiten, keine Entsprechung in der Inhaltsübersicht. Den Anspruch, eine Typologie der legitimen Herrschaft zu bieten, die der erste Unterabschnitt ankündigt, erfüllt der überlieferte Einleitungstext „Herrschaft“ nicht. Aufzeichnungen zu den beiden letztgenannten Unterabschnitten zur „Entwicklung des modernen Staates“ und den „modernen politischen Parteien“ sind nicht überliefert. Dies zwingt dazu, einen Augenblick innezuhalten und den überlieferten Textbestand genau[70]er anzusehen. Von Herrschaftstypen, die durch das „Legitimitäts“-Einverständnis charakterisiert sind, ist nur im Anfangstext „Herrschaft“ kurz die Rede und dann nur ein weiteres Mal im Text „Umbildung des Charisma“, wo von den „drei Grundtypen der Herrschaftsstruktur“ die Rede ist, während in der Realität mannigfache Misch- und Übergangsformen vorkämen Vgl. Nippel, Wilfried, Einleitung, in: MWG I/22-5, S. 25 f., wo er betont, daß die nicht-legitime Herrschaft nur an wenigen Stellen der „Stadt“ behandelt wird; vgl. auch ders., Webers „Stadt“. Entstehung – Struktur der Argumentation – Rezeption, in: Bruhns, Hinnerk und Nippel, Wilfried (Hg.), Max Weber und die Stadt im Kulturvergleich. – Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2000, S. 11–38, hier: S. 12.
38
– übrigens eine Aussage, die sich in etwas anderer Formulierung auch in einem Brief an Heinrich Sieveking vom 29. Juni 1913 wiederfindet.[70] Vgl. unten, S. 513.
39
Die Beschreibung der Herrschaftsformen und ihrer in der Realität vorkommenden Vielfalt erfolgt nicht – wie zu erwarten wäre – in drei, den Grundtypen der Herrschaft entsprechenden Kapiteln, sondern in sechs überlieferten Texten. Der Text „Bürokratismus“ analysiert eine, wenn auch die typischste, Form der rationalen Herrschaftsausübung (die monokratische im Gegensatz zu der ebenfalls möglichen kollegialen); Vgl. den Brief Max Webers an Heinrich Sieveking vom 29. Juni 1913, MWG II/8, S. 254.
40
zur traditionellen Herrschaft liegen uns zwei Texte, „Patrimonialismus“ und „Feudalismus“, und zur charismatischen Herrschaft sogar drei verschiedene Texte vor: „Charismatismus“ (unvollendet), „Umbildung des Charisma“ und der unter der Überschrift „Legitimität“ überlieferte Text (jetzt: „Erhaltung des Charisma“). Vgl. dazu Weber, Die drei reinen Typen, unten, S. 728 f.
Die Komposition der „Herrschaftssoziologie“, wie sie uns überliefert ist, steht den Planungen von 1909/10 und dem Handbuchartikel „Agrarverhältnisse im Altertum“ näher als der Disposition von 1914. Max Weber geht in der „Herrschaftssoziologie“ komparatistisch vor. Dies ist vor allem das in den „Agrarverhältnissen“ angewendete und virtuos beherrschte Verfahren. Die Besonderheiten der antiken Polis werden dort im Vergleich zur mittelalterlichen Stadt deutlich gemacht und umgekehrt.
41
Die strukturellen Unterschiede der auf dem militärischen Prinzip beruhenden Polisorganisation gegen die am Markt und seinen Erfordernissen orientierte Stadtorganisation des Mittelalters werden durch ihre Nähe und Ferne zum modernen Kapitalismus bestimmt. So wird in dem 1907/08 erweiterten Artikel über die „Agrarverhältnisse“ nicht nur die Art der Bodenverteilung behandelt, sondern die damit zusammenhängende Struktur der Verwaltung, der Militärorganisation, der sozialen Schichtung und des religiösen Einflusses. Die einzelnen Strukturfaktoren bedingen sich wechselseitig und eröffnen damit eine Multivarianz von Zuordnungsmöglichkeiten und unterschiedlichen Ausformungen. Diese Grundintention Max Webers, die [71]„Bedeutung der Wirtschaft für die Cultur“ zu relativieren Weber, Agrarverhältnisse3, S. 171–183.
42
und stattdessen die wechselseitigen Zusammenhänge zu erfassen, zieht sich als roter Faden von den frühen Vorlesungen über den Handbuchartikel „Agrarverhältnisse im Altertum“ und die Konzeption von „Wirtschaft und Gesellschaft“ bis hin zu den späten Vorlesungen: Es ist die „Kritik der materialistischen Geschichtsauffassung“.[71] Weber, Max, Notizen zur Vorlesung „Allgemeine (‚theoretische‘) Nationalökonomie“, Deponat Max Weber, BSB München, Ana 446, OM 3, Bl. 48–51R (MWG III/1).
43
Bezogen auf die „Herrschaftssoziologie“ bedeutet dies, wie es in dem Abschnitt über den Zusammenhang von patrimonialen und feudalen Herrschaftsstrukturen zur Wirtschaft exemplarisch dargestellt ist, einerseits die wirtschaftlichen Entstehungsbedingungen der politischen Gebilde zu benennen und andererseits den Einfluß der Herrschaftsorganisation auf die Struktur der Wirtschaft deutlich zu machen. Dieses Verfahren erläutert Max Weber in dem Einleitungstext zur „Herrschaftssoziologie“ Im Stoffverteilungsplan vom Mai 1910 heißt es beim dritten Unterpunkt zum Beitrag „Wirtschaft und Gesellschaft“: „Kritik des historischen Materialismus“ (VA Mohr/Siebeck. Deponat BSB München, Ana 446 (MWG I/22-6 [[MWG I/24]]); dass., in: MWG II/6, S. 768); die Wiener Vorlesung im Sommersemester 1918 war als „Wirtschaft und Gesellschaft (Positive Kritik der materialistischen Geschichtsauffassung)“ angekündigt, vgl. Öffentliche Vorlesungen an der k.k. Universität zu Wien im Sommer-Semester 1918. – Wien: Adolf Holzhausen 1918, S. 10.
44
und bricht damit monokausale Zuordnungen von bestimmten Wirtschaftsordnungen zu bestimmten Herrschaftssystemen auf, wie dies durch den Marxismus, aber auch die nationalökonomischen Theorien der Wirtschaftsstufen nahegelegt wurde. Vgl. unten, S. 127–129.
45
Methodisch war dieses Verfahren nur möglich durch einen Vergleich der Strukturformen. Vgl. die direkte Anspielung auf marxistische Theorien, unten, S. 419 mit Anm. 2.
Die Strukturformen der Herrschaft bestimmt Max Weber zunächst – wie er in dem Einleitungstext zur „Herrschaftssoziologie“ schreibt – „durch die allgemeine Eigenart der Beziehung des oder der Herren zu dem Apparat und beider zu den Beherrschten und weiterhin durch die ihr spezifischen Prinzipien der ‚Organisation‘“.
46
Ein wesentlicher Teil der Ausführungen dreht sich also um die Darstellung der verschiedenen Herrschaftsformen und ihrer Organisationsprinzipien oder – anders formuliert – um die Frage: Wie funktioniert Herrschaft? Vgl. unten, S. 146.
47
Max Weber beginnt mit der systematischen Beschreibung der in seiner Gegenwart bedeutsamsten Form, der bürokratischen Herrschaftsstruktur, und faßt sie als ein Organisationsprinzip, das nicht nur in staatlichen Verwaltungen, sondern auch im Heerwesen, [72]den Kirchen, den Massenparteien und modernen Großbetrieben wirksam ist. „Bürokratische Herrschaft“ ist somit nicht nur eine politische, sondern auch eine soziale Strukturform der Herrschaft. Er bestimmt diese Form der Herrschaftsorganisation als rationalen Typus der Verwaltung und besitzt so ein heuristisches Mittel, mit dem er die älteren vor- oder halbbürokratischen Strukturformen (patriarchale, präbendale, patrimoniale, feudale und charismatische, aber auch theokratische bzw. hierokratische Formen) vergleichend analysieren kann. Vgl. unten, S. 491.
48
Dementsprechend finden sich ausführlichere Vergleiche mit der bürokratischen Herrschaftsstruktur in den Texten „Patrimonialismus“, „Feudalismus“, „Charismatismus“ und „Umbildung des Charisma“.[72] Vgl. dazu insbes. unten, S. 228 f. und S. 233 f. („rationale bürokratische Herrschaftsstruktur“).
49
Für die Niederschrift aller dieser, auf Vergleich beruhenden Passagen ist der „Bürokratismus“-Text deshalb eine conditio sine qua non. Das von Max Weber gewählte, die Idealtypenbildung zugrunde legende komparatistische Verfahren durchbricht zugleich entwicklungshistorische Ansätze. Vgl. die entsprechenden Stellen im Text „Patrimonialismus“, unten, S. 247, 291–294 und 341 ff.
N
; im Text „Feudalismus“, unten, S. 402–407; im Text „Charismatismus“, unten, S. 460–462 und im Text „Umbildung des Charisma“, unten, S. 481–484. Verweisangabe der MWG-Druckfassung „712 f.“ in MWG digital korrigiert; es handelt sich um eine nicht umgestellte Seitenangabe der Erstausgabe.
50
Die „drei Grundtypen der Herrschaftsstruktur“ sind eben – wie er betont – „nicht einfach hintereinander in eine Entwicklungslinie“ zu stellen. Weber versucht an einigen Stellen (unten, S. 234 und 413) linearen Entwicklungsvorstellungen entgegenzuwirken.
51
Vgl. unten, S. 513.
Die Strukturmerkmale der bürokratischen Organisation fallen – wie im „Bürokratismus“-Text angeführt – mit denen des modernen Kapitalismus zusammen, d. h. hier überschneiden sich die Prinzipien der politisch-gesellschaftlichen mit denen der wirtschaftlichen Organisation.
52
Kaum trennbar von beidem sind die Prinzipien der Rechtsordnung, die sich durch Unpersönlichkeit, Sachlichkeit und formale Berechenbarkeit auszeichnet. Exemplarisch untersucht Max Weber die kulturellen Bedingungen und Auswirkungen der Herrschaftsstruktur nicht – wie sonst – am Beispiel der Religion als einer für die Lebensführung besonders prägenden Kultursphäre, sondern an dem der Erziehung. Diese stellt dem bürokratischen Herrschaftsapparat speziell ausgebildete Beamte und Juristen zur Verfügung und fördert damit das kultur- und seelenlose Berufs- und Fachmenschentum, wie es am Ende der „Protestantischen Ethik“ in düsteren Farben beschrieben wird. Zur marxistisch geprägten Sichtweise vgl. oben, S. 31.
53
Die Erziehung wirkt selbstverständlich nicht [73]nur auf die Herrschaftsstruktur, sondern insbesondere auf die Wirtschaftsstruktur, je nach dem, welche Art von Wirtschaftsgesinnung sie erzeugt oder ablehnt. Ebenso, wie die Rechtsordnung nicht nur auf die Herrschafts-, sondern auch auf die Wirtschaftsordnung und die Erziehung Einfluß nimmt und umgekehrt. Zwischen den einzelnen Bereichen und Kultursphären gibt es folglich vielschichtige Wechselwirkungen. Zusätzlich geht Max Weber im „Bürokratismus“-Text auf das spannungsreiche Verhältnis von bürokratischer Verwaltung und moderner Demokratie ein. Zusammengefaßt behandelt der „Bürokratismus“-Text in idealtypischer Weise die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Voraussetzungen sowie Folgewirkungen der bürokratischen Herrschaft und ist daher unter dem Aspekt der Gesamtkonzeption von „Wirtschaft und Gesellschaft“ als einer seiner Kerntexte zu betrachten. Vgl. Weber, Protestantische Ethik II, S. 107–109.
Bei der Darstellung der nicht- bzw. halbbürokratischen Herrschaftsformen bezieht sich Max Weber auf die Bereiche Wirtschaft, Recht und Erziehung. Direkt oder indirekt fragt er bei der Behandlung jeder einzelnen Strukturform der Herrschaft: Wie bestimmt sich das jeweilige Verhältnis der Herrschaftsstruktur zur bürokratischen Verwaltung, das der Rechtsordnung zum rationalen Recht, das der Wirtschaftsordnung zum modernen Kapitalismus und das der Erziehung zum modernen Fachmenschentum? Anders formuliert lautet die übergreifende Frage: Wie rational sind die jeweiligen Herrschafts-, Wirtschafts-, Rechtsordnungen und ihre Erziehungssysteme? Und wie verhalten sie sich zueinander? Der Rationalitätstypus ist somit der nicht immer deutlich zutage tretende Vergleichsmaßstab der Untersuchung. Während Max Weber für den Bereich der charismatischen Herrschaft bereits zu eigenen typologischen Bezeichnungen kommt, d. h. von charismatischer Justiz und charismatischer Erziehung spricht,
54
fehlt eine solche übergeordnete Bezeichnung für den Bereich der später sogenannten „traditionalen Herrschaft“. Patrimoniale, ständische und feudale Herrschaftsformen erscheinen ihm noch zu unterschiedlich, so daß er von patrimonialer bzw. ständischer Rechtsprechung oder von ritterlich-ständischer und konfuzianischer Erziehung spricht.[73] Vgl. unten, S. 468 f. und 530–534; zu der systematischen Verklammerung von Herrschafts- und Erziehungstypen vgl. Flitner, Elisabeth, Grundmuster und Varianten von Erziehung in modernen Gesellschaften. Eine erziehungswissenschaftliche Lektüre der herrschafts- und religionssoziologischen Schriften Max Webers, in: Hanke/Mommsen, S. 265–281.
55
Möglicherweise ist gerade diese fehlende systematische Zusammenschau der traditionellen Herrschaftsformen ein wichtiges Indiz für die [74]nicht abgeschlossene Überarbeitung der beiden Texte „Patrimonialismus“ und „Feudalismus“. Vgl. unten, S. 233, 417 f., 447 f. und 534.
Für das Unabgeschlossene der älteren Fassung der „Herrschaftssoziologie“ spricht auch, daß die Legitimitätsfrage nicht für alle Herrschaftsformen gleichermaßen gestellt und behandelt wird. Ihre Berücksichtigung fehlt in den Texten „Bürokratismus“ und „Patrimonialismus“. Bei der Bürokratie und der Patrimonialbürokratie steht die Frage nach dem technischen Funktionieren der Verwaltungen im Vordergrund,
56
der Legitimitätstypus der rational-legalen Herrschaft tritt nicht in Erscheinung. Das Legitimitätsthema wird hingegen im Zusammenhang mit der feudalen Herrschaft aufgeworfen, wo es um die Legitimität von Lehen geht,[74] Vgl. z. B. unten, S. 185, 207–210, 284 f. und 321–324.
57
und im Zusammenhang mit dem patriarchalen Patrimonialismus, wo die Legitimität der Herrschaft durch die Theorie des Wohlfahrtsstaates erzeugt werde. Vgl. unten, S. 397 und 410.
58
Sehr intensiv behandelt Weber die Legitimitätsfrage hingegen in den Texten zur charismatischen Herrschaft. Da hier im ursprünglichen Stadium eine stabile äußere Organisation fehlt, sind die inneren Bindungskräfte um so wichtiger für den Erhalt der Herrschaft. Es geht vor allem um den Glauben der Beherrschten an die Rechtmäßigkeit des Herrschers, der von ihm erlassenen Regeln und des von ihm okkupierten Besitzes. Die Herrscher des Altertums ließen sich daher – wie Weber bereits in den „Agrarverhältnissen im Altertum“ anführte Vgl. unten, S. 450.
59
– von den Göttern oder von den Priestern in ihrem Amt bestätigen, um ihrer Herrschaft Legitimität zu verleihen. Man kann fast von einem Legitimitätsüberschuß sprechen, den die Religionen und Priester der politischen Gewalt zur Verfügung stellen. Politik und Religion sind deshalb in vormodernen Zeiten eng aufeinander angewiesen, wobei das Verhältnis zwischen beiden Sphären zunehmend komplizierter und sublimer wird, wie Max Weber eingehend in dem Text „Staat und Hierokratie“ dokumentiert. Zwischen dem Organisationsgrad und dem Legitimitätsbedarf eines Herrschaftssystems besteht somit eine direkte Korrelation: je höher der Organisationsgrad eines Herrschaftssystems, desto mehr tritt die Legitimitätsfrage in den Hintergrund. Bei Systemen mit niedrigem Organisationsgrad ist sie jedoch für die Stabilisierung der Herrschaft von entscheidender Bedeutung. Max Weber wirft aus diesem Grund gerade bei den nicht-rationalen Herrschaftsformen die Frage nach [75]deren Stabilität bzw. Labilität auf, Vgl. Weber, Agrarverhältnisse3, S. 74 (Mesopotamien), S. 93 (Israel), S. 97 (Hellas), S. 111 (Orient).
60
während die Bürokratie ja seiner Ansicht nach, wenn sie erst einmal etabliert ist, zu den „am schwersten zu zertrümmernden sozialen Gebilden“ gehört.[75] Daher stellte Max Weber auch die Frage, inwieweit die Wirtschaftsordnung stabilisierend auf die Herrschafts- und Verwaltungsstruktur wirken könne, vgl. dazu unten, S. 440–442.
61
Vgl. unten, S. 208.
2. Die „Herrschaftssoziologie“ im Kontext der älteren Fassung von „Wirtschaft und Gesellschaft“
Nach den beiden überlieferten Plänen zum „Handbuch der politischen Ökonomie“ (1910) bzw. zum „Grundriß der Sozialökonomik“ (1914) steht die Behandlung des Staates bzw. der Herrschaft jeweils am Ende der Stoffgliederung, einmal in der Sequenz der sozialen Gruppen und später sogar als Gipfelpunkt des gesamten Beitrags „Wirtschaft und Gesellschaft“.
1
Auch im Silvesterbrief 1913 enden die Mitteilungen über den Handbuch-Beitrag mit der „Staats- und Herrschafts-Lehre“. Vgl. den Stoffverteilungsplan für das „Handbuch der politischen Ökonomie“ vom Mai 1910, VA Mohr/Siebeck, Deponat BSB München, Ana 446 (MWG I/22-6 [[MWG I/24]]); dass., in: MWG II/6, S. 768, und Einteilung des Gesamtwerkes, in: GdS1 Abt. I, 1914, S. XI (MWG I/22-6 [[MWG I/24]]).
2
Diese Äußerungen Max Webers vermitteln den Eindruck, daß die anderen Texte quasi auf die Staats- bzw. Herrschaftssoziologie zulaufen. Ob dies beim überlieferten Textbestand zu „Wirtschaft und Gesellschaft“ und zu verschiedenen Zeitpunkten der Manuskriptabfassung und -bearbeitung der Fall war, soll im folgenden kurz untersucht werden. Vgl. oben, S. 3.
Die von der Max Weber-Gesamtausgabe unter dem Obertitel „Gemeinschaften“ edierten Texte gehen in unterschiedlicher Weise auf das Herrschaftsthema ein. Bei der Darstellung der Hausgemeinschaften spielt die patriarchale, urwüchsige Form der Hausherrschaft naturgemäß eine wichtige Rolle. Hier ist das „Haus“ Träger des religiös-magischen, rechtlichen, ökonomischen und politisch-sozialen Lebens. Seine Behandlung fällt aber nur dann unter die „Kategorie der ,Herrschaft‘“,
3
wenn das Hausherrschaftsprinzip konstitutiv für die Struktur des politischen Verbandes ist. An den Stellen, wo es um die mögliche Weiterentwicklung der Hausherrschaft geht, verweist Max Weber daher auf die „Analyse der Herrschaftsformen“. Weber, Hausgemeinschaften, MWG I/22-1, S. 114 mit Anm. 2.
4
Der „Herrschaftssoziologie“ stehen – wie Wolfgang J. Momm[76]sen sagt Vgl. ebd., S. 161 mit Anm. 92 oder S. 151 mit Anm. 68.
5
– die Ausführungen im Text „Politische Gemeinschaften“ am nächsten.[76] Vgl. den Editorischen Bericht zu „Politische Gemeinschaften“, MWG I/22-1, S. 201.
6
Hier wird mithilfe der Terminologie des Kategorienaufsatzes der logisch notwendige Entwicklungsschritt von den politischen Gemeinschaften zu den politischen Verbänden beschrieben. Die Bildung des politischen Verbandes zeichnet sich durch Gebietsherrschaft, Rechtsmonopolisierung sowie Monopolisierung der inneren und äußeren Gewaltausübung aus. Der politische Verband wird – so Weber – zum Träger der „legitime[n] Gewaltsamkeit“. Vgl. Weber, Politische Gemeinschaften, MWG I/22-1, S. 200–215.
7
Hier benennt Max Weber in kompakter Form die entwicklungstheoretischen Voraussetzungen für die nachfolgende Behandlung der politischen Herrschaftsformen. Die zweite Seite der Herrschaftslehre – die Behandlung der sozialen Strukturformen – wird durch die Schlußpassage des Textes „,Klassen‘, ,Stände‘ und ‚Parteien‘“ angekündigt. Vgl. ebd., S. 215.
8
Bei den Ausführungen über die Parteien, als einem wichtigen Phänomen sozialer Machtverteilung, geht es um deren Struktur innerhalb bereits bestehender vergesellschafteter politischer Verbände, d. h. von Verbänden mit rationaler Satzung und rationaler Verwaltung. Diese geben den äußeren Rahmen für die Parteienbildung ab. Aus diesem Grund unterbricht Weber die Darstellung der Parteien, da er ohne Erläuterung der verschiedenen, den politischen Verband prägenden Herrschaftsstrukturen nichts Genaues zur Struktur der Parteien sagen kann. Dies ist das Thema der nicht eingelösten Parteiensoziologie, wie sie in der „Grundriß“-Einteilung 1914 als Punkt 8e) angegeben ist. Weber, „Klassen“, „Stände“ und „Parteien“, MWG I/22-1, S. 270.
9
In den überlieferten Texten zur „Herrschaftssoziologie“ werden die Parteien dementsprechend nur am Rande mitbehandelt und zwar im Zusammenhang mit der Bürokratisierung und der charismatischen (Partei-)Führerschaft.“Vgl. Einteilung des Gesamtwerkes, in: GdS1 Abt. I, 1914, S. XI (MWG I/22-6) [[MWG I/24, S. 169]].
10
Vgl. unten, S. 181 f., 202 f., bes. aber S. 502–513.
Die Editoren der Religiösen Gemeinschaften weisen die philologischen und thematischen Verknüpfungen zur „Herrschaftssoziologie“ im Editorischen Bericht und in den Sacherläuterungen bereits detailliert nach.
11
An mehreren Stellen verweist Max Weber pauschal auf die Ausführungen der „Herrschaftssoziologie“. Vgl. den Editorischen Bericht, in MWG I/22-2, S. 96–99, sowie die tabellarische Übersicht über die Verweisstruktur, ebd., S. 117; zu thematischen Parallelitäten vgl. ebd., S. 110, Anm. 32, sowie die Sacherläuterungen z. B. auf S. 235, Anm. 47 und S. 311, Anm. 82.
12
Es verwundert nicht, daß die dichtesten Ver[77]weisbeziehungen zu den thematisch verwandten Textteilen der „Herrschaftssoziologie“ bestehen, also den Texten „Umbildung des Charisma“ Vgl. Weber, Religiöse Gemeinschaften, MWG I/22-2, S. 159 mit Anm. 76, S. 194 mit Anm. 53, S. 199 mit Anm. 61, S. 396 mit Anm. 52, und S. 441 mit Anm. 42.
13
und „Staat und Hierokratie“,[77] Vgl. dazu den Editorischen Bericht zum Text „Umbildung des Charisma“, unten, S. 477.
14
aber auch zu der den modernen Kapitalismus systematisch behandelnden Passage des Textes „Feudalismus“. Vgl. dazu unten, Anm. 16.
15
Auffällig ist, daß sich acht Verweise aus dem Bestand der „Religiösen Gemeinschaften“ auf den Text „Staat und Hierokratie“ beziehen, während es umgekehrt nur einen Verweis gibt. Vgl. den Editorischen Bericht zum Text „Feudalismus“, unten, S. 376.
16
Dieses Zahlenverhältnis spricht dafür, daß der Text „Staat und Hierokratie“ der ältere von beiden ist und daher gezielt auf ihn verwiesen werden konnte. Durch zwei Hinweise auf die Behandlung des außerokzidentalen Mönchtums wissen wir, daß die im Original überlieferten und wohl nachträglich in den Text „Staat und Hierokratie“ eingefügten Seiten bereits bei der Niederschrift der „Religiösen Gemeinschaften“ vorgelegen haben müssen. Vgl. dazu die Einzelnachweise im Editorischen Bericht zum Text „Staat und Hierokratie“, unten, S. 570 f.
17
Die Verweisstruktur gibt in diesem Fall sogar eine wichtige Hilfestellung zur Beantwortung der Frage, ob der Text „Staat und Hierokratie“ eventuell durch die umfangreichere Behandlung des Gegenstandes in den „Religiösen Gemeinschaften“ hätte abgelöst werden sollen. Dagegen spricht zunächst, daß die Verweise aus den „Religiösen Gemeinschaften“ auf eine bewußte Einbindung des älteren Textes „Staat und Hierokratie“ in den Textbestand von 1913/14 schließen lassen. Dieselbe Absicht wird in der Disposition zum „Grundriß der Sozialökonomik“ im Frühjahr 1914 bekundet, wo beide Texte getrennt aufgeführt werden. Vgl. ebd., S. 283 mit Anm. 43, und S. 339 mit Anm. 32, die sich beide auf die Manuskriptseiten, unten, S. 595–599 und 599–602, beziehen.
18
Während die „Religiösen Gemeinschaften“ den inneren Entwicklungsgang der religiösen Vergemeinschaftung verfolgen und die organisatorisch-institutionelle Seite kaum in Betracht ziehen, geht es im Text „Staat und Hierokratie“ sehr wohl um den Aspekt der Institutionalisierung, vor allem aber um das spannungsreiche Verhältnis von „imperium und sacerdotium“. Vgl. den Abschnitt 5. „Religiöse Gemeinschaften“ und den Abschnitt 8b. „Politische und hierokratische Herrschaft“, Einteilung des Gesamtwerkes, in: GdS1 Abt. I, 1914, S. XI (MWG I/22-6) [[MWG I/24, S. 169]].
19
Mit der Bemerkung: „Die Beziehungen zwischen politischer Gewalt und religiöser Gemeinde […] gehö[78]ren in die Analyse der ,Herrschaft‘“ Vgl. unten, S. 532.
20
weist Weber expressis verbis auf diese unterschiedliche Akzentuierung der beiden Textbestände hin. [78] Weber, Religiöse Gemeinschaften, MWG I/22-2, S. 199.
Die systematische Bedeutung der „Stadt“ für die „Herrschaftssoziologie“ ist bereits angesprochen worden.
21
Sie stellt – wie die „Grundriß“-Disposition von 1914 und der Bericht über den Vortrag von 1917 nahelegen Vgl. dazu oben, S. 22 f.
22
– das Verbindungsglied zur nicht überlieferten Darstellung der modernen Verfassungsgeschichte dar und hätte die Besonderheit der okzidentalen Entwicklung (Verbandsgründung durch Schwureinung oder Verbrüderung) verdeutlichen können. „Die Stadt“ ist jedoch nicht in der Form überliefert, daß sie als der 1914 angekündigte Unterabschnitt zur „Herrschaftssoziologie“ gelesen werden könnte. Vgl. Einteilung des Gesamtwerkes, in: GdS1 Abt. I, 1914, S. XI (MWG I/22-6 [[MWG I/24]]), und Weber, Probleme der Staatssoziologie, unten, S. 755 f.
23
Schon Marianne Weber und Melchior Palyi hatten offensichtlich Schwierigkeiten, die „Stadt“ im nachgelassenen Konvolut von „Wirtschaft und Gesellschaft“ zu positionieren, und behandelten sie nicht als einen der „Herrschaftssoziologie“ zugehörigen Textbestand. Vgl. dazu die Bemerkungen des Bandherausgebers Wilfried Nippel, oben, S. 69 mit Anm. 37.
24
Obwohl in der „Stadt“ einige der in der „Herrschaftssoziologie“ präzisierten Ausdrücke, wie z. B. „Amts“- und „Gentilcharisma“, „Patrimonialismus“ oder „Patrimonialbürokratie“, verwendet werden, Vgl. die Anordnung in der Erstausgabe von „Wirtschaft und Gesellschaft“ (WuG1, S. 513–600) vor der „Herrschaftssoziologie“ (ebd., S. 603 ff.). Die entsprechenden Vorausverweise auf in der „Stadt“-Studie behandelte Sachverhalte (z. B. unten, S. 344 mit Anm. 65, S. 360 mit Anm. 14, sowie S. 383 mit Anm. 13, S. 417 mit Anm. 97) hätten dann die falsche Verweisrichtung. Vgl. dazu auch Orihara, Hiroshi, Über den „Abschied“ hinaus zu einer Rekonstruktion von Max Webers Werk: „Wirtschaft und Gesellschaft“, 3 Teile, in: University of Tokyo, Department of Social and International Relations, Working Papers, No. 30, Nov. 1992, No. 36, June 1993, No. 47, June 1994 (hinfort: Orihara I–III), hier: Orihara II, S. 107 f.
25
gilt dies nicht für den Herrschaftsbegriff. Er wird in ganz traditioneller Weise gebraucht, der spezifische Bedeutungsgehalt fehlt und damit auch eine an der soziologischen Kategorie ausgerichtete Behandlung der verschiedenen Stadttypen. Eine pauschale Referenz auf die „Herrschaftssoziologie“ gibt es nicht. Dennoch besteht im Vergleich zu allen anderen Texten der Vorkriegsfassung von „Wirtschaft und Gesellschaft“ zwischen dem Textbestand der „Herrschaftssoziologie“ und dem der „Stadt“ über[79]haupt die engste philologisch belegbare Verbindung: So führt der einzige eindeutig aufzulösende Verweis aus dem überlieferten Gesamtbestand von „Wirtschaft und Gesellschaft“ vom Text „Patrimonialismus“ zur „Stadt“-Studie. Vgl. Weber, Die Stadt, MWG I/22-5, z. B. S. 174, 177, 219 (zum Amts- und Gentilcharisma) und z. B. S. 239 f. und 242 f. (zur Patrimonialbürokratie) und S. 132, 189 und 243 (zum Patrimonialismus), sowie die Editorischen Berichte zum Text „Umbildung des Charisma“ und „Patrimonialismus“, unten, S. 475 und 240 f.
26
Die patrimonialistische Herrschaft, wie sie sich seit der frühen Neuzeit auf dem europäischen Kontinent in Form des Patrimonialbürokratismus etablierte, wird in der „Stadt“ von Max Weber als gegenläufige Entwicklung zur englischen Verwaltungsorganisation betrachtet.[79] Vgl. unten, S. 360 mit Anm. 14, sowie die Aussage im Editorischen Bericht zu Weber, Die Stadt, MWG I/22-5, S. 47; nicht so eindeutig läßt sich ein weiterer Verweis über das Mittel der Städtegründung in der „Stadt“-Studie auflösen, vgl. unten, S. 344 mit Anm. 65.
27
Die Ausführungen über den Patrimonialismus bilden daher ein Gegenstück zu den dortigen Darlegungen, was auf eine – zumindest partiell – gemeinsame Textgenese hindeutet. Dies legt auch der Hinweis auf den „stadtherrschaftlichen Feudalismus“ nahe, der in der „Herrschaftssoziologie“ nicht behandelt wird, dafür aber bei den Ausführungen zur antiken Polis in der „Stadt“ eine Rolle spielt. Vgl. Weber, Die Stadt, MWG I/22-5, S. 235–243.
28
Vgl. unten, S. 385 mit Anm. 19.
Der Zusammenhang zwischen der „Rechtssoziologie“ und der „Herrschaftssoziologie“ ist nicht nur aus konzeptionellen Gründen aufschlußreich, sondern insbesondere wegen der überlieferten Originalmanuskripte zu dem Text „Die Wirtschaft und die Ordnungen“ sowie zu den Paragraphen 1 bis 7 der „Rechtssoziologie“, die gemeinsam im Teilband I/22-3 „Recht“ ediert werden. Dieses Manuskriptkonvolut zeichnet sich durch drei deutlich voneinander abgrenzbare Schreibmaschinenschriften sowie handschriftliche Überarbeitungen und Zusatzblätter aus. Über die Details wird die Edition des entsprechenden Bandes informieren. Hier geht es speziell um den Zusammenhang mit der „Herrschaftssoziologie“. Auffällig ist zunächst, daß sich Hinweise auf die „Besprechung der Herrschaft“ in allen Textschichten der überlieferten „Recht“-Originalmanuskripte finden. Das ist bedeutsam, weil der inhaltliche Aufbau der vermutlich ältesten schreibmaschinenschriftlichen Fassung, die in der überlieferten Manuskriptabfolge den Text „Die Wirtschaft und die Ordnungen“ durchzieht und teilweise in die §§ 1 und 3 „Recht“ eingearbeitet worden ist,
29
dem im Stoffverteilungsplan 1910 angekündigten Kapitel 4a) „Wirtschaft und Recht (1. prinzipielles Verhältnis, 2. Epochen der Entwicklung des heuti[80]gen Zustands)" entspricht. Vgl. Weber, Die Wirtschaft und die Ordnungen, S. 1–16, 19 (WuG1, S. 368–385), und Weber, Recht § 1, S. 7–13 (WuG1, S. 392–396) und ders., Recht § 3, S. 1–4 (WuG1 S. 396–401).
30
Im ersten Teil des Typoskripts (d. h. der Schreibmaschinenfassung ohne die handschriftlichen Zusätze) zu „Die Wirtschaft und die Ordnungen“ behandelt Max Weber systematisch den Zusammenhang von Wirtschafts-, Rechts- und staatlicher Ordnung. Im zweiten Teil skizziert er die wichtigsten Schritte der Rechtsentwicklung bezogen auf das Privat- und Zivilprozeßrecht, klammert aber die Behandlung des heute sogenannten öffentlichen Rechts aus und weist diese der „Besprechung der Herrschaft“ zu.[80] Stoffverteilungsplan für das „Handbuch der politischen Ökonomie“ vom Mai 1910, VA Mohr/Siebeck, Deponat BSB München, Ana 446 (MWG I/22-6 [[MWG I/24]]), vgl. MWG II/6, S. 768.
31
Aufgabe der Herrschaftslehre soll, wie Weber angibt, fernerhin sein, das Verhältnis des „imperium“ – hier als Sammelbegriff für die nicht-innerhäuslichen Gewalten eingeführt Vgl. Weber, Recht § 1, S. 9 (WuG1, S. 393).
32
– zu Regeln aller Art darzustellen, einmal die Bindung der Herrschergewalt an sie, aber auch deren Beschränkung durch anderweitige Regeln (d. h. „heteronome Ordnungen“). Ebd., S. 7 (WuG1, S. 392).
33
Dieser frühe Manuskriptbestand, der – auch wegen der auffälligen und intensiven Auseinandersetzung mit Rudolf Stammler – vermutlich schon 1912 oder früher niedergeschrieben wurde, gibt uns zwei wichtige Informationen: 1) eine „Erörterung der Herrschaft“ war schon zu diesem frühen Zeitpunkt vorgesehen, Vgl. unten, S. 248–251.
34
2) sollte diese die „Art der Struktur des politischen Verbandes“ Zu diesem frühen Zeitpunkt wahrscheinlich ohne den präzisierten Herrschaftsbegriff; vgl. dazu oben, S. 67.
35
mit Referenz auf die Wirtschafts- und Rechtsentwicklung behandeln und den Schwerpunkt auf die Besonderheiten der okzidentalen Entwicklung legen. Diese Schreibabsicht wird durch einen Verweis Webers in der frühen Typoskriptschicht gestützt, der auf die spätere Erörterung der Gewaltenteilung „im ständischen politischen Gebilde und in der bureaukratischen Organisation“ hinwies. Vgl. Weber, Recht § 1, S. 10 f. (WuG1, S. 394).
36
An dieser Stelle erweitert bzw. präzisiert er bei der handschriftlichen Überarbeitung das Spektrum der zu behandelnden Herrschaftsformen um die patrimonialen und feudalen politischen Gebilde. Auffällig ist, daß Weber in der Frühfassung des Rechtsmanuskripts noch nicht auf das Problem der Legitimität von Herrschaft eingeht Ebd., S. 8 (WuG1 S. 393).
37
und den Charisma-Be[81]griff noch nicht zur Beschreibung von nicht-rationalen Prozessen der Rechtsfindung und Rechtsschöpfung verwendet. Nur an einer Stelle geht es um die Abgrenzung der Legitimität der Befehlsgewalten der verschiedenen Imperium-Träger untereinander, vgl. Recht § 1, S. 8 (WuG1 S. 393). Ebd., S. 7 (WuG1 S. 392). Die späteren Bemerkungen zur Legitimität zielen einerseits auf die Legitimität einzelner Befehle im Gegensatz zur legitimierenden Norm (vgl. Weber, Recht § 3, S. 6; WuG1, S. 404) und andererseits auf die Legitimierung erworbener [81]Rechte (z. B. Weber, Recht § 7, S. 15 f.; WuG1, S. 498) ab. Der herrschaftssoziologischen Konzeption entspricht am meisten eine Aussage in der handschriftlichen Überarbeitung zur zweiten Typoskriptschicht, daß die Legitimität von patrimonialen Häuptlingen und Fürsten auf „als heilig geltenden Traditionsnormen“ beruhe (vgl. Weber, Recht § 6, S. 4; WuG1, S. 486). Insgesamt findet sich aber nicht der im Kategorienaufsatz formulierte Gedanke des Legitimitäts- bzw. Herrschaftseinverständnisses.
Das ändert sich in der zweiten Schreibmaschinenschicht, dort wird vor allem in Recht § 2 die charismatische Offenbarung neuer Rechtsregeln beschrieben. Die revolutionierende, schöpferische und legitimitätsstiftende Funktion des Charisma tritt nun auf.
38
Dies entspricht den Ausführungen, die sich in der „Herrschaftssoziologie“ in dem abgebrochenen Text „Charismatismus“, in den Texten „Umbildung des Charisma“ und „Erhaltung des Charisma“ sowie am Anfang des Textes „Staat und Hierokratie“ finden. Vgl. die Passage in Weber, Recht § 3, S. 5–16 (WuG1, S. 402–411), bes. aber S. 5–8 (WuG1, S. 402–405), dort auch schon der Satz in der Typoskriptfassung: „Die Rechtsoffenbarung in diesen Formen ist das revolutionierende Element gegenüber der Stabilität der Tradition.“ (ebd., S. 5; WuG1, S. 402).
39
Für die nicht-rationalen, vorbürokratischen Formen der Rechtsfindung und Rechtsschöpfung führt Max Weber in der „Herrschaftssoziologie“ den Begriff der „‚charismatischen‘ Justiz“ ein Vgl. den Text „Charismatismus“, unten, S. 467–469, den Text „Umbildung des Charisma“, unten, S. 492, den Text „Erhaltung des Charisma“, unten, S. 559–563, und den Text „Staat und Hierokratie“, unten, S. 579–581.
40
und zwar in einem Rechtsexkurs des „Bürokratismus“-Textes, der die Schritte zur „Bürokratisierung der Rechtspflege“ beschreibt und sich inhaltlich mit den Ausführungen in Recht § 3 überschneidet. Vgl. unten, S. 188, 468 und 634, sowie Weber, Recht § 3, S. 15 (WuG1, S. 410) in der Überarbeitungshandschrift zur zweiten Typoskriptschicht.
41
Auffällig ist, daß Rationalisierungsprozesse in den Bereichen Staat und Recht im „Bürokrattsmus“-Text hauptsächlich unter dem Begriff der „Bürokratisierung“ und nicht der „Rationalisierung“ gefaßt werden. Vgl. dazu den Editorischen Bericht zum Text „Bürokratismus“, unten, S. 153 f.
42
Hinweise auf die beiden Entwicklungsmöglichkeiten patrimonialfürstlicher Rechtspflege Vgl. den Text „Bürokratismus“, unten, S. 187–193 und 228, „Rationalisierung“ nur einmal (ebd., S. 193), sowie Weber, Recht § 2, S. 33 (WuG1, S. 433), in der zweiten Typoskriptschicht heißt es: „Bürokratisierung des Organhandelns der Einverständnisgemeinschaften“, und der Verweis in Weber, Recht § 4, S. 9 (WuG1, S. 466), auf die „allgemeine Wirkung jeder Bürokratisierung der Herrschaft“.
43
(gemeint ist die patriarchal-arbiträre und die ständisch-stereotypierte) weisen aus der zweiten Typoskriptschicht des Rechtsmanuskripts auf Passagen der uns überlieferten Texte „Patrimonialismus“ und „Feudalismus“. Zusammen mit dem [82]Verweis auf die Behandlung der „Machtstellung der Priesterschaft im Verhältnis zur politischen Gewalt“ in Recht § 5, Weber, Recht § 6, S. 3 (WuG1, S. 484).
44
der eindeutig auf das Thema des Textes „Staat und Hierokratie“ hinweist, ergibt sich der Befund, daß anhand der Verweise der mittleren Typoskriptschicht der „Rechtssoziologie“ die Konturen der „Herrschaftssoziologie“, wie sie uns überliefert ist, deutlich werden. Ausführungen zur bürokratischen, patriarchalen, patrimonialen, ständischen und charismatischen Herrschaft müssen dementsprechend bei der Abfassung der Rechts-Texte konzipiert gewesen sein bzw. vorgelegen haben. Zur Rechtsstruktur jeder dieser angeführten Herrschaftsformen finden sich im überlieferten Textbestand der „Herrschaftssoziologie“ kleinere oder umfangreichere Ausführungen.[82] Weber, Recht § 5, S. [1] (WuG1, S. 468).
45
Offen bleibt die Frage, ob die zweite Typoskriptschicht der „Rechtssoziologie“ den Stand zu Beginn des Jahres 1913 widerspiegelt, als Max Weber dem Verleger Paul Siebeck mitteilte, daß sein Beitrag „incl. Staat und Recht“ nahezu fertig sei. Vgl. unten im Text „Bürokratismus“, S. 187–197, im Text „Patrimonialismus“, S. 257–264, 288–290, 309 f. und 315–317, im Text „Feudalismus“, S. 399–406 und 436 f., im Text „Charismatismus“, S. 468 f.
46
Ein Verweis in der handschriftlichen Überarbeitungsschicht auf die „Analyse der ,Herrschaft‘“ (jetzt in Anführungsstrichen), Brief Max Webers an Paul Siebeck vom 23. Jan. 1913, MWG II/8, S. 52.
47
könnte darauf hinweisen, daß „Herrschaft“ – im Gegensatz zu den anderen Verweisformulierungen – nun als präzisierter Begriff bzw. Kategorie gebraucht wird, also die definitorische Arbeit des Kategorienaufsatzes voraussetzt. Weber, Recht § 6, S. 4 (WuG1, S. 486).
48
In der handschriftlichen Überarbeitung, insbesondere deutlich nachvollziehbar in der ersten Typoskriptschicht des Textes „Die Wirtschaft und die Ordnungen“, wird die spezifizierte Terminologie des Kategorienaufsatzes nachgetragen, was darauf hindeutet, daß die Überarbeitung des Konvoluts um die Jahreswende 1912/13 bzw. danach stattgefunden hat. Genaueres dazu in MWG I/22-3.
Vorbehaltlich einer abschließenden Würdigung im Teilband I/22-6
N
, der die verschiedenen Teilbereiche der Edition der nachgelassenen Fassung von „Wirtschaft und Gesellschaft“ in ihrem Zusammenhang darstellen wird, seien hier nur kurz die ins Auge fallenden Unterschiede zwischen der „Rechts“- und „Herrschaftssoziologie“ benannt. Die „Rechtssoziologie“ ist, wie das Manuskript belegt, für den Druck vorbereitet, die verschiedenen Textschichten sind durch Überarbeitung in einen homogenen Zusammenhang gebracht worden, was sich auch inhaltlich in dem die Ausführungen zusammenfassenden § 8 niederschlägt. Der „Herrschaftssoziologie“ fehlt ein solcher Abschluß: inhaltlich, weil die Ausführungen mit der frühen Neuzeit enden und die Entwicklungslinie nicht über die [83]Stadt bis hin zum modernen Anstaltsstaat verfolgt worden ist; formal, weil dort Rückbezüge auf die Ausführungen der „Rechtssoziologie“ fehlen, wo es inhaltlich naheliegen würde und u.U. Verdoppelungen hätten vermieden werden können. Der technisch fortgeschrittenere Zustand der „Rechtssoziologie“ zeigt sich auch daran, daß es wesentlich mehr Verweise auf die „Herrschaftssoziologie“ gibt als umgekehrt. Hinsichtlich der konzeptionellen Abstimmung beider Textbestände bliebe auch die Frage zu klären, weshalb ein in der „Rechtssoziologie“ so exponiert eingeführter Begriff wie „imperium“, der die Essenz der politischen Befehlsgewalt umschreibt, in der „Herrschaftssoziologie“ nicht aufgegriffen und systematisch miteinbezogen worden ist.Jetzt: MWG I/24.
49
[83] Nur an einer Stelle ist ein Verweis zu den „Machtverhältnissen von imperium und sacerdotium“ eingeflochten, vgl. den Text „Umbildung des Charisma“, unten, S. 532.
Tabellarische Übersicht über die Pauschalverweise auf die „Herrschaftssoziologie“ in der älteren Fassung von „Wirtschaft und Gesellschaft“
| Editionsbereich | Verweisformulierung 50 Zum unterschiedlichen Gebrauch von „Herrschaft“ – mit und ohne Anführungszeichen – vgl. oben, S. 67, Anm. 24. | Seitenangaben |
| Gemeinschaften | MWG I/22-1 | |
| Wirtschaftliche Beziehungen der Gemeinschaften im allgemeinen | „Eigenarten der Herrschaftsstruktur“ | S. 106 |
| Hausgemeinschaften | „Kategorie der ‚Herrschaft‘“ | S. 114 |
| „Analyse der ‚Herrschaft‘“ | S. 151 | |
| „Analyse der Herrschaftsformen“ | S. 161 | |
| Politische Gemeinschaften | „Art der Herrschaftsstruktur“ | S. 210 |
| „Klassen“, „Stände“ und „Parteien“ | „Strukturformen der sozialen Herrschaft“ | S. 270 |
| Religiöse Gemeinschaften | MWG I/22-2 | |
| Abschnitt 2 | „bei Erörterung der Herrschaftsformen“ | S. 159 |
| Abschnitt 5 | „Kasuistik der Herrschaftsformen“ | S. 194 |
| „Analyse der ‚Herrschaft‘“ | S. 199 | |
| Abschnitt 11 | „Besprechung der Herrschaftsformen“ | S. 396 |
| Abschnitt 12 | „die inneren Strukturformen der ‚Herrschaft‘“ | S. 441 |
| [84] | ||
| Recht | Mskr./WuG1 | |
| Recht § 1 | „Erörterung der Herrschaft“ [Type 1] 51 [84] Hinweis auf die Schreibmaschinentypen, die hier aufgrund ihrer Schichtung im Manuskript als 1, 2 und 3 bezeichnet worden sind. Scheibmaschinentype 1 ist wohl als die älteste, während Type 3 als eine Abschrift älterer Manuskriptteile zu betrachten ist. Findet sich der Verweis in einer handschriftlichen Überarbeitung, so ist dies mit „Überarb.“ vermerkt. | S. 7/S. 392 |
| „bei Besprechung der Herrschaft“ [Type 1] | S. 9/S. 393 | |
| Recht § 4 | „Bürokratisierung der Herrschaft“ [Type 2] | S. 9/S. 466 |
| Recht § 5 | „Analyse der Herrschaftsformen“ [Type 2 + Überarb.] | S. 1/S. 467 |
| „Bedingungen der Herrschaftsstrukturen“ [Type 2 + Überarb.] | S. 2/S. 468 | |
| Recht § 6 | „Erörterung der Herrschaftsformen“ [Type 2] | S. 1/S. 482 |
| „Analyse der ‚Herrschaft‘“ [handschriftl. Überarb.] | S. 4/S. 486 | |
| Recht § 8 | „Besprechung der politischen Herrschaft“ | –/S. 504 |
| „Verschiedenheiten der allgemeinen Herrschaftsstruktur“ | –/S. 508 | |
| Die Stadt | keine | MWG I/22-5 |
3. Die Weiterentwicklung nach 1914 – Schritte zur jüngeren Fassung
Den Anspruch einer Typologie der Herrschaft, wie er in der Disposition zum „Grundriß der Sozialökonomik“ von 1914 angekündigt ist, erfüllt erstmalig ein kurzer Abriß, der zuerst – in Petitdruck gesetzt und quasi als Anhang zur Einleitung – in der ersten Folge der Aufsätze zur „Wirtschaftsethik der Weltreligionen“ im Oktober 1915 erschienen ist.
52
Max Weber sandte im Sommer das Manuskript sowie Zusatzblätter zur Einleitung an den Verlag. Vgl. Weber, Einleitung, S. 28–30 (MWG I/19, S. 119–127).
53
Es ist eine bislang unentschiedene Kontroverse, ob die Einleitung ebenfalls, [85]wie der Haupttextbestand zum Konfuzianismus, bereits 1913 geschrieben worden ist oder ob sie erst im Zuge der Veröffentlichung im „Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik“ entworfen wurde. Vgl. die Briefe Max Webers an Paul Siebeck, vor dem 2. Juli und am 14. Juli 1915, VA Mohr/Siebeck, Deponat BSB München, Ana 446 (MWG II/9).
54
Vieles spricht dafür, daß die herrschaftssoziologische Passage eigens für den religionssoziologischen Zusammenhang verfaßt wurde. Im Unterschied zu den überlieferten Texten zur „Herrschaftssoziologie“ beginnt Max Weber hier mit der „charismatischen Autorität“, während der „rationale Typus der Herrschaft“ erst an dritter Stelle nach der auf Tradition gegründeten Herrschaft („traditionalistische Autorität“) angeführt wird.[85] Vgl. dazu Schluchter, Wolfgang, Religion und Lebensführung, Band 2: Studien zu Max Webers Religions- und Herrschaftssoziologie. – Frankfurt am Main: Suhrkamp 1988, S. 584.
55
Ebenfalls passend zur religionssoziologischen Fragestellung rückt hier die systematische Trennung in alltägliche bzw. außeralltägliche Herrschaftsformen in den Vordergrund. Wichtig für die weitere Entwicklung der Herrschaftstypologie sind an diesem kurzen Text – im Erstdruck von 1915 füllt er kaum zwei Textseiten – die Verknüpfung des Legitimitäts- mit dem Legalitätsaspekt bei der rationalen Herrschaft sowie der Hinweis auf die methodische Bedeutung und die Grenzen der Typenbildung: „Hier sei nur betont: daß sie mitnichten den Anspruch erhebt, die einzig mögliche zu sein, noch vollends: daß alle empirischen Herrschaftsgebilde einem dieser Typen ,rein‘ entsprechen müßten. […] Die angegebene Terminologie will also nicht die unendliche Mannigfaltigkeit des Historischen schematisch vergewaltigen, sondern sie möchte nur für bestimmte Zwecke brauchbare begriffliche Orientierungspunkte schaffen.“ Vgl. Weber, Einleitung, S. 28 f. (MWG I/19, S. 120 f., 124 mit textkritischer Anm. h).
56
Dies kann auch durch Wortneubildungen, wie z. B. „Patrimonialbürokratie“, geschehen, Ebd., S. 29 f. (MWG I/19, S. 125 f.).
57
die zur Erfassung der Misch- und Übergangsformen erforderlich sind. Schließlich folgt am Ende des Textes der kurze Hinweis auf die systematische Erörterung der Herrschaftstypologie im Zusammenhang mit der Wirtschaft „an anderer Stelle“, Ebd., S. 29 (MWG I/19, S. 125).
58
das heißt wohl im „Grundriß“-Beitrag „Wirtschaft und Gesellschaft“. Der Text markiert zuverlässig den konzeptionellen Stand von Webers herrschaftssoziologischen Forschungen 1914/15. Auffällig ist, daß die Herrschaftstypen zwar fixiert sind, ihnen aber immer noch das spezifische Vokabular der „legalen“ und „traditionalen“ Herrschaft fehlt. Ebd., S. 30 (MWG I/19, S. 126, textkritische Anm. I).
Parallel zu den politischen Aufsätzen und Überlegungen über die Notwendigkeit einer verfassungspolitischen Neuordnung im Nachkriegsdeutschland treten im Laufe des Jahres 1917 die Fragestellungen der [86]Herrschaftssoziologie wieder in den Vordergrund, jetzt allerdings wiederum mit einer starken Fixierung auf den Staats- und nicht auf den Herrschaftsbegriff. Besonders in der Artikelserie der „Frankfurter Zeitung“, die im Frühjahr und Frühsommer 1917 publiziert wurde und ein Jahr später als eigenständige Broschüre unter dem Titel „Parlament und Regierung im neugeordneten Deutschland. Zur politischen Kritik des Beamtentums und Parteiwesens“ erschien,
59
knüpft Weber an seine Bürokratismus-Ausführungen an. Im September 1917 bietet er Vorträge zu den Themen „Staat und Verfassung“ – mit den Stichworten: Untersuchung der „realen Mächte des modernen Staates“: Verfassung, Verfassungslücken, Bürokratie, „Monarch und seine Funktionen“, Parlament und „Parteien als Unterlage der voluntaristischen Organisationen (,Führerschaft‘ und ,Gefolgschaft‘)“ – sowie zur „Problematik der soziologischen Staatslehre“ an.[86] Vgl. Weber, Max, Parlament und Regierung im neugeordneten Deutschland. Zur politischen Kritik des Beamtentums und Parteiwesens, in: MWG I/15, S. 421–596, dort insbes. der Editorische Bericht, ebd., S. 424, 430 f.
60
Und auch bei seinem Vortrag am Abend des 29. September auf Burg Lauenstein über „Die Persönlichkeit und die Lebensordnungen“ kommt er – wie wir aus Notizen von Ferdinand Tönnies wissen – auf die drei Grundtypen der Herrschaft zu sprechen: „Regierung (Führung) 1. rational, 2. tradition. 3. Charisma“. Vgl. die Briefe Max Webers an Martin Spahn vom 15. Sept. [1917], BA Koblenz, Nl. Martin Spahn, Nr. 57 (MWG II/9; für die Einsicht in die Transkription danke ich Herrn Manfred Schön, Düsseldorf) und an Ludo Moritz Hartmann vom 24. Sept. 1917, GStA PK, VI. HA, Nl. Max Weber, Nr. 15, Bl. 9 (MWG II/9).
61
Ebenfalls aus zweiter Hand stammen die ausführlichen Informationen in der „Neuen Freien Presse“ über Max Webers Vortrag „Probleme der Staatssoziologie“, den er am Abend des 25. Oktober 1917 in Wien auf Einladung der Soziologischen Gesellschaft hielt. Weber, Max, Vorträge während der Lauensteiner Kulturtagungen am 30. Mai und 29. [September] 1917, in: MWG 1/15, S. 701–707, Zitat: S. 707.
62
Dieser Vortrag ist vor allen Dingen deshalb von Bedeutung, weil er direkt an die herrschaftssoziologischen Reflexionen der Vorkriegszeit anknüpft. Max Weber erläutert darin den Unterschied zwischen einer staatsrechtlichen und einer soziologischen Betrachtung der Staatsverfassung. Das Thema von 1909, die Abgrenzung einer empirischen von einer normativ-dogmatisch ausgerichteten Staatslehre, wird hier in einfachen Worten wieder aufgegriffen. Dann leitet der Bericht zu der ausführlichen Behandlung der „Herrschafts-(Autoritäts-)Begriffe“ Vgl. Weber, Probleme der Staatssoziologie, unten, S. 745–756.
63
und den Legitimitätstypen über und stellt – was einmalig im Werk ist – neben die drei bereits bekannten Herrschaftstypen einen „vierten Legitimitätsgedanken“, der auf dem [87]„Willen der Beherrschten“ beruht. Vgl. unten, S. 753.
64
Spezifischer Träger dieses „modernen demokratischen Gedanken[s]“ sei „das soziologische Gebilde der okzidentalen Stadt“.[87] Vgl. unten, S. 755.
65
An dieser, leider nur indirekt überlieferten, Stelle wird außerdem deutlich, in welcher Form Max Weber die Stadt-Studie entsprechend der „Grundriß“-Disposition vom Juni 1914 in das Herrschafts-Kapitel von „Wirtschaft und Gesellschaft“ hätte integrieren wollen. Der Gedanke einer „demokratischen Legitimität“, der im überlieferten Textbestand der „Herrschaftssoziologie“ fehlt, wäre somit im Rahmen der Behandlung der okzidentalen Stadt aufgehoben gewesen, unabhängig davon, ob sie als eigener Legitimitätstypus oder „illegitime“ Form der Herrschaft oder – wie es später in der Neufassung von 1919/20 heißt – als „herrschaftsfremde Umdeutung des Charisma“ Ebd.
66
bezeichnet worden wäre. Insofern stellt der Vortragsbericht ein wichtiges „missing link“ zur Erhellung der nicht eingelösten Vorkriegsplanungen zur „Herrschaftssoziologie“ dar. Weber, Max, Die Typen der Herrschaft, in: WuG1, S. 155 (MWG I/23).
Die Oktober-Reise nach Wien diente Max Weber vor allem zu informellen Gesprächen mit Vertretern der juristischen Fakultät der Universität Wien und des k.k. Ministeriums für Kultus und Unterricht über seine Berufung auf einen der beiden vakanten Wiener nationalökonomischen Lehrstühle. Aus den überlieferten Berichten und Briefen geht hervor, daß Max Weber die Arbeiten an „Wirtschaft und Gesellschaft“ vor Übernahme der Lehrverpflichtungen abschließen wollte. Im September 1917 teilte er mit, das Buch sei bereits zu Zweidritteln fertig.
67
Im kurzen Wiener Sommersemester las er zweistündig „Wirtschaft und Gesellschaft. Positive Kritik der materialistischen Geschichtsauffassung“ Vgl. die Wiedergabe dieser Information Max Webers in einem Bericht von Edmund Bernatzik vom 24. Sept. 1917. Der Bericht war dem Schreiben der Rechts- und staatswissenschaftlichen Fakultät der k.k. Universität Wien an das k.k. Ministerium für Kultus- und Unterricht vom 28. Sept. 1917 beigefügt (Allgemeines Verwaltungsarchiv Wien, Faszikel 751, 4 C/1, zu den Vorgängen Nr. 32 831, 33 387, S. [8]).
68
und knüpfte damit direkt an den alten Stoffverteilungsplan von 1909/10 an. Man darf vermuten, daß er spätestens zu diesem Zeitpunkt das alte Manuskript wieder vornahm. Vgl. das Vorlesungsverzeichnis der k.k. Universität zu Wien im Sommer-Semester 1918. – Wien: Adolf Holzhausen 1918, S. 10; entgegen der dortigen Ankündigung fand die Vorlesung zweistündig statt, wie sich aus den Meldelisten der Studenten (UA Wien) ergibt.
69
In Vgl. dazu die Briefe Max Webers an Paul Siebeck vom 26. Nov. 1917 (VA Mohr/Siebeck, Deponat BSB München, Ana 446; MWG II/9): „Ich lese: mein Buch für den Grundriß“, und vom 16. Febr. 1918 (ebd.; MWG II/10): „Denn ich muß doch in Wien sofort Kolleg und dann ,Grundriß‘ machen […]“.
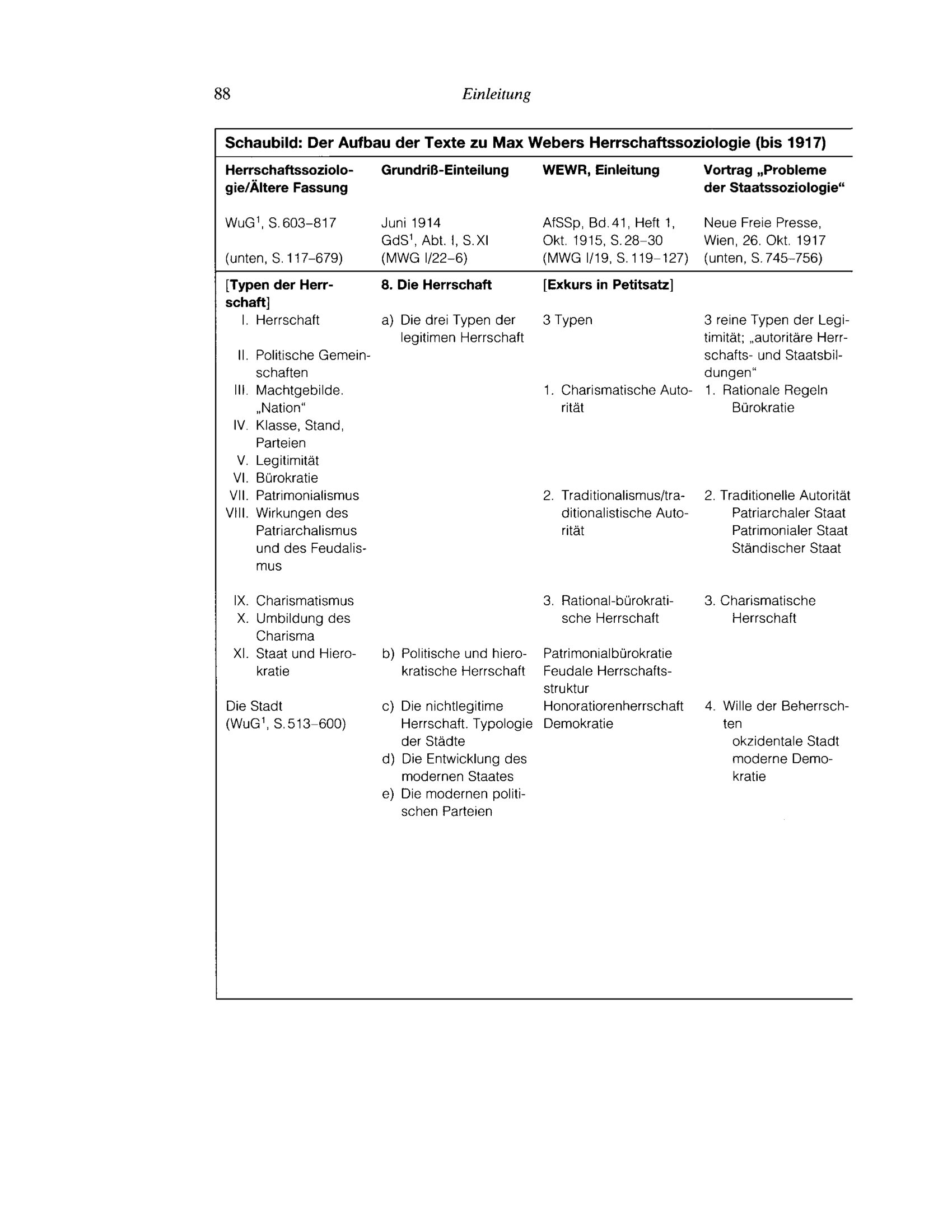
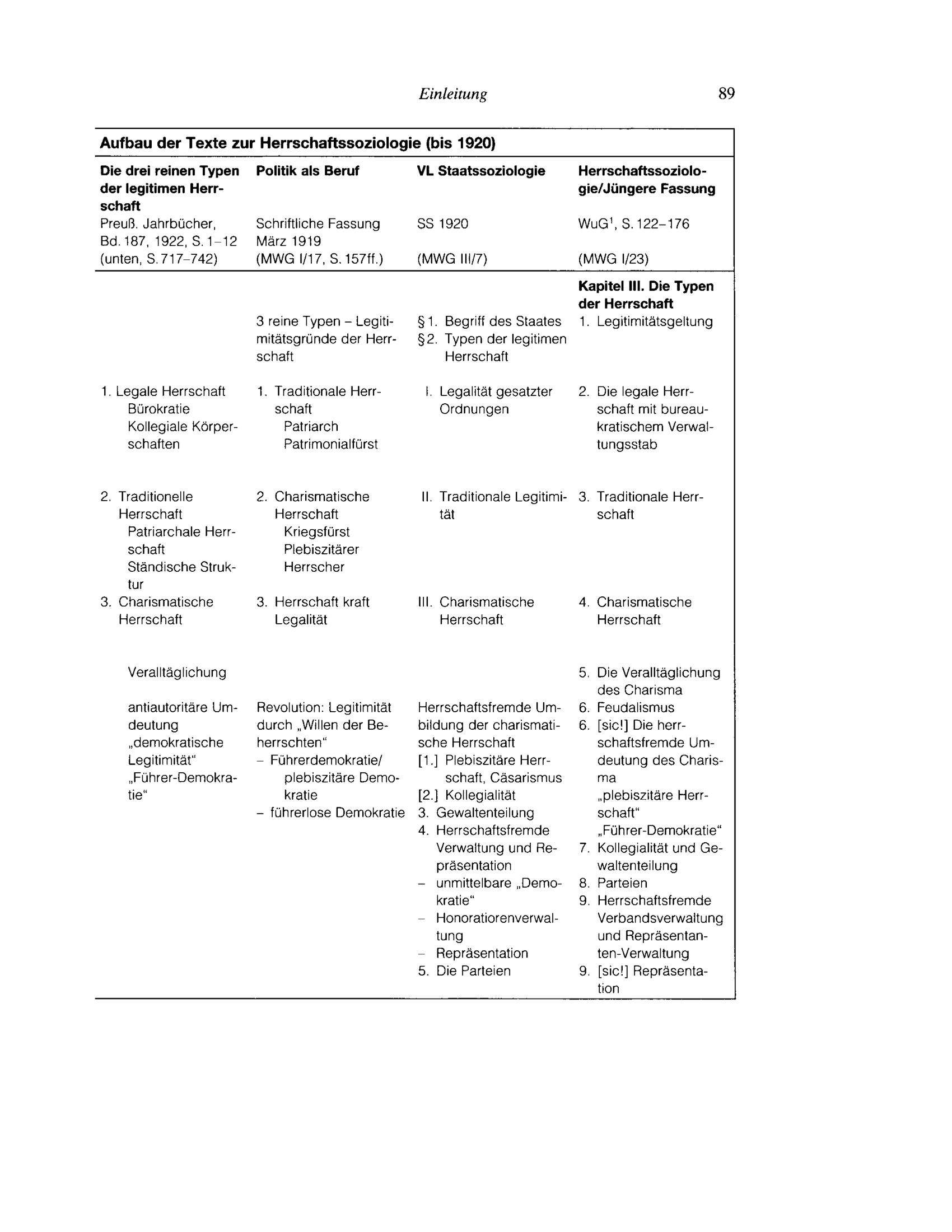
[90]diese Phase, d. h. zwischen dem Sommer 1917 und Sommer 1918, dürfte die Abfassung des erst postum veröffentlichten Textes „Die drei reinen Typen der legitimen Herrschaft“ gefallen sein.
70
Er führt in knapper und systematischer Form in die drei Herrschaftstypen ein und verwendet dabei die spezifische Begrifflichkeit und Systematik der Herrschaftstypologie, die wir aus der ersten Lieferung zu „Wirtschaft und Gesellschaft“ kennen.[90] Weber, Die drei reinen Typen, unten, S. 717–742.
71
Da Weber auf den Zusammenhang mit der Wirtschaft eingeht und auf weitere, nicht überlieferte Ausführungen hinweist, ist der Text als ein Einführungstext einzustufen. Trotz der naheliegenden Vermutung, Max Weber habe mit der Abfassung dieses Textes die Ankündigung der „Grundriß“-Einteilung von 1914, wo unter dem Titel „Die drei Typen der legitimen Herrschaft“ ein Einleitungstext zur „Herrschaftssoziologie“ angeführt war, eingelöst, handelt es sich bei dem postum überlieferten Text „Die drei reinen Typen der legitimen Herrschaft“ um einen später abgefaßten Text. Somit stellt der Text ein wichtiges Zwischenglied zur weiteren Präzisierung und Straffung der Herrschaftstypologie dar, wie die nun folgende Entwicklung zeigen wird. Für die Detailanalyse vgl. den Editorischen Bericht zu „Die drei reinen Typen“, unten, S. 718–722.
Am 20. Juli 1918 ist die Wiener Episode der Gastprofessur beendet und Max Weber kehrt nach Heidelberg zurück. Die bald einsetzenden politischen Umwälzungen und die eigenen vielfältigen politischen Aktivitäten dürften ihm in den nun folgenden Monaten kaum die Zeit zu einer Weiterarbeit am „alten Manuskript“ gelassen haben. Erst am 28. Januar 1919 greift Weber in seiner berühmten Rede „Politik als Beruf“ die Fäden der Herrschafts- und Staatssoziologie wieder auf. In der im Juli 1919 veröffentlichten Druckfassung der Rede findet sich eine prägnante Zusammenfassung des soziologischen Staatsbegriffs, der Herrschaftstypen und der ihnen entsprechenden Formen der Verwaltungsstruktur.
72
Hier begegnet uns die Herrschaftstypologie in ihrer konzeptionell und terminologisch ausgereiften Form, wie sie sich ebenfalls in der seit dem Sommer 1919 überarbeiteten Fassung der Einleitung zur „Wirtschaftsethik der Weltreligionen“ für den ersten Band der „Gesammelten Aufsätze zur Religionssoziologie“ findet, Weber, Max, Politik als Beruf, MWG I/17, S. 157–191; die schriftliche Ausarbeitung war bereits im März 1919 fertiggestellt, erschien aber erst im Juli (vgl. dazu den Editorischen Bericht zu „Politik als Beruf“, ebd., S. 132–134).
73
aber auch im dritten Kapitel der Neufassung von „Wirt[91]schaft und Gesellschaft“, Weber, Max, Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen. Vergleichende religionssoziologische Versuche. Einleitung, in: ders., GARS I, S. 237–275, hier: S. 267–275 (MWG I/19, S. 119–127).
74
das Max Weber im April 1920 an den Verlag schickte,[91] Weber, Max, Die Typen der Herrschaft, in: WuG1, S. 122–176 (MWG I/23).
75
sowie in der parallel dazu gehaltenen Vorlesung vom Sommersemester 1920.Vgl. den Brief Max Webers an Paul Siebeck vom 1. Apr. 1920, VA Mohr/Siebeck, Deponat BSB München, Ana 446 (MWG II/10).
76
Bis zu seinem unerwarteten Tod am 14. Juni 1920 las Max Weber das neugefaßte Herrschaftskapitel in seiner vierstündigen Vorlesung „Allgemeine Staatslehre und Politik (Staatssoziologie)“ an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Vgl. die Kollegmit- und -nachschriften von Hans Ficker und Erwin Stölzl, Deponat Max Weber, BSB München, Ana 446 (MWG III/7).
