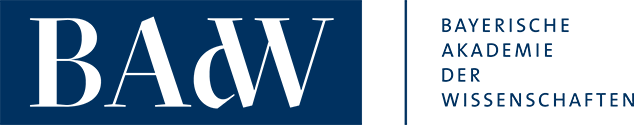[123][A 1]Die protestantische Ethik und der „Geist“ des Kapitalismus.a [123]In A folgt: Von Max Weber.
[123]In A folgt: Von Max Weber.
I. Das Problem.
Inhalt: 1. Konfession und soziale Schichtung. [S. 123] – 2. Der „Geist“
b
des Kapitalismus. [S. 140] – 3. Luthers Berufsbegriff. Aufgabe der Untersuchung. [S. 178] A: „Geist“,
1.
Ein Blick in die Berufsstatistik
1
eines konfessionell gemischten Landes pflegt, mit relativ geringen Abweichungen und Ausnahmen[123]In Deutschland fanden am 5. Juni 1882, am 14. Juni 1895 und am 12. Juni 1907 umfassende Erhebungen zur beruflichen Stellung der Erwerbspersonen statt, verbunden mit einer Zählung der landwirtschaftlichen und gewerblichen Betriebe (veröffentlicht in den amtlichen Statistiken).
1)
, eine Erscheinung zu zeigen, welche in den letzten Jahren [124]mehrfach in der katholischen Presse und Literatur[123][A 1]Diese erklären sich – nicht alle, aber überwiegend – daraus, daß natürlich die Konfessionalität der Arbeiterschaft einer Industrie in erster Linie von der Konfession ihres Standorts bzw. des Rekrutierungsgebiets ihrer Arbeiterschaft abhängt. Dieser Umstand verwirrt zuweilen auf den ersten Blick das Bild, welches manche Konfessionsstatistiken
2
– etwa der Rheinprovinz Die Religionszugehörigkeit wurde seit dem 19. Jahrhundert in Deutschland bei Volkszählungen erfragt, so auch am 1. Dezember 1890, 2. Dezember 1895 und 1. Dezember 1900 (veröffentlicht in den amtlichen Statistiken).
3
– bieten. Überdies sind natürlich nur bei weitgehender Spezialisierung und Auszählung der einzelnen Berufe die Zahlen schlüssig. Sonst werden unter Umständen ganz große Unternehmer mit alleinarbeitenden „Meistern“ in der Kategorie „Betriebsleiter“ zusammengeworfen. Die Provinz Rheinland war von 1822 bis zum 2. Weltkrieg die am stärksten industrialisierte preußische Provinz (v.a. Kohle-, Eisen- und Stahlindustrie). Im Jahr 1900 hatte sie nahezu 6 Mio. Einwohner, davon waren 28,9 % evangelisch und 69,8 % katholisch. Vgl. Statistik des Deutschen Reichs, Band 150, 1903, hier nach: Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich, hg. vom Kaiserlichen Statistischen Amt, 24. Jg., 1903. – Berlin: Puttkammer & Mühlbrecht 1903 (hinfort: Statistisches Jahrbuch 1903), S. 1 und 7.
2)
und auf den Katholikentagen Deutschlands lebhaft erörtert worden ist:[124]Vgl. z. B. Schell, Der Katholizismus als Prinzip des Fortschrittes. Würzburg 1897 S. 31. –
c
v. Hertling, Das Prinzip des Katholizismus und die Wissenschaft. Freiburg 1899 S. 58.[124]A: 31. ; es folgt ein Absatz, aufgehoben und Gedankenstrich ergänzt.
6
| Die im Kontext der Inferioritätsdebatte (vgl. oben, Anm. 4) entstandenen Schriften des Würzburger Theologie-Professors Herman Schell und Georg v. Hertlings, des Präsidenten der 1876 gegründeten Görres-Gesellschaft „zur Pflege der katholischen Wissenschaften“, riefen zur Überwindung des „Bildungsdeficits“ (v. Hertling) und der „wissenschaftlichen Inferiorität“ (Schell) auf. Mit den Seitenangaben bezieht sich Weber auf Zitate aus den Schriften, die Offenbacher, Konfession, S. 23 f., zu Schell, Katholizismus, und v. Hertling, Prinzip des Katholizismus, beibringt. (Weber übernimmt charakteristische Fehler; lies: Schell, Katholizismus: 1. Aufl. 1897, S. 22; 7. Aufl. 1899, S. 31; daß die Schrift 1899 bereits eine 7. Auflage erreichte, zeigt ihre damalige Popularität.)
4
den ganz vorwiegend protestantischen Charakter des Kapitalbesitzes und Unternehmertums sowohl, wie der oberen gelernten Schichten der Arbeiterschaft und namentlich des höheren technisch oder kaufmännisch vorge[A 2]bildeten Personals der modernen Unternehmungen.[124]Nachdem der Kulturkampf beigelegt war, warfen in den 1890er Jahren die Katholiken die Frage ihrer paritätischen Beteiligung an Staat, Wirtschaft und Kultur auf. Diese „Paritätsfrage“ wurde von der innerkatholischen Diskussion um die Ursachen „katholischer Inferiorität“ begleitet. Julius Bachem setzte sich in der „Kölnischen Volkszeitung“ für eine stärkere Beteiligung der Katholiken am industriellen Leben ein. Die Beteiligung an Wirtschaft und Bildung wurde wiederholt auch auf den Deutschen Katholikentagen diskutiert (letzteres seit 1892 und besonders seit 1896; als Beispiele seien genannt: der Vortrag Georg v. Hertlings über „Katholizismus und Wissenschaft“ von 1897 und die Rede Ernst Feigenwinters über „Der Katholik und das moderne Erwerbsleben“ von 1902, in: Verhandlungen der General-Versammlung der Katholiken Deutschlands 1897. – Landshut: Jos. Thomann 1897, S. 136–145, und dass. 1902. – Mannheim: Jean Grimm 1902, S. 320–330).
3)
Nicht nur da, wo die Differenz der Konfession mit einem Unterschied der Nationalität und damit des Grades der Kulturentwicklung zusammenfällt, wie im deutschen Osten zwischen Deutschen und Polen,[A 2]Einer meiner Schüler hat vor einigen Jahren das eingehendste statistische Material, welches wir über diese Dinge besitzen, die badische Konfessionsstatistik, durchgearbeitet. Vgl. Martin Offenbacher, Konfession und soziale Schichtung. Eine Studie über die wirtschaftliche Lage der Katholiken und Protestanten in Baden. Tübingen und [125]Leipzig 1901 (Bd. IV, Heft 5 der volkswirtschaftlichen Abhandlungen der badischen Hochschulen).
7
Die Thatsachen und Zahlen, die nachstehend zur Illustration vorgeführt werden, entstammen alle dieser Arbeit. [125]Offenbacher, Konfession, erschien bereits 1900 in den von Weber mitherausgegebenen „Volkswirtschaftlichen Abhandlungen der badischen Hochschulen“, S. 1–102 [409–510]. Weber bezieht sich auf diesen Text, nicht auf Offenbachers 1901 als kürzerer Sonderdruck erschienene Dissertation. – Er übernimmt Offenbachers Titel für den 1. Abschnitt, vgl. oben, S. 123.
5
sondern fast überall da, wo überhaupt die kapi[125]talistische Entwicklung freie Hand hatte, die Bevölkerung nach ihren Bedürfnissen sozial umzuschichten und beruflich zu gliedern, – und je mehr dies der Fall war, desto deutlicher, – finden wir jene Erscheinung in den Zahlen der Konfessionsstatistik ausgeprägt. Nun ist freilich die relativ weit stärkere, d. h. ihren Prozentanteil an der Gesamtbevölkerung überragende Beteiligung der Protestanten am Kapitalbesitz, Die Polen, insgesamt zu 96 % römisch-katholisch, siedelten v.a. in den östlichen preußischen Provinzen, so in Posen (61 % der Bevölkerung), Westpreußen (35 %), Schlesien (knapp 24 %) und Ostpreußen (14 %). Insgesamt lebten 1900 ca. 3 Mio. Polen in Preußen.
4)
an der Leitung und den oberen Stufen der Arbeit in den großen modernen gewerblichen und Handelsunter[126]nehmungen, Es kam z. B. im Jahre 1895
Die Juden mit über 4 Millionen auf 1000 marschieren freilich weit an der Spitze. (Die Zahlen nach Offenbacher a. a. O. S. 21.)
8
in Baden Bezug ist die Volkszählung von 1895, vgl. oben, S. 123, Anm. 2.
| auf je 1000 Evangelische | ein Kapitalrentensteuerkapital d [125]A: Kapitalrentensteuerkapitel 9 Im Großherzogtum Baden verwandte man damals das Steuerkapitalsystem. Das Steuerkapital ist bei direkten Steuern die Summe, für die die Steuer so ausgeworfen ist, daß die relative Steuerhöhe (Steuerfuß) für alle steuerpflichtigen Personen oder Gegenstände gleich erscheint. Es handelt sich beim Steuerkapital also um eine rein rechnerische Größe der Steuerverwaltung, die den Vergleich zwischen verschiedenen Steuerarten (etwa Grund-, Häuser-, Gewerbe-, Einkommens-, Kapitalrentensteuer) erleichtern soll. Das Steuerkapital kann demnach ein Vielfaches des jeweils zu versteuernden Betrages sein. Die in dieser Tabelle ausgewiesenen Relationen zwischen den Steuerkapitalien der Konfessionen dürfen deshalb nicht ohne weiteres mit den Relationen zwischen den zu versteuernden Kapitalrenten gleichgesetzt werden (daher Kapitalrenten-Steuerkapital). | von 954 060 Mk. |
| [auf je] 1000 Katholiken | [ein Kapitalrentensteuerkapital] | [von] 589 000 [Mk. ] |
10
Leicht abweichende Zahlen bei Offenbacher, Konfession, S. 21: 954 900 Mk. (Protestanten) und 589 800 Mk. (Katholiken; bei den Israeliten 4 137 100 Mk.). – Nach der amtlichen Statistik lauten die Zahlen für Baden im Jahr 1895 (vgl. Statistisches Jahrbuch für das Großherzogthum Baden, 29. Jg.: 1897 und 1898. – Karlsruhe: Macklot’sche Druckerei 1898): 637 604 evangelische, 1 057 417 katholische, 25 903 israelitische Ortsanwesende am 2. Dez. 1895, Gesamtbevölkerung 1 725 464 (S. 28 f.), Kapitalrentensteuer (nach Kapitalien) für Evangelische und Israeliten 1895 : 609 237 180 Mk. bzw. 107 149 910 Mk. (S. 508–512; für die Katholiken nicht angegeben), Kapitalrentensteuerkapital in Baden 1895 insges.: 1 342 541 540 Mk. (S. 465). Rechnet man mit den dort veröffentlichten Zahlen, weichen die Ergebnisse von Offenbachers und Webers Angaben leicht ab.
5)
zum Teil auf historische Gründe zurückzuführen,[126]Hierüber sind die gesamten Ausführungen der Offenbacherschen Arbeit zu vergleichen.
6)
die weit in der Vergangenheit liegen und bei denen die konfessionelle Zugehörigkeit nicht als Ursache ökonomischer Erscheinungen, sondern, bis zu einem gewissen Grade, als Folge von solchen erscheint. Die Beteiligung an jenen ökonomischen Funktionen setzt teils Kapitalbesitz, teils kostspielige Erziehung, teils, und meist, beides voraus und ist also an den Besitz ererbten Reichtums oder doch einer gewissen Wohlhabenheit gebunden. Gerade eine große Zahl der reichsten, durch Natur oder Verkehrslage begünstigten und wirtschaftlich entwickeltsten Gebiete des Reiches, insbesondere aber die Mehrzahl der reichen Städte, hatten sich aber im 16. Jahrhundert dem Protestantismus zugewendet, und die [A 3]Nachwirkungen davon kommen den Protestanten noch heute im ökonomischen Kampf ums Dasein zugute. Es entsteht aber alsdann die historische Frage: welchen Grund hatte diese besonders starke Prädisposition der ökonomisch entwickeltsten Gebiete für eine kirchliche Revolution? Und da ist die Antwort keineswegs so einfach[,] wie man zunächst glauben könnte. Gewiß erscheint die Abstreifung des ökonomischen Traditionalismus als ein Moment, welches die Neigung zum Zweifel auch an der religiösen Tradition und zur Auflehnung gegen die traditionellen Autoritäten überhaupt ganz wesentlich unterstützen mußte. Aber dabei ist zu berücksichtigen, was heute oft vergessen wird, daß die Reformation nicht sowohl die Beseitigung der kirchlichen Herrschaft über das Leben überhaupt, als vielmehr die Ersetzung der bisherigen Form derselben durch eine andere bedeutete, und zwar die Ersetzung einer höchst bequemen, praktisch damals wenig fühlbaren, vielfach fast nur noch formalen Herrschaft durch eine im denkbar weitgehendsten Maße in alle Sphären des häuslichen und öffentlichen Lebens eindringende, unendlich lästige und ernstgemeinte [127]Reglementierung der ganzen Lebensführung. Die Herrschaft der katholischen Kirche, – „die Ketzer strafend, doch den Sündern mild“, Auch hierfür nähere Darlegungen für Baden in den beiden ersten Kapiteln der Offenbacherschen Arbeit.
11
| [126]Nach Offenbacher, Konfession, wurden die badischen Protestanten durch historische Schicksale in ihrem wirtschaftlichen Fortkommen begünstigt („Natürliche und politisch-historische Einflüsse“, S. 4–15), was zu ihren im Vergleich zu den Katholiken besseren Vermögensverhältnissen beitrug und auch ihre Schul- und Berufswahl beeinflußte („Kulturelle Einflüsse“, S. 15–24).
12
wie sie früher noch mehr als heute war, – ertragen in der Gegenwart auch Völker von durchaus moderner wirtschaftlicher Physiognomie, die Herrschaft des Calvinismus, so wie sie im 16. Jahrhundert in Genf und Schottland, um die Wende des 16. und 17. in großen Teilen der Niederlande, im 17. in Neuengland und zeitweise in England selbst in Kraft stand, wäre für uns die schlechthin unerträglichste Form der kirchlichen Kontrolle des einzelnen, die es geben könnte. Nicht ein Zuviel, sondern ein Zuwenig von kirchlich-religiöser Beherrschung des Lebens war es ja, was gerade diejenigen Reformatoren, welche in den ökonomisch entwickeltsten Ländern entstanden, zu tadeln fanden. Wie kommt es nun, daß damals gerade diese ökonomisch entwickeltsten Länder, und, wie wir noch sehen werden,[127]Die Wendung stammt aus Conrad Ferdinand Meyers Gedichtzyklus „Huttens letzte Tage“ (zuerst 1871, letzte Überarbeitung 1891). Im 40. Gedicht lauscht Ulrich von Hutten im Traum dem Mariengebet des Ignatius von Loyola. Darin heißt es (seit der 5. Aufl. 1884): „Die Ketzer tötend, doch den Sündern mild, Bekehren wir die Welt zu Deinem Bild.“ Meyer, Conrad Ferdinand, Huttens letzte Tage. Eine Dichtung, in: ders., Sämtliche Werke. Hist.-krit. Ausg., besorgt von Hans Zeller und Alfred Zäch, 8. Band. – Bern: Benteli 1970, S. 85. – Die Wendung findet sich auch in Wittich, Elsaß, S. 20; zitiert unten, S. 133, Anm. 33.
13
innerhalb ihrer grade die ökonomisch aufsteigenden „bürgerlichen“ Klassen jene puritanische Tyrannei nicht etwa nur über sich ergehen ließen, sondern in ihrer Verteidigung ein Heldentum entwickelten, wie gerade bürgerliche Klassen als solche es selten vorher und niemals nachher gekannt haben: „the last of our heroisms“, wie Carlyle nicht ohne Grund sagt? Weber, Protestantische Ethik II, unten, bes. S. 414–420.
14
Thomas Carlyle leitete seine Ausgabe von „Oliver Cromwell’s Letters and Speeches“ folgendermaßen ein: „One wishes there were a History of English Puritans, the last of all our Heroisms; but sees small prospect of such a thing at present.“ Carlyle, Cromwell’s Letters and Speeches I, p. 1. – Die von Weber verwendete Kurzform findet sich auch bei Weingarten, Revolutionskirchen Englands, S. 435 (zu Weingarten vgl. den Editorischen Bericht, oben, S. 98; zitiert: Weber, Protestantische Ethik II, unten, S. 248, Fn. 4).
Aber weiter und namentlich: mag, wie gesagt, die stärkere [A 4]Beteiligung der Protestanten am Kapitalbesitz und den leitenden Stellungen innerhalb der modernen Wirtschaft heute zum Teil einfach als Folge ihrer geschichtlich überkommenen durchschnittlich besseren Vermögensausstattung zu verstehen sein, so zeigen sich [128]andererseits Erscheinungen, bei welchen das Kausalverhältnis unzweifelhaft so nicht liegt. Dahin gehören, um nur einiges anzuführen, u. a. die folgenden: Zunächst der ganz allgemein, in Baden ebenso wie in Bayern und z. B. in Ungarn, nachweisbare Unterschied in der Art des höheren Unterrichts, den katholische Eltern im Gegensatz zu protestantischen ihren Kindern zuzuwenden pflegen. Daß der Prozentsatz der Katholiken unter den Schülern und Abiturienten der „höheren“ Lehranstalten
15
im ganzen hinter ihrem Gesamtanteil an der Bevölkerung beträchtlich zurückbleibt,[128]Offenbacher unterscheidet für Baden fünf „,höhere‘ Lehranstalten“ (auch: „Mittelschulen“): (neuhumanistisches) Gymnasium, (mathematisch-naturwissenschaftlich ausgerichtetes) Realgymnasium, Oberrealschule (ohne Latein, Abschluß mit der Reifeprüfung), Realschule und höhere Bürgerschule (7- oder 6-klassig bzw. 6-klassig, mit oder ohne Latein, ohne Reifeprüfung). Vgl. Offenbacher, Konfession, S. 16. Zu der Einteilung auch: Statistisches Jahrbuch für das Großherzogtum Baden, 28. Jg.: 1895 und 1896. – Karlsruhe: Macklot’sche Druckerei 1897, S. 343–345.
7)
[129]wird man zwar zum erheblichen Teile den erwähnten überkommenen Vermögensunterschieden zurechnen. Daß aber auch innerhalb der katholischen Abiturienten der Prozentsatz derjenigen, welche aus den modernen[,] speziell für die Vorbereitung zu technischen Studien und gewerblich-kaufmännischen Berufen, überhaupt für ein bürgerliches Erwerbsleben bestimmten und geeigneten Anstalten: Realgymnasien, Realschulen, höheren Bürgerschulen usw. hervorgehen, wiederum auffallend stärker hinter dem der Protestanten zurückbleibt,[128][A 4]Von der Bevölkerung Badens waren 1895 : 37,0 Proz. Protestanten[,] 61,3 Proz. Katholiken, 1,5 Proz. Juden. Die Konfessionalität der Schüler aber stellte sich 1885/95
Genau die gleichen Erscheinungen in Preußen, Bayern, Württemberg, den Reichslanden,
e
auf den über die Volksschulen[128]A: 1885/91
f
A: Volkschulen
16
hinausgehenden und nicht obligatorisch zu besuchenden Schulen wie folgt dar Die Volksschule gehörte zum niederen Schulwesen. In allen deutschen Staaten galt bis zum Alter von 14, mitunter auch bis zum Alter von 15 Jahren Schulpflicht.
g
(nach Offenbacher a. a. O. S. 16):A: folgt wiederholtes Wort sinngemäß durch dar ersetzt.
17
Offenbacher legt für Protestanten und Katholiken (637 946 bzw. 1 057 075), nicht aber für die Juden (bei Offenbacher: Israeliten) und die Gesamtbevölkerung Badens von den offiziellen Statistiken leicht abweichende Zahlen zugrunde, die aber die gerundeten prozentualen Anteile nicht verändern. – In der von Weber im folgenden nach Offenbacher, Konfession, S. 16, wiedergegebenen Tabelle präsentiert Offenbacher den Zehnjahres-Durchschnitt von 1885 bis 1895 (dort ohne Hervorhebungen), macht aber in Zeile zwei einen Fehler, den Weber übernimmt: Die Prozente addieren sich auf 109. Vermutlich liegt der Anteil der Protestanten an den Schülern des Realgymnasiums um 10 Prozentpunkte zu hoch.
| Protestanten | Katholiken | Juden | |
| Gymnasien | 43 Proz. | 46 Proz. | 9,5 Proz. |
| Realgymnasien | 69 " | 31 " | 9 " |
| Oberrealschulen | 52 " | 41 " | 7 " |
| Realschulen | 49 " | 40 " | 11 " |
| höhere Bürgerschulen | 51 " | 37 " | 12 " |
| Durchschnitt | 48 Proz. | 42 Proz. | 10 Proz. |
18
Ungarn (s. die Zahlen bei Offenbacher a. a. O. S. 18 f.). Elsaß-Lothringen wurde nach der Eingliederung in das Deutsche Reich nicht als Bundesstaat, sondern als reichsunmittelbares Gebiet behandelt und von einem vom Kaiser eingesetzten Statthalter verwaltet.
8)
während diejenige Vorbildung, welche die | [A 5]humanistischen Gymnasien bieten, von ihnen bevorzugt wird, – das ist eine Erscheinung, die damit nicht erklärt ist, die vielmehr umgekehrt ihrerseits zur Erklärung der geringen Anteilnahme der Katholiken am kapitalistischen Erwerb herangezogen werden muß. Noch auffallender aber ist eine Beobachtung, welche die geringere Anteilnahme der Katholiken an der gelernten Arbeiterschaft der modernen Großindustrie verstehen hilft. Die bekannte Erscheinung, daß die Fabrik ihre gelernten Arbeitskräfte in starkem Maße dem Nachwuchs des Handwerks entnimmt, diesem also die Vorbildung ihrer Arbeitskräfte überläßt und sie ihm nach vollendeter Vorbildung entzieht, zeigt sich in wesentlich stärkerem Maße bei den protestantischen als bei den katholischen Handwerksgesellen. Von den Handwerksgesellen zeigen m.a. W. die Katholiken die [130]stärkere Neigung zum Verbleiben im Handwerk, werden also relativ häufig Handwerksmeister, während die Protestanten in relativ stärkerem Maße in die Fabriken abströmen, um hier die oberen Staffeln der gelernten Arbeiterschaft und des gewerblichen Beamtentums zu füllen.[129]S[iehe] die Ziffern in voriger Note, wonach die, hinter der katholischen Bevölkerungsquote um ein Drittel zurückbleibende katholische Gesamtfrequenz der mittleren Lehranstalten nur in den Gymnasien (wesentlich behufs Vorbildung zum theologischen Studium)
19
um einige Prozente überschritten wird. Als charakteristisch sei mit Rücksicht auf spätere Ausführungen[129]Voraussetzung für das Studium der Theologie und der Alten Sprachen war das Abitur an einem humanistischen Gymnasium. Absolventen des Realgymnasiums oder der Oberrealschule konnten Theologie nur dann studieren, wenn sie eine Zusatzprüfung in den klassischen Sprachen ablegten (eingeführt 1902).
h
[129]A: Ausführungen,
20
noch herausgehoben, daß in Ungarn die [A 5]Reformierten die typischen Erscheinungen der protestantischen Mittelschulfrequenz in noch gesteigertem Maß aufwiesen (Offenbacher a. a. O. S. 19 Anm. a[m] E[nde]). Weber, Protestantische Ethik II, unten, S. 242–425, zur asketischen Lebensauffassung im Calvinismus.
21
Nach Offenbacher, Konfession, S. 18 f., waren im Jahre 1876 in Ungarn Juden und Reformierte, gemessen an ihrem Bevölkerungsanteil, unter den Gymnasiasten überrepräsentiert, Protestanten (gemeint: Lutheraner), römische Katholiken und griechische Katholiken dagegen unterrepräsentiert.
9)
In diesen Fällen liegt zweifellos das Kausalverhältnis so, daß die anerzogene geistige Eigenart, und zwar hier die durch die religiöse Atmosphäre der Heimat und des Elternhauses bedingte Richtung der Erziehung, die Berufswahl und die weiteren beruflichen Schicksale bestimmt hat. [130]S[iehe] die Nachweise bei Offenbacher a. a. O. S. 54 und die Tabellen am Schluß der Arbeit.
24
| Offenbacher, Konfession, verweist S. 54 f. auf die hohe Anzahl von Protestanten, die aus Handwerksberufen kamen und in die Großindustrie abströmten, besonders in den Maschinenbau. Die bessere soziale Lage und Bildung der Protestanten äußere sich auch darin, daß sie im Handwerk die geistig anspruchsvollen und Geschicklichkeit erfordernden Berufe wie etwa Setzer oder Drucker ausübten. – Die Tabellen ebd., S. 69–99.
Die geringere Beteiligung der Katholiken am modernen Erwerbsleben in Deutschland ist nun aber um so auffallender, als sie der sonst in der Gegenwart so häufig gemachten Erfahrung zuwiderläuft, daß nationale oder religiöse Minderheiten, welche als „Beherrschte“ einer anderen Gruppe als der „herrschenden“ gegenüberstehen, durch ihren freiwilligen oder unfreiwilligen Ausschluß von politisch einflußreichen Stellungen gerade in besonders starkem Maße auf die Bahn des Erwerbes getrieben zu werden pflegen, daß ihre begabtesten Angehörigen hier den Ehrgeiz, der auf dem Boden des Staatsdienstes keine Verwertung finden kann, zu befriedigen suchen. So verhält es sich heute unverkennbar mit den in zweifellosem ökonomischen Fortschreiten begriffenen Polen in [A 6]Rußland und Preußen
22
– im Gegensatz zu dem von ihnen beherrschten Galizien[130]Polen lebten in Rußland, hier vorwiegend in Russisch-Polen (Königreich Polen oder, nach 1815, Kongreß-Polen), in Österreich (Galizien, vgl. die folgende Anm.) und in Preußen (vgl. oben, S. 124, Anm. 5).
23
–, so früher mit den Hugenotten in Frank[131]reich unter Ludwig XIV., Galizien war österreichisches Kronland. Die Bevölkerung bestand 1900 zu 55 % aus Polen (meist römisch-katholisch), v.a. in Westgalizien, und zu 42 % aus Ruthenen (meist griechisch-katholisch), v.a. in Ostgalizien. Galizien besaß einen eigenen Landtag und eine eigene Verwaltung, wodurch sich das nationale Polentum behaupten konnte. 1890 war die Industrie noch wenig entwickelt, der Bildungsstand niedrig.
25
den Nonkonformisten und Quäkern[131]Frankreichs Protestanten, die „Hugenotten“, galten um die Mitte des 17. Jahrhunderts als Träger des Fortschritts und der Kultur in Staat, Industrie, Handel und Wissenschaft. Unter Ludwig XIV. (reg. 1661–1715) wurden sie systematisch aus ihren Ämtern und Berufen gedrängt und seit 1681 offen verfolgt. Nach dem Widerruf des Edikts von Nantes (1685) flohen hunderttausende Hugenotten ins Ausland. Näheres im Glossar, unten, S. 831.
26
in England und – last not least – mit den Juden seit zwei Jahrtausenden. Aber bei den Katholiken in Deutschland sehen wir von einer solchen Wirkung nichts oder wenigstens nichts in die Augen Fallendes, und auch in der Vergangenheit haben sie weder in Holland noch in England in den Zeiten, wo sie entweder verfolgt oder nur toleriert waren, irgendeine besonders hervortretende ökonomische Entwicklung aufzuweisen. Der Grund des verschiedenen Verhaltens muß also der Hauptsache nach doch in der inneren Eigenart, nicht in der äußeren historisch-politischen Lage der Konfessionen gesucht werden. Für die Quäker in England z. B. anschaulich Bernstein, Kommunistische Strömungen, S. 680–685.
10)
[131][A 6]Das schließt natürlich nicht aus, daß auch die letztere höchst wichtige Konse¬ quenzen gehabt hat[,] und steht namentlich damit nicht im Widerspruch, daß es, wie späterhin zu erörtern,
27
für die Entwicklung der ganzen Lebensatmosphäre mancher protestantischer Sekten von ausschlaggebender, auch auf ihre Beteiligung am Wirtschaftsleben zurückwirkender, Bedeutung war, daß sie kleine und deshalb homogene Minoritäten repräsentierten, – wie dies z. B. bei den strengen Calvinisten außerhalb von Genf und Neu-England eigentlich überall, selbst da[,] wo sie politisch herrschten, der Fall war. | Weber, Protestantische Ethik II, unten, S. 242–425, zur asketischen Lebensführung der Religionsgemeinschaften.
Es würde also darauf ankommen zu untersuchen, welches diejenigen Elemente jener Eigenart der Konfessionen sind oder waren, die in der vorstehend geschilderten Richtung gewirkt haben und teilweise noch wirken. Man könnte nun bei oberflächlicher Betrachtung und aus gewissen modernen Eindrücken heraus versucht sein, den Gegensatz so zu formulieren, daß die größere „Weltfremdheit“ des Katholizismus, die asketischen Züge, welche seine höchsten Ideale aufweisen, seine Bekenner zu einer größeren Indifferenz gegenüber den Gütern dieser Welt erziehen müßten. Diese Begründung entspricht denn auch in der Tat dem heute üblichen populären Schema der Beurteilung beider Konfessionen. Von protestantischer Seite benutzt man diese Auffassung zur Kritik jener [132](wirklichen oder angeblichen) asketischen Ideale der katholischen Lebensführung, von katholischer antwortet man mit dem Vorwurf des „Materialismus“, welcher die Folge der Säkularisation aller Lebensinhalte durch den Protestantismus sei.
28
Auch ein moderner Schriftsteller glaubte den Gegensatz, wie er in dem Verhalten beider Konfessionen gegenüber dem Erwerbsleben zutage tritt, dahin formulieren zu sollen: „Der Katholik … ist ruhiger; mit ge[A 7]ringerem Erwerbstrieb ausgestattet, gibt er auf einen möglichst gesicherten Lebenslauf, wenn auch mit kleinerem Einkommen, mehr, als auf ein gefährdetes, aufregendes, aber eventuell Ehren und Reichtümer bringendes Leben. Der Volksmund meint scherzhaft: entweder gut essen, oder ruhig schlafen. Im vorliegenden Fall ißt der Protestant gern gut, während der Katholik ruhig schlafen will.“[132]Vermutlich Anspielung auf die konfessionelle Polemik aus der Zeit des preußischen Kulturkampfs. Z.B. hieß es auf dem Deutschen Katholikentag 1872 (vgl. Verhandlungen der XXII. General-Versammlung der Katholiken Deutschlands zu Breslau 1872. – Breslau: G. P. Aderholz 1872): „Wir haben den modernen Staat, das ist der Staat ohne Gott“, dessen Glückseligkeit darin liege, „zum größten Reichthum“ zu führen (S. 187). Vor dem „Verfall in den Materialismus“ aber schütze die Welt allein der Papst (vgl. S. 130–134, Zitat S. 130). Oder während einer Landtagsdebatte über die Vorbildung und Anstellung der Geistlichen führte der Sprecher der Deutschen Fortschrittspartei „die Freiheit der individuellen, religiösen Ueberzeugung oder des religiösen Glaubens“ gegen die Hierarchie der römisch-katholischen Kirche ins Feld. Abgeordnete der Zentrumspartei warfen ihm „Materialismus“ vor (vgl. Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Preußischen Landtags, Haus der Abgeordneten, 1. Band. – Berlin: W. Moeser 1873, 28. Sitzung am 17. Jan. 1873, S. 629–635, Zitat S. 633.
11)
In der Tat mag mit dem „gut essen wollen“ die Motivation für den kirchlich indifferenteren Teil der Protestanten in Deutschland und für die Gegenwart, zwar unvollständig, aber doch wenigstens teilweise richtig charakterisiert sein. Aber nicht nur lagen die Dinge in der Vergangenheit sehr anders: für die englischen, holländischen und amerikanischen Puritaner war bekanntlich das gerade Gegenteil von „Weltfreude“ charakteristisch[,] und zwar, wie wir noch sehen werden,[132][A 7]Dr. Offenbacher, a. a. O. S. 68.
30
Mit dem „moderne[n] Schriftsteller“ (oben, Z. 4 f.) ist vermutlich Offenbacher selbst gemeint. Bei Offenbacher, Konfession, S. 68, heißt es: „Der Katholik in Baden ist ruhiger; mit geringem Erwerbstrieb ausgestattet […]“ (bei Offenbacher kein Zitat).
29
sogar einer ihrer für uns wichtigsten Charakterzüge, – sondern z. B. der französische Protestantismus hat den Charakter, [133]der den calvinistischen Kirchen überhaupt und zumal denen „unter dem Kreuz“ Weber, Protestantische Ethik II, unten, S. 242–425, zur asketischen Lebensführung der Puritaner.
31
in der Zeit der Glaubenskämpfe überall aufgeprägt wurde, in hohem Maße bis heute bewahrt. Er ist dennoch – oder, so werden wir weiterhin zu fragen haben: vielleicht gerade deshalb? – bekanntlich einer der wichtigsten Träger der gewerblichen und kapitalistischen Entwicklung Frankreichs gewesen und in dem kleinen Maßstabe, in welchem die Verfolgung es zuließ, geblieben.[133]Bezeichnung für Kirchen, die verfolgt wurden und im Verborgenen bleiben mußten, wie die protestantischen Kirchen in Frankreich, in den Niederlanden oder auch am Niederrhein. So auch von Polenz für die erstgenannten gebraucht (vgl. Polenz, Calvinismus I, S. 434, 442, 503 und S. 600; Polenz wird zitiert: Weber, Protestantische Ethik II, unten, S. 248, Fn. 4). Vgl. auch das Glossar, unten, S. 833.
32
Wenn man diesen Ernst und das starke Vorwalten religiöser Interessen in der Lebensführung „Weltfremdheit“ nennen will, dann waren und sind die französischen Calvinisten ebenso weltfremd wie (im allgemeinen) die deutschen oder doch mindestens die norddeutschen Katholiken, denen ihr Katholizismus unzweifelhaft in einem Maße Herzenssache ist, wie keinem anderen Volke der Erde, – und beide unterscheiden sich dann nach der gleichen Richtung von der vorherrschenden Religionspartei: den in ihren unteren Schichten höchst „lebensfrohen“, in ihren oberen direkt religionsfeindlichen Katholiken Frankreichs und den heute im weltlichen Erwerbsleben aufgehenden und in ihren oberen Schichten vorwiegend religiös indifferenten Protestanten Deutschlands. Gemeint sind die Hugenotten. Vgl. dazu oben, S. 131, Anm. 25, und das Glossar, unten, S. 831.
12)
[134]Kaum etwas zeigt so [A 8]deutlich, wie diese Parallele, daß mit so vagen Vorstellungen, wie der (angeblichen!) „Weltfremdheit“ des Katholizismus, der (angeblichen!) materialistischen „Weltfreude“ des Protestantismus und vielen ähnlichen hier nichts anzufangen ist, schon weil sie in dieser Allgemeinheit teils auch heute noch, teils wenigstens für die Vergangenheit gar nicht zutreffen. Wollte man aber mit ihnen operieren, dann müßten außer den schon gemachten Bemerkungen noch manche andere Beobachtungen, die sich ohne weiteres aufdrängen, sogar den Gedanken nahe legen, ob nicht der ganze Gegensatz zwischen „Weltfremdheit“, „Askese“ und kirchlicher Frömmigkeit auf der einen Seite, Beteiligung am kapitalistischen Erwerbsleben auf der anderen Seite geradezu in eine innere Verwandtschaft umzukehren sei. [133]Ungemein feine Bemerkungen über die charakteristische Eigenart der Konfessionen in Deutschland und Frankreich und die Kreuzung dieser Gegensätze mit den sonstigen Kulturelementen im elsässischen Nationalitätenkampf in der vortrefflichen | [A 8]Schrift von W. Wittich, Deutsche und französische Kultur im Elsaß (Illustrierte Elsäss[ische]
i
Rundschau, 1900, auch als Sonderabdruck erschienen).[133]A: Elsäß.
33
| Wittich, Elsaß, S. 20, schreibt: „Der Protestantismus Frankreichs ist der strenge weltfeindliche Kalvinismus, der das ganze Leben erfüllt und seinen Anhänger zu einem tüchtigen, aber unduldsamen, der Weltfreude abgeneigten Menschen macht. Der französische Katholizismus ist die katholische Kirche der romanischen Länder, ,die Ketzer strafend, doch den Sündern mild.‘ Dabei hat die katholische Kirche über einen großen Teil ihrer Bekenner die Macht verloren, sie sind liberal oder sozialistisch, d. h. ungläubig und antikirchlich geworden. In Deutschland ist es gerade umgekehrt. Hier sind es gerade die Protestanten, die Anhänger der Staatskirche, die den politischen Liberalismus und die religiöse Gleichgültigkeit hauptsächlich vertreten, während die Katholiken streng religiös völlig der Kirche unterthan sind […].“
In der Tat ist nun schon auffallend – um mit einigen ganz äußerlichen Momenten zu beginnen –[,] wie groß die Zahl der Vertreter gerade der innerlichsten Formen christlicher Frömmigkeit ist, die aus kaufmännischen Kreisen stammen. Speziell der Pietismus verdankt eine auffallend große Zahl seiner ernstesten Bekenner dieser Abstammung. Man könnte da an eine Art Kontrastwirkung des „Mammonismus“ auf innerliche und dem Kaufmannsberuf nicht angepaßte Naturen denken, und sicherlich hat, wie bei Franz von Assisi,
34
so auch bei vielen jener Pietisten, sich der Hergang der „Bekehrung“ subjektiv dem Bekehrten selbst sehr oft so dargestellt. Und ähnlich könnte man dann die gleichfalls – bis auf Cecil Rhodes[134]Franz von Assisi wuchs als Sohn eines wohlhabenden Kaufmanns auf und war der Legende nach Haupt der genußfreudigen Jugend in Assisi. Nach einem einschneidenden Erlebnis bekehrte er sich und wurde ein in freiwilliger Armut umherziehender Bußprediger, dann Ordensgründer.
35
herab – so auffallend häufige Erscheinung, daß aus Pfarrhäusern kapitalistische Unternehmer größten Stils hervorgehen, als eine Reaktion gegen asketische Jugenderziehung zu erklären suchen. Indessen diese Erklärungsweise versagt da, wo ein virtuoser kapitalistischer Erwerbssinn mit den intensivsten Formen einer das ganze Leben durchdringenden und regelnden Frömmigkeit in denselben Personen und Menschengruppen zusammentrifft, [135]und diese Fälle sind nicht etwa vereinzelt, sondern sie sind geradezu bezeichnendes Merkmal für ganze Gruppen der historisch wichtigsten protestantischen Kirchen und Sekten. Speziell der Calvinismus zeigt, wo immer er aufgetreten ist, diese Kombination. So wenig er in der Zeit der Ausbreitung der Reformation in irgendeinem Lande (wie überhaupt irgend eine der protestantischen Konfessionen) [A 9]an eine bestimmte einzelne Klasse gebunden war, so charakteristisch und in gewissem Sinn „typisch“ ist es doch z. B., daß in den französischen Hugenottenkirchen alsbald Mönche und Industrielle (Kaufleute, Handwerker) numerisch besonders stark unter den Proselyten vertreten waren und, namentlich in den Zeiten der Verfolgung, vertreten blieben. Cecil Rhodes, ein Protagonist des britischen Imperialismus in Südafrika, der durch seine Gold- und Diamantengeschäfte zu einem der reichsten Männer seiner Zeit wurde, stammte aus einem englischen Landpfarrhaus. Erwähnt z. B. in: Cecil Rhodes †, in: FZ vom 27. März 1902, Nr. 86, 2. Mo.Bl., S. 1.
13)
Und schon die Spanier wußten, daß „die Ketzerei“ (d. h. der Calvinismus der Niederlän[136]der) „den Handelsgeist befördere“[,] und Gothein[135][A 9]S[iehe] darüber jetzt: Dupin de St. André, L’ancienne église réformée de Tours. Les membres de l’église (Bull[etin] de la soc[iété] de l’hist[oire] du Protest[antisme] 4. s[érie] t. 1
k
).[135]A: 10
36
Man könnte auch hier wieder – und namentlich katholischen Beurteilern wird dieser Gedanke nahe liegen – die Sucht nach Emanzipation von der klösterlichen oder überhaupt kirchlichen Kontrolle als das treibende Motiv ansehen. Aber dem steht nicht nur das Urteil auch gegnerischer Zeitgenossen (einschließlich Rabelais)[135]Vgl. Dupin, Église réformée de Tours, in der von Weber genannten Zeitschrift, Quatrième série, tome I.
37
entgegen, sondern es zeigen z. B. die Gewissensbedenken der ersten Nationalsynoden der Hugenotten (z. B. 1. Synode, C[as] Partic[uliers], article 11 Anspielung auf die Zustandsbeschreibung des französischen Satirikers und Humoristen François Rabelais, die das Gegenteil eines reglementierten monastischen Lebens vermittelt (Trunk- und Freßsucht der Mönche). Vgl. z. B. Polenz, Calvinismus I, S. 169–173, 195–197.
l
bei Aymon, Synod[es] Nat[ionaux] p. 10),A: qu. 10
38
ob ein Bankier Ältester einer Kirche werden dürfe[,] und die, trotz Calvins unzweideutiger Stellungnahme, Weber bezieht sich auf die Verhandlungen der Premier Synode, dort unter Faits speciaux, article XI, in: Aymon, Synodes Nationaux I, p. 10. Die erste Nationalsynode der französischen reformierten Gemeinden, d. h. der Hugenotten, fand in Zeiten schlimmster Verfolgung am 25. Mai 1559 in Paris statt.
39
auf den Nationalsynoden stets wiederkeh[136]rende Erörterung Calvin billigte das Zinsennehmen, das von der römischen Kirche verboten war (vgl. im Glossar: „Wucherverbot“, unten, S. 842), allerdings mit Einschränkungen: So dürfe man mit Geldleihe keinen Wucher betreiben und keine Zinsen von den Armen und Bedürftigen nehmen. Der Staat habe die Aufgabe, die Obergrenze der Zinsen festzulegen. Nach Wiskemann, Nationalökonomische Ansichten, S. 80 f. (von Weber zitiert unten, S. 201, Fn. 50), auf den sich auch Kampschulte, Calvin I, S. 429, bezieht (Kampschulte wird eingeführt: Weber, Protestantische Ethik II, unten, S. 247, Fn. 4).
40
der Erlaubtheit des Zinsennehmens anläßlich der Anfrage bedenklicher Gemeindeglieder zwar die starke Beteiligung der hieran interessierten Kreise, zugleich aber doch wohl auch, daß der Wunsch, die „usuraria pravitas“[136]Vgl. etwa Aymon, Synodes Nationaux I, p. 26 (3. Synode), p. 35 und 39 (4. Synode), p. 86 (6. Synode), das Verbot exorbitanter Zinsen p. 153 (11. Synode) und weitere Fälle.
41
ohne Beichtkontrolle ausüben zu können, nicht maßgebend gewesen sein kann. usuraria pravitas (lat.), unerlaubte, strafbare Zinsnahme. Vgl. dazu auch im Glossar: „usura“, unten, S. 840.
14)
bezeichnet die calvinistische Diaspora mit Recht als die „Pflanzschule der Kapitalwirtschaft“. W[irtschafts-]G[eschichte] des Schwarzwalds I, 674
m
.[136]A: 67
42
Gothein, Wirtschaftsgeschichte des Schwarzwaldes, S. 674: „Wer den Spuren der kapitalistischen Entwickelung nachgeht, in welchem Lande Europas es auch sei, immer wird sich ihm dieselbe Thatsache aufdrängen: Die calvinistische Diaspora ist zugleich die Pflanzschule der Kapitalwirtschaft. Die Spanier drückten sie mit bitterer Resignation dahin aus: ,Die Ketzerei befördert den Handelsgeist.‘“
15)
Man könnte ja hier die Überlegenheit der französischen und holländischen wirtschaftlichen Kultur, welcher diese Diaspora überwiegend entstammte, für das Entscheidende ansehen, oder auch den gewaltigen Einfluß des Exils und der Herausreißung aus den traditionellen Lebensbeziehungen. Daran anschließend die kurzen Bemerkungen Sombarts, Der moderne Kapitalismus I S. 380.
43
Sombart, Der moderne Kapitalismus I, S. 380 f.: „Unzureichend erscheint mir auch eine Begründung modern-kapitalistischen Wesens mit der Zugehörigkeit zu bestimmten Religionsgemeinschaften. Daß der Protestantismus, zumal in seinen Spielarten des Calvinismus und Quäkertums, die Entwicklung des Kapitalismus wesentlich gefördert hat, ist eine zu bekannte Thatsache, als daß sie des weiteren begründet zu werden brauchte.“ Dazu zitiert Sombart Gothein (wie vorherige Anm.) und fährt fort: „Wenn jedoch jemand gegen diesen Erklärungsversuch […] einwenden wollte: die protestantischen Religionssysteme seien zunächst vielmehr Wirkung als Ursache des modern-kapitalistischen Geistes, so wird man ihm schwer die Irrtümlichkeit seiner Auffassung darthun können, es sei denn mit Hilfe eines empirischen Nachweises konkret-historischer Zusammenhänge, auf welche wir also immer wieder hingewiesen werden, sobald wir auch nur einigermaßen befriedigenden Aufschluß über die Entstehung des modernen Kapitalismus gewinnen wollen.“
16)
Allein in [137]Frankreich selbst stand, wie [A 10]aus Colberts Kämpfen bekannt ist, Denn daß die bloße Tatsache des Heimatwechsels bei der Arbeit zu den mächtigsten Mitteln ihrer Intensivierung gehört, steht durchaus fest. – Dasselbe polnische Mädchen, welches in der Heimat durch keine noch so günstigen Verdienstchancen aus seiner traditionalistischen Trägheit herauszubringen ist, wandelt scheinbar seine ganze Natur und ist ungemessener Ausnutzung fähig, wenn es als Sachsengängerin in der Fremde arbeitet.
44
Bei den italienischen Wanderarbeitern zeigt sich genau die gleiche [137]Erscheinung. Und daß hier nicht nur der erziehende Einfluß des Eintrittes in ein höheres „Kulturmilieu“ das Entscheidende ist – so sehr er natürlich mitspielt, – zeigt sich darin, daß die gleiche Erscheinung eintritt, auch wo – wie in der Landwirtschaft – die Art der Beschäftigung genau die [A 10]gleiche ist wie in der Heimat und die Unterbringung in Wanderarbeiterkasernen usw. sogar ein temporäres Herabsteigen auf ein Niveau der Lebenshaltung bedingt, wie es in der Heimat nie ertragen werden würde. – Die bloße Tatsache des Arbeitens in ganz anderen Umgebungen als den gewohnten bricht hier den Traditionalismus und ist das „Erziehliche“. Es braucht kaum angedeutet zu werden, wieviel von der amerikanischen ökonomischen Entwicklung auf solchen Wirkungen ruht. Für das Altertum ist die ganz ähnliche Bedeutung des babylonischen Exils Fast wörtlich in der zweiten Fassung von Webers Artikel „Entwickelungstendenzen in der Lage der ostelbischen Landarbeiter“ (1894), MWG I/4, S. 362–462. Dort heißt es [137]S. 447: „Polnische Mädchen, welche in der Heimath kein noch so hoher Lohn zu energischer Arbeit anspornt, leisten auswärts Außergewöhnliches.“ Über die landwirtschaftlichen Wanderarbeiter („Sachsengänger“) ebd., S. 446–448.
47
[138]für die Juden, man möchte sagen, mit Händen in den Inschriften zu greifen. Unter dem babylonischen König Nebukadnezar II. wurden 598/97 und 587/86 v. Chr. (Zerstörung Jerusalems und des ersten Tempels) die Bewohner des Staates Juda, vor allem die Jerusalemer Oberschicht, nach Babylonien zwangsdeportiert. [138]Nach der Eroberung Babylons durch die Perser durften die Juden unter Kyros II. seit 538 v. Chr. in ihre Heimat zurückkehren; manche blieben jedoch in Babylonien (vgl. unten, Anm. 49).
49
– Aber für die Calvinisten spielt, wie schon der immerhin unverkennbare Unterschied in der ökonomischen Eigenart der puritanischen Neu-England-Kolonien gegenüber dem katholischen Maryland, dem episkopalistischen Süden und dem interkonfessionellen Rhode Island zeigt, Wahrscheinlich Anspielung auf die Tontafel-Dokumente des Handels- und Kredithauses Muraschu in Nippur (ca. 455–403 v. Chr.). Darauf sind Geschäfte mit den Diaspora-Juden der Umgebung erwähnt, wie man an den Namen erkennen kann. Vgl. Hilprecht, H[ermann V.] und Clay, A[lbert T.], Business Documents of Murashû Sons of Nippur dated in the Reign of Artaxerxes I (464–424 B.C.) (The Babylonian Expedition of the University of Pennsylvania, Ser. A, vol. 9). – Philadelphia, PA: University of Philadelphia 1898; Clay, A[lbert T.], dass. dated in the Reign of Darius II (424–404 B.C.) (ebd., vol. 10), ebd., 1904. – Weber, Agrarverhältnisse3, verweist später auf „die von Hilprecht edierten Ausgrabungen der Univ[ersity] of Pennsylvania“ (MWG I/6, S. 730; dazu S. 841). Ferner später Weber, Antikes Judentum, MWG I/21, S. 707 (dazu Eckart Otto, Einleitung, MWG I/21, S. 127 mit Anm. 30).
50
der Einfluß ihrer religiösen Eigenart ganz unverkennbar als selbständiger Faktor eine Rolle. Einiges dazu unten, S. 152, Anm. 53 und 55.
45
im 17. Jahrhundert die Sache ganz ebenso. Selbst Österreich hat – von anderen Ländern zu schweigen – protestantische Fabrikanten gelegentlich direkt importiert. Jean Baptiste Colbert war von 1661 an über 22 Jahre Finanzminister Ludwigs XIV. Neben der wirtschaftlichen Vereinheitlichung Frankreichs strebte er auch die religiöse an. Juden und Hugenotten wollte er vertreiben, obwohl man über die Hugenotten sagte, sie besäßen großes Kapital und hätten die tüchtigsten Kaufleute. Darüber hinaus stellten sie „einen sehr bedeutenden Anteil an der Verwaltung der Finanzen, den Staatspachtungen, dem Anleihewesen. Es ist bemerkenswert, mit welchem Eifer und Erfolg sie sich der aufkommenden Manufaktur widmeten. […] Es bestand zu jener Zeit das Sprichwort: ,riche comme un protestant.‘“ Hecht, Gustav Heinrich, Colbert’s politische und volkswirtschaftliche Grundanschauungen (Volkswirtschaftliche Abhandlungen der Badischen Hochschulen, 1. Band, 2. Heft). – Freiburg i. B., Leipzig und Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) 1898, Zitat S. 20 f. (von Weber zusammen mit einem Artikel von Gustav Cohn über Colbert als Literatur aufgeführt im Vorlesungs-Grundriß, MWG III/1, S. 82; vgl. ebd., S. 104).
46
Noch eklatanter ist, woran ebenfalls nur erinnert zu werden braucht, der Zusammenhang religiöser Lebensreglementierung mit intensivster Entwicklung des geschäft[138]lichen Sinnes bei einer ganzen Anzahl gerade derjenigen Sekten, deren „Lebensfremdheit“ ebenso sprichwörtlich geworden ist, wie ihr Reichtum: insbesondere den Quäkern und Mennoniten. Die Rolle, welche die ersteren in England und Nordamerika spielten, fiel den letzteren in den Niederlanden und Deutschland zu. Daß in Ostpreußen selbst Friedrich Wilhelm I. die Mennoniten trotz ihrer absoluten Weigerung, Militärdienst zu tun, als unentbehrliche Träger der Industrie gewähren ließ, Protestanten wurden zur Ausübung ihres Gewerbes in Österreich angesiedelt, notiert z. B. Adler, Max, Die Anfänge der merkantilistischen Gewerbepolitik in Österreich, in: Wiener Staatswissenschaftliche Studien, hg. von Edmund Bernatzik und Eugen von Philippovich, 4. Band, 3. Heft. – Wien und Leipzig: Franz Deuticke 1903, S. 50. Ausführlicher später Otruba, Gustav, Die Wirtschaftspolitik Maria Theresias. – Wien: Bergland Verlag 1963, S. 33–36: Maria Theresia warb Facharbeiter aus Italien, aus Frankreich, aus den Niederlanden und besonders aus England (Stahlfabrikanten und Maschinisten) zum Aufbau von in Österreich noch nicht vorhandenen Fabrikzweigen an. Den Angeworbenen gewährte sie ökonomische Privilegien, auch freie Religionsausübung. Dasselbe galt für Zeugmacher, die aus Sachsen und der Lausitz angeworben wurden oder aus Preußisch-Schlesien nach Mähren einwanderten.
48
ist nur eine, aber allerdings bei der Eigenart dieses Königs wohl eine der stärksten, von den zahlreichen wohlbekannten Tatsachen, die das illustrieren. Daß endlich für die Pietisten die Kombination von intensiver Frömmigkeit mit [139]ebenso stark entwickeltem geschäftlichen Sinn und Erfolg ebenfalls galt, Die Mennoniten verweigerten Kriegsdienst und Eid. In Ostpreußen siedelten sie sich seit 1711 im Memelland an, und nach einem Aufruf Friedrich Wilhelms I. kamen sie 1721 nach Königsberg. Gegen Bezahlung wurden sie vom Wehrdienst befreit und durften Gottesdienste abhalten. In Königsberg machten sie sich v.a. durch ihre gewerblichen Tätigkeiten und durch das Kapital, das sie ins Land gebracht hatten, nahezu unersetzlich. Dies wurde deutlich, als es trotz der ihnen zugesicherten Privilegien in der Militärdienstfrage zu Zwischenfällen kam und ihnen 1732 Ausweisung drohte. Aufgrund ihrer wirtschaftlichen Verdienste um Königsberg verzichtete der König auf ihre Ausweisung und gewährte ihnen erneut Wehrfreiheit – „unter der Bedingung, daß sie Woll- und Zeugfabriken anlegten“. Vgl. Mannhardt, W[ilhelm], Die Wehrfreiheit der Altpreußischen Mennoniten. Eine geschichtliche Erörterung. – Marienburg: Selbstverlag der Altpreußischen Mennonitengemeinden 1863, S. 116–120, S. LXX–LXXV, Zitat S. 120.
17)
ist bekannt genug: – man braucht nur an Calw zu erinnern[139]Das schließt natürlich nicht aus, daß der Pietismus, ebenso wie auch andere religiöse Richtungen, sich gewissen „Fortschritten“ kapitalistischer Wirtschaftsverfassung – z. B. dem Übergang zum Fabriksystem – aus patriarchalistischen Stimmungen heraus später widersetzt haben
n
. Es ist das, was eine religiöse Richtung als Ideal erstrebte[,] und das, was ihr Einfluß auf die Lebensführung ihrer Anhänger faktisch bewirkte, scharf zu scheiden, wie wir noch oft sehen werden.[139]Zu erwarten wäre: hat
53
| Vgl. Weber, Protestantische Ethik II, unten, S. 420 ff.
51
–; es mögen daher in diesen ja nur ganz provisorischen Ausführungen die Beispiele nicht weiter gehäuft werden. Denn schon diese wenigen zeigen alle das eine: der „Geist der Arbeit“, des „Fort[A 11]schritts“ oder wie er sonst bezeichnet wird, dessen Weckung man dem Protestantismus zuzuschreiben neigt, darf nicht, wie es heute zu geschehen pflegt, im „aufklärerischen“ Sinn verstanden werden. Der alte Protestantismus der Luther, Calvin, Knox, Voët[139]Ein Hinweis auf Calw findet sich etwa bei Gothein, Wirtschaftsgeschichte des Schwarzwaldes, S. 675, 685–689; ausführlich bei: Troeltsch, Walter, Die Calwer Zeughandlungskompagnie und ihre Arbeiter. Studien zur Gewerbe- und Sozialgeschichte Altwürttembergs. – Jena: Gustav Fischer 1897, bes. S. 149–153, den Weber im Vorlesungs-Grundriß als Literatur nennt, vgl. MWG III/1, S. 104 (auf den Pietismus Calws geht Troeltsch allerdings nicht ein). – Die wirtschaftliche Blüte der Stadt war Folge der Geschäftstüchtigkeit der Calwer Zeughandlungs-Compagnie, von 1650 bis 1797 ein Familien- und Geschäftsverband von Calwer Färbern und Wollstoff-Händlern, der auch eine eigene „Manufaktur“ besaß und ausgedehnte Geldgeschäfte betrieb. Erfolgreich war sie v.a. in der 1. Hälfte des 18. Jahrhunderts (vgl. Troeltsch, ebd., S. 149–153). Viele der Compagnieverwandten gehörten dem Pietismus an.
52
hatte mit dem, was man heute „Fortschritt“ nennt, wenig zu schaffen. Zu ganzen Seiten des modernen Lebens, die heute der extremste Konfessionelle nicht mehr entbehren möchte, stand er direkt feindlich. Soll also eine innere Verwandtschaft altprotestantischen Geistes und moderner kapitalistischer Kultur gefunden werden, so müssen wir wohl oder übel versuchen, sie nicht in dessen (angeblicher) mehr oder minder materialistischer oder doch anti-asketischer „Weltfreude“, sondern vielmehr in seinen rein religiösen Zügen zu suchen. – Montesquieu sagt (Esprit des lois Buch XX [140]cap. 7) von den Engländern, sie hätten es „in drei wichtigen Dingen von allen Völkern der Welt am weitesten gebracht: in der Frömmigkeit, im Handel und in der Freiheit“. John Knox, wichtigste Person der Reformation in Schottland; Gisbert Voet, Haupt der „Nadere Reformatie“ (bei Weber: des niederländisch-reformierten Pietismus), die die reformierte orthodoxe Lehre mit asketischer Frömmigkeitspraxis zu verbinden suchte und über 100 Jahre die einflußreichste Richtung in der niederländischen Kirche war. Vgl. die Einträge im Personenverzeichnis, unten, S. 793 f. und 816.
54
Sollte ihre Überlegenheit auf dem Gebiet des Erwerbs – und, was wir später in anderem Zusammenhang auch noch berühren werden, ihre Eignung für freiheitliche politische Institutionen – vielleicht mit jenem Frömmigkeitsrekord, den Montesquieu ihnen zuerkennt, zusammenhängen? [140]„C’est le peuple du monde qui a le mieux su se prévaloir à la fois de ces trois grandes choses: la religion, le commerce et la liberté.“ Montesquieu, Esprit des lois, p. 301, zitiert nach Webers Handexemplar (Max Weber-Arbeitsstelle, BAdW München). Livre XX, Chapitre VII ist überschrieben: „Esprit de l’Angleterre sur le commerce“. Da die wichtigsten deutschen Ausgaben „religion“ nicht mit „Frömmigkeit“, sondern mit „Religion“ wiedergeben, dürfte Weber den Satz selbst übersetzt haben. Ferner dazu den Editorischen Bericht, oben, S. 101 mit Anm. 28.
Eine ganze Anzahl möglicher Beziehungen steigen, dunkel empfunden, alsbald vor uns auf, wenn wir die Frage so stellen. Es wird nun eben die Aufgabe sein müssen, das, was uns hier undeutlich vorschwebt, so deutlich zu formulieren, als dies bei der unausschöpfbaren Mannigfaltigkeit, die in jeder historischen Erscheinung steckt, überhaupt möglich ist. Um dies aber zu können, muß das Gebiet der vagen Allgemeinvorstellungen, mit dem bisher operiert worden ist, notgedrungen verlassen und in die charakteristische Eigenart und die Unterschiede jener großen religiösen Gedankenwelten einzudringen versucht werden, die in den verschiedenen Ausprägungen der christlichen Religion uns geschichtlich gegeben sind.
Vorher aber sind noch einige Bemerkungen erforderlich, zunächst über die Eigenart des Objektes, um dessen geschichtliche Erklärung es sich handelt, dann über den Sinn, in welchem eine solche Erklärung überhaupt im Rahmen dieser Untersuchungen möglich ist.
2.
In der Überschrift dieser Studie ist der etwas anspruchsvoll klingende Begriff: „Geist des Kapitalismus“ verwendet. Was soll darunter verstanden werden?
[141][A 12]Wenn überhaupt ein Objekt auffindbar ist, für welches der Verwendung jener Bezeichnung irgendein Sinn zukommen kann, so kann es nur ein „historisches Individuum“ sein, d. h. ein Komplex von Zusammenhängen in der geschichtlichen Wirklichkeit, die wir unter dem Gesichtspunkte ihrer Kulturbedeutung begrifflich zu einem Ganzen zusammenschließen.
1
[141]Der Begriff „historisches Individuum“ stammt von Heinrich Rickert und steht im Zusammenhang mit seiner Wertbeziehungslehre und der Lehre von der individualisierenden Begriffsbildung. Er bezeichnet Auswahl und Konstitution eines zu untersuchenden Objekts, das ein logisch Unteilbares wird („ln-dividuum“). Vgl. Rickert, Heinrich, Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung. Eine logische Einleitung in die historischen Wissenschaften. – Tübingen und Leipzig: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) 1902 (hinfort: Rickert, Grenzen), S. 336–370. Charakteristische Formulierung: „Wir fragen nur danach, wie die Einzigartigkeit den Grund der Einheit bilden kann, und da muß die Antwort lauten, daß ln-dividuen auf einen Werth bezogene Individuen sind.“ Ebd., S. 351 f. Weber übernimmt diese Lehre vor allem in seinem „Objektivitäts“-Aufsatz, der parallel zur ersten Folge der „Protestantischen Ethik“ entstand (vgl. die Einleitung, oben, S. 12–22). Zum Begriff „historisches Individuum“ vgl. Weber, Objektivität, S. 53–59.
Ein solcher historischer Begriff aber kann, da er inhaltlich sich auf eine in ihrer individuellen Eigenart bedeutungsvolle Erscheinung bezieht, nicht nach dem Schema: „genus proximum, differentia specifica“ definiert (zu deutsch: „abgegrenzt“),
2
sondern er muß aus seinen einzelnen[,] der geschichtlichen Wirklichkeit zu entnehmenden Bestandteilen komponiert werden. Die endgültige begriffliche Erfassung kann nicht am Anfang, sondern nur am Schluß der Untersuchung stehen: es wird sich m.a. W. erst im Lauf der Erörterung und als deren wesentliches Ergebnis zu zeigen haben, wie das, was wir hier unter dem „Geist“ des Kapitalismus verstehen, am besten – d. h. für die uns hier interessierenden Gesichtspunkte adäquatesten – zu formulieren sei. Diese „Gesichtspunkte“ wiederum (von denen noch zu reden sein wird) Abgekürzte Form; nach der mittelalterlichen Schullogik heißt es: „definitio fiat per genus proximum et differentias specificas“ (nach Aristoteles, bei dem jede Definition aus der Angabe der Gattungs- und Artmerkmale besteht; Topik VI, 5, 143 a 15). Vgl. Weber, Objektivität, S. 54. Auch hier folgt Weber Rickert, der zwischen individualisierender und generalisierender Begriffsbildung unterschied. Letztere ziele unter anderem auch auf Gattungsbegriffe. Vgl. Rickert, Grenzen (wie voherige Anm. 1), S. 123–146, wo er die Dreistufigkeit naturwissenschaftlicher Begriffsbildung als fortschreitende Entfernung von Anschaulichkeit durch Vereinfachung darstellt (empirische Allgemeinheit, Klassifikation, unbedingt allgemeine Geltung).
3
sind nun nicht etwa [142]die einzig möglichen, unter denen die historischen Erscheinungen, die wir betrachten, analysiert werden können. Andere Gesichtspunkte der Betrachtung würden hier, wie bei jeder historischen Erscheinung, andere Züge als die „wesentlichen“ ergeben: – woraus ohne weiteres folgt, daß man unter dem „Geist“ des Kapitalismus durchaus nicht notwendig nur das verstehen könne oder müsse, was sich uns als das für unsere Auffassung „Wesentliche“ daran darstellen wird. Das liegt eben im Wesen der „historischen Begriffsbildung“, welche für ihre methodischen Zwecke die geschichtliche Wirklichkeit nicht in abstrakte Gattungsbegriffe einzuschachteln, sondern in konkrete Zusammenhänge von stets und unvermeidlich individueller Färbung einzugliedern strebt. Zur Rolle der gesichtspunktabhängigen Erkenntnis in den Kulturwissenschaften vgl. Weber, Objektivität, S. 46 ff.
Soll gleichwohl eine Feststellung des Objektes, um dessen Analyse und historische Erklärung es sich handelt, gegeben werden, – wie dies ja notgedrungen geschehen muß, – so kann es sich also nicht um eine begriffliche „Definition“, sondern nur um eine provisorische Veranschaulichung dessen handeln, was hier mit dem „Geist“ des Kapitalismus gemeint ist. Eine solche ist nun in der Tat zum Zwecke einer Verständigung über den Gegenstand der Untersuchung unentbehrlich, und wir halten uns zu diesem Behufe an ein Dokument jenes „Geistes“, welches das, [A 13]worauf es hier zunächst ankommt, in nahezu klassischer Reinheit enthält:
4
[142]Zu den Passagen aus Benjamin Franklins Werk vgl. Webers Angaben, unten, S. 145 mit Fn. 18. Weber folgt weitgehend der Textauswahl und der Übersetzung von Ferdinand Kürnberger in seinem Roman „Der Amerika-Müde“, S. 19–21, korrigiert die Übersetzung aber auch anhand des Originals in der von Sparks herausgegebenen Werkausgabe, vgl. unten, S. 145, Fn. 19. Bei der ersten Passage (S. 142, Z. 22 – S. 144, Z. 24) handelt es sich um einen Auszug aus dem Traktat „Advice to a young tradesman“ (Sparks, Works of Franklin II, p. 87–89), bei der zweiten (S. 145, Z. 1–13) um einen Auszug aus Franklins „Necessary hints to those that would be rich“ (Sparks, ebd. II, p. 80 f.). Die Eingangssätze und Schlußpassagen beider „Essays“ fehlen bei Weber und Kürnberger. Franklin, Advice, p. 87, beginnt mit „To my Friend, A. B.“, und endet mit „An Old Tradesman“. – Vgl. auch den Editorischen Bericht, oben, S. 109–111.
„Bedenke
o
,[142]o-o (bis S. 145: aufläuft.“) Petitdruck in A.
5
daß die Zeit Geld Der Text beginnt wie bei Kürnberger. Im Original folgt auf die Überschrift („Advice to a young tradesman. Written in the year 1748“) und die Widmung (vgl. oben, Anm. 4) ein diese aufgreifender Eingangssatz.
6
ist; wer täglich zehn Schillinge durch seine Arbeit erwerben könnte Bei Franklin hervorgehoben: „time“, bei Kürnberger: „Geld“.
7
und den halben Tag spazie[143]ren geht, oder auf seinem Zimmer faulenzt, der darf, auch wenn er nur sechs Pence für sein Vergnügen ausgibt, nicht dies allein berechnen, er hat nebendem noch fünf Schillinge ausgegeben oder vielmehr weggeworfen. Bei Kürnberger hervorgehoben: „könnte“, bei Franklin nicht hervorgehoben.
Bedenke, daß Kredit Geld ist.
8
Läßt jemand sein Geld, nachdem es zahlbar ist, bei mir stehen, so schenkt er mir die Interessen, oder so viel als ich während dieser Zeit damit anfangen kann. Dies beläuft sich auf eine beträchtliche Summe, wenn ein Mann guten und großen Kredit hat und guten Gebrauch davon macht. [143]Bei Franklin hervorgehoben: „credit“, bei Kürnberger ohne Hervorhebung.
Bedenke, daß Geld von einer zeugungskräftigen und fruchtbaren Natur ist.
9
Geld kann Geld erzeugen und die Sprößlinge können noch mehr erzeugen und so fort. Fünf Schillinge umgeschlagen sind sechs, wieder umgetrieben sieben Schilling drei Pence und so fort bis es hundert Pfund Sterling sind. Je mehr davon vorhanden ist, desto mehr erzeugt das Geld beim Umschlag, so daß der Nutzen schneller und immer schneller Weber folgt hier nicht Kürnberger, sondern dem Original („prolific, generating nature“).
10
steigt. Wer ein Mutterschwein tötet, vernichtet Wiedergabe nach Franklin: „[…] so that the profits rise quicker and quicker“, während Kürnberger mit „höher und höher“ übersetzt.
11
dessen ganze Nachkommenschaft bis ins tausendste Glied. Wer ein Fünfschillingsstück umbringt, mordet alles, was damit hätte produziert werden können, ganze Kolonnen von Pfund Sterling. Im Englischen: „kills“ („tötet“) und „destroys“ („vernichtet“).
12
Bei Franklin heißt es (Advice, p. 88): „He that murders a crown, destroys all that it might have produced, even scores of pounds.“ (Kürnberger, Der Amerika-Müde, S. 20, übersetzt: „Der Verschwender d. h. der Mörder von einem Schilling bringt seinen Enkel um eine Million.“) – Es folgt bei Franklin (ebd.) ein Abschnitt, der inhaltlich weitgehend mit der Passage übereinstimmt, die unten, S. 145, Z. 1–13, aus „Necessary hints“ zitiert ist. Der Abschnitt fehlt auch bei Kürnberger.
Bedenke, daß – nach dem Sprichwort
13
– ein guter Zahler der Herr von jedermanns Beutel ist. Wer dafür bekannt ist, pünktlich zur versprochenen Zeit zu zahlen, der kann zu jeder Zeit alles Geld entlehnen, was seine Freunde gerade nicht brauchen. Einfügung Webers nach Franklin; „this saying“ fehlt bei Kürnberger. Der Wortlaut des Sprichworts ist bei Franklin hervorgehoben.
14
Ohne Absatz bei Franklin und Kürnberger.
Dies ist bisweilen von großem Nutzen. Neben Fleiß und Mäßigkeit
15
trägt nichts so sehr dazu bei, einen jungen Mann in der Welt [144]vorwärts zu bringen, Im Englischen: „industry and frugality".
16
als Pünktlichkeit und Gerechtigkeit bei allen seinen Geschäften.[144]Hervorhebung von Weber.
17
Deshalb behalte niemals erborgtes Geld eine Stunde länger als du versprachst, damit nicht der Ärger darüber deines Freundes Börse dir auf immer verschließe. Franklin: „in all his dealings“, Kürnberger: „in seinem Handel“.
Die unbedeutendsten Handlungen, die den Kredit eines Mannes beeinflussen, müssen von ihm beachtet werden.
18
Der Schlag deines Hammers, den dein Gläubiger um 5 Uhr morgens oder um 8 Uhr abends Weber lehnt sich hier, anders als Kürnberger, eng an Franklin an („The most trifling actions that affect a man’s credit are to be regarded.“).
19
vernimmt, stellt ihn auf sechs Monate zufrieden; sieht er dich aber am Billardtisch oder hört er deine Stimme im Wirtshause, wenn du bei der Arbeit sein solltest, Bei Franklin und Kürnberger: 9 Uhr abends.
20
so läßt er dich am nächsten Morgen um die Zahlung mahnen, und fordert sein Geld, bevor du es zur Verfügung hast. Der Nebensatz fehlt bei Kürnberger, Weber hält sich an das Original.
21
Nach Kürnberger. Franklin, Advice, p. 88: „[…] demands it, before he can receive it, in a lump.“
Außerdem zeigt dies, daß du ein Gedächtnis für deine Schulden hast, es läßt dich als einen ebenso sorgfältigen wie ehrlichen Mann erscheinen, und das vermehrt deinen Kredit.
22
Weber folgt Kürnberger; Franklin, Advice, p. 88: „[…] mindful of what you owe; […] and that still increases your credit.“ Hervorhebungen von Weber.
Hüte dich, daß du alles was du besitzest für dein Eigentum hältst und demgemäß lebst. In diese Täuschung geraten viele Leute, die Kredit haben. Um dies zu verhüten, halte eine genaue Rechnung
23
über deine Ausgaben und dein Einkommen. Machst du dir die Mühe, einmal auf die Einzelheiten zu achten, so hat das folgende gute Wirkung: Auslassung, auch bei Kürnberger. Bei Franklin, Advice, p. 89 folgt: „for some time“.
24
Du entdeckst was für wunderbar kleine Ausgaben zu großen Summen [A 14]anschwellen Weber bleibt im Vorangehenden gegenüber Kürnberger näher an Franklin.
25
und du wirst bemerken, was hätte gespart werden können und was in Zukunft gespart werden kann. Bei Franklin, Advice, p. 89: „[…] you will discover how wonderfully small, trifling expenses mount up to large sums […]“. Weber folgt hier der Wiedergabe Kürnbergers.
26
… Franklin, ebd., fährt fort: „[…] without occasioning any great inconveniance.“ Dies fehlt bei Weber und Kürnberger. – Der Schlußabschnitt von Franklin, Advice, in dem [145]der „Old Tradesman“ seine Ratschläge zusammenfaßt, der Weg zum Reichtum gründe auf „industry and frugality; that is, waste neither time nor money“ (p. 89), wird weder von Weber noch von Kürnberger wiedergegeben.
[145]Für
27
6 £ jährlich kannst du den Gebrauch von 100 £ haben, vorausgesetzt, daß du ein Mann von bekannter Klugheit und Ehrlichkeit bist. Wer täglich einen Groschen nutzlos ausgibt, gibt an 6 £ jährlich nutzlos aus, und das ist der Preis für den Gebrauch von 100 £. Wer täglich einen Teil seiner Zeit zum Werte eines Groschen verschwendet (und das mögen nur ein paar Minuten sein), verliert, einen Tag in den andern gerechnet, das Vorrecht 100 £ jährlich zu gebrauchen. Oben, Z. 1–13, gibt Weber eine Passage aus Franklin, Necessary hints, p. 80 f., wieder. Bei Franklin folgt nach der Überschrift („Necessary hints to those that would be rich. Written in the Year 1736“) der Eingangssatz: „The use of money is all the advantage there is in having money“ (p. 80), den Weber ausläßt. Kürnberger wählt einen Einstieg, der an den ausgelassenen Abschnitt aus Franklin, Advice (vgl. oben, S. 144 f., Anm. 26), angelehnt ist. Bei Franklin bildet im folgenden jeder Satz einen eigenen Abschnitt.
28
Wer nutzlos Zeit im Wert von 5 Schillingen vergeudet, verliert 5 Schillinge und könnte ebenso gut 5 Schillinge ins Meer werfen. Wer 5 Schillinge verliert, verliert nicht nur die Summe, sondern alles was damit bei Verwendung im Gewerbe hätte verdient werden können, – was, wenn ein junger Mann ein höheres Alter erreicht, zu einer ganz bedeutenden Summe aufläuft.“ Weber gibt die ersten drei Sätze von Franklin, Necessary hints, inkl. des bei Franklin nicht enthaltenen Klammerzusatzes nahezu wörtlich nach Kürnberger wieder. Bei Weber und Kürnberger fehlt im letzten Satz die Wiedergabe von „idly“ („He that wastes idly a groat’s worth […]“, Franklin, ebd., p. 81), und beide korrigieren „[…] wastes the privilege of using one hundred pounds each day“ (ebd.) zu „[…] jährlich“.
o
[145]o(ab S. 142: „Bedenke […])–o Petitdruck in A.
29
Weber folgt in den letzten beiden Sätzen Franklin, Necessary hints, während Kürnberger, Der Amerika-Müde, S. 21, zwei abweichende Schlußsätze hat. Bei Franklin, Necessary hints, p. 81, im zuletzt wiedergegebenen Satz: „[…] but all the advantage that might be made by turning it in dealing […].“ – Die zweite Hälfte des Franklinschen Essays geben Weber und Kürnberger nicht wieder.
Es ist Benjamin Franklin,
18)
der in diesen Sätzen – den gleichen, die[145][A 14]Der Schlußpassus aus: Necessary hints to those that would be rich (geschrieben 1736), das Übrige aus: Advice to a young tradesmann (1748), Works ed. Sparks Vol. II p. 87.
19)
Ferdinand Kürnberger in seinem geist- und giftsprühenden „amerikanischen Kulturbilde“ In etwas freierer Übertragung, die hier nach dem Original korrigiert ist.
20)
als Glaubensbekenntnis des Yan[146]keetums verhöhnt „Der Amerikamüde“ (Frankfurt 1855), bekanntlich eine dichterische Paraphrase der amerikanischen Eindrücke Lenaus.
30
Das Buch wäre als Kunstwerk heute etwas [146]schwer genießbar, aber es ist als Dokument der (heute längst verblaßten) Gegensätze deutschen und amerikanischen Empfindens, man kann auch sagen: jenes Innenlebens, wie es seit der deutschen Mystik des Mittelalters den deutschen Katholiken (K[ürnberger] war liberaler Katholik) und Protestanten trotz alledem gemeinsam geblieben ist, gegen puritanisch-kapitalistische Tatkraft schlechthin unübertroffen. | Der österreichische Dichter Nikolaus Lenau wollte sich 1832 als Farmer in Nordamerika niederlassen, kehrte aber bereits ein Jahr später enttäuscht nach Europa zu[146]rück. (Heute versteht man Kürnbergers Roman in erster Linie als kritische Gegenstimme zu Ernst Willkomms Roman „Die Europamüden" (1838). Der Bezug auf Lenau tritt dagegen zurück.)
31
– zu uns predigt. Daß es der „Geist des Kapitalismus“ ist, der aus ihm in charakteristischer Weise redet, wird niemand bezweifeln, so wenig etwa behauptet werden soll, daß nun alles, was man unter diesem „Geist“ verstehen kann, darin enthalten sei. Verweilen wir noch etwas bei dieser Stelle, deren Lebensweisheit Kürnbergers „Amerikamüder“ dahin zusammenfaßt: „Aus Rindern macht man Talg, aus Menschen Geld“, „Amerikanisches Kulturbild“ lautet der Untertitel von Kürnberger, Der Amerika-Müde. – Die Passagen aus dem Werk Franklins werden in Kürnbergers Roman im Schulunterricht einer New Yorker Schule gelesen, wobei der Lehrer sie den Schülern als eine Anweisung zum Geldverdienen empfiehlt. Kürnberger karikiert diese Szene. Der dem Unterricht beiwohnende „amerika-müde“ Protagonist Dr. Moorfeld bemerkt, an den Lehrer gewandt, Franklin habe durch sein Leben ein höheres Ideal aufgestellt und mehr als auf der Bank in der Wissenschaft hinterlassen, etwa mit der Erfindung des Blitzableiters. „Ohne sie würden wir die Doctrine eines Mannes vor uns haben, der sich so weit vergessen hätte, unsre Bestimmung dahin zu definiren: Aus dem Rinde macht man Talg, aus dem Menschen Geld. Mag sein, daß ein unfertiges Volk eine Zeitlang auf diesen Standpunkt sich herabstellen muß, ein fertiges aber sagt: Geist macht man aus dem Menschen, nicht Geld!“ (Kürnberger, Der Amerika-Müde, S. 21).
32
so fällt als das Eigentümliche in dieser „Philosophie des Geizes“ der Gedanke der Verpflichtung des einzelnen gegenüber dem als Selbstzweck vorausgesetzten Interesse an der Vergrößerung seines Vermögens auf. Zitiert oben, Anm. 31.
Wenn Jakob Fugger einem Geschäftskollegen, der sich zur Ruhe gesetzt hat und ihm zuredet das gleiche zu tun, da er nun „lang genug gewonnen“ habe und andere auch gewinnen lassen [A 15]solle, dies als „Kleinmut“ verweist und antwortet: „er (Fugger) hätte viel einen andern Sinn, wollte gewinnen dieweil er könnte“,
21)
so unter[147]scheidet sich der „Geist“ dieser Äußerung offensichtlich von Franklin: was dort als Ausfluß kaufmännischen Wagemuts und einer persönlichen sittlich indifferenten Neigung geäußert wird, nimmt hier den Charakter einer ethisch gefärbten Maxime der Lebensführung an. In diesem spezifischen Sinne wird hier der Begriff „Geist des Kapitalismus“ gebraucht.[A 15]Sombart hat dies Zitat aus einem Fuggerschen Promemoria dem Abschnitt über die „Genesis des Kapitalismus“ (Der moderne Kapitalismus Band I S. 193 cf. das. S. 396
p
) als Motto vorgesetzt.[146]A: 390
33
Weber zitiert hier aus einem „Motto“ Sombarts zum Zweiten Buch: Sombart, Der moderne Kapitalismus I, überschrieben „Die Genesis des modernen Kapitalismus“ [147](ebd., S. 193; dass. S. 396). Für Sombart ist Jakob Fugger der mit kapitalistischem Geist beseelte neue Unternehmer. Er folge einem auf Kalkulation und Spekulation basierenden Geschäftssinn: „Er wolle gewinnen, dieweil er könne – das wird die Devise des kapitalistischen Unternehmers“ (S. 397).
22)
[147]Darauf beruht die gegenüber Sombart etwas andere Problemstellung hier. Die sehr erhebliche praktische Bedeutung des Unterschieds wird später hervortreten.
34
Übrigens sei schon hier bemerkt, daß Sombart diese ethische Seite des kapitalistischen Unternehmers Gemeint sein dürfte: Weber, Protestantische Ethik II, unten, bes. S. 366–425.
q
keineswegs unbeachtet gelassen hat. Nur erscheint sie in seinem Gedankenzusammenhang naturgemäß als das vom Kapitalismus Bewirkte, während wir für unsere Zwecke hier die umgekehrte Hypothese als heuristisches Mittel in Betracht ziehen müssen. Endgültig kann erst am Abschluß der Untersuchung Stellung genommen werden.[147]A: Unternehmens
35
Für Sombarts Auffassung cf. a. a. O. I S. 357, 380 usw. Vermutlich bezieht sich Weber auf die geplante Fortsetzung seiner Artikelfolge; dazu die Einleitung mit Anhang, oben, S. 66 f. und 90–96.
36
Seine Gedanken[148]gänge knüpfen hier an die glänzenden Bilder in Simmels „Philosophie des Geldes“ (letztes Kapitel) an. Die beiden angegebenen Seitenzahlen können nicht stimmen. Aus dem Zusammenhang zu schließen, dürfte sich Weber bei Sombart, Der moderne Kapitalismus I, auf S. 381–390 beziehen. Sombart skizziert hier die „konkret-historische[n] Zusammenhänge“ (S. 381), wie sie seiner Auffassung nach zur Entstehung des Kapitalismus führten. Auf S. 383 heißt es: „Damit aber war die Zeit erfüllt, daß sich jener merkwürdige psychologische Prozeß in den Menschen abermals vollzog, dessen Verlauf uns neuerdings mit gewohnter Meisterschaft Georg Simmel geschildert hat: die Erhebung des absoluten Mittels – des Geldes – zum höchsten Zweck. In dem Maße, wie man die Wirksamkeit des Geldbesitzes, seine Fähigkeit des Allesverschaffens sah […], konzentriert sich von nun ab alles Streben in dem heißen, glühenden, unstillbaren Verlangen nach Geld.“
37
An dieser Stelle muß zunächst jede eingehende Auseinandersetzung zurückgestellt werden. [148]Vgl. Simmel, Philosophie des Geldes, 6. Kapitel, S. 455–554. Darin schildert er den „Stil des Lebens“ (Kapitelüberschrift), der mit der modernen Geldwirtschaft verbunden sei.
Allerdings sind nun alle moralischen Vorhaltungen Franklins utilitarisch gewendet: die Ehrlichkeit ist nützlich, weil sie Kredit bringt, die Pünktlichkeit, der Fleiß, die Mäßigkeit ebenso, und nur deshalb sind sie Tugenden: – woraus u.a. folgen würde, daß, wo z. B. der Schein der Ehrlichkeit den gleichen Dienst tut, dieser genügen und ein unnötiges Surplus an dieser Tugend als unproduktive Verschwendung in den Augen Franklins verwerflich erscheinen müßte. [148]Und in der Tat: wer in seiner Selbstbiographie die Erzählung von seiner „Bekehrung“ zu jenen Tugenden
23)
oder [A 16]vollends die Ausführungen über den Nutzen, den die strikte Aufrechterhaltung des Scheines der Bescheidenheit, des geflissentlichen Zurückstellens der eigenen Verdienste[,] für die Erreichung allgemeiner Anerkennung In deutscher Übersetzung:
38
„Ich überzeugte mich endlich, daß Wahrheit, Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit im Verkehr zwischen Mensch und Mensch von höchster Wichtigkeit für unser Lebensglück seien, und entschloß mich von jenem Augenblick an und schrieb auch den Entschluß in mein Tagebuch, sie mein Lebenlang zu üben. Die Offenbarung als solche hatte jedoch in der Tat kein Gewicht bei mir, sondern ich war der Meinung, daß, obschon gewisse Handlungen nicht schlecht, bloß weil die offenbarte Lehre sie verbietet, oder gut deshalb seien, weil sie selbige vorschreibt, doch – in Anbetracht aller Umstände – jene Handlungen uns wahrscheinlich nur, weil sie ihrer Natur nach schädlich Weber folgt der Übersetzung der Lebenserinnerungen Franklins von Berthold Auerbach, hg. von Friedrich Kapp; Zitat: Franklin, Sein Leben, S. 227. (Webers Handexemplar, das er von Kapp im Jugendalter geschenkt bekommen hatte, befindet sich in der Max Weber-Arbeitsstelle, BAdW München; vgl. die Einleitung, oben, S. 52, Anm. 1, und den Editorischen Bericht, oben, S. 110 mit Anm. 55.)
39
sind, verboten, oder weil sie wohltätig sind, uns anbefohlen worden seien.“ | Bei Franklin, ebd., heißt es: „schlecht“, nicht „schädlich“.
24)
habe, liest, muß notwendig zu dem Schluß kommen, daß nach Franklin jene wie alle Tugenden auch nur soweit Tugenden sind, als sie in concreto dem einzelnen „nützlich“ sind[,] und das [149]Surrogat des bloßen Scheins überall da genügt, wo es den gleichen Dienst leistet – eine für den strikten Utilitarismus in der Tat unentrinnbare Konsequenz. Das, was Deutsche an den Tugenden des Amerikanismus als „Heuchelei“ zu empfinden gewohnt sind, scheint hier in flagranti ertappt[A 16]„Ich rückte mich soviel wie möglich aus den Augen und gab es“ – nämlich die von ihm angeregte Schöpfung einer Bibliothek
40
– „für ein Unternehmen einer ,Anzahl von Freunden‘ aus, welche mich gebeten hätten, herumzugehen und es denjenigen Leuten vorzuschlagen, welche sie für Freunde des Lesens hielten. Auf diese Weise ging mein Geschäft glatter von statten, und ich bediente mich dieses Verfahrens hernach immer bei derartigen Gelegenheiten und kann es nach meinen häufigen Erfolgen aufrichtig Franklin, ebd., S. 276 f. Franklin und seine Diskussions-Freunde des „Junto-Clubs“ gründeten 1731 die erste öffentliche Leihbibliothek in Amerika.
41
empfehlen. Das augenblickliche kleine Opfer der Eigenliebe, welches man dabei bringt, wird später reichlich vergolten werden. Wenn es eine Zeitlang unbekannt bleibt, wem das eigentliche Verdienst gebührt, wird irgend jemand, der eitler als der betreffende ist, ermutigt werden, das Verdienst zu beanspruchen, und dann wird der Neid selbst geneigt sein, dem ersten Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, indem er jene angemaßten Federn ausreißt und sie ihrem rechtmäßigen Eigentümer zurückgibt.“ | Bei Franklin, ebd., S. 276: „herzlich“, nicht „aufrichtig“.
r
. – Allein so einfach liegen die Dinge in Wahrheit keineswegs. Nicht nur Benjamin Franklins eigener Charakter, wie er gerade in der immerhin seltenen Ehrlichkeit seiner Selbstbiographie zutage tritt, und der Umstand, daß er die Tatsache selbst, daß ihm die „Nützlichkeit“ der Tugend aufgegangen sei, auf eine Offenbarung Gottes zurückführt, der ihn dadurch zur Tugend bestimmen wollte,[149]A: zu ertappen
42
zeigen, daß hier doch noch etwas anderes als eine Verbrämung rein egozentrischer Maximen vorliegt. Sondern vor allem ist das „summum bonum“ dieser „Ethik“, der Erwerb von Geld und immer mehr Geld, unter strengster Vermeidung alles unbefangenen Genießens, so gänzlich aller eudämonistischen oder gar hedonistischen Gesichtspunkte entkleidet, so rein als Selbstzweck gedacht, daß es als etwas gegenüber dem „Glück“ oder dem „Nutzen“ des einzelnen Individuums jedenfalls gänzlich Transzendentes und schlechthin Irrationales erscheint. Der Mensch ist auf das Erwerben als Zweck seines Lebens, nicht mehr das Erwerben auf den Menschen als Mittel [A 17]zum Zweck der Befriedigung seiner materiellen Lebensbedürfnisse bezogen. Diese für das unbefangene Empfinden schlechthin sinnlose Umkehrung des, wie wir sagen würden, „natürlichen“ Sachverhalts ist nun ganz offenbar ebenso unbedingt ein Leitmotiv des Kapitalismus, wie sie dem von seinem Hauche nicht berührten Menschen fremd ist. Aber sie enthält zugleich eine Empfindungsreihe, welche sich mit gewissen religiösen Vorstellungen eng berührt. Fragt man nämlich: warum denn „aus Menschen Geld gemacht“ werden soll,[149]Zur „Offenbarung Gottes“ als Franklins Quelle der Tugend vgl. das Zitat oben, S. 148, Fn. 23. Vgl. auch Franklin, Sein Leben, S. 281 ff.
43
so antwortet Benjamin Franklin, obwohl selbst konfessionell farbloser Deist, Kürnberger, Der Amerika-Müde, S. 21; im Zitat oben, S. 146, Anm. 31.
44
in seiner Autobiographie darauf mit einem Bibelspruch, [150]den, wie er sagt, sein streng calvinistischer Vater ihm in der Jugend immer wieder eingeprägt habe: Weber nimmt hier Franklins Selbstbezeichnung auf (Franklin, Sein Leben, S. 226: „vollkommener Deist“). Als Deist konnte Franklin von sich selbst sagen, er sei „niemals ohne einige religiöse Grundsätze“ gewesen. „Ich bezweifelte z. B. niemals das Dasein Gottes, bezweifelte nie, daß er die Welt geschaffen habe und durch seine Vorsehung [150]leite; daß der passendste Gottesdienst darin bestehe, den Menschen Gutes zu erweisen […]“ (S. 280).
45
„Siehst du einen Mann rüstig in seinem Beruf, so soll er vor Königen stehen.“ Er habe „eine fromme Erziehung in den Grundsätzen der Lehre Calvin’s“ erhalten, schreibt Franklin (Sein Leben, S. 225), an anderer Stelle, er sei „gewissenhaft und fromm als Presbyterianer“ erzogen worden (S. 279 f.).
25)
[150][A 17]Spr. Sal. c. 22 v. 29. Luther übersetzt: „in seinem Geschäft“,
47
die älteren englischen Bibelübersetzungen „business“. In Spr 22,29 übersetzt Luther bereits 1524 in einer Teilausgabe des AT, welche die Sprüche Salomos enthält (dass. 1545), „ynn seynem geschefft“ (vgl. Luther, WA.DB, Band 10/II, z.St.). Weber dürfte allerdings einer modernen Lutherbibel folgen (auch [1892]: „in seinem Geschäft“), vgl. den Editorischen Bericht, oben, S. 113 f.
48
S[iehe] darüber weiter unten. Weber stützt sich sehr wahrscheinlich auf die „authorised version“ von 1611, die „businesse“ übersetzt. („business“ übersetzen auch Coverdale 1535, Cranmer 1539, Geneva 1560 und Parker 1568, während Wyclif und das katholische, 1609 in Douay erschienene AT „werc“ bzw. „worke“ haben; bei Murray, James A. H., A New English Dictionary on Historical Principles, vol. 1. – Oxford: Clarendon Press 1887, s.v. business, p. 1205 f. Zu den Bibeln vgl. den Editorischen Bericht, oben, S. 118 f.)
49
| Siehe unten, S. 187, Fn. 40.
46
Der Gelderwerb ist – sofern er in legaler Weise erfolgt – innerhalb der modernen Wirtschaftsordnung das Resultat, und der Ausdruck der Tüchtigkeit im Beruf und diese Tüchtigkeit ist, wie nun unschwer zu erkennen ist, das wirkliche A und O der Moral Franklins, wie sie in der zitierten Stelle ebenso wie in allen seinen Schriften ohne Ausnahme uns entgegentritt. Franklin, ebd., S. 278, dort „redlich“, nicht „rüstig“.
In der Tat: jener eigentümliche, uns heute so geläufige und in Wahrheit doch so wenig selbstverständliche Gedanke der Berufspflicht, einer Verpflichtung, die der Einzelne empfinden soll und empfindet gegenüber dem Inhalt seiner „beruflichen“ Tätigkeit, gleichviel worin sie besteht, gleichviel insbesondere ob sie dem unbefangenen Empfinden als reine Verwertung seiner Arbeitskraft oder gar nur seines Sachgüterbesitzes (als „Kapital“) erscheinen muß, – dieser Gedanke ist es, welcher der „Sozialethik“ der kapitalistischen Kultur charakteristisch, ja in gewissem Sinne für sie von konstitutiver Bedeutung ist. Nicht als ob er nur auf dem Boden des Kapitalismus gewachsen wäre: wir werden ihn vielmehr später in die Vergangenheit zurück zu verfolgen suchen. Und noch weniger soll natürlich behauptet werden, daß für den heutigen Kapita[151]lismus die subjektive Aneignung dieser ethischen Maxime durch seine einzelnen Träger, etwa die Unternehmer oder die Arbeiter der modernen kapitalistischen Betriebe, Bedingung der Fortexistenz sei. Die heutige kapitalistische Wirtschaftsordnung ist ein ungeheurer Kosmos, in den der einzelne [A 18]hineingeboren wird und der für ihn, wenigstens als einzelnen, als faktisch unabänderliches Gehäuse, in dem er zu leben hat, gegeben ist. Er zwingt dem Einzelnen, soweit er in den Zusammenhang des „Marktes“ verflochten ist, die Normen seines wirtschaftlichen Handelns auf. Der Fabrikant, welcher diesen Normen dauernd entgegenhandelt, wird ökonomisch ebenso unfehlbar eliminiert, wie der Arbeiter, der sich ihnen nicht anpassen kann oder will, als Arbeitsloser auf die Straße gesetzt wird.
26)
[151][A 18]Wenn man den auf sozialdemokratischen Parteitagen gefallenen Satz: „wer nicht pariert, fliegt hinaus“,
51
als „Kasernenton“ bezeichnet hat, so ist das ein arges Mißverständnis: aus der Kaserne fliegt der Renitente keineswegs „hinaus“, sondern erst recht „hinein“ – in die Arrestzelle nämlich. Sondern es ist das ökonomische Lebensschicksal des modernen Arbeiters, wie er es auf Schritt und Tritt erlebt, welches er in der Partei wiederfindet und erträgt: die Disziplin in der Partei ist Widerspiegelung der Disziplin in der Fabrik. | August Bebel gebrauchte die Parole auf dem Dresdner Parteitag 1903: „Der Parteitag kann nur Direktiven geben, er kann die Marschroute angeben. Tut er das, so muß die Fraktion danach marschieren, sie mag wollen oder nicht. […] Es wäre auch noch schöner, wenn es anders wäre, da würde es allerdings heißen: Wer nicht pariert, fliegt hinaus.“ Protokoll über die Verhandlungen des Parteitages der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Abgehalten zu Dresden vom 13. bis 20. September 1903. – Berlin: Expedition der Buchhandlung Vorwärts 1903, S. 298–321, Zitat S. 308. Letzter Satz zitiert etwa in der FZ, 48. Jg., Nr. 259 vom 18. Sept. 1903, 2. Mo.Bl., S. 1, und im Heidelberger Tageblatt, Nr. 220 vom 21. Sept. 1903, S. 1 (allerdings jeweils ohne den Kommentar „Kasernenton“).
Der heutige, zur Herrschaft im Wirtschaftsleben gelangte Kapitalismus also erzieht und schafft sich im Wege der „ökonomischen Auslese“
50
die Wirtschaftssubjekte – Unternehmer und Arbeiter –, deren er bedarf. Allein gerade hier kann man die Schranken des „Auslese“-Begriffes als Mittel der Erklärung historischer Erscheinungen mit Händen greifen. Damit jene der Eigenart des Kapita[152]lismus „angepaßte“ Art der Lebensführung und „Berufs“-Auffassung „ausgelesen“ werden, über andere den Sieg davon tragen konnte, mußte sie offenbar zunächst entstanden sein, und zwar nicht in einzelnen isolierten Individuen, sondern als eine Anschauungsweise, die von Menschengruppen getragen wurde. Diese Entstehung ist also das eigentlich zu Erklärende. Auf die Vorstellung des naiven Geschichtsmaterialismus, daß derartige „Ideen“ als „Wiederspiegelung“ oder „Überbau“ ökonomischer Situationen ins Leben treten, werden wir eingehender erst später zu sprechen kommen.[151]Weber verwendet mit dem Begriff „Auslese“ darwinistische Begrifflichkeit. Auf das Wirtschaftsleben bezieht er ihn bereits in seiner Vorlesung „Allgemeine (,theoretische‘) Nationalökonomie“, MWG III/1, „Die natürliche Auslese beim Menschen“, S. 351–358. Er betont, daß nicht naturgesetzliche Ausleseprozesse, sondern „menschl[iche] Institutionen [und] Formen der W[irtschafts]Verfassung“ dabei von Bedeutung seien (ebd., S. 353).
52
An dieser Stelle genügt es für unseren Zweck wohl, darauf hinzuweisen, daß jedenfalls ohne Zweifel im Geburtslande Benjamin Franklins (Massachusetts) der „kapitalistische Geist“ (in unserem hier angenommenen Sinn) vor der „kapitalistischen Entwicklung“ da war, daß er z. B. in den Nachbarkolonien – den späteren Südstaaten der Union – ungleich unentwickelter geblieben war, und zwar trotzdem diese letzteren von großen Kapitalisten zu Geschäftszwecken,[152]Anspielung auf das Basis-Überbau-Schema des historischen Materialismus, etwa im „Kommunistischen Manifest“ (vgl. Weber, Objektivität, S. 42). Siehe dazu unten, S. 174.
53
die Neuengland-Kolonien aber von Predigern und „Graduates“ in Verbindung mit Kleinbürgern, Handwerkern und Yeomen Vgl. Doyle, The English in America I (Doyle wird von Weber, Protestantische Ethik II, unten, S. 248, Fn. 4, eingeführt), p. 134: „Virginia was the offspring of economical distress, as New England was of ecclesiastical conflicts.“ Die Kolonialisierung Virginias z. B. erfolgte durch englische Handelsgesellschaften. Die ersten Kolonisten hofften, Gold und andere Bodenschätze zu finden und schnell zu Reichtum zu kommen (1606–1608). Nach Mißerfolgen sicherte schließlich der Tabakanbau und -export die Existenz der Siedler. Vgl. Doyle, ebd., „The Virginia Company“, p. 134–245.
54
aus religiösen Gründen ins Leben gerufen wurden. Die Prediger namentlich bei Masson, Milton II, p. 554–563; der Hinweis auf „graduates“ (und die „yeomen“, die kleinen Grundbesitzer) auch bei Doyle, The English in America III (= The Puritan colonies II), p. 113 f.
55
[153]In [A 19]diesem Falle liegt also das Kausalverhältnis jedenfalls umgekehrt[,] als vom „materialistischen“ Standpunkt aus zu postulieren wäre. Aber die Jugend solcher „Ideen“ ist überhaupt dornenvoller, als die Theoretiker des „Überbaues“ annehmen, und ihre „Entwicklung“ vollzieht sich nicht wie die einer Blume. Der kapitalistische Geist in dem Sinne, den wir für diesen Begriff bisher gewonnen haben, hat sich in schwerem Kampf gegen eine Welt feindlicher Mächte durchzusetzen gehabt. Eine Gesinnung[,] wie sie in den zitierten Ausführungen Benjamin Franklins zum Ausdruck kam und den Beifall eines ganzen Volkes fand, wäre im Altertum wie im Mittelalter ebenso als Ausdruck des schmutzigsten Geistes und einer schlechthin würdelosen Gesinnung proskribiert worden, wie dies noch heute von allen denjenigen sozialen Gruppen regelmäßig geschieht, welche in die spezifisch moderne kapitalistische Wirtschaft am wenigsten verflochten oder ihr am wenigsten angepaßt sind. Nicht etwa deshalb, weil „der Erwerbstrieb“ in den „präkapitalistischen“ Epochen noch etwas Unbekanntes oder Unentwickeltes gewesen wäre Als Beispiele seien genannt: Plymouth, die erste Puritaner-Kolonie. Sie wurde von den „Pilgervätern“, die sich schon zuvor mit ihrer Flucht ins niederländische Leiden von der anglikanischen Staatskirche losgesagt hatten, zusammen mit anderen Auswanderern 1620 gegründet. Finanziert wurde die Unternehmung allerdings von Londoner Kaufleuten mit Gewinninteressen, doch konnte Plymouth sich bald wirtschaftlich selbst behaupten. Vgl. Doyle, The English in America II (= The Puritan colonies I), p. 14–108. – Massachusetts Bay etablierte sich bereits 1629 als „exclusively Puritan settlement“ (Doyle, ebd., p. 129). – Rhode Island geht auf den Separatisten Roger Williams zurück, einen Salemer Prediger (1631/32), der gegenüber der sich in der Massachusetts Bay etablierenden Kirche das voluntaristische Prinzip und größere Freiheiten forderte. Vgl. Doyle, ebd., p. 154 ff., 240 ff.
56
– wie man so oft gesagt hat – oder weil die „auri sacra fames“,[153]Möglicherweise ist Weber hierbei von Sombart angeregt. Nach diesem geht „das Erwachen des Erwerbstriebs“ (Sombart, Der moderne Kapitalismus I, S. 378–390, Kapitelüberschrift) mit einer während des Mittelalters intensivierten, die bisherigen Grenzen sprengenden „Wertung des Geldbesitzes“ einher (S. 381). Er meint, das überall und zu allen Zeiten vorhandene „Goldfieber“ habe zu bestimmten Zeiten „einen akuten Charakter“ angenommen (ebd.), so auch im ausgehenden Mittelalter.
57
die Geldgier, damals – oder auch heute – außerhalb des bürgerlichen Kapitalismus geringer wäre als innerhalb der spezifisch kapitalistischen Sphäre, wie die Illusion moderner Romantiker sich die Sache vorstellt. An diesem Punkt liegt der Unterschied kapitalistischen und präkapitalistischen „Geistes“ nicht: Die Habgier des chinesischen Mandarinen, des altrömischen Aristokraten, des rückständigsten modernen Agrariers hält jeden Vergleich aus. Und die „auri sacra fames“ des neapolitanischen Kutschers oder Barcajuolo oder vollends des asiatischen Vertreters ähnlicher Gewerbe, ebenso aber auch des Handwerkers südeuropäischer oder asiatischer Länder äußert sich, wie jeder an sich erfahren kann, sogar außerordentlich viel penetranter und insbesondere [154]skrupelloser als etwa diejenige des Engländers im gleichen Falle. Die absolute Skrupellosigkeit der Geltendmachung des Eigeninteresses ist gerade ein ganz spezifisches Charakteristikum solcher Länder, deren bürgerlich-kapitalistische Entwicklung „rückständig“ geblieben ist. Wie jeder Fabrikant weiß, ist die mangelnde „coscienziosità“ der Arbeiter Redewendung nach Vergil, Aeneis 3,56 f.: „quid non mortalia pectora cogis, auri sacra fames“ („wozu treibst du nicht die Herzen der Menschen, verfluchter Hunger nach Gold“). Für das „Goldfieber“ (vgl. vorherige Anm.) gebraucht auch von Sombart, Der moderne Kapitalismus I, S. 383.
27)
solcher Länder, etwa Italiens im Gegen[A 20]satz zu Deutschland, eines der Haupthemmnisse ihrer kapitalistischen Entfaltung gewesen und in gewissem Maße noch immer. Der Kapitalismus kann den praktischen Vertreter des undisziplinierten „liberum arbitrium“[154][A 19]Vgl. die in jeder Hinsicht treffenden Bemerkungen Sombarts, Die
s
deutsche Volkswirtschaft im neunzehnten Jahrhundert S. 123 oben.[154]A: die
62
Überhaupt brauche ich – obwohl die nachfolgenden Studien in ihren Gesichtspunkten auf viel ältere [A 20]Arbeiten zurückgehen – wohl nicht besonders zu betonen, wieviel Sombart, Volkswirtschaft, S. 123, äußert sich bei der Frage nach spezifischen charakterlichen Eigenschaften, die die deutsche Bevölkerung in besonderem Maße zur Ausbildung des Kapitalismus befähigten: „Dem Südländer, der die Gebiete nordischer und insonderheit deutscher Kultur bereist, fällt nichts so sehr auf, wie diese unverdrossene Pflichterfüllung in allen Schichten der Bevölkerung, […] diese Tüchtigkeit zu allen und in allen Dingen, diese durch nichts von ihrem Ziele abzubringende Gewissenhaftigkeit: die Coscienziosità, die den größten Unternehmer wie den letzten Tagelöhner in gleichem Maße erfüllt und die vielleicht ihren prägnantesten Ausdruck gerade in Deutschland in seinem Beamtentum findet.“ Im Handexemplar Max Webers (Max Weber-Arbeitsstelle, BAdW München) ist der Satz mit senkrechtem Randstrich markiert.
t
sie der bloßen Tatsache, daß Sombarts große Arbeiten mit ihren scharfen Formulierungen vorliegen, verdanken, [155]auch – und gerade – da, wo sie andere Wege gehen.Lies: wie viel
63
Auch wer durch Sombarts Formulierungen sich immer wieder zu entschiedenstem Widerspruch angeregt fühlt und manche Thesen direkt ablehnt, hat die Pflicht, sich dessen bewußt zu sein. Als geradezu blamabel muß das Verhalten der deutschen nationalökonomischen Kritik gegenüber diesen Arbeiten bezeichnet werden. Der erste und lange Zeit einzige, der eine eingehende sachliche Auseinandersetzung mit gewissen historischen Thesen Sombarts unternommen hat, war ein Historiker (v. Below in der Histor[ischen] Zeitschr[ift] 1903).[155]Gemeint sind: Sombart, Der moderne Kapitalismus I, II, und ders., Volkswirtschaft. Zu Sombart vgl. auch die Einleitung, oben, S. 35–39 u. ö.
64
– Was aber gegenüber den eigentlich nationalökonomischen Teilen von Sombarts Arbeiten an Kritik „geleistet“ worden ist, wäre mit dem Ausdruck „platt“ wohl noch zu höflich bezeichnet. Vgl. Below, Entstehung des modernen Kapitalismus.
65
| Weber war der Meinung, Sombarts Werk werde im Fach nicht angemessen gewürdigt. Schmollers Rezension, die des Lehrers, hielt er für zu subjektiv, Hans Delbrücks Rezension für fachfremd und inkompetent. (Vgl. Schmoller, G[ustav], [Rez.] Sombart, Werner, Der moderne Kapitalismus, in: Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft im Deutschen Reich, 27. Jg., Heft 1, 1903, S. 291–300, und Delbrück, [Hans,] Besprechung von Sombart, Der moderne Kapitalismus. – Die deutsche Volkswirthschaft im neunzehnten Jahrhundert, in: Preußische Jahrbücher, hg. von Hans Delbrück, 113. Band. – Berlin: Georg Stilke 1903, S. 333–350.) Vergeblich versuchte Weber, Lujo Brentano für eine sachgerechte Kritik zu gewinnen. Vgl. etwa Max Webers Briefe an denselben vom 4. Okt. 1903 und vom 9. und 28. März und 22. Mai 1904 (BA Koblenz, Nl. Lujo Brentano, Nr. 67, Bl. 161–164, 149–150, 147–148 und 159–160; MWG II/4), an Georg v. Below vom 17. Juli 1904 (GStA PK, VI. HA, Nl. Max Weber, Nr. 30, Band 4, BI. 95–96; MWG II/4) sowie an Heinrich Sieveking vom 1. Dez. 1904 (StA Hamburg, Nl. Heinrich Sieveking; MWG II/4). – Sämtliche Rezensionen zu Sombart, Der moderne Kapitalismus I und II, die im wesentlichen 1902 bis 1904 erschienen, sind dokumentiert (und z. T. abgedruckt) in: Sombarts ,Moderner Kapitalismus‘. Materialien zur Kritik und Rezeption, hg. und eingeleitet von Bernhard vom Brocke. – München: dtv 1987, S. 450–453.
58
als Arbeiter nicht brauchen, so wenig er, wie wir schon von Franklin lernen konnten,[154]liberum arbitrium (lat.), „freier Wille“, „freies Ermessen“.
59
den in seiner äußern Gebarung schlechthin skrupellosen Geschäftsmann brauchen kann. In der verschiedenen Entwicklung irgend eines „Triebes“ nach dem Gelde also liegt der Unterschied nicht. Die auri sacra fames ist so alt wie die uns bekannte Geschichte der Menschheit, wir werden aber sehen, Siehe oben, S. 142–145, dazu S. 145–150.
60
daß diejenigen, die ihr als Trieb sich vorbehaltlos hingeben – wie etwa jener holländische Kapitän, der „Gewinnes halber durch die Hölle fahren wollte, und wenn er sich die Segel ansengte“ Weber, Protestantische Ethik II, unten, bes. S. 366–425.
61
–[,] keineswegs die Vertreter der[155]jenigen Gesinnung waren, aus welcher der kapitalistische „Geist“ als Massenerscheinung – und darauf kommt es an – hervorbrach. In der von Weber, unten, S. 247, Fn. 4, zitierten Literatur bei Fruin, Tien Jaren, S. 232: „,Om winst zou de Hollandsche koopman door de hel varen, op gevaar af van er zijn zeilen te zengen‘, zoo pochte de koopman zelf.“
Vielmehr ist der Gegner, mit welchem der „Geist“ des Kapitalismus in erster Linie zu ringen hatte, jene Art des Empfindens und der Gebarung, die man als „Traditionalismus“ zu bezeichnen pflegt. Auch hier muß jeder Versuch einer abschließenden „Definition“ suspendiert werden, vielmehr machen wir uns – natürlich auch hier lediglich provisorisch – an einigen Spezialfällen deutlich, was damit gemeint ist, dabei von „unten“, bei den Arbeitern, beginnend.
Eins der technischen Mittel, welches der moderne Unternehmer anzuwenden pflegt, um von „seinen“ Arbeitern ein möglichstes Maximum von Arbeitsleistung zu erlangen, die „Intensität“ der Arbeit zu steigern, ist der Akkordlohn. In der Landwirtschaft z. B. [156]pflegt ein Fall, der die möglichste Steigerung der Arbeitsintensität [A 21]gebieterisch fordert, die Einbringung der Ernte zu sein, da, zumal bei unsicherem Wetter, an der denkbar größten Beschleunigung derselben oft ganz außerordentlich hohe Gewinn- oder Verlustchancen hängen. Demgemäß pflegt hier durchweg das Akkordlohnsystem verwendet zu werden. Und da mit Steigerung der Erträge und der Betriebsintensität das Interesse des Unternehmers an Beschleunigung der Ernte im allgemeinen immer größer zu werden pflegt, so hat man natürlich immer wieder versucht, durch Erhöhung der Akkordsätze die Arbeiter, denen so sich Gelegenheit bot, innerhalb einer kurzen Zeitspanne einen für sich außergewöhnlich hohen Verdienst zu machen, an der Steigerung ihrer Arbeitsleistung zu interessieren. Allein hier zeigten sich nun eigentümliche Schwierigkeiten: Die Heraufsetzung der Akkordsätze bewirkte auffallend oft nicht etwa, daß mehr, sondern daß weniger an Arbeitsleistung in der gleichen Zeitspanne erzielt wurde, weil die Arbeiter die Akkorderhöhung nicht mit Herauf-, sondern mit Herabsetzung der Tagesleistung beantworteten.
66
Der Mann, der z. B. bei 1 Mark pro Morgen Getreidemähen bisher 21/2 Morgen täglich gemäht und so 21/2 Mk. pro Tag verdient hatte, mähte nach Erhöhung des Akkordsatzes pro Morgen um 25 Pfg. nicht, wie gehofft wurde, angesichts der hohen Verdienstgelegenheit etwa 3 Morgen, um so 3 Mk. 75 Pfg. zu verdienen – wie dies sehr wohl möglich gewesen wäre –[,] sondern nur noch 2 Morgen pro Tag, weil er so ebenfalls 21/2 Mk. wie bisher verdiente und damit, nach biblischem Wort, „ihm genügen“[156]Dazu die Einsichten, die Weber aus der Landarbeiterenquête des Vereins für Socialpolitik gewonnen hatte. Dort schreibt er etwa über die Rübenarbeit in den mecklenburgischen Großherzogtümern und im Kreis Lauenburg: „Die Arbeiter verlangen meist, daß die Akkordsätze so angesetzt werden, daß ca. 50 Pf. bis 2 Mk. oder 25–50 % des Lohnes mehr verdient werden können, und arbeiten dann häufig nicht mehr, sondern kürzen die Arbeitszeit entsprechend, – eine Erscheinung, die sich bei Arbeitern mit hoher Lebenshaltung häufig, so auch in Pommern, findet.“ Weber, Landarbeiter, MWG I/3, S. 867 und 869; ähnlich S. 224, S. 574 f. Vgl. auch Weber, Die Erhebung des Vereins für Sozialpolitik über die Lage der Landarbeiter, in: MWG I/4, S. 120–153, hier S. 142 f. – Im folgenden handelt sich um ein „illustratives“ Rechenbeispiel (vgl. unten, S. 159, Fn. 28). Exakte Zahlen, die von Region zu Region schwanken, in: Weber, Landarbeiter, MWG I/3, passim.
67
ließ. Der Mehrverdienst reizte [157]ihn weniger als die Minderarbeit; er fragte nicht: wieviel kann ich pro Tag verdienen, wenn ich das mögliche Maximum an Arbeit leiste, sondern: wieviel muß ich arbeiten, um denjenigen Betrag – 21/2 Mk. – zu verdienen, den ich bisher einnahm und der meine traditionellen Bedürfnisse deckt? Dies ist nun dasjenige Verhalten, welches – im Anschluß an den üblichen Sprachgebrauch – als „Traditionalismus“ bezeichnet werden soll: der Mensch will „von Natur“ nicht Geld und mehr Geld verdienen, sondern einfach leben, so leben[,] wie er zu leben gewohnt ist[,] und soviel erwerben, wie dazu erforderlich ist. Überall, wo der Kapitalismus sein Werk der Steigerung der „Produktivität“ der menschlichen Arbeit durch Steigerung ihrer Intensität begann, stieß er auf den unendlich zähen Widerstand dieses Leitmotivs präkapitalistischer wirtschaftlicher Arbeit, und er stößt noch heute überall um so mehr darauf, je „rückständiger“ (vom kapitalistischen Standpunkt aus) die Arbeiter[A 22]schaft ist, auf die er sich angewiesen sieht. Es lag nun – um wieder zu unserem Beispiel zurückzukehren – sehr nahe, da der Appell an den „Erwerbssinn“ durch höhere Lohnsätze versagte, es mit dem gerade umgekehrten Mittel zu versuchen: durch Herabsetzung der Lohnsätze den Arbeiter zu zwingen, zur Erhaltung seines bisherigen Verdienstes mehr zu leisten als bisher. Ohnehin schien ja und scheint noch heute der unbefangenen Betrachtung niederer Lohn und hoher Profit in Korrelation zu stehen, alles, was an Lohn mehr gezahlt wurde, eine entsprechende Minderung des Profits bedeuten zu müssen. Jenen Weg hat denn auch der Kapitalismus von Anfang an wieder und immer wieder beschritten, und Jahrhunderte lang galt es als Glaubenssatz, daß niedere Löhne „produktiv“ seien, d. h. daß sie die Arbeitsleistung steigerten, daß[,] wie schon Pieter de la Court Vgl. Sir 40,18 [1892]: „Wer sich mit seiner Arbeit nähret und läßt ihm genügen, der hat ein fein ruhig Leben. Das heißt einen Schatz über alle Schätze finden.“ Im NT: [157]1 Tim 6,8 [1892]: „Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so lasset uns genügen.“ Vgl. dazu 2 Kor 12,9; 1 Tim 6,6.
a
– in diesem Punkte[,] wie wir sehen werden,[157]A: Cour
68
ganz im Geist des alten Calvinismus denkend – gesagt hatte, das Volk nur arbeitet, weil und so lange es arm ist. Weber, Protestantische Ethik II, unten, S. 417–419; bei der variierten (Zitat-)Wiederholung auf Calvin zurückgeführt, S. 418 mit Anm. 63.
69
Konnte für den niederländischen Textilfabrikanten und Staatstheoretiker Pieter de la Court nicht belegt werden. De la Court, der sich für größtmögliche Handelsfreiheit einsetzte, wandte sich gegen Gilden und Kompanien, die fähige und fleißige Leute [158]vom Handel ausschlössen, wegen ihrer Privilegierung selbst aber zu Faulheit und Trägheit neigten. In diesem Zusammenhang heißt es etwa: „[…] we say that necessity makes the old wife trot, hunger makes raw beans sweet, and poverty begets ingenuity. And besides, it is well known, now especially when Holland is so heavily taxed, that other less burdened people, who have no fisheries, manufactures, trafick and freight ships, cannot long subsist but by their industry, subtilty, courage, and frugality.“ Daraus läßt sich Webers Zuspitzung allerdings nicht herleiten. Vgl. de la Courts Schrift „Interest van Holland“ (1662; die Schrift wird Hollands Ratspensionär Johan de Witt zugeschrieben, hier nach der englischen Übersetzung): The true Interest and Political Maxims, of the Republic of Holland […]. Written by […] John de Witt […], translated from the Original Dutch […] by John Campbell. – London: J. Nourse 1746, p. 60 f., Zitat p. 61.
[158]Allein die Wirksamkeit dieses anscheinend so probaten Mittels hat Schranken.
28)
Gewiß verlangt der Kapitalismus zu seiner Entfaltung das Vorhandensein von Bevölkerungsüberschüssen, die er zu billigem Preis auf dem „Arbeitsmarkt“ mieten kann. Allein ein Zuviel von „Reservearmee“[158][A 22]Auf die Frage, wo diese Schranken liegen, gehen wir hier natürlich so wenig ein wie auf eine Stellungnahme zu der bekannten[,] von Brassey zuerst aufgestellten,
72
von [159]Brentano theoretisch, Vgl. Brassey, Thomas, Work and Wages. Practically illustrated, 2. ed. – London: Bell and Deldy 1872 (von Weber bereits als Literatur aufgeführt im Vorlesungs-Grundriß, MWG III/1, S. 109 und 114, und zur Lohntheorie herangezogen, so Weber, Vorlesungen über „Allgemeine (,theoretische‘) Nationalökonomie“, MWG III/1, S. 589).
75
von Schulze-Gävernitz historisch und konstruktiv zugleich, Vgl. Brentano, Lujo, Über das Verhältniß von Arbeitslohn und Arbeitszeit zur Arbeitsleistung, 2., völlig umgearbeitete Aufl. – Berlin: Duncker & Humblot 1893 (von Weber als Literatur bereits im Vorlesungs-Grundriß, MWG III/1, S. 110, genannt).
76
formulierten und vertretenen Theorie vom Zusammenhang zwischen hohem Lohn und hoher Arbeitsleistung. Die Diskussion ist durch Hasbachs eindringende Studien (Schmollers Jahrbuch 1903 S. 385–391 und 417 f.) wieder eröffnet. Gemeint sein dürfte: Schulze-Gävernitz, Gerhart v., Der Großbetrieb ein wirtschaftlicher und sozialer Fortschritt. Eine Studie auf dem Gebiete der Baumwollindustrie. – Leipzig: Duncker & Humblot 1892 (hinfort: Schulze-Gävernitz, Großbetrieb; ebenfalls Literaturhinweis Webers bereits im Vorlesungs-Grundriß, MWG III/1, S. 109 f.).
77
Für uns genügt hier die von niemand bezweifelte und auch nicht bezweifelbare Tatsache, daß niederer Lohn und hoher Profit, niederer Lohn und günstige Chancen industrieller Entwicklung jedenfalls nicht einfach zusammenfallen,– daß überhaupt nicht einfach mechanische Geldoperationen die „Erziehung“ zur kapitalistischen Kultur Vgl. Hasbach, Charakteristik, S. 385–391, und den Anhang, S. 417–421, wo er sich kritisch mit Brassey und Brentano auseinandersetzt. Dort weist er auf die Faktoren hin, die den positiven Zusammenhang von Leistung und Lohnhöhe stören.
b
und damit die Möglichkeit kapitalistischer Wirtschaft herbeiführen. Alle gewählten Beispiele sind rein illustrativ. | [159]A: Kultur,
70
begünstigt zwar unter Umständen sein quantitatives Umsichgreifen, hemmt aber seine qualitative Entwicklung, namentlich den Übergang zu Betriebsformen, welche die Arbeit intensiv ausnützen. Niederer Lohn ist mit billiger Arbeit keineswegs identisch. Schon rein quantitativ betrachtet, sinkt die Arbeitsleistung unter allen Umständen mit physiologisch ungenügendem Lohn und bedeutet ein solcher auf die Dauer oft geradezu eine „Auslese der Untauglichsten“. Anspielung auf die „industrielle Reservearmee“ bei Marx, die (arbeitslose, überschüssige, im Bedarfsfall bereitstehende und daher disponible) „Zuschuß“-Arbeiterbevölkerung auf dem Arbeitsmarkt. Vgl. Marx, Karl, Das Kapital. Kritik der politischen Oekonomie, Erster Band, Buch I: Der Produktionsprocess des Kapitals, 3. vermehrte Aufl. – Hamburg: Otto Meissner 1883, S. 646–664 (dass., in: Karl Marx Friedrich Engels Gesamtausgabe (MEGA), 2. Abt., Band 8. – Berlin: Dietz 1989, S. 590–608).
71
Der heutige durchschnittliche Schlesier [A 23]mäht bei voller Anstrengung wenig mehr als zwei Drittel soviel Land in der gleichen Zeit wie der besser gelohnte und genährte Pommer oder Mecklenburger, der Pole leistet phy[159]sisch, je weiter östlich er her ist, destoweniger im Vergleich zum Deutschen. Als Zitat nicht nachgewiesen; möglicherweise Umbildung nach „survival of the fittest“ (Darwin, Charles, Origin of Species by means of natural selection, or the preservation of favored races in the struggle for life. – New York: P. F. Collier & Son 1902, Chapter IV: „Natural selection; or the survival of the fittest“, p. 120–189; bei der Formulierung „survival of the fittest“ folgt Darwin Herbert Spencer, vgl. ebd., p. 99).
73
Und auch rein geschäftlich versagt der niedere Lohn als Stütze kapitalistischer Entwicklung überall da, wo es sich um die Herstellung von Produkten handelt, welche irgendwelche qualifizierte (gelernte) Arbeit oder etwa die Bedienung kostspieliger und leicht zu beschädigender Maschinen oder überhaupt ein irgend erhebliches Maß scharfer Aufmerksamkeit und Initiative erfordern. Hier rentiert der niedere Lohn nicht und schlägt in seiner Wirkung in das Gegenteil des Beabsichtigten um. Denn hier ist nicht nur ein entwickeltes Verantwortlichkeitsgefühl schlechthin unentbehrlich, sondern überhaupt eine Gesinnung, welche mindestens während der Arbeit von der steten Frage: wie bei einem Maximum von Bequemlichkeit und einem Minimum von Leistung dennoch der gewohnte Lohn zu gewinnen sei, sich loslöst und die Arbeit so betreibt, als ob sie absoluter Selbstzweck – „Beruf“ – wäre. Eine solche Gesinnung aber ist nichts Naturgegebenes. Sie kann auch weder durch hohe noch durch niedere Löhne unmittelbar hervorgebracht werden, sondern nur das Produkt eines lang andauernden „Erziehungsprozesses“[159]Beinahe wörtlich: Weber, Die Erhebung des Vereins für Sozialpolitik über die Lage der Landarbeiter, MWG I/4, S. 142 f.
74
sein. Heute gelingt dem ein[160]mal im Sattel sitzenden Kapitalismus die Rekrutierung seiner Arbeiter in allen Industrieländern und innerhalb der einzelnen Länder in allen Industriegebieten verhältnismäßig leicht. In der Vergangenheit war sie in jedem einzelnen Fall ein äußerst schwieriges Problem. Als Zitat nicht nachgewiesen.
29)
Und selbst [A 24]heute kommt er nicht immer ohne die Unterstützung eines mächtigen Helfers zum Ziele, der, wie wir weiter sehen werden,[160][A 23]Die Einbürgerung auch kapitalistischer Gewerbe ist deshalb oft nicht ohne umfassende Zuwanderungsbewegungen aus Gebieten älterer Kultur möglich gewesen. So richtig Sombarts Bemerkungen über den Gegensatz der an die Person gebundenen „Fertigkeiten“ und Gewerbegeheimnisse des Handwerkers gegenüber der wissenschaftlich objektivierten modernen Technik sind:
79
für die Zeit der Entstehung des Kapitalismus ist der Unterschied kaum vorhanden, – ja, die (so zu sagen) ethischen Qualitäten des kapitalistischen Arbeiters (und in gewissem Umfang auch: Unternehmers) standen an „Seltenheitswert“ oft höher als die in jahrhundertelangem Traditionalismus erstarrten Fertigkeiten des Handwerkers. Und selbst die heutige Industrie ist von solchen durch lange Tradition und Erziehung zur intensiven Arbeit erworbenen Eigenschaften der Bevölkerung in der Wahl ihrer Standorte durchaus nicht schlechthin unabhängig. Es entspricht dem heutigen wissenschaftlichen Gesamtvorstellungskreis, daß, wo diese Abhängigkeit einmal beobachtet wird, man sie auf ererbte Rassenqualität Vgl. Sombart, Volkswirtschaft, S. 153–171, bes. S. 165.
c
statt auf die Tradition und Er[A 24]ziehung schiebt, m. E. mit sehr zweifelhaftem Recht.[160]A: Rassenqualität,
80
Auch davon wird wohl später gelegentlich noch zu reden sein. Weber notiert in seinem Handexemplar von Sombart, Volkswirtschaft (Max Weber-Arbeitsstelle, BAdW München), zu dessen Äußerung, offenbar alle Europäer besäßen „im Gegensatz zu andern Rassen“ eine „Generalqualifikation zum Kapitalismus“: „alles nicht beweisbar“ (S. 121; „im Gegensatz zu andern Rassen“ ist unterstrichen und mit Fragezeichen am Rand versehen). – Allerdings heißt es bei Sombart, Der moderne Kapitalismus I, S. 380, auch: „Denn das Rassenmerkmal als Erklärung eines Phänomens benutzen, heißt den kausalen Regressus sehr früh abbrechen, heißt auf die Aufdeckung intimerer psychologischer Zusammenhänge verzichten, heißt im Grunde eine Bankerotterklärung aller wirklichen Motivierung.“ Man solle „bei der Feststellung socialer Kausalzusammenhänge das Rassenmoment immer lieber nur als bedingendes, aber nicht als verursachendes Moment in Betracht ziehen.“
81
Weber kommt darauf in der „Protestantischen Ethik“ nicht mehr zurück.
78
ihm in der Zeit seines Werdens zur Seite stand. Was gemeint ist, kann man sich wieder an einem Beispiel klar machen. Ein Bild rückständiger traditionalistischer Form der Arbeit bieten heute besonders oft die Arbeiterinnen, besonders die unverheirateten. Insbesondere ihr absoluter Mangel an Fähigkeit und Willigkeit, überkommene und einmal erlernte Arten des Arbeitens zugunsten anderer, praktischerer, aufzugeben, sich [161]neuen Arbeitsformen anzupassen, zu lernen und den Verstand zu konzentrieren oder nur überhaupt zu brauchen, ist eine fast allgemeine Klage von Arbeitgebern, die Mädchen, zumal deutsche Mädchen, beschäftigen.[160]Weber, Protestantische Ethik II, unten, S. 242–425.
82
Auseinandersetzungen über die Möglichkeit, sich die Arbeit leichter, vor allem einträglicher, zu gestalten, pflegen bei ihnen auf völliges Unverständnis zu stoßen, Erhöhung der Akkordsätze prallt wirkungslos an der Mauer der Gewöhnung ab. Anders – und das ist ein für unsere Betrachtung nicht unwichtiger Punkt – pflegt es regelmäßig nur mit spezifisch religiös erzogenen, namentlich mit Mädchen pietistischer Provenienz zu stehen. Man kann es oft hören, und mir wurde es noch kürzlich durch einen Verwandten für die Leinenindustrie bestätigt,[161]Eine schriftliche Quelle zur Anpassungsunfähigkeit und zur Lernunwilligkeit junger Arbeiterinnen konnte nicht ermittelt werden. Die ältere, verheiratete Arbeiterin galt jedoch als „Ideal der ,Arbeitswilligen‘“, und manche Unternehmer gaben ihr deshalb den Vorzug. Vgl. Handbuch der Frauenbewegung, hg. von Helene Lange und Gertrud Bäumer, IV. Teil: Die deutsche Frau im Beruf. – Berlin: W. Moeser 1902, S. 195 f.
83
daß weitaus die günstigsten Chancen wirtschaftlicher Erziehung sich bei dieser Kategorie eröffnen Verwandte Webers betrieben eine Leinenweberei in Oerlinghausen. Carl David Weber (1824–1907) war der Firmengründer; sein Sohn Carl (Carlo) Weber (1858–1923) und sein Schwiegersohn Bruno Müller (1848–1913) leiteten zu diesem Zeitpunkt die Firma. Die persönliche Auskunft ist in den Briefen Max Webers nicht nachweisbar.
d
. Die Fähigkeit der Konzentration der Gedanken sowohl als die absolut zentrale Fähigkeit, sich der Arbeit gegenüber verpflichtet zu fühlen, finden sich hier besonders oft vereinigt mit strenger Wirtschaftlichkeit, die mit dem Verdienst und seiner Höhe überhaupt rechnet[,] und mit einer nüchternen Selbstbeherrschung und Mäßigkeit, welche die Leistungsfähigkeit ungemein steigert.[161]A: eröffnet
84
Der Boden für jene Auffassung der Arbeit als Selbst[162]zweck, als „Beruf“, wie sie der Kapitalismus fordert, ist hier am günstigsten, die Chance, den traditionalistischen Schlendrian zu überwinden, infolge der religiösen Erziehung am größten. Schon diese Betrachtung aus der Gegenwart des Kapitalismus Weber kommt in seiner späteren Untersuchung „Zur Psychophysik der industriellen Arbeit“ (Weber, Psychophysik, MWG I/11, S. 150–380), die er 1908/09 im Oerlinghauser Betrieb durchführte, zu einem ähnlichen Ergebnis. Dort heißt es, daß „die Arbeiterinnen, welche dem Kreise pietistischer Konventikel entstammen, qualitativ besonders hervortreten. Es ist wohl unmöglich ein Zufall, daß die beiden Arbeiterinnen, welche es in den beiden Abteilungen der Säumerei […] zu Meisterinnen gebracht haben […], jenen religiösen Kreisen angehörten, – daß ferner die beiden Taschentuchweberinnen, für welche das gleiche zutrifft […], – und daß endlich in der verantwortlichen und schwer kontrollierbaren Schlichterei ebenfalls pietistische Arbeitskräfte figurieren“ (S. 278 f.).
30)
zeigt uns wieder, daß es sich [A 25]jedenfalls verlohnt, einmal zu fragen, wie diese Zusammenhänge kapitalistischer Anpassungsfähigkeit mit religiösen Momenten sich denn in der Zeit seiner Jugend gestaltet haben mögen. Denn daß sie auch damals in ähnlicher Art bestanden, ist aus vielen Einzelerscheinungen zu schließen. Der Abscheu und die Verfolgung, welchen z. B. die methodistischen Arbeiter im 18. Jahrhundert von seiten ihrer Arbeitsgenossen begegneten, bezog sich, wie schon die in den Berichten so oft wiederkehrende Zerstörung ihres Handwerkszeuges andeutet,[162]Die vorstehenden Bemerkungen könnten mißverstanden werden. Die Neigung eines sattsam bekannten Typus modernster Geschäftsleute, den Satz: „Dem Volke muß die Religion erhalten bleiben“
86
in ihrer Weise zu fruktifizieren[,] und die Beflissenheit breiter Kreise[,] speziell der lutherischen Geistlichkeit, aus einer allgemeinen Sympathie für das „Autoritäre“ heraus sich ihnen als „schwarze Polizei“ zur Verfügung [A 25]zu stellen, wo es gilt, den Streik als Sünde, die Gewerkvereine als Förderer der „Geflügeltes Wort“ nach Kaiser Wilhelm I., der es am 6. November 1887 auf einem Gedenkblatt niederschrieb, das in die Altarbibel der Sieges-Dankkirche zu Altwasser in Schlesien eingelegt wurde. Bereits zuvor hatte Wilhelm I. Ähnliches gegenüber protestantischen Geistlichen in Züllichau geäußert (23. August 1878), vgl. die Notiz in: Allgemeine Evangelisch-Lutherische Kirchenzeitung vom 18. Nov. 1887, 20. Jg., Nr. 46. – Leipzig: Dörffling und Franke 1887, Sp. 1134.
e
„Begehrlichkeit“ zu brandmarken usw.,[162]A: der der
87
– das sind Dinge, womit die Erscheinungen, von de[163]nen hier die Rede ist, nichts zu tun haben. Es handelt sich bei den im Text berührten Momenten um nicht vereinzelte, sondern sehr häufige, und wie wir sehen werden, Als „schwarze Polizei“ bezeichnet man die Zusammenarbeit von Pfarrerschaft und staatlichen Instanzen (vgl. auch Weber, Objektivität, S. 44). Konkret ist es möglich, daß Weber hier auf den Streik der Textilarbeiter in der sächsischen Kleinstadt Crimmitschau von August 1903 bis zur Niederschlagung im Januar 1904 anspielt. In einer Zuschrift in der von Martin Rade herausgegebenen „Christlichen Welt“ (18. Jg., Nr. 2 vom 8. Jan. 1904, Sp. 41–44) hatte der Crimmitschauer Pfarrer Franz Schink sich auf die Seite der Unternehmer gestellt und behauptet, er könne „weder in materieller noch in formeller Beziehung ein Recht finden, welches die Entfesselung eines so außerordentlichen […] Kampfes zu rechtfertigen vermöchte“ (Sp. 41). Gegen die Berichter[163]stattung in den Zeitungen müsse er die Behörden, d. h. die Polizei, verteidigen (vgl. Sp. 43). Sowohl der Vorfall als auch die Zuschrift wurden viel diskutiert und auch von anderen (neben Rade in der „Christlichen Welt“ etwa Lujo Brentano, Friedrich Naumann, Gottfried Traub, auch Alice Salomon) scharf zurückgewiesen. Vgl. dazu Schaarschmidt, Erich, Geschichte der Crimmitschauer Arbeiterbewegung. Inaugural-Diss. – Dresden: Risse 1934.
89
in typischer Art wiederkehrende Tatsachen. Weber, Protestantische Ethik II, unten, bes. S. 242–425, passim.
85
keineswegs nur oder vorwiegend auf ihre religiösen Exzentrizitäten – davon hatte England viel [163]und Auffallenderes gesehen –, sondern auf ihre spezifische „Arbeitswilligkeit“, wie man heute sagen würde. [162]Im Zusammenhang der Verfolgungen von Anhängern der methodistischen Bewegung in den Anfangsjahren erwähnt Jacoby, Handbuch des Methodismus, S. 40 (Jacoby nennt Weber, Protestantische Ethik II, unten, S. 339, Fn. 114), unter den Verwüstungen auch die Zerstörung von Handwerkszeug in ihren Werkstätten. Im Exemplar der UB Heidelberg ist der entsprechende Satz von Weber unterstrichen, mit Randmarkierung und „NB!“ versehen.
Doch wenden wir uns zunächst wieder der Gegenwart und zwar nunmehr den Unternehmern zu, um auch hier die Bedeutung des „Traditionalismus“ uns zu verdeutlichen.
Sombart hat in seinen Erörterungen über die Genesis des Kapitalismus
31)
Der moderne Kapitalismus Band I S. 62.
90
Sombart, Der moderne Kapitalismus I, S. 62, unterscheidet „die beiden grossen Gruppen von Wirtschaftssystemen“: „Bedarfsdeckungswirtschaften“ und „Erwerbswirtschaften“.
f
als die beiden großen „Leitmotive“, zwischen denen sich die ökonomische Geschichte bewegt habe, „Bedarfsdeckung“ und „Erwerb“ geschieden, je nachdem[163]A: Kapitalismus1),
g
das Ausmaß des persönlichen Bedarfs oder das von den Schranken des letzteren unabhängige Streben nach Gewinn und die Möglichkeit der Gewinnerzielung für die Art und Richtung der wirtschaftlichen Tätigkeit maßgebend werden. Was er als „System der Bedarfsdeckungswirtschaft“Lies: nachdem ob
88
bezeichnet, scheint sich auf den ersten Blick Vgl. unten, Anm. 90.
h
mit dem, was hier als „ökonomischer Traditionalismus“ umschrieben wurde, zu decken. Das ist dann in der Tat der Fall, wenn man den Begriff „Bedarf“ mit „traditionellem Bedarf“ gleichsetzt. Wenn aber nicht, dann fallen breite Massen von Wirtschaften, welche nach der Form ihrer Organisation als „kapitalistische“ auch im Sinne der von Sombart an einer anderen Stelle seines WerkesA: Blick,
32)
gegebenen Defi[164]nition des „Kapitals“ zu betrachten sind, aus dem Bereich der „Erwerbs“-Wirtschaften heraus und gehören zum Bereich der „Bedarfsdeckungswirtschaften“. Auch Wirtschaften nämlich, die von [A 26]privaten Unternehmern in der Form eines Umschlags von Kapital (= Geld oder geldwerten Gütern) zu Gewinnzwecken durch Ankauf von Produktionsmitteln und Verkauf der Produkte, also zweifellos als „kapitalistische Unternehmungen“ geleitet werden, können gleichwohl traditionalistischen Charakter an sich tragen, und dies ist im Lauf auch der neueren Wirtschaftsgeschichte nicht nur ausnahmsweise, sondern – mit stets wiederkehrenden Unterbrechungen durch immer neue und immer gewaltigere Einbrüche des „kapitalistischen Geistes“ – geradezu regelmäßig der Fall gewesen. Die „kapitalistische“ Form einer Wirtschaft und der Geist, in dem sie geführt wird, stehen zwar generell im Verhältnis adäquater Beziehung, nicht aber in dem einer „gesetzlichen“ Abhängigkeit voneinander; und wenn wir trotzdem für diejenige Gesinnung, welche berufsmäßig und systematisch Gewinn um des Gewinnes willen in der Art, wie dies an dem Beispiel Benjamin Franklins verdeutlicht wurde, S. 195 a. a. O.
91
| „Kapitalismus heissen wir eine Wirtschaftsweise, in der die specifische Wirtschaftsform die kapitalistische Unternehmung ist. […] Kapitalistische Unternehmung aber nenne ich diejenige Wirtschaftsform, deren Zweck es ist, durch eine Summe von Vertragsabschlüssen über geldwerte Leistungen und Gegenleistungen ein Sachver[164]mögen zu verwerten, d. h. mit einem Aufschlag (Profit) dem Eigentümer zu reproduzieren. Ein Sachvermögen, das solcher Art genutzt wird, heisst Kapital.“ Sombart, Der moderne Kapitalismus I, S. 195.
92
erstrebt, hier provisorisch den Ausdruck „Geist des Kapitalismus“ gebrauchen, so geschieht dies aus dem historischen Grunde, weil jene Gesinnung in der kapitalistischen Unternehmung ihre adäquateste Form, die kapitalistische Unternehmung andererseits in ihr die adäquateste geistige Triebkraft gefunden hat. Vgl. oben, S. 142–145.
Aber an sich kann beides sehr wohl auseinanderfallen. Benjamin Franklin war mit „kapitalistischem Geist“ erfüllt zu einer Zeit, wo sein Buchdruckereibetrieb der Form nach sich in nichts von irgendeinem Handwerkerbetrieb unterschied.
93
Und wir werden sehen, Benjamin Franklin betrieb von 1728 bis 1748 in Philadelphia eine eigene Druckerei.
94
daß überhaupt an der Schwelle der Neuzeit keineswegs allein oder vorwiegend die „kapitalistischen“ Unternehmer des Handelspatriziates, sondern auch und sogar ganz besonders die aufstrebenden Schichten des Mittelstandes die Träger derjenigen Gesinnung [165]waren, die wir hier als „Geist des Kapitalismus“ bezeichnet haben. Weber, Protestantische Ethik II, unten, bes. S. 414–417.
33)
Auch im [A 27]19. Jahrhundert sind nicht die vornehmen Gentlemen von Liverpool und Hamburg mit ihrem altererbten Kaufmannsvermögen, sondern die aus oft recht kleinen Verhältnissen aufsteigenden Parvenüs von Manchester oder Rheinland-Westfalen ihre[165][A 26]Es ist eben – nur das soll hier hervorgehoben werden – a priori durchaus nicht die Annahme geboten, daß die Technik des kapitalistischen Unternehmens und der Geist der „Berufsarbeit“, der dem Kapitalismus seine expansive Energie zu verleihen pflegt, in denselben sozialen Schichten ihren ursprünglichen Nährboden finden. Entsprechend liegt es mit den sozialen Beziehungen religiöser Bewußtseinsinhalte. Der Calvinismus ist historisch einer der zweifellosen Träger der Erziehung zum „kapitalistischen Geist“. Aber die großen Geldbesitzer waren in den Niederlanden z. B., aus Gründen, die später zu erörtern sein werden,
95
überwiegend nicht Anhänger des Calvinismus strengster Observanz, sondern Arminianer. Das aufsteigende Kleinbürgertum war hier und sonst „typischer“ Träger kapitalistischer Ethik und calvinistischen Kirchentums. | [165]Ebd., unten, S. 402 f., Fn. 54b.
i
klassischen Repräsentanten. [165]Bezugswort ist: Gesinnung
Der Betrieb etwa einer Bank, oder des Exportgroßhandels, oder auch eines größeren Detailgeschäfts, oder endlich eines großen Verlegers hausindustriell hergestellter Waren sind
j
zwar sicherlich nur in der Form der kapitalistischen Unternehmung möglich. Gleichwohl können sie alle in streng traditionalistischem Geiste geführt werden: die Geschäfte der großen Notenbanken dürfen gar nicht anders betrieben werden, der überseeische Handel ganzer Epochen hat auf der Basis von Monopolen und Reglements streng traditionellen Charakter gehabt, im Detailhandel – und es ist hier nicht nur von den kleinen kapitallosen Tagedieben die Rede, welche heute nach Staatshilfe schreien – ist die Revolutionierung, welche dem alten Traditionalismus ein Ende macht, noch in vollem Gange – dieselbe Umwälzung, welche die alten Formen des Verlagssystems gesprengt hat, mit dem ja die moderne Heimarbeit nur der Form nach Verwandtschaft besitzt. Wie sie verläuft und was sie bedeutet, mag – so bekannt ja diese Dinge sind – wiederum an einem Spezialfall veranschaulicht werden. Zu erwarten wäre: ist
Bis gegen die Mitte des vorigen Jahrhunderts war das Leben eines Verlegers wenigstens in manchen Branchen der kontinenta[166]len Textilindustrie
34)
ein für unsere heutigen Begriffe ziemlich gemächliches.[166][A 27]Das nachstehende Bild ist aus den Verhältnissen verschiedener Einzelbranchen an verschiedenen Orten „idealtypisch“ kompiliert; es ist für den illustrativen Zweck, dem es hier dient, natürlich gleichgültig, daß der Vorgang in keinem der Beispiele, an die gedacht ist, sich gerade ganz genau in der geschilderten Art abgespielt hat. |
1
Man mag sich seinen Verlauf etwa so vorstellen: Die Bauern kamen mit ihren Geweben – oft (bei Leinen) noch vorwiegend oder ganz aus selbstproduziertem Rohstoffe hergestellt – in die Stadt, in der die Verleger wohnten[,] und erhielten nach sorgsamer – oft amtlicher – Prüfung der Qualität die üblichen Preise dafür gezahlt. Die Kunden der Verleger waren für den Absatz auf alle weiteren Entfernungen Zwischenhändler, die ebenfalls hergereist kamen, nach Mustern oder herkömmlichen Qualitäten vom Lager kauften oder, und dann lange vorher, bestellten – woraufhin dann eventuell weiter bei den Bauern bestellt wurde. Eigenes [A 28]Bereisen der Kundschaft geschah, wenn überhaupt, dann selten einmal in großen Perioden, sonst genügte Korrespondenz und Musterversendung. Mäßiger Umfang der Comptoirstunden – vielleicht 5–6 am Tage, zeitweise erheblich weniger, in der Campagnezeit, wo es eine solche gab, mehr, – leidlicher, zur anständigen Lebensführung und in guten Zeiten zur Rücklage eines kleinen Vermögens ausreichender Verdienst, im ganzen relativ große Verträglichkeit der Konkurrenten untereinander bei großer Übereinstimmung der „Geschäftsgrundsätze“, ausgiebiger täglicher Besuch der „Ressource“,[166]Der im folgenden entwickelte „Idealtypus“ eines traditionalistisch gesinnten Verlegers in der Textilindustrie (vgl. dazu unten, S. 170 f.) trägt Züge von Max Webers Großvater, des Bielefelder Leinenhändlers Carl August Weber (1796–1872). Vgl. Roth, Familiengeschichte, S. 251.
2
daneben je nachdem noch Dämmerschoppen, Kränzchen und gemächliches Lebenstempo überhaupt. Die „Geschlossene Gesellschaft Ressource“ war ein in Bielefeld 1795 vornehmlich von Leinenhändlern gegründeter Verein, der die Geselligkeit pflegte. Vgl. Roth, ebd., S. 251, Anm. 32.
Es war eine in jeder Hinsicht „kapitalistische“ Form der Organisation, wenn man auf den rein kaufmännisch-geschäftlichen Charakter der Unternehmen
k
, ebenso wenn man auf die Tatsache der Unentbehrlichkeit des Dazwischentretens von Kapitalvorräten, welche in dem Geschäft umgeschlagen wurden, ebenso endlich, [167]wenn man auf die objektive Seite des ökonomischen Hergangs sieht. Aber es war traditionalistische Wirtschaft, wenn man auf den Geist sieht, der die Unternehmer beseelte: die traditionelle Lebenshaltung, die traditionelle Höhe des Profits, das traditionelle Maß von Arbeit, die traditionelle Art der Geschäftsführung und der Beziehungen zu den Arbeitern und dem wesentlich traditionellen Kundenkreise, die traditionelle[166]A: Unternehmer
l
Art der Kundengewinnung und des Absatzes beherrschten den Geschäftsbetrieb, lagen – so kann man geradezu sagen – der „Ethik“ dieses Kreises von Unternehmern zugrunde. [167]A: der
Irgendwann nun wurde diese Behaglichkeit plötzlich gestört, und zwar oft ganz ohne daß dabei irgend eine prinzipielle Änderung der Organisationsform – etwa Übergang zum geschlossenen Betrieb, zum Maschinenstuhl und dgl. – stattgefunden hätte. Was geschah, war vielmehr oft lediglich dies:
3
daß irgend ein junger Mann aus einer der beteiligten Verlegerfamilien aus der Stadt auf das Land zog, die Weber für seinen Bedarf sorgfältig auswählte, ihre Abhängigkeit und Kontrolle verschärfte, sie so aus Bauern zu Arbeitern erzog, andererseits aber den Absatz durch möglichst direktes Herangehen an die letzten Abnehmer: die Detailgeschäfte, ganz in die eigene Hand nahm, Kunden persönlich warb, sie regelmäßig jährlich bereiste, vor allem aber die Qualität der Produkte ausschließlich ihren Bedürfnissen und Wünschen anzupassen, ihnen „mundgerecht“ zu machen wußte und zugleich den Grundsatz „billiger Preis, großer Umsatz“ durchzuführen begann. Alsdann nun wieder[A 29]holte sich, was immer und überall die Folge eines solchen „Rationalisierungs“-Prozesses ist: wer nicht hinaufstieg, mußte hinabsteigen. Die Idylle brach unter dem beginnenden erbitterten Konkurrenzkampf zusammen, ansehnliche Vermögen wurden gewonnen und nicht auf Zinsen gelegt, sondern immer wieder im [168]Geschäft investiert, die alte behäbige und behagliche Lebenshaltung wich harter Nüchternheit, bei denen, die mitmachten und hochkamen, weil sie nicht verbrauchen, sondern erwerben wollten, bei denen, die bei der alten Art blieben, weil sie sich einschränken mußten. Und – worauf es hier vor allem ankommt – es war in solchen Fällen in der Regel nicht etwa ein Zustrom neuen Geldes, welcher diese Umwälzung hervorbrachte – mit wenigen Tausenden von Verwandten hergeliehenen Kapitals wurde in manchen mir bekannten Fällen der ganze „Revolutionierungs-Prozeß“ ins Werk gesetzt –, sondern der neue Geist, eben der „Geist des Kapitalismus“, der eingezogen war. Die Frage nach den Triebkräften der Entwicklung des Kapitalismus ist nicht in erster Linie eine Frage nach der Herkunft der kapitalistisch verwertbaren Geldvorräte,[167]Im folgenden lassen sich Bezüge zu Webers Onkel Carl David Weber (1824–1907), dem Sohn Carl August Webers, herstellen. Carl David Weber gründete 1850 in dem im Fürstentum Lippe gelegenen Dorf Oerlinghausen ein neues Unternehmen (später: Carl Weber & Co., seit 1907 GmbH). Dabei ließ er im Verlagssystem mit Hausindustrie hochwertiges Leinen herstellen. Die Bielefelder Leinenindustrie dagegen ging unter dem Druck der preußischen Regierung zu fabrikmäßiger Leinenproduktion über, woran die Firma „Weber, Laer & Niemann“, bei der Carl David Weber Teilhaber war, 1861 zu Grunde ging. Vgl. Roth, Familiengeschichte, S. 250–256.
4
sondern nach der Entwicklung des kapitalistischen Geistes. Wo er auflebt und sich auszuwirken vermag, da schaffte er sich die Geldvorräte als Mittel seines Wirkens, nicht aber umgekehrt. Aber sein Einzug pflegt kein friedlicher zu sein. Eine Flut von Mißtrauen, gelegentlich von Haß, vor allem von moralischer Entrüstung stemmt sich regelmäßig dem ersten Neuerer entgegen, oft – mir sind mehrere Fälle der Art[168]Dieser Frage geht Sombart nach, der die Grundrentenhypothese vertritt. Nach ihm bildete sich im Mittelalter ein „Urvermögen“, das in der Hand des städtischen Patriziats lag („Die Anfänge des bürgerlichen Reichtums“, Sombart, Der moderne Kapitalismus I, S. 282–324). „Jene Summen, mit denen in Italien und Flandern seit dem 13. Jahrhundert und noch früher, in den übrigen Ländern seit dem 14. Jahrhundert in größerem Stile Geld- und Handelsgeschäfte gemacht wurden, die also recht eigentlich als die Urvermögen anzusehen sind, aus denen sich das Kapital zu entwickeln vermochte: sie sind accumulierte Grundrente“ (S. 291). Dazu kamen Gewinne aus der ausbeuterischen Kolonialwirtschaft (vgl. S. 325–377). – Weber lehnte diese Grundrentenhypothese ab.
m
bekannt – beginnt eine förmliche Legendenbildung über geheimnisvolle Schatten in seinem Vorleben.[168]A: derart
5
Es ist so leicht niemand unbefangen genug zu bemerken, daß gerade einen solchen Unternehmer „neuen Stils“ Nach Roth, Familiengeschichte, S. 251–253, wurde im Familien- und Bekanntenkreis kolportiert, Carl David Weber habe sich durch einen geschäftlichen Spanien-Aufenthalt der preußischen Militärpflicht entzogen und sei deshalb mit seiner Neugründung in das Fürstentum Lippe ausgewichen. Vgl. auch oben, S. 167, Anm. 3.
6
nur ein ungewöhnlich fester Charakter vor dem Verlust der nüchternen Selbst[169]beherrschung und vor moralischem wie ökonomischem Schiffbruch bewahren kann Sombart spricht vom „neuen Stil des Wirtschaftslebens“ (Sombart, Der moderne Kapitalismus II, S. 68–89).
n
, daß neben Klarheit des Blickes und Tatkraft[169]A: können
o
vor allem doch auch ganz bestimmte und sehr ausgeprägte „ethische“ Qualitäten es sind, welche bei solchen Neuerungen ihm das schlechthin unentbehrliche Vertrauen der Kunden und der Arbeiter gewinnen und ihm die Spannkraft zur Überwindung der ungezählten Widerstände erhalten, vor allem aber die so unendlich viel intensivere Arbeitsleistung, welche nunmehr von dem Unternehmer gefordert wird und die mit bequemem Lebensgenuß unvereinbar ist, überhaupt ermöglicht haben: – nur eben ethische Qualitäten spezifisch anderer Art als die dem Traditionalismus der Vergangenheit adäquaten. A: Tatkraft,
[A 30]Nun wird man freilich zu bemerken geneigt sein, daß diese persönlichen moralischen Qualitäten mit irgend welchen ethischen Maximen oder gar religiösen Gedanken an sich nicht das geringste zu schaffen haben, daß nach dieser Richtung wesentlich etwas Negatives: die Fähigkeit, sich der überkommenen Tradition zu entziehen, also am ehesten liberale Aufklärung die adäquate Grundlage jener Lebensführung sei. Und in der Tat ist dies heute im allgemeinen durchaus der Fall. Nicht nur fehlt regelmäßig eine Beziehung der Lebensführung auf religiöse Ausgangspunkte, sondern wo eine Beziehung besteht, pflegt sie wenigstens in Deutschland negativer Art zu sein. Solche vom „kapitalistischen Geist“ erfüllte Naturen pflegen heute, wenn nicht gerade kirchenfeindlich, so doch indifferent zu sein. Der Gedanke an die „fromme Langeweile“ des Paradieses
7
hat für ihre tatenfrohe Natur wenig Verlockendes, die Religion erscheint ihnen als ein Mittel, die Menschen vom Arbeiten auf dem Boden dieser Erde abzuziehen. Würde man sie selbst nach dem Sinn ihres rastlosen Jagens fragen, welches des eigenen Besitzes niemals froh wird[169]Sehr wahrscheinlich Anspielung auf Johann Wolfgang von Goethe. In seinen Erläuterungen zum West-östlichen Divan heißt es, die indische „edle reine Naturreligion“ habe sich durch Zoroaster in einen „umständlichen Cultus“ verwandelt, so daß man jetzt „ein verdüstertes Volk [erblicke], welches gemeine Langeweile durch fromme Langeweile zu tödten trachtet“. Goethe, Noten zum West-östlichen Divan, S. 19–24, Zitat S. 20.
p
und deshalb gerade bei rein diesseitiger Orientierung des Lebens so sinnlos erscheinen muß, so [170]würden sie, falls sie überhaupt eine Antwort wissen, zuweilen antworten: „die Sorge für Kinder und Enkel“, – häufiger aber und – da jenes Motiv ja offenbar kein ihnen eigentümliches ist, sondern bei dem „traditionalistischen Menschen“ ganz ebenso wirkte, – richtiger ganz einfach: daß ihnen das Geschäft mit seiner steten Arbeit „zum Leben unentbehrlich“ geworden sei. Das ist in der Tat die einzig zutreffende Motivierung, und sie bringt zugleich das Irrationale dieser Lebensführung, bei welcher der Mensch für sein Geschäft da ist, nicht umgekehrt, zum Ausdruck. Selbstverständlich spielt die Empfindung für die Macht und das Ansehen, welches die bloße Tatsache des Besitzes gewährt, dabei ihre Rolle: wo einmal die Phantasie eines ganzen Volkes in der Richtung auf das quantitativ „Große“ gelenkt ist, wie in den Vereinigten Staaten, da wirkt diese Zahlenromantik mit unwiderstehlichem Zauber auf die „Dichter“ unter den Kaufleuten, – aber sonst sind es im ganzen nicht die eigentlich führenden und namentlich nicht die dauernd erfolgreichen Unternehmer, die sich davon einnehmen lassen. Und vollends das Einlaufen in den Hafen des Fideikommißbesitzes und Briefadels mit Söhnen, deren Gebarung auf der Universität und im Offizierkorps ihre Abstammung vergessen zu machen sucht, wie es der übliche Lebenslauf deutscher [A 31]kapitalistischer Parvenü-Familien ist, stellt ein epigonenhaftes Décadenceprodukt dar.A: wird,
8
Der „Idealtypus“ des kapitalistischen Unternehmers,[170]Anspielung auf die damals weitverbreitete Neigung von zu Reichtum gekommenen bürgerlichen Kreisen, ein Rittergut zu erwerben und es durch eine Fideikommißstiftung an die Familie zu binden. Man hoffte, daraufhin einen Adelstitel – mittels eines Adelsbriefes – zu erlangen. Weber bekämpfte diese Tendenz heftig. Vgl. dazu Weber, Fideikommißfrage, MWG I/8, S. 81–188 (S. 175 spricht Weber vom „Parvenü-Fideikommiß“), sowie die Einleitung, oben, S. 10.
35)
wie er auch bei uns in einzelnen hervorragenden Beispielen vertreten war, hat mit solchem gröberen oder feineren[170][A 31]Das soll nun heißen: derjenige Unternehmertypus, den wir hier zum Gegenstand unserer Betrachtung machen, nicht irgend ein empirischer Durchschnitt (über den Begriff „Idealtypus“ s. m[eine] Ausf[ührungen] in dieser Zeitschrift Bd. XIX Heft 1).
9
Weber bezieht sich auf seinen Objektivitäts-Aufsatz, S. 64 ff., wo er den „Idealtypus“ entwickelt. Vgl. dazu auch die Einleitung, oben, S. 12–22, bes. S. 19 ff.
q
Protzentum nichts Verwandtes. Er scheut die Ostentation und den unnötigen Aufwand ebenso wie den bewußten Genuß seiner Macht und die ihm eher unbequeme [171]Entgegennahme von äußeren Zeichen der gesellschaftlichen Achtung, die er genießt. Seine Lebensführung trägt m.a. W. oft – und es wird auf die geschichtliche Bedeutung dieser für uns nicht unwichtigen Erscheinung einzugehen sein – einen gewissen asketischen Zug an sich, wie er ja in der früher zitierten „Predigt“ Franklins deutlich zutage tritt.[170]A: feinerem
10
Es ist namentlich keineswegs selten, sondern recht häufig bei ihm ein Maß von kühler Bescheidenheit zu finden, welches wesentlich aufrichtiger ist als jene Reserve, die Benjamin Franklin so klug zu empfehlen weiß. Er „hat nichts“ von seinem Reichtum für seine Person, – außer der irrationalen Empfindung der „Berufserfüllung“.[171]Siehe oben, S. 142–145.
36)
[171]Daß dieser „asketische“ Zug für die Entwicklung des Kapitalismus nichts Peripherisches, sondern von hervorragender Bedeutung war, kann erst die weitere Darstellung lehren. Nur sie kann überhaupt erweisen, daß es sich nicht um willkürlich herausgegriffene Züge handelt. |
Das aber ist es eben, was dem präkapitalistischen Menschen so unfaßlich und rätselhaft, so schmutzig und verächtlich erscheint. Daß jemand zum Zweck seiner Lebensarbeit ausschließlich den Gedanken machen könne, dereinst mit hohem materiellen Gewicht an Geld und Gut belastet ins Grab zu sinken, scheint ihm nur als Produkt perverser Triebe: der „auri sacra fames“[,]
11
erklärlich. „Verfluchter Hunger nach Gold“. Vgl. auch das Glossar, unten, S. 822.
In der Gegenwart, unter unseren politischen, privatrechtlichen und Verkehrsinstitutionen, bei den Betriebsformen und der Struktur, die unserer Wirtschaft eigen ist, könnte nun dieser „Geist“ des Kapitalismus, wie gesagt,
12
als ein reines Anpassungsprodukt verständlich sein. Die kapitalistische Wirtschaftsordnung braucht diese rücksichtslose Hingabe an den „Beruf“ des Geldverdienens: sie ist eine Art des Sichverhaltens zu den äußeren Gütern, welche jener Struktur so sehr adäquat, so sehr mit den Bedingungen des Sieges im ökonomischen Daseinskampfe verknüpft ist, daß von einem notwendigen Zusammenhange jener „chrematistischen“ Siehe oben, S. 160–162.
13
Lebensführung mit [A 32]irgend einer einheitlichen Weltanschauung heute keine Rede mehr sein kann. Sie hat es namentlich nicht mehr nötig, [172]sich von der Billigung irgendwelcher religiöser Potenzen tragen zu lassen[,] und empfindet die Beeinflussung des Wirtschaftslebens durch die kirchlichen Normen, soweit sie überhaupt noch fühlbar ist, ebenso als Hemmnis, wie die staatliche Reglementierung desselben. Die handelspolitische und sozialpolitische Interessenlage pflegen dann die „Weltanschauung“ zu bestimmen. Aber das sind Erscheinungen einer Zeit, in welcher der Kapitalismus, zum Siege gelangt, sich von den alten Stützen emanzipiert hat: wie er dereinst nur im Bunde mit der werdenden modernen Staatsgewalt die alten Formen mittelalterlicher Wirtschaftsregulierung sprengte, so könnte – wollen wir vorläufig sagen – das gleiche auch für seine Beziehungen zu den religiösen Mächten der Fall gewesen sein. Ob und in welchem Sinne es etwa der Fall gewesen ist, das eben soll hier untersucht werden. Denn daß jene Auffassung des Gelderwerbs als eines den Menschen sich verpflichtenden Selbstzweckes, als „Beruf“, dem sittlichen Empfinden ganzer Epochen zuwiderlief, bedarf kaum des Beweises. In dem Satz „Deo placere non potest“, der von der Tätigkeit des Kaufmanns gebraucht wurde, Chrematistisch (von griech. χpῆμα, Tl. chrḗma, „Geld“), am Gelderwerb um seiner selbst willen orientiert.
14
lag, gegenüber den radikal antichrematistischen Ansichten[172]„[Ein Kaufmann] kann vor Gott keinen Gefallen finden“, Ausdruck des kirchlichen Wucherverbots (vgl. das Glossar, unten, S. 842) für das kaufmännische Erwerbsleben. Zitat aus dem Corpus Iuris Canonici, Decreti prima pars, Distinctio 88, C[aput] XI. Vgl. Friedberg, Aemilius, Corpus Iuris Canonici. Editio Lipsiensis secunda post Aemilii Ludouici Richteri curas ad librorum manu scriptorum […], Pars Prior: Decretum Magistri Gratiani. – Leipzig: B. Tauchnitz 1879, Sp. 308: „Eiciens Dominus uendentes et ementes de templo, significauit, quia homo mercator uix aut numquam potest Deo placere.“ Das Decretum Gratiani (um 1140) fußt hier auf einer Kommentarstelle des Johannes Chrysostomos zum Matthäus-Evangelium.
15
breitester Kreise, schon ein hoher Grad von Entgegenkommen der katholischen Doktrin gegenüber den Interessen der mit der Kirche politisch so eng liierten Geldmächte der italienischen Städte. Und auch wo die Doktrin noch mehr sich akkommodierte, wie etwa bei Antonin von Florenz, „Antichrematistisch“, Ablehnung eines rein auf Bereicherung zielenden Gelderwerbs.
16
schwand doch die Empfindung niemals ganz, daß es sich bei der auf Erwerb als Selbstzweck gerichteten Tätigkeit im Grunde um ein pudendum handle, welches nur die einmal vorhandenen Ordnungen des Lebens zu tolerieren nötig[173]ten. Eine „sittliche“ Anschauung wie die Benjamin Franklins wäre einfach undenkbar gewesen. Dies war vor allem die Auffassung der beteiligten Kreise selbst: ihre Lebensarbeit war, günstigenfalls, etwas sittlich Indifferentes, Toleriertes, aber immerhin schon wegen der steten Gefahr, mit dem kirchlichen Wucherverbot zu kollidieren, für die Seligkeit Bedenkliches: ganz erhebliche Summen flossen, wie die Quellen zeigen, beim Tode reicher Leute als „Gewissensgelder“ an kirchliche Institute, unter Umständen auch zurück an frühere Schuldner als zu Unrecht ihnen abgenommene „usura“. Antonin hielt am kirchlichen Wucherverbot (vgl. das Glossar, unten, S. 842) fest, erkannte aber bereits, daß Geld im Zusammenhang mit wirtschaftlicher Arbeit auch produktiv sein könne. Vgl. auch unten, S. 199, Anm. 6.
17
Auch skeptische und unkirchliche Naturen pflegten, weil es zur Versicherung gegen die Ungewißheiten des Zustandes nach dem Tode immerhin [A 33]besser so war und weil ja (wenigstens nach der sehr verbreiteten laxeren Auffassung) die äußere Unterwerfung unter die Gebote der Kirche zur Seligkeit genügte, sich durch solche Pauschsummen mit ihr für alle Fälle abzufinden.[173]usura (lat.), „Zins“, vgl. auch das Glossar, unten, S. 840. ‒ Weber hatte sich für seine Dissertation mit verschiedenen italienischen Zunftstatuten beschäftigt (darunter auch die Statuten der „Arte di Calimala“, vgl. das folgende Beispiel der „Pauschsummen“ für „usura“, oben und unten, S. 173 f., Fn. 37). Die Statuten bezogen „fast alle“ zum kirchlichen Wucherverbot „Stellung“, weil sie mit ihm kollidierten; vgl. Weber, Handelsgesellschaften, MWG I/1, S. 269‒272, Zitat S. 272. ‒ Kirchlicherseits war seit 1139 und 1179 vorgesehen, daß Wucherer exkommuniziert wurden und kein christliches Begräbnis erhielten, es sei denn, sie hatten vor ihrem Tod Ersatz geleistet oder diesen sichergestellt (dies bezog sich allerdings auf die gewerbsmäßige Wucherei, nicht auf jeden Einzelfall). Vgl. Funk, Franz Xaver, Zins und Wucher. ‒ Tübingen: Laupp’sche Buchhandlung 1868, S. 261; Endemann, W[ilhelm], Die nationalökonomischen Grundsätze der canonistischen Lehre, in: Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, 1. Band, 1863, S. 26‒48 u. ö., hier S. 32‒34.
37)
Gerade hierin tritt das Außersittliche und teilweise Widersittliche, welches nach der eigenen Auffassung der Beteiligten ihrem Tun anhaftete, deutlich zutage. Wie ist nun aus diesem, im günstigen Fall, sittlich [174]tolerierten Gebaren ein „Beruf“ im Sinne Benjamin Franklins geworden? Wie ist es historisch erklärlich, daß im Zentrum der „kapitalistischen“ Entwicklung der damaligen Welt, in Florenz im 14. und 15. Jahrhundert, dem Geld- und Kapitalmarkt aller politischen Großmächte, als sittlich bedenklich galt, was in den hinterwäldlerisch-kleinbürgerlichen Verhältnissen von Pennsylvanien im 18. Jahrhundert, wo die Wirtschaft aus purem Geldmangel stets in Naturaltausch zu kollabieren drohte,[173][A 33]Wie man sich dabei mit dem Wucherverbot abfand, lehrt z. B. Buch I c. 65 des Statuts der Arte di Calimala (mir liegt augenblicklich nur die italienische Redaktion bei Emiliani-Giudici, Stor[ia] dei Com[uni] Ital[iani] Bd. III S. 246 vor):
18
Procurino i [174]consoli con quelli frati che parrà loro, che perdono si faccia e come fare si possa il meglio per l’amore di ciascuno, del dono, merito o guiderdono Statuto dell’Arte di Calimala, liber I, c. 65 („Di fare l’perdono dell’usure“), in: Emiliani-Giudici, Storia III, S. 246 f. Bei der „Arte di Calimala“ handelt es sich um die Florentiner Zunft der Tuchkaufleute. Ihre Statuten stammen in der vorliegenden Fassung aus dem Jahr 1331. Der von der Zunft alljährlich pauschal besorgte Ablaß diente dazu, für die Mitglieder die kirchliche Absolution bei Wuchersünden zu erwirken, die während ihrer Geschäfte entstanden waren. ‒ Weber, der in seiner Dissertation intensiv die Statuten der Arte di Calimala herangezogen hatte, kommt darin allerdings auf den hier thematisierten Zusammenhang nicht zu sprechen (vgl. Weber, Handelsgesellschaften, MWG I/1, S. 608).
21
, ovvero Bei Emiliani-Giudici, Storia III: „guiderdone“ (gebräuchlich auch: guiderdono).
22
interesse per l’anno presente e secondo che altra volta fatto fue. Also eine Art Beschaffung des Ablasses von seiten der Zunft für ihre Mitglieder von Amtswegen und im Submissionswege. Höchst charakteristisch für den außersittlichen Charakter des Kapitalgewinns sind auch die weiter folgenden Anweisungen, ebenso z. B. das unmittelbar vorhergehende Gebot (c. 63), alle Zinsen und Profite als „Geschenk“ zu buchen. Bei Emiliani-Giudici, ebd.: „overo“ (im Italienischen allerdings bevorzugt: „ovvero“).
23
Den heutigen schwarzen Listen der Börse gegen solche, die den Differenzeinwand erheben, Statuto dell’Arte di Calimala, liber I, c. 63 („Di scrivere per dono quello che si dà per merito“), in: Emiliani-Giudici, Storia III, S. 246.
24
entsprach oft der Verruf gegen solche, die das geistliche Gericht mit der exceptio usurariae pravitatis Ein Differenzeinwand konnte bei Termingeschäften vor Gericht erhoben werden, bei denen eine Effektiverfüllung ‒ d. h. eine Bezahlung mit effektiven (wirklich vorhandenen) Waren oder Wertpapieren ‒ von vornherein ausgeschlossen wurde, die vielmehr auf die Zahlung der Differenz zwischen dem Kurs zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses und dem Kurs am Erfüllungstermin zielten. Diejenigen, die einen solchen Einwand erhoben, kamen zeitweise auf schwarze Listen der Börse. Vgl. Weber, Die Ergebnisse der deutschen Börsenenquete, in: MWG I/5, S. 175‒550, hier S. 507 mit Anm. 14.
25
angingen. | exceptio usurariae pravitatis (lat.), Einrede (Einwand) gegen unerlaubte, strafbare Zinsnahme nach dem kirchlichen Wucherverbot.
19
von größeren gewerblichen Unternehmungen kaum eine Spur, von Banken nur die vorsintflutlichen Anfänge zu bemerken waren, als Inhalt einer sittlich löblichen, ja gebotenen Lebensführung gelten konnte? – Hier von einer „Wiederspiegelung“ der „materiellen“ Verhältnisse in dem „ideellen Überbau“ reden zu wollen,[174]Vgl. Sharpless, Quaker Experiment I, p. 105 f. (Sharpless wird genannt: Weber, Protestantische Ethik II, unten, S. 415, Fn. 75); dazu auch Franklin, Sein Leben, S. 244‒246.
20
wäre ja barer Unsinn. – Welchem Gedankenkreise entstammt also die Einordnung einer äußerlich [175]rein auf Gewinn gerichteten Tätigkeit unter die Kategorie des „Berufs“, dem gegenüber sich der einzelne verpflichtet fühlt? Denn dieser Gedanke ist es ja auch hier, welcher der Lebensführung des Unternehmers „neuen Stils“ den ethischen Unterbau und Halt gewährt. Vgl. dazu oben, S. 152 f.
Man hat – so namentlich Sombart in höchst glücklichen und wirkungsvollen Ausführungen – als das Grundmotiv der modernen [A 34]Wirtschaft überhaupt den „ökonomischen Rationalismus“ bezeichnet. Mit unzweifelhaftem Recht, wenn darunter jene Ausweitung der Produktivität der Arbeit verstanden wird, welche durch die Gliederung des Produktionsprozesses unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten dessen Gebundenheit an die natürlich gegebenen „organischen“ Schranken der menschlichen Person beseitigt hat.
26
Dieser Rationalisierungsprozeß auf dem Gebiete der Technik und Ökonomik bedingt nun unzweifelhaft auch einen wichtigen Teil der „Lebensideale“ der modernen bürgerlichen Gesellschaft: die Arbeit im Dienste einer rationalen Gestaltung der materiellen Güterversorgung der Menschheit hat den Vertretern des „kapitalistischen Geistes“ zweifellos immer auch als einer der richtungsweisenden Zwecke ihrer Lebensarbeit vorgeschwebt.[175]Sombart, Der moderne Kapitalismus I, S. 391‒397, trägt die Kapitelüberschrift „Die Ausbildung des ökonomischen Rationalismus“. Als Voraussetzung des ökonomischen Rationalismus gilt Sombart die doppelte Buchführung. „Die moderne Buchführung ist so eingerichtet, daß sie nach inneren wissenschaftlichen Regeln unabhängig von dem Belieben und Können des einzelnen Wirtschaftssubjekts dem Laufe des Wirtschaftslebens ganz bestimmte, objektive Normen setzt“ (S. 394).
27
Man braucht z. B. Franklins Schilderung seiner Bestrebungen im Dienst der kommunalen improvements von Philadelphia nur zu lesen, Vgl. Sombart, ebd., S. 397: „Wir beobachten nämlich, wie langsam sich das Verhältnis von Mittel und Zweck wieder umkehrt. Es war das Novum gewesen, die wirtschaftliche Thätigkeit als Mittel zum Zwecke des Erwerbes anzusehen. Langsam vollzieht sich nun abermals eine Wandlung des Inhalts, daß der neue Zweck seine fascinierende Wirkung einbüßt und die wirtschaftliche Thätigkeit selbst wieder als Zweck erscheint. Aber nun in der neugeprägten Form: als Kalkulation, Spekulation, als Geschäft.“
28
um diese sehr selbstverständliche Wahrheit mit Händen zu greifen. [176]Und die Freude und der Stolz, zahlreichen Menschen „Arbeit gegeben“, mitgeschaffen zu haben am ökonomischen „Aufblühen“ der Heimatstadt Franklin richtete in Philadelphia nicht nur die erste öffentliche Leihbibliothek ein (vgl. oben, S. 148 mit Anm. 40), sondern verbesserte die Stadtwache, gründete einen Feuerlöschverein, eine Akademie (die spätere Universität), unterstützte die Einrichtung eines öffentlichen Hospitals und anderes mehr. Vgl. Franklin, Sein Leben, S. 331‒335, 366‒371, 376 f. u. ö.
r
in jenem, an Volks- und Handelszahlen orientierten, Sinn des Worts, den der Kapitalismus nun einmal damit verbindet, – dies alles gehört selbstverständlich zu der spezifischen und unzweifelhaft „idealistisch“ gemeinten Lebensfreude des modernen Unternehmertums. Und ebenso ist es natürlich eine der fundamentalen Eigenschaften der kapitalistischen Privatwirtschaft, daß sie auf der Basis streng rechnerischen Kalküls rationalisiert, – wie Sombart sich ausdrückt: „rechenhaft“ gestaltet,[176]A: Heimatsstadt
29
– planvoll und nüchtern auf den erstrebten wirtschaftlichen Erfolg ausgerichtet ist, im Gegensatz zu dem von der Hand in den Mund Leben[176]„Rechenhaftigkeit und Schematistik“ brachte die doppelte Buchführung mit sich; Sombart, Der moderne Kapitalismus I, S. 395.
s
des Bauern und dem privilegierten Schlendrian des Zunfthandwerkers. Lies: Von-der-Hand-in-den-Mund-Leben
Es scheint also, als sei die Entwicklung des „kapitalistischen Geistes“ am einfachsten als Teilerscheinung in der Gesamtentwicklung des Rationalismus zu verstehen und müsse aus dessen prinzipieller Stellung zu den letzten Lebensproblemen ableitbar sein. Dabei käme also der Protestantismus nur insoweit historisch in Betracht, als er etwa als „Vorfrucht“ rein rationalistischer Lebensanschauungen eine Rolle gespielt hätte. Allein sobald man ernstlich den Versuch macht, zeigt sich, daß eine so einfache Problemstellung schon um deswillen nicht angeht, weil die Geschichte des Rationalismus keineswegs eine auf den einzelnen Lebensgebieten parallel fortschreitende Entwicklung zeigt. Die Rationalisierung [A 35]des Privatrechts z. B. ist, wenn man sie als begriffliche Vereinfachung und Gliederung des Rechtsstoffes auffaßt, in ihrer bisher höchsten Form im römischen Recht des späteren Altertums erreicht, sie ist am rückständigsten in einigen der ökonomisch am meisten rationalisierten Länder, speziell in England, wo die Renaissance des römischen Rechts seinerzeit an der Macht der großen Juristenzünfte scheiterte,
30
während seine Herrschaft in den katholischen [177]Gebieten Südeuropas stets fortbestanden hat. Die rein diesseitige rationale Philosophie hat im 18. Jahrhundert ihre Stätte durchaus nicht allein oder auch nur vorzugsweise in den kapitalistisch höchstentwickelten Ländern gefunden. Der Voltairianismus Englands Common law besteht nicht aus gesatztem Recht wie das römische Recht, sondern aus richterlichen Entscheidungen (Präjudizien). Es wurde im 16. Jahrhundert von den vier großen, in London ansässigen Anwaltsinnungen entwickelt (inns of court), die es lehrten und in den Gerichtshöfen praktisch anwandten. Es behaupte[177]te sich erfolgreich gegen das mit Wiedererwachen des klassischen Altertums an den Universitäten gelehrte römische Recht.
31
ist noch heute Gemeingut breiter oberer und – was praktisch wichtiger ist – mittlerer Schichten gerade in den romanisch-katholischen Ländern. Versteht man vollends unter praktischem „Rationalismus“ jene Art Lebensführung, welche die Welt bewußt auf die diesseitigen Interessen des einzelnen Ich bezieht und von hier aus beurteilt, so war und ist noch heute dieser Lebensstil erst recht „typische“ Eigenart der Völker des „liberum arbitrium“, wie es dem Italiener und Franzosen in Fleisch und Blut steckt; und wir konnten uns bereits überzeugen, Bezeichnung einer nach Voltaire benannten Richtung. Voltaire gilt als einer der einflußreichsten französischen Vertreter der europäischen Aufklärung und in vorrevolutionärer Zeit als Vorkämpfer für Vernunft, Menschenwürde und Toleranz.
32
daß dies keineswegs der Boden ist, auf welchem jene Beziehung des Menschen auf seinen „Beruf“ als Aufgabe, wie sie der Kapitalismus braucht, vorzugsweise gedeiht. Man kann eben das Leben unter höchst verschiedenen letzten Gesichtspunkten und nach sehr verschiedenen Richtungen hin „rationalisieren“, der „Rationalismus“ ist ein historischer Begriff, der eine Welt von Gegensätzen in sich schließt, und wir werden gerade zu untersuchen haben, wes Geistes Kind diejenige konkrete Form „rationalen“ Denkens und Lebens war, aus welcher jener „Berufs“-Gedanke und jenes, – wie wir sahen, Siehe oben, S. 153 f.
33
vom Standpunkt der rein eudämonistischen Eigeninteressen aus so irrationale – Sichhingeben an die Berufsarbeit erwachsen ist, welches einer der charakteristischsten Bestandteile unserer kapitalistischen Kultur war und noch immer ist. Uns interessiert hier gerade die Herkunft jenes irrationalen Elements, welches in diesem wie in jedem „Berufs“-Begriff liegt. Siehe oben, S. 149 und 169 f.
[178]3.
Nun ist unverkennbar, daß schon in dem deutschen Worte „Beruf“[,] ebenso wie in vielleicht noch deutlicherer Weise in dem englischen „calling“, eine religiöse Vorstellung – die einer von [A 36]Gott gestellten Aufgabe – wenigstens mitklingt und, je nachdrücklicher wir auf das Wort im konkreten Fall den Ton legen, desto fühlbarer wird. Und verfolgen wir nun das Wort geschichtlich und durch die Kultursprachen hindurch, so zeigt sich zunächst, daß die lateinisch-katholischen Völker für das, was wir „Beruf“ (im Sinne von Lebensstellung, umgrenztes Arbeitsgebiet) nennen, einen Ausdruck ähnlicher Färbung ebensowenig kennen wie das klassische Altertum,
38)
wäh[179]rend es bei allen protestantischen Völkern existiert. [A 37]Und es zeigt sich ferner, daß nicht irgend eine ethnisch bedingte Eigenart der [180]germanischen Sprachen, etwa der Ausdruck eines „germanischen Volksgeistes“ [178][A 36]Im Griechischen fehlt eine dem deutschen Wort in der ethischen Färbung entsprechende Bezeichnung überhaupt. Wo Luther unserem heutigen Sprachgebrauch schon ganz entsprechend (s. u.)
1
bei Jesus Sirach XI, 20 u. 21: „bleibe in deinem Beruf“ übersetzt, hat die LXX das eine Mal: ἔργον, das andere Mal: πόνος.[178]Siehe unten, S. 183, Fn. 40.
2
Sonst wird im Altertum τὰ προσήκοντα in dem allgemeinen Sinn von „Pflichten“ verwendet. Sir 11,20 f. lauten nach der Septuaginta (LXX) und nach Luthers Übersetzung von 1533 (ohne begriffliche Abweichungen 1545); Wiedergabe nach Luther, WA.DB, Band 12, z.St. (wie oben, S. 112, Anm. 59):
Hervorgehoben sind hier die griechischen Begriffe ἔργον, Tl. érgon (V. 20) – nach Passow, Handwörterbuch5: „Werk, 1) Arbeit, Geschäft, obliegende Sache; Verrichtung, Handthierung, Beschäftigung […]“ – und πόνος, Tl. pónos (V. 21 ) – „Arbeit, bes. saure, lästige, mühsame, ermattende, erschöpfende Arbeit, Anstrengung, Mühe“. In der unterschiedlichen Verseinteilung des Sirachbuchs folgt Weber hier und im folgenden der Lutherbibel. (Zitat aus der LXX hier nach: Vetus testamentum graece iuxta LXX interpres […], ed. Constantinus de Tischendorf, tomus II, 7. ed. – Leipzig: F. A. Brockhaus 1887.)
| στῆθι ἐν διαθήκῃ σου καὶ ὁμίλει ἐν αὐτῇ, | V. 20 Bleib jnn Gottes wort, vnd vbe dich drinnen, |
| καὶ ἐν τῷ ἔργῳ σου παλαιώθητι. | vnd beharre jnn deinem beruff, |
| μὴ θαύμαζε ἐν ἔργοις ἁμαρτωλοῦ, | Vnd las dich nicht jrren, wie die Gottlosen nach gut trachten, |
| πίστευε τῷ κυρίῳ καὶ ἔμμενε τῷ πόνῳ σου | V. 21 Vertrawe du Gott, vnd bleib jnn deinem beruff, |
| […] | [V. 22 Denn es ist dem HERRN gar leicht, einen armen reich zu machen.] |
3
In der Sprache der Stoa trägt gelegentlich κάματος (auf welches mich Herr Kollege Dieterich aufmerksam machte) eine ähnliche gedankliche Färbung bei sprachlich indifferenter [179]Provenienz. Griech., Tl. tá prosḗkonta – nach Passow, Handwörterbuch5, s.v. προσήκω: „die Pflichten, Verpflichtungen“.
4
– Im Lateinischen drückt man das, was wir mit „Beruf“ übersetzen, die arbeitsteilige dauernde Tätigkeit eines Menschen, welche (normalerweise) zugleich für ihn Einkommensquelle und damit dauernde ökonomische Existenzgrundlage ist, neben dem farblosen „opus“, mit einer dem ethischen Gehalt des deutschen Wortes wenigstens verwandten Färbung entweder durch officium (aus opificium, also ursprünglich ethisch farblos, später, so besonders bei Seneca[,] de benef[iciis] IV, 18 = Beruf)[179]Griech., Tl. kámatos – nach Passow, Handwörterbuch5: „die schwere u. saure Arbeit, Mühe, Anstrengung“. – Weber bezieht sich vermutlich auf eine mündliche Auskunft des klassischen Philologen und Religionswissenschaftlers Albrecht Dieterich (1896–1908), seit 1903 Professor in Heidelberg und Mitinitiator des „Eranos“-Kreises.
5
oder durch munus – von den Frohnden der alten Bürgergemeinde abgeleitet, – oder endlich durch professio aus, welch letzteres Wort in dieser Bedeutung charakteristischerweise ebenfalls von öffentlichrechtlichen Pflichten, nämlich den alten Steuerdeklarationen der Bürger abstammen dürfte, später speziell für die im modernen Sinn „liberalen Berufe“ (so: professio bene dicendi) verwendet wird und auf diesem engeren Gebiete eine unserem Wort „Beruf“ in jeder Hinsicht ziemlich ähnliche Gesamtbedeutung annimmt (auch im mehr innerlichen Sinn des Wortes; so wenn es bei Cicero von Jemand heißt: non intelligit quid profiteatur, in dem Sinn von: „er erkennt seinen eigentlichen Beruf nicht“), Seneca, De beneficiis IV,18: „Nam quo alio tuti sumus, quam quod mutuis iuvamur officiis? hoc uno instructior vita contraque incursiones subitas munitior est, beneficiorum commercio.“ (Zit. nach: Seneca, Opera I/2). – Zitiert auch bei Maurenbrecher, Thomas von Aquino (von Weber eingeführt unten, S. 191, Fn. 42), S. 37, Anm. 2.
6
– nur daß es eben natürlich durchaus diesseitig, ohne jede religiöse Färbung gedacht ist. Dies ist bei „ars“, welches in der Kaiserzeit für „Handwerk“ verwendet wird, natürlich erst recht der Fall. – Die Vulgata übersetzt die obigen Stellen bei Jesus Sirach das eine Mal mit „opus“, das andere Mal (v. 21) mit „locus“, „non intelligit quid profiteatur“ bei Cicero nicht nachweisbar; „professio bene dicendi“ etwa in Cicero, De oratore I, 6, 20 f.: „etenim ex rerum cognitione efflorescat et redundet oportet oratio. [quae nisi sit ab oratore percepta et cognita, inanem quandam habet elocutionem et paene puerilem.] […] quamquam vis oratoris professioque ipsa bene dicendi hoc suscipere ac polliceri videatur, ut omni de re, quaecumque sit proposita, ornate ab eo copioseque dicatur“. Μ. Tullii Ciceronis Opera rhetorica, recensuit C. L. Kayser, vol. II. (editio stereotypa). – Leipzig: Bernhard Tauchnitz 1860, z.St. (eckige Klammern mit Wortlaut im Text). Übersetzt: „[…] liegt nicht ein vom Redner voll erfasster und erkannter Gegenstand zugrunde, so beherrscht er nur leeres und beinahe kindisches Geschwätz. […] gleichwohl scheint das Wesen des Redners und der Anspruch, gut zu reden, das auf sich zu nehmen und zu verheißen, dass er über jedes Thema, welches auch immer ihm gestellt wird, mit reichem Schmuck und Wort und gedankenreich sprechen kann.“ Zitiert nach Cicero, De oratore. Über den Redner. Lat.-dt., hg. und übers. von Theodor Nüßlein (Sammlung Tusculum). – Düsseldorf: Patmos, Artemis & Winkler 2007, z.St.
7
was in diesem Fall [180]etwa „soziale Stellung“ bedeuten würde. – In den romanischen Sprachen hat nur das spanische „vocacion“ Die Vulgata übersetzt ἔργον (Tl. érgon; Sgl.) mit opus (hier: Pl. opera) und πόνος (Tl. pónos) mit locus, die Luther beidemale mit „Beruf“ wiedergibt (vgl. oben, S. 178, Fn. 38 mit Anm. 2): [V. 20] Sta in testamento tuo, et in illo colloquere, Et in opera mandatorum tuorum veterasce. Ne manseris in operibus peccatorum. [V. 21] Confide autem in Deo, et mane in loco tuo. (Hier mit Hervorhebung der entscheidenden Begriffe.)
9
im Sinne des inneren „Berufes“ zu etwas, vom geistlichen Amt übertragen, eine dem deutschen Wortsinn teilweise entsprechende Färbung, wird aber nie vom „Beruf“ im vocación (span.), „Berufung, Bestimmung“.
a
äußerlichen Sinn gebraucht. In den romanischen Bibelübersetzungen wird das spanische vocacion, das italienische vocazione und chiamamento[180]A: in
10
sonst in einer dem gleich zu erörternden lutherischen und calvinistischen Sprachgebrauch teilweise entsprechenden Bedeutung nur zur Übersetzung des neutestamentlichen „κλῆσις“ vocazione (italien.), „Rufen, Ruf; Berufung“ u. a.; chiamamento (italien., Substantiv), von chiamare, „rufen, berufen, nennen“.
11
, der Berufung durch das Evangelium zum ewigen Heil, [A 37]verwendet, wo die Vulgata „vocatio“ hat. „Chiamamento“ verwendet in dieser Art z. B. die italienische Bibelübersetzung aus dem 15. Jahrhundert, die in der Collezione di opere inedite o Griech., Tl. klḗsis, „Ruf, Aufforderung, Einladung, Berufung“ (nach Cremer, Hermann, Biblisch-theologisches Wörterbuch der Neutestamentlichen Gräcität, 8. verm. und verb. Aufl. – Gotha: Friedrich Andreas Perthes 1895; hinfort: Cremer, Wörterbuch).
b
rare, Bologna 1887 abgedruckt ist,A: e
12
neben „vocazione“, welches die modernen italienischen Bibelübersetzungen benutzen. In der „Bibbia volgare“ von 1471 [HD] (enthalten in der von Weber hier angegebenen „Collezione“ von 1887) ist lat. vocatio (Vulgata) mit „chiamamento“ in 1 Kor 1,26; 2 Thess 1,11; Hebr 3,1; 2 Petr 1,10 übersetzt (1 Kor 7,20: „E ciascuno che è chiamato“), aber auch mit „vocazione“ in Eph 1,18; 4,1 und 4,4.
13
Die für „Beruf“ im äußerlichen Sinn von regelmäßiger Erwerbstätigkeit verwendeten Worte in den romanischen Sprachen tragen dagegen, wie aus dem lexikalischen Material und aus einer freundlichen eingehenden Darlegung meines verehrten Freundes Professor Baist (Freiburg) hervorgeht, Die bis heute maßgebliche italienische Bibelübersetzung der Protestanten geht auf Giovanni Diodati, Genf 1607 [HD], rev. 1641, zurück. In ihrer 1888 veröffentlichten Fassung enthält sie an sämtlichen in der vorhergehenden Anm. genannten ntl. Stellen „vocazione“. Dasselbe gilt für die Bibelübersetzung Antonio Martinis (1760–1781), die Standardbibel der Katholiken, in der Ausgabe von 1821 [HD].
14
durchweg keinerlei religiöse Prägung an sich, mögen sie nun, wie die von ministerium [181]oder officium abgeleiteten[,] ursprünglich eine gewisse ethische Färbung gehabt haben oder[,] wie die von ars, professio und implicare (impiego) Vermutlich mündliche Darlegung Gottfried Baists (1853–1920), seit 1891 Professor für Romanistik in Freiburg i. Br.
15
abgeleiteten[,] auch dieser von Anfang an völlig entbehren. Die eingangs erwähnten Stellen bei Jesus Sirach, wo Luther „Beruf“ hat, werden übersetzt: französisch v. 20 office, v. 21 labeur (calvinistische Übersetzung),[181]impiego (italien.), hier „Amt, Anstellung, Stellung“.
16
spanisch v. 20 obra, v. 21 lugar (nach der Vulgata), Belegt für französische protestantische Bibeln des 16. und beginnenden 17. Jahrhunderts: „office“ und „labeur“ Sir 11,20 f. übersetzen Pierre Robert Olivétan (1535; 1565 [HD]) und die calvinistische „Genfer Bibel“ von 1588, eine Revision der Übersetzung Olivétans durch die „Vénérable Compagnie“, die Genfer Geistlichkeit (1638 [HD]). (Anders später Jean Diodati in seiner Revision der „Genfer Bibel“ (1644): labeur (V. 22), trauail (V. 23), und Jean Frédéric Ostervald (1724, rev. 1744, überprüft für die Ausgabe 1903): ouvrage (V. 20), travail (V. 21).)
17
italienisch: ältere Übersetzungen: luogo (nach der Vulgata), neue Übersetzungen: „posto“ (protestantisch). Weber scheint sich hier auf die Übersetzung nach der Vulgata von Phelipe Scio de San Miguel (1790–1793, hier eingesehen die Ausgabe 1821 [HD]) zu stützen: obra (V. 21) und lugar (V. 22). (In der ersten gedruckten spanischen Vollbibel (Basel 1569 [HD]) übersetzt Cas(s)iodoro de Reina dagegen: obra (V. 21), trabajo (V. 22). Die Begriffe werden in der von Cipriano de Valera überarbeiteten Ausgabe dieser protestantischen Bibel (Amsterdam 1602 [HD]) beibehalten, während die Ausgabe von 1622 [HD] die Begriffe mit vocacion (!) (V. 21) und trabajo (V. 22) wiedergibt.)
18
Die „Bibbia volgare“ von 1471 [HD] (vgl. oben, S. 180, Fn. 38 mit Anm. 12) übersetzt: opera (V. 21), luogo (V. 22); ebenso Antonio Brucioli (1532, hier eingesehen die Ausgabe 1541). (Die 1562 erschienene protestantische Vollbibel, eine Neufassung von Bruciolis Text, hat dagegen: offitio (V. 21), fatica (V. 22). Giovanni Diodati (1607 [HD]; von ihm rev. 1641) hat: opera (dort V. 25, 1641: lauoro), fatica (dort V. 26); Mattia d’Erberg 1711 [HD] ebenfalls „opera“ und „fatica“.) – Der katholische Antonio Martini (1777 und 1821 [HD], dort V. 22) übersetzt mit „posto“. Für eine protestantische italienische Bibelausgabe konnte „posto“ dagegen nicht nachgewiesen werden.
8
dabei beteiligt ist, sondern daß das Wort in seinem [181]heutigen Sinn aus den Bibelübersetzungen stammt[,] und zwar aus dem Geist der Übersetzer, nicht aus dem Geist des Originals.[180]Webers Anspielung auf einen „Volksgeist“ oder „Volkscharakter“ (unten, S. 212, auch Protestantische Ethik II, unten, S. 246, Fn. 3, S. 262, 366, 389, Fn. 40, S. 411, Fn. 69, S. 424, und Weber, Kritische Bemerkungen, unten, S. 486, Fn. 8) dürfte Anlehnung an den Begriff Friedrich Carl von Savignys und seiner Schule haben, die „den Begriff des – notwendig irrational-individuellen – ,Volksgeistes‘ als des Schöpfers von Recht, Sprache und den übrigen Kulturgütern der Völker“ hypostasierten. „Dieser Begriff ,Volksgeist‘ selbst wird dabei nicht als ein provisorisches Verhältnis […], sondern als ein einheitliches reales Wesen metaphysischen Charakters behandelt und nicht als Resultante unzähliger Kultureinwirkungen, sondern umgekehrt als der Realgrund aller einzelnen Kulturäußerungen des Volks angesehen, welche aus ihm emanieren.“ Zitate: Weber, Roscher und Knies I, S. 9 f.
39)
Es scheint in der lutherischen Bibelübersetzung zuerst an einer Stelle des Jesus Sirach (XI, 20 u. 21) ganz in unserem heutigen Sinn ver[182]wendet zu sein. Dagegen enthält die Augsburger Konfession den Begriff nur teilweise entwickelt und implicite.
Nur Art. XXVI (Kolde S. 81) wird in der Wendung: … „daß Kasteiung dienen soll nicht damit Gnade zu verdienen, sondern den Leib geschickt zu halten, daß er nicht verhindere, was einem nach seinem Beruf (lateinisch: juxta vocationem suam) zu schaffen befohlen ist“,
19
Wenn Art. XVI (s. die Ausg. v[on] Kolde S. 43) lehrt: „Denn das Evangelium … stößt nicht um weltlich Regiment, Polizei und Ehestand, sondern will, daß man solches alles halte als Gottes Ordnung und in solchen Ständen christliche Liebe und rechte gute Werke, ein jeder nach seinem Beruf, beweise“ (lateinisch heißt es nur: [182][„]et in talibus ordinationibus exercere caritatem“[,] eod. S. 42), Die Ausgabe von Kolde, Augsburgische Konfession, enthält eine Synopse der lateinischen Editio princeps von April/Mai 1531 und des deutschen Textes (nach einer Kopie aus der Mainzer Erzkanzlei), die 1580 in das Konkordienbuch eingegangen ist (die Originale von 1530 sind nicht erhalten). Abweichungen des deutschen Erstdrucks (Herbst 1531) führt Kolde im Apparat auf. Das 28 Artikel umfassende Bekenntnis hat Philipp Melanchthon entscheidend geprägt, redigiert und immer wieder überarbeitet; er verantwortete auch die lateinische und deutsche Editio princeps. – Weber gibt im folgenden eine Analyse der wichtigsten Stellen, die den Berufsbegriff enthalten.
20
so zeigt die daraus gezogene Konsequenz, daß man der Obrigkeit gehorchen müsse, daß hier, wenigstens in erster Linie, an „Beruf“ als objektive Ordnung im Sinn von κλῆσις 1. Kor. 7, 20 gedacht ist. Und Art. XXVII spricht (bei Kolde S. 83 unten) von „Beruf“ (lateinisch: in vocatione sua) nur in Verbindung mit den von Gott geordneten Ständen: Pfarrer, Obrigkeit, Fürsten- und Herrenstand u. dgl., und auch dies im Deutschen nur in der Fassung des Konkordienbuches, während in der deutschen Ed[itio] princeps der betreffende Satz fehlt.[182]Der oben von Weber wiedergegebene deutsche Text der Synopse lautet an dieser Stelle in Art. XVI („Von der Polizei und weltlichem Regiment“): „[…] daß man solches alles halte als wahrhaftige Ordnung […]“. („Gottes Ordnung“ entnimmt Weber der im Apparat aufgeführten deutschen Editio princeps (Kolde, Augsburgische Konfession, S. 42 f.) oder der lateinischen Fassung („ordinationes Dei“).)
21
Der Text der Synopse von Art. XXVII („Von Klostergelübden“) enthält den Berufsbegriff: „Item daß man mehr verdienet mit dem Klosterleben denn mit allen andern Ständen, so von Gott geordnet sind, als Pfarrherr- und Predigerstand, Obrigkeit-[,] Fürsten-[,] Herrenstand und dergl., die alle nach Gottes Gebot, Wort und Befehl in ihrem Beruf ohne erdichtete Geistlichkeit dienen […].“ In der deutschen Editio princeps weicht der Text ab: „Also rhümen sie das klosterleben, vnd setzens viel höher denn die Tauff, und sonst eusserliche Gottliche stende, als vber Oberkeit, Predigampt, Ehestand“ (Kolde, Augsburgische Konfession, S. 83). Lat.: „[…] qui in mandatis Dei sine factitiis religionibus suae vocationi serviunt“ (S. 84).
Nur Art. XXVI (Kolde S. 81) wird in der Wendung: … „daß Kasteiung dienen soll nicht damit Gnade zu verdienen, sondern den Leib geschickt zu halten, daß er nicht verhindere, was einem nach seinem Beruf (lateinisch: juxta vocationem suam) zu schaffen befohlen ist“,
c
[182]A: ist,“
22
– das Wort in einem unseren heutigen Begriff wenigstens mit umfassenden Im Art. XXVI („Vom Unterschied der Speis“, d. h. über Speise- und Fastenregeln sowie Askese) bei Kolde, Augsburgische Konfession, S. 81: „[…] was einem jeglichen nach seinem Beruf […]“.
d
Sinn gebraucht. A: umfassendem
40)
Es hat dann sehr bald in der [A 38]Profansprache aller [183]protestantischen Völker seine heutige Bedeutung angenommen, [184]während vorher in der profanen Literatur keines [A 39]derselben irgend [185]ein Ansatz zu einem derartigen Wortsinn zu bemerken war und [186]auch in der Predigtliteratur, soviel ersichtlich, [A 40]nur bei einem der [187]deutschen Mystiker, deren Einfluß auf Luther bekannt ist. Vor den lutherischen Bibelübersetzungen kommt, wie die Lexika ergeben [A 38]und die Herren Kollegen Braune und Hoops mir freundlichst bestätigten[,]
Luther übersetzt zweierlei zunächst ganz verschiedene Begriffe mit „Beruf“. Einmal die paulinische ,,κλῆσις“ im Sinne der Berufung zum ewigen Heil durch Gott. Dahin gehören: 1. Cor. 1,26; Eph. 1,18; 4,1.4; 2. Thess. 1,11; Hebr. 3,1; 2. Petri 1,10.
Offenbar nun enthält der Ratschlag bei Sirach, von der allgemeinen Mahnung zum Gottvertrauen abgesehen, nicht die geringste Beziehung auf eine spezifische religiöse Wertung der „Berufs“-Arbeit und der Ausdruck πόνος (Mühsal)
Bei Luther (in den üblichen modernen Ausgaben) lautet der ganze Zusammenhang, in dem diese Stelle steht[,] wie folgt: 1. Kor. 7, v. 17:
In der Tat ist offenbar, daß das Wort κλῆσις an dieser – und nur an dieser – Stelle so ziemlich dem lateinischen „status“ und unserem „Stand“ (Ehestand, Stand des Knechtes, usw.) wenigstens annähernd entspricht.
Schon im 16. Jahrhundert ist dann der Begriff „Beruf“ in der außerkirchlichen Literatur im heutigen Sinne eingebürgert. Die Bibelübersetzer vor Luther hatten für κλῆσις das Wort „Berufung“ gebraucht, (so z. B. in den Heidelberger Inkunabeln von 1462/66, 1485),
23
das Wort „Beruf“, holländisch: „beroep“, englisch: „calling“, dänisch: „kald“, schwedisch: „kallelse“ in keiner der Sprachen, die es jetzt enthalten, in seinem heutigen weltlich gemeinten Sinn vor. Die mit „Beruf“ gleichlautenden mittelhochdeutschen, mittelniederdeutschen und mittelniederländischen Worte bedeuten sämtlich „Ruf“ in dessen heutiger deutscher Bedeutung, einschließlich insbesondere auch – in spätmittelalterlicher Zeit – der „Berufung“ (= Vokation) eines Kandidaten zu einer geistlichen Pfründe durch den Anstellungsberechtigten – ein Spezialfall, der auch bei den skandinavischen Sprachen in den Wörterbüchern hervorgehoben zu werden pflegt. Weber beruft sich auf die vermutlich mündlichen Mitteilungen des Germanisten Wilhelm Braune (1850–1926), seit 1888 Professor in Heidelberg, und des Anglisten Johannes Hoops (1865–1949), seit 1896 a.o. und seit 1902 o. Professor ebd.
24
In dieser letzteren Be[183]deutung braucht auch Luther das Wort gelegentlich. Allein, mag später diese Spezialverwendung des Wortes seiner Umdeutung ebenfalls zugute gekommen sein, so geht doch die Schöpfung des modernen „Berufs“-Begriffs auch sprachlich auf die Bibelübersetzungen, und zwar die protestantischen, zurück, und nur bei Tauler († 1361) finden sich später zu erwähnende Ansätze dazu. Z. B. Helms, Svenn Henrik, Neues vollst. Schwedisch-deutsches und deutsch-schwedisches Wörterbuch […], Stereotypausg., 5. Aufl. – Leipzig: Otto Holzes Nach[183]folger 1904, S. 206: s.v. Kall: „der Beruf, das Amt, die Pflicht; der Pfarrdienst […]“, s.v. „Kallelse“: „die Berufung; der Ruf“, unter den Spezialbedeutungen: „‒ till ett pastorat, die Berufung od. der Ruf zu einem Pfarramt“; und: ders., Neues vollst. Wörterbuch der dänisch-norwegischen und deutschen Sprache […], Stereotypausg., 7. Aufl., ebd. 1904, S. 196, s.v. Kald: „der Ruf zu Etwas, Beruf, die Berufung zum Amte; das Amt (namentlich das Predigeramt) […]“.
25
Siehe in derselben Fn. unten, S. 184 f.
Luther übersetzt zweierlei zunächst ganz verschiedene Begriffe mit „Beruf“. Einmal die paulinische ,,κλῆσις“ im Sinne der Berufung zum ewigen Heil durch Gott. Dahin gehören: 1. Cor. 1,26; Eph. 1,18; 4,1.4; 2. Thess. 1,11; Hebr. 3,1; 2. Petri 1,10.
26
In allen diesen Fällen handelt es sich um den rein religiösen Begriff jener Berufung, die durch Gott vermittels des durch den Apostel verkündeten Evangeliums erfolgt ist[,] und hat der Begriff κλῆσις nicht das Mindeste mit weltlichen „Berufen“ im heutigen Sinne zu tun. Die deutschen Bibeln vor Luther schreiben in diesem Fall: „ruffunge“ (so sämtliche Inkunabeln der Heidelberger Bibliothek), Vgl. Luthers Übersetzung 1522–1545 mit „Beruf“ in: WA.DB, Band 7, z.St. (1522: 1 Kor 1,26: „ruff“), dazu den Editorischen Bericht, oben, S. 112.
27
brauchen auch wohl statt „von Gott geruffet“: „von Gott gefordert“. An den von Weber genannten Stellen haben sämtliche 14 hochdeutsche vorlutherische Bibeldrucke, darunter die Heidelberger Inkunabeln (vgl. den Editorischen Bericht, oben, S. 117, Anm. 78), „růffung“ (teilweise auch: růffungen in Eph 1,18) oder „rúffunge" (1 Kor 1,26) bzw. „rúffung“ (2 Petr 1,10). Vgl. Die erste deutsche Bibel, 2. Band, hg. von W. Kurrelmeyer. – Tübingen: Gedr. für den Litterarischen Verein in Stuttgart [bei Laupp] 1905 (hinfort: Kurrelmeyer, Erste deutsche Bibel II).
28
– Zweitens aber übersetzt er – wie schon früher erwähnt – die in der vorigen Note Im 4. bis 14. Bibeldruck heißt es 1 Kor 7,17 f. 21 f.: „geuodert“, vgl. Kurrelmeyer, Erste deutsche Bibel II (wie oben, Anm. 27), z.St. (von gevordern, auch belegt als gevodern, „fordern“, „verlangen“, vgl. s.v. in: Lexer, Matthias, Mittelhochdeutsches Handwörterbuch, 1. Band. – Leipzig: S. Hirzel 1872).
29
wiedergegebenen Worte Jesus Sirachs: ἐν τῷ ἔργῳ σουπαλαιώθητι und καὶ ἔμμενε τῷ πόνῳ σου mit: beharre in deinem Beruf und bleibe in deinem Beruf, Die „vorige Note“ bezieht sich auf Fn. 38 (S. 178–181).
30
statt: bleibe bei deiner Arbeit, und die späteren (autorisierten) katholischen Bibelübersetzungen (z. B. die von Fleischütz, Fulda 1781) haben sich hier (wie in den neutestamentlichen Stellen) ihm einfach angeschlossen. Vgl. oben, S. 178, Fn. 38 mit Anm. 2.
31
Die lutherische Übersetzung bei dieser Sirachstelle ist, soviel ich sehe, der erste Fall, in welchem das Wort „Beruf“ ganz in seinem heutigen rein weltlichen Sinn gebraucht wird. In diesem Sinne [184]existierte es vorher, wie oben erwähnt, Die von Joseph Fleischütz herausgegebene katholische Bibel (6 Bände, 1778–1781 [HD]) verwendet in Sir 11,21 (dort V. 22) den Berufsbegriff: „Ferne von sündhaften Handlungen, vertraue Gott, und betreib fleißig deinen Beruf.“ Fleischütz verwendet „Beruf“ ebenfalls an den von Weber oben genannten ntl. Stellen (verbale Formulierung in Eph 4,4).
32
in der deutschen Sprache nicht, auch – soviel ich sehe – nicht im Munde der älteren Bibelübersetzer oder Prediger. Die deutschen Bibeln vor Luther übersetzen in der Sirachstelle „Werk“.[184]Siehe in der derselben Fn., oben, S. 182 f.
33
Berthold von Regensburg gebraucht in Predigten da, wo wir von „Beruf“ sprechen würden, das Wort „Arbeit“. Die erste gedruckte deutsche Bibel, die sog. Mentelin-Bibel 1466, überträgt die beiden Sirachverse: „Ste in deim gezeug vnd entzamt red in im: vnd er alt in den wercken deiner gebott. […] Wann versich dich an gott: vnd beleib in deiner stat.“ Statt „den wercken deiner gebott“ lesen die 4. bis 14. Bibel den Singular „dem werck […]“. Vgl. Die erste deutsche Bibel, 8. Band, hg. von W. Kurrelmeyer. – Tübingen: Gedr. für den Litterarischen Verein in Stuttgart [bei Laupp] 1912, z.St. – Zu den Inkunabeln vgl. den Editorischen Bericht, oben, S. 117, Anm. 78.
34
Der Sprachgebrauch ist hier also derselbe wie derjenige der Antike. Die erste mir bisher bekannte Stelle, wo zwar nicht „Beruf“, aber „Ruf“ (als Übersetzung von κλῆσις) auf rein weltliche Arbeit angewendet wird, findet sich in der schönen Predigt Taulers über Ephes. 4 (Basler Ausg. f[olio] 117 v): von Bauern, die „misten“ gehen: sie fahren oft besser, „so sie folgen einfeltiglich irem Ruff denn die geistlichen Menschen, [A 39]die auf ihren Ruf nicht Acht haben“. Weber dürfte sich bei Berthold von Regensburg, dem bekanntesten mittelalterlichen Volksprediger, in erster Linie auf die Predigt „Von vier Dingen“ beziehen, in: ders., Vollständige Ausgabe seiner deutschen Predigten […] von Franz Pfeiffer, 1. Band. – Wien: Wilhelm Braumüller 1862, S. 549–565. „Unde dâ von sült ir an der rehten arbeit funden werden, der bûman an sînem bûwe, der koufman an sînem koufe […], der hantwerkman an sînem hantwerke, der ritter an sîner ritterschaft, der geistliche mensche an sîner arbeit, die im unser herre geordent hât. […] Alliu diu antwerk oder ander arbeit, sie sîn geistlich oder werltlich, die eht der werlte nützelich und êrlich sind, die sint gote löbelich, die sol man arbeiten mit der triuwe unde mit der gerehtikeit, daz ez iu nütze werde an lîbe und an sêle“ (Zitat S. 562). In anderen Predigten gebraucht Berthold auch „amt“ (z. B. ebd., S. 11–28 und S. 140–156).
35
Dies Wort ist in diesem Sinne in die Profansprache nicht eingedrungen. Und trotzdem Luthers Sprachgebrauch anfangs (s. Werke, Erl[anger] Ausg. 51, S. 51) zwischen „Ruf“ und „Beruf“ schwankt, In der Predigt über Eph 4,1 ff. (Basler Ausg. 1521, fol. 116v–118r; von Weber wörtlich wiedergegebenes, modernisiertes Zitat nach fol. 117v) beschreibt Tauler, wie der Mensch seinem Ruf, seiner Berufung durch Gott zu einer Lebensaufgabe, gerecht wird. Hierzu betrachtet er drei nach dem Grad ihrer Vollkommenheit unterschiedene Menschengruppen. Die gewöhnlichen Menschen folgen ihrem Ruf, indem sie Gottes Gebote und Verbote halten (praecepta); die Menschen auf der zweiten Stufe (Mönche und Ordensleute) befolgen die „evangelischen Räte“ (consilia), d. h. Reinheit des Leibes, Besitzlosigkeit und Gehorsam. Auf der obersten (mystischen) Stufe folgen die Menschen dem Vorbild Christi, und zwar auf wirkende (aktive) und leidende (passive) Weise. – An der von Weber zitierten Stelle wird dem sich einseitig nach der geistlichen Seite bemühenden Menschen, der seiner Berufung nicht gerecht wird, der weltliche, sich redlich um die Ernährung seiner selbst und seiner Familie bemühende Mensch – Frau, Schuster, Bauer – als mahnendes gutes Beispiel gegenübergestellt. Zur Hochschätzung der weltlichen Arbeit vgl. auch die Predigt Taulers, Basler Ausg., fol. 94v–96r, die jedoch anstelle des Begriffs „Ruf“ Dienst, Tätigkeit, Arbeit, Werk gebraucht. – Hinweise auf beide Predigten gibt Seeberg, Dogmengeschichte II, S. 165, Anm. 4.
36
ist eine direkte Beeinflus[185]sung durch Tauler durchaus nicht sicher, obwohl manche Anklänge gerade an diese Predigt Taulers sich z. B. in der „Freiheit eines Christenmenschen“ finden. Denn in dem rein weltlichen Sinn wie Tauler l. c. hat Luther das Wort zunächst nicht verwendet (dies gegen Denifle, Luther, S. 163). [185]Weber bezieht sich auf Luthers Auslegung von 1 Korinther 7 von 1523. Luther übersetzt κλῆσις (klḗsis; V. 20) mit „Ruf“ (Luther, 1 Korinther 7, S. 51). In der Exegese des Verses paraphrasiert er: „[…] S. Paulus Wort, da er sagt, du sollest im Beruf bleiben, darin du berufen bist […]“ (S. 52).
37
Denifle zitiert aus der genannten Tauler-Predigt, in der Tauler die weltliche Arbeit als „Ruf Gottes“ adele. Er stört sich dabei an Walther Köhlers Interpretation, der dies als „spezifisch (!) Lutherisch klingende … betonte hohe Werthung der Erkenntniß des gottgegebenen Berufes“ werte. Denn Denifle meint, Luther habe nur allgemeines kirchliches Gedankengut übernommen (vgl. Denifle, Luther, S. 163, Anm. 1).
Offenbar nun enthält der Ratschlag bei Sirach, von der allgemeinen Mahnung zum Gottvertrauen abgesehen, nicht die geringste Beziehung auf eine spezifische religiöse Wertung der „Berufs“-Arbeit und der Ausdruck πόνος (Mühsal)
e
wohl eher das Gegenteil einer solchen.[185]A: (Muhsal)
38
Was Jesus Sirach sagt, entspricht einfach der Mahnung des Psalmisten (Ps. 37,3): bleibe im Lande und nähre dich redlich, wie auch die Zusammenstellung mit der Mahnung (v. 20), sich nicht die Weise der Gottlosen, nach Gut zu trachten, zum Muster zu nehmen, auf das deutlichste ergibt. Die Brücke zwischen jenen beiden anscheinend ganz heterogenen Verwendungen des Wortes Beruf bei Luther schlägt eine Stelle im ersten Korintherbrief und ihre Übersetzung. Vgl. das Septuaginta-Zitat Sir 11,21, oben, S. 178, Anm. 2.
Bei Luther (in den üblichen modernen Ausgaben) lautet der ganze Zusammenhang, in dem diese Stelle steht[,] wie folgt: 1. Kor. 7, v. 17:
39
„… ein jeglicher, wie ihn der Herr berufen hat, also wandle er … (18) Ist jemand beschnitten berufen, der zeuge keine Vorhaut. Ist jemand berufen in der Vorhaut, der lasse sich nicht beschneiden. (19) Die Beschneidung ist nichts und die Vorhaut ist nichts; sondern Gottes Gebot halten. (20) Ein jeglicher bleibe in dem Beruf, in dem er berufen ist (ἐν τῇ κλήσει ᾖ ἐκλήθη, – wie Geheimrat A[dalbert] Merx mir sagt, ein zweifelloser Hebraismus, – Vulgata: in qua vocatione vocatus est). Webers Wiedergabe von 1 Kor 7,17 ff. liegt sehr wahrscheinlich eine Bibelausgabe nach der Übersetzung Luthers zugrunde, die vor der revidierten Lutherbibel von 1892 erschienen war und deren Text Weber seinerseits geringfügig modernisiert. Vgl. den Editorischen Bericht, oben, S. 113 f. mit Anm. 64.
40
(21) Bist du ein Knecht berufen, sorge des nicht; doch kannst du frei werden, so brauche des viel lieber. (22) Denn wer ein Knecht berufen ist, der ist ein Gefreiter des Herrn; desgleichen wer ein Freier berufen ist, der ist ein Knecht Christi. (23) Ihr seid teuer erkauft; werdet nicht der Menschen Knechte. (24) Ein jeglicher, lieben Brüder, worinnen er berufen ist, darinnen bleibe er bei Gott.“ V. 29 folgt dann der Hinweis darauf, daß „die Zeit kurz“ sei, worauf die bekannten, durch eschatologi[186]sche Erwartungen (v. 31) motivierten Anweisungen folgen, die Weiber zu haben, als hätte man sie nicht, zu kaufen, als besitze man das Gekaufte nicht usw. In v. 20 hatte Luther im Anschluß an die älteren deutschen Übertragungen noch 1523 in seiner Exegese dieses Kapitels κλῆσις mit „Ruf“ übersetzt (Erl[anger] Ausgabe, Bd. 51, Mit Hebraismus dürfte hier die Nachbildung einer figura etymologica (Nomen und Verbum haben denselben Stamm) im Griechischen gemeint sein, wie sie im Hebräischen (bzw. Semitischen) öfters verwendet wird. Zur griechischen Wendung mit Übersetzung vgl. oben, S. 178, Anm. 2. – Die Mitteilung von Adalbert Merx (1838–[186]1909), Orientalist und biblischer Philologe, seit 1875 Professor für Altes Testament in Heidelberg, erfolgte vermutlich mündlich.
f
S. 51) und damals mit „Stand“ interpretiert.[186]A: Bd., 51
41
Vgl. Luther, 1 Korinther 7, S. 51, wie oben, S. 184 f., Anm. 36. Die deutschen Inkunabeln des 15. Jahrhunderts haben in 1 Kor 7,20 „rúffung“ (z. B. Mentelin und Eggestein) oder „beruͦffung“ (4.–14. Bibeldruck). Vgl. Kurrelmeyer, Erste deutsche Bibel II (wie oben, S. 183, Anm. 28).
In der Tat ist offenbar, daß das Wort κλῆσις an dieser – und nur an dieser – Stelle so ziemlich dem lateinischen „status“ und unserem „Stand“ (Ehestand, Stand des Knechtes, usw.) wenigstens annähernd entspricht.
42
In einer wenigstens daran erinnernden Bedeutung findet sich dieses Wort – der Wurzel nach mit ἐκκλησία Luther, 1 Korinther 7 von 1523 (Erlanger Ausgabe, Band 51, S. 1–69). Luther will der Höherstellung des Ordens- und Klerikerstands ein Ende machen, indem er den weltlichen Stand samt Eheleben aufwertet. Selig mache nicht der „Stand“, sondern allein der Glaube (S. 47 f.), was Luther über den Ehestand hinaus auch auf andere „Stände“ (bei Luther auch: „Beruf“) wie den des Knechtes (nach 1 Kor 7,21 f.), gleichgültig, ob frei oder unfrei, ausweitet (vgl. S. 51). ,,[D]ieß Wörtlein, Ruf“ (griech. κλῆσις, Tl. klḗsis, lat. vocatio; 1 Kor 7,20) möchte er darum nicht (wie traditionell üblich) als Ruf in den Ehe- oder Priesterstand verstehen, sondern als den „evangelischen Ruf“ von Gott, was bedeute: „Wie dich das Evangelion trifft, und wie dich sein Rüfen findet, so bleibe. Rüft dirs im Ehestand, so bleibe in demselben Rüfen, darinnen dichs findet; rüft dirs in der Knechtschaft, so bleib in der Knechtschaft, darinnen du berufen wirst“ (Luther, 1 Korinther 7, S. 56 f.).
g
, „berufene Versammlung“, verwandt – in der griechischen Literatur, soweit das lexikalische [A 40]Material reicht, nur einmal in einer Stelle des Dionysius von Halikarnaß, wo es dem lateinischen classis – einem griechischen Lehnworte = die „einberufene“, aufgebotene Bürgerabteilung – entspricht.A: ἔκκλησια
43
Theophylaktos (11./12. Jahrh[undert]) interpretiert 1. Kor. 7,20: ἐν οἵῳ βίῳ καὶ ἐv οἵῳ τάγματι καὶ πολιτεύματι Vgl. hierzu z. B. Passow, Handwörterbuch5, s.v. κλῆσις: Bei Dionysius (Antiquitates 4,18) seien „κλῆσις u. κλῆσεις die Bürgerabtheilungen, die röm. classes, deren Benennung er davon richtig herleitet“. Ähnlich: Meyer, Heinr[ich] Aug[ust] Wilh[elm], Kritisch exegetisches Handbuch über den ersten Brief an die Korinther (Kritisch exegetischer Kommentar über das Neue Testament, begr. von dems., 5. Abth.), 5., verb. und verm. Aufl. – Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht 1870, S. 201 [dass., neu bearb. von G. F. Heinrici, 8. Aufl. 1896, S. 230 f.]. Meyer verweist auf Dionysius und fügt hinzu, daß auch bei den griechischen Profanschriftstellern und im gesamten NT κλῆσις (klḗsis) niemals im Sinne von Beruf oder Stand vorkomme (ebd.). So auch Cremer, Wörterbuch (wie oben, S. 178, Anm. 2), s.v. κλῆσις.
h
ὢν ἐπίστευσενA: πσλιτεύματι
i
(Herr Kollege Deißmann machte mich auf die Stelle aufmerksam).A: ἐπιστευσεν
44
– Unserem heutigen „Beruf“ entspricht [187]κλῆσις auch in unserer Stelle jedenfalls nicht. Aber Luther, der in der eschatologisch motivierten Mahnung, daß jeder in seinem gegenwärtigen Stande bleiben sollte, κλῆσις mit „Beruf“ übersetzt hatte, hat dann, als er später die Apokryphen übersetzte, in dem traditionalistisch und antichrematistisch motivierten Rat des Jesus Sirach, daß jeder bei seiner Hantierung bleiben möge, schon wegen der sachlichen Ähnlichkeit des Ratschlages πόνος ebenfalls mit „Beruf“ übersetzt. Das griechische Zitat aus dem Schrifttum des Theophylaktos gibt auch Meyer (wie vorherige Anm.) z.St. wieder. Weber bezieht sich seinerseits vermutlich aber auf eine mündliche Auskunft von Adolf Deissmann (1866–1937), seit 1897 Professor für Neues Testament in Heidelberg und Mitbegründer des „Eranos“-Kreises.
46
Inzwischen (oder etwa gleichzeitig) war 1530 in der Augsburger Konfession das protestantische Dogma über die Nutzlosigkeit der katholischen Überbietung der innerweltlichen Sittlichkeit festgelegt und dabei die Wendung „einem jeglichen nach seinem Beruf“ gebraucht worden (s. vor[ige] Anm.). Luther übersetzt in den Bibelausgaben von 1522 bis 1545 κλῆσις (klḗsis) in 1 Kor 7,20 stets mit „ruff“, nicht „Beruf“ (Ausnahme das von Weber beobachtete Schwanken zwischen „Ruf“ und „Beruf“ in der Exegese von 1523, vgl. oben, S. 184). Vgl. dazu den Editorischen Bericht, oben, S. 113. Im Sirachbuch (1533 = 1545) übersetzte er πόνος (pόnos) und ἔργον (érgon) in Sir 11,20 (bzw. V. 21) dagegen mit „beruff“ (vgl. oben, S. 178, Fn. 38 mit Anm. 2).
47
Dies und jene gerade Anfang der 30er Jahre sich wesentlich steigernde Schätzung der Heiligkeit der Ordnung, in die der einzelne gestellt ist, die ein Ausfluß seines immer schärfer präzisierten Glaubens an die ganz spezielle göttliche Fügung auch in den Einzelheiten des Lebens war, zugleich aber seine sich steigernde Neigung zur Hinnahme der weltlichen Ordnungen als von Gott unabänderlich gewollt, treten hier in Luthers Übersetzung hervor. Weber dürfte die gesamte Augsburger Konfession von 1530 meinen, im engeren Sinn Art. XXVII („Von Klostergelübden“). – Zum Zitat siehe oben, S. 181, Fn. 39.
48
Denn während er jetzt πόνος und ἔργον bei Jesus Sirach mit „Beruf“ übersetzt, hatte er einige Jahre vorher noch in Sprüche Salomon[is] 22,29 das hebräische, מְלָאכָה, welches den „πόνος“ und „ἔργον“ des griechischen Textes von Jesus Sirach zweifellos zugrunde lag und vom Stamm לאך = senden, schicken, also von dem Begriff „Sendung“ abgeleitet ist, Bei der Entwicklung von Luthers Berufsverständnis folgt Weber der Darstellung von Eger, Anschauungen Luthers vom Beruf, worauf er selbst unten, S. 190, Fn. 41, hinweist.
49
und – ganz wie das deutsche Beruf, und das nordische kald, kallelse, Spr 22,29 zitiert Weber auch oben, S. 150, Fn. 25. Luther übersetzt die Wortform (mit Präposition und Pronominalsuffix) des von Weber genannten hebräischen Substantivs מְלָאכָה, Tl. melāʼkāh, schon 1524 in einer Teilübersetzung des AT, die die Sprüche Salomos enthält, mit „in seinem Geschäft“. Dem Substantiv liegt die Wortwurzel לאךְ /l'k, „senden“, zugrunde (vgl. s.v., in: Gesenius, Wilhelm, Hebräisches und aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament, bearb. von Frants Buhl, 13. Aufl. – Leipzig: Vogel 1899).
50
– insbesondere vom geistlichen „Beruf“ ausgeht, mit „Geschäft“ übertragen (LXX: ἔργον, Vulg[ata]: opus, englische Bibeln: business, Zu dänisch „kald“ und schwedisch „kallelse“ vgl. oben, S. 182, Fn. 40.
51
entspre[188]chend auch die nordischen und alle sonstige Übersetzungen). Vgl. oben, S. 150, Fn. 25 mit Anm. 48. Auch zeitgenössisch heißt es „business“, z. B. The Holy Bible, containing the Old and New Testaments […] appointed to be read in Churches. – Oxford: University Press, for the British and Foreign Bible Society 1898, z.St.
52
Gedanklich war freilich bei מְלָאכָה der Zusammenhang mit dem Stammbegriff, wie Herr Geh.-Rat Merx mich belehrt, schon im Altertum ebenso völlig verloren gegangen, wie für unser „Beruf“ etwa in dem Wort „Berufsstatistik“.[188]Die Resen-Svaning-Bibel, Kopenhagen 1647, die in Dänemark und Norwegen zur Standardbibel wurde, übersetzt Spr 22,29 allerdings mit „Gierning“ (dän., „Tat, Handlung, Werk“; ebenso Sir 11,25 (sic), für V. 26 wird „arbeyde“ gebraucht). Sie waren in der UB Heidelberg nicht vorhanden. Ebenso übersetzt die dänische „Biblia det er den ganske Heilige Skrifts Bøger“ von 1819.
53
Zu Adalbert Merx vgl. in derselben Fn. oben, S. 185. – Tatsächlich lag dem griechischen Begriff ἔργον (érgon) in Sir 11,20 der oben von Weber genannte hebräische Begriff zugrunde. Das zeigen die zwischen 1896 und 1900 in der Geniza der Kairoer Ben-Esra-Synagoge gefundenen Fragmente des hebräischen Originals verschiedener Sirach-Handschriften, das bis dahin unbekannt war. Näheres im Glossar, unten, S. 832.
Schon im 16. Jahrhundert ist dann der Begriff „Beruf“ in der außerkirchlichen Literatur im heutigen Sinne eingebürgert. Die Bibelübersetzer vor Luther hatten für κλῆσις das Wort „Berufung“ gebraucht, (so z. B. in den Heidelberger Inkunabeln von 1462/66, 1485),
54
die Ecksche Ingolstädter Übersetzung von 1537 sagt: „in dem Ruf, worin er beruft ist“. Weber bezieht sich mit 1462/66 auf die Eggesteinsche Bibel, den zweiten der 14 hochdeutschen vorlutherischen Bibeldrucke (Inkunabeln), der lange Zeit aufgrund der fehlerhaften Angabe 1462 im Stuttgarter Exemplar als erster Druck galt. Im Quartkatalog der UB Heidelberg ist sie einmal als erster Druck 1462–1466, das anderemal mit „nicht nach 24.5.1466“ aufgeführt. – Bei der Inkunabel von 1485 handelt es sich um den (zehnten) Druck, Straßburg, als Verleger gilt Grüninger. Zu den Inkunabeln vgl. den Editorischen Bericht, oben, S. 117, Anm. 78. – Die Inkunabeln geben vocatio 1 Kor 7,20 im 4. bis 14. Druck mit „beruͤffung“ wieder, Mentelin und Eggestein (sowie der 3. Druck) haben hier „rúffung“, zu den übrigen ntl. Stellen („růffung[en]“/„rúffung[e]“) vgl. oben, S. 183, Anm. 28. Nach Kurrelmeyer, Erste deutsche Bibel II (ebd.), z.St.
55
Die späteren katholischen Übersetzungen folgen meist direkt Luther. Johann Eck (1537 [HD]) folgt im NT weitgehend der Übersetzung von Hieronymus Emser (1527), der seinerseits auf Luther fußt und in 1 Kor 7,20 wie von Weber zu Eck zitiert überträgt.
56
In England Während Dietenberger (1534 [HD]) 1 Kor 7,20 mit einer Verbform umschreibt, gebrauchen Ulenberg [HD], die Mainzer Bibel, Fleischütz [HD] und Allioli (hier eingesehen: 1838 und 1851) das Substantiv „Beruf“. – Zu den katholischen Bibeln vgl. den Editorischen Bericht, oben, S. 114 f.
57
hat die Wiclefsche Bibelübersetzung (1382) hier „cleping“ (das [189]altenglische Wort, welches später durch das Lehnwort „calling“ ersetzt wurde), Die genannten englischen Bibelübersetzungen waren zu Webers Zeit in Deutschland schwer erhältlich, weshalb Weber nach Murrays Wörterbucheintrag „calling“ zitiert (vgl. in dieser Fn., unten, S. 189 f.). Murray gibt darin die englischen Übersetzungsvarianten von κλῆσις (klḗsis) in 1 Kor 7,20 nach den in „The English Hexapla“ in Kolumnen abgedruckten Bibeln z.St. wieder (vgl. den Editorischen Bericht, oben, S. 118 f.). Als sechste Übersetzung folgt in der Hexapla die „Authorised“ oder King James Version von 1611 (mitaufgeführt bei Murray, s.v. calling). Sie übersetzt κλῆσις in 1 Kor 7,20 mit „calling“.
60
die Tindalesche Vgl. Murray, James A. H., A New English Dictionary on Historical Principles, vol. 2. – Oxford: Clarendon Press 1893, s.v. cleping, p. 490 (vgl. auch ders., s.v. calling, p. 39, unter [Nr.] 9).
k
von 1534 wendet den Gedanken weltlich: „in the same state wherein he was called“, ebenso die Geneva von 1557. Die offizielle [A 41]Cranmersche Übersetzung von 1539 ersetzte „state“ durch „calling“, während die (katholische) Rheimser Bibel von 1582 ebenso wie die höfischen anglikanischen Bibeln der elisabethanischen Zeit[189]A: Tindalsche
61
charakteristischerweise wieder zu „vocation“ in Anlehnung an die Vulgata zurückkehren. Daß die Cranmersche Bibelübersetzung die Quelle des puritanischen Begriffes „calling“ im Sinn von Beruf = trade ist, hat schon Murray s.v. calling zutreffend er[190]kannt. Was Weber unter den „höfischen anglikanischen Bibeln der elisabethanischen Zeit“ versteht, muß offen bleiben. Unter Elisabeth I. (reg. 1558–1603) erschien 1568 eine von Matthew Parker, dem Erzbischof von Canterbury, für den Gebrauch der anglikanischen Kirche bestimmte Bibelübersetzung, die sog. „Bishops’ Bible“. Sie hat in 1 Kor 7,20 allerdings „calling“. Dagegen übersetzt die „Geneva“ von 1560 (mit Abweichungen im NT zur von Weber oben im Text zitierten Version von 1557) an dieser Stelle „vocation“; „vocation“ behält auch das 1576 von Laurence Tomson revidierte NT der Geneva Bible bei. Die Geneva Bible wurde auch für die Predigten im anglikanischen Gottesdienst, auch am Hof, verwendet. Vgl. den Editorischen Bericht, oben, S. 119.
62
Schon Mitte des 16. Jahrh[underts] findet sich calling in jenem Sinn gebraucht, schon 1588 sprach man von „unlawful callings“, 1603 von „greater callings“ im Sinne von „höhere“ Berufe usw. (s. Murray a. a. O.).[190]„Calling“ unter der Wortbedeutung „II. Summons, call, vocations“ im speziellen Sinn von „position, estate, or station in life; rank“ (bei Murray, s.v. calling, p. 39, [Nr.] 10) gründet nach Murrays Wörterbucheintrag auf 1 Kor 7,20 („Founded on 1 Cor. vii. 20 […]“). Ebenso Wortbedeutung [Nr.] 11, „Hence, Ordinary occupation, means by which livelihood is earned, business, trade“, durch Murrays Hinzufügung: „Often etymologized in the same way as prec[eding]“, d. h. [Nr.] 10 (ebd.).
63
Vgl. Murray, s.v. calling, p. 39.
45
[187]Weber spielt auf Tauler an; vgl. oben, S. 184 f., Fn. 40.
[188][A 41]Und wie die Wortbedeutung[,] so ist auch – das dürfte im ganzen ja bekannt sein – der Gedanke neu und ein Produkt der Reforma[189]tion. Nicht als ob gewisse Ansätze zu jener Schätzung der weltlichen Alltagsarbeit, welche in diesem Berufsbegriff vorliegt, nicht schon im Mittelalter vorhanden gewesen wären – davon wird später zu reden sein
58
–, aber unbedingt neu war jedenfalls zunächst eins: die Schätzung der Pflichterfüllung innerhalb der weltlichen Berufe als des höchsten Inhaltes, den die sittliche Selbstbetätigung überhaupt annehmen könne. Dies war es, was die Vorstellung von der religiösen Bedeutung der weltlichen Alltagsarbeit zur unvermeidlichen Folge hatte und den Berufsbegriff erzeugte. Es kommt also in dem Begriffe „Beruf“ jenes Zentraldogma aller protestantischen Denominationen zum Ausdruck, welches die katholische Unterscheidung der christlichen Sittlichkeitsgebote in „praecepta“ und „consilia“ verwirft[189]Weber dürfte sich auf Tauler beziehen: Weber, Protestantische Ethik II, unten, S. 278 f. mit Anm. 33. Vgl. auch oben, S. 184 f., Fn. 40, und unten, S. 208 f.
59
und als das einzige Mittel[,] Gott wohlge[190]fällig zu leben, nicht eine Überbietung der innerweltlichen Sittlichkeit durch mönchische Askese, sondern ausschließlich die Erfüllung der innerweltlichen Pflichten kennt[,] wie sie sich aus der Lebensstellung des einzelnen ergeben, die dadurch eben sein „Beruf“ wird. Bei den consilia evangelica („evangelische Räte“, Armut, Keuschheit und Gehorsam) handelt es sich nach der römisch-katholischen Moraltheologie um die Weisungen für das Mönchtum, während für Laien die im Alltagsleben zu befolgenden praecepta (Sittlichkeitsgebote und -verbote) galten. Vgl. auch das Glossar, unten, S. 825.
Bei Luther
41)
entwickelt dieser Gedanke sich im Laufe des ersten Jahrzehntes seiner reformatorischen Tätigkeit. Anfangs gehört ihm, durchaus im Sinne der vorwiegenden mittelalterlichen Tradition, wie sie z. B. Thomas von Aquino repräsentiert, Vgl. zum folgenden die lehrreiche Darstellung bei K. Eger, „Die Anschauung Luthers vom Beruf“ (Gießen 1900),
64
deren vielleicht einzige Lücke in der bei ihm, wie bei fast allen anderen theologischen Schriftstellern, noch nicht genügend klaren Analyse des Begriffes der „lex naturae“ bestehen dürfte (s. dazu E. Tröltsch in der Besprechung von Seebergs Dogmengeschichte, Gött[ingische] Gel[ehrte] Anz[eigen] 1902). Gemeint ist: Eger, Die Anschauungen Luthers vom Beruf.
65
Weber schließt sich der Kritik Troeltschs, Rez. Seeberg, bes. S. 21 ff. (KGA 4, bes. S. 97 ff.), an. Nach Troeltsch stammt der Begriff „lex naturae“ aus der stoisch-eklektischen Popularphilosophie und muß mit dem christlichen Gesetz in Beziehung gesetzt werden. Weber ergänzt darum seine Darstellung der Entwicklung des Berufsbegriffs bei Luther um den bei Eger ungenügend berücksichtigten Begriff „lex naturae“; vgl. unten, S. 192, Fn. 43, S. 193, Fn. 43, S. 202, Fn. 51, S. 204, Fn. 54, und S. 207, Fn. 57.
42)
die [A 42]weltliche [191]Arbeit, obwohl von Gott gewollt, zum Kreatürlichen, sie ist die unentbehrliche Naturgrundlage des Glaubenslebens, Denn wenn Thomas von Aquin die ständische und berufliche Gliederung der Menschen als Werk der göttlichen Vorsehung hinstellt, so ist damit der objektive Kosmos der Gesellschaft gemeint. Daß der einzelne aber sich einem bestimmten [A 42]konkreten „Beruf“ (wie wir sagen würden, Thomas sagt: ministerium oder officium) zuwendet, hat seinen Grund in „causae naturales“. Quaest[iones] quodlibetal[es] VII art. 17 c:
66
[191]„Haec autem diversificatio hominum in diversis officiis contingit primo ex divina providentia, quae ita hominum status distribuit, … secundo etiam ex causis naturalibus, ex quibus contingit, quod in diversis hominibus sunt diversae inclinationes ad diversa officia …“ Der Gegensatz gegen den protestantischen (auch den sonst, namentlich in der Betonung des Providentiellen, nahe verwandten späteren lutherischen) Berufsbegriff liegt so klar zutage, daß es vorläufig bei diesem Zitat bewenden kann, da auf die Würdigung der katholischen Anschauungsweise später zurückzukommen ist. Das Zitat aus Quaestiones quodlibetales VII („De opere manuali“), art. 17 c[onclusio], entstammt: Thomas von Aquin, Opera Omnia IX/2, p. 566. Zitiert auch bei Maurenbrecher, Thomas von Aquino, S. 34 f., Anm. 6 (dort mit einem weiteren, inhaltlich ähnlichen Zitat, worin Thomas „ministerium“ anstelle von „officium“ verwendet). Auf[191]grund des providentiellen Charakters der Stände- und Berufsgliederung – so Maurenbrecher – „ist nun jede Teilarbeit, die der einzelne verrichtet, sein ,Beruf‘, seine Pflicht, sein ,Amt‘, eine Dienstleistung, die er der Gesamtheit gegenüber hat“ (S. 35).
68
S[iehe] über Thomas: Maurenbrecher, Th[omas] v[on] Aquinos Stellung zum Wirtschaftsleben seiner Zeit, 1898. Wo übrigens in Einzelheiten Luther mit Thomas übereinzustimmen scheint, ist es wohl mehr die allgemeine Lehre der Scholastik überhaupt, als Thomas speziell, was ihn beeinflußt hat. Denn Thomas scheint er, nach Denifles Nachweisungen, tatsächlich nur unzulänglich gekannt zu haben (s. Denifle, Luther und Luthertum, 1903, S. 501 und dazu Köhler, Ein Wort zu Denifles Luther, 1904, S. 25 f.). Weber, Protestantische Ethik II, unten, S. 379–381.
69
Weber nimmt Bezug auf eine aktuelle Debatte. Der römisch-katholische Kirchenhistoriker Heinrich Denifle, ein ausgewiesener Kenner der Scholastik, stellt in seinem Werk „Luther und Luthertum in der ersten Entwickelung quellenmäßig dargestellt“, das Anfang 1904 (nicht: 1903) erschien, die These auf, Luther sei zu Beginn seiner Auseinandersetzung mit den Scholastikern in den Jahren 1515/16 lediglich „ein Halbwisser, ein Halbgebildeter“ gewesen (S. 501 u. ö.), habe nur die Spätscholastik, nicht aber ihre „Blüthezeit“ im 13. Jahrhundert und insbesondere nicht Thomas von Aquin aus den Quellen studiert (vgl. Denifles „Nachweisungen“, ebd., S. 502–568). Der Protestant Walther Köhler entgegnet ihm, Luther habe Thomas sehr wohl gekannt, als Anhänger von Wilhelm von Ockham ihn jedoch von vornherein antagonistisch gelesen (Köhler, Denifle, S. 25 f.). Daß er Thomas auch bei Übereinstimmungen nicht zitiere, liege an dem in der wissenschaftlichen Theologie der Zeit üblichen Umgang mit Quellen (S. 7 ff.). „Ein ,Halbwisser‘ […] war er darnach gewiß vom modernen Standpunkte aus, nicht aber von dem seiner Zeit aus […]“ (S. 26). – Weber folgt hier dem Lutherkritiker Denifle.
43)
sittlich an sich indifferent wie Essen und Trinken. Aber mit der klareren Durchführung des „sola-fide“-Gedankens In „Von der Freiheit eines Christenmenschen“ wird zunächst 1. die „zweierlei Natur“ des Menschen für die Konstruktion der innerweltlichen Pflichten im Sinne der [192]lex naturae (hier = natürliche Ordnung der Welt) verwendet, die daraus folgt, daß (Erl[anger] Ausg. 27 S. 188) der Mensch faktisch an seinen Leib und die soziale Gemeinschaft gebunden ist.
71
– 2. In dieser Situation wird er (S. 196), – das ist eine daran angeknüpfte zweite Begründung, – wenn er ein gläubiger Christ ist, den Entschluß fassen, Gottes aus reiner Liebe gefaßten Gnadenentschluß durch Nächstenliebe zu vergelten. Luthers Schrift „Von der Freiheit eines Christenmenschen“ von 1520 gehört zu seinen zentralen reformatorischen Schriften. Nach Luther enthält sie „die ganze Summe eines christlichen Lebens“ (ebd., S. 173). Entsprechend der „zweierlei Natur“ (S. 176) des Christenmenschen, der geistigen und leiblichen, hat die Schrift zwei Teile. Teil I: Vom innerlichen, durch den Glauben frei gewordenen Menschen gelte: „Ein Christenmensch ist ein freier Herr uber alle Ding, und niemand unterthan“ (S. 176). Teil II: Vom äußerlichen Menschen, genauer dem gerechtfertigten Menschen, der in dieser Welt und damit in sozialen Bezügen lebe, gelte: „Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Ding, und Jdermann unterthan“ (ebd.). Weber gibt im folgenden die Gedanken Luthers aus dem zweiten Teil (S. 188 ff.) in einer eigenen Systematik wieder. – Luthers Schrift wird ausführlich besprochen von Eger, Anschauungen Luthers vom Beruf, S. 34–38, kritisch S. 39–43. – Zu „lex naturae“ vgl. oben, S. 190, Anm. 65.
72
Mit dieser sehr lockeren Verknüpfung von „Glaube“ und „Liebe“ kreuzt sich 3. (S. 190) die alte asketische Begründung der Arbeit als eines Mittels, dem „inneren“ [193]Menschen die Herrschaft über den Leib zu verleihen. Weber hat folgende Stelle von Luther, Von der Freiheit eines Christenmenschen, im Exemplar der UB Heidelberg am Rand markiert: „Ei, so will ich solchen Vater, der mich mit seinen uberschwenglichen Gutern also ubirschüttet hat, wiederumb frei, fröhlich und umbsonst thun, was ihm wohlgefället, und gegen meinen Nähsten auch werden ein Christen, wie Christus mir worden ist, und nicht mehr thun, denn was ich nur sehe, ihm noth, nützlich und seliglich sein; dieweil ich doch durch meinen Glauben allis Dings in Christo gnug habe“ (ebd., S. 196). Weber notiert am Rand: „loser Zus.hang zwischen Glauben u. Liebe“ (vgl. den folgenden Satz oben im Text). So auch Eger, Anschauungen Luthers vom Beruf, S. 40 f.
74
– 4. Das Arbeiten sei daher, – so heißt es in Verbindung damit weiter, [A 43]und hier kommt wieder der Gedanke der „lex naturae“ (hier = natürliche Sittlichkeit) Im Exemplar der UB Heidelberg hat Weber die zweite Satzhälfte mit einer eckigen Klammer am Rand markiert und teilweise unterstrichen („arbeitet so viel er“): „Daraus denn ein Jglicher kann selbst nehmen die Maaß und Bescheidenheit den Leib zu casteien; denn er fastet, wachet, arbeit so viel er sicht dem Leib noth sein, seinen Muthwillen zu dämpfen“ (Luther, Von der Freiheit eines Christenmenschen, S. 190). Weber kommentiert am Seitenrand: „ganz mönchisch“.
75
in anderer Wendung zur Geltung, – ein schon dem Adam (vor dem Fall) eigener, von Gott ihm eingepflanzter Trieb gewesen, dem er „allein Gott zu gefallen“ nachgegangen sei. Zu „lex naturae“ vgl. oben, S. 190, Anm. 65.
76
– Endlich 5. (S. 191 „Nu war Adam von Gott frumm und wohlgeschaffen ohn Sund, daß er durch sein arbeiten und huten nit durft frumm und rechtfertig werden; doch daß er nit müßig gieng, gab ihm Gott zu schaffen, das Paradies zu pflanzen, bauen und bewahren. Wilchs wären eitel frei Werk gewesen, umb keins Dings willen gethan, denn allein Gott zu gefallen […]“ (Luther, Von der Freiheit eines Christenmenschen, S. 190). Diese Sätze markiert Weber im Exemplar der UB Heidelberg mit Randstrich, „allein Gott zu gefallen“ ist zusätzlich unterstrichen. Er vermerkt am Rand: „cf Adam in der Staatslehre“. Dabei dürfte es sich um einen Hinweis auf Jellineks Vortrag „Adam in der Staatslehre“ handeln, gehalten im historisch-philosophischen Verein zu Heidelberg (Heidelberg: G. Koester 1893; dass, in: ders., Ausgewählte Schriften und Reden, Band 2. – Berlin: O. Haering 1911, S. 23–44). In dem Vortrag gibt Jellinek einen Abriß über die verschiedenen Begründungen des Staates mit Hilfe des biblischen Adam, von Augustinus über das Mittelalter zu Luther und bis ins 19. Jahrhundert.
l
und 199) erscheint im Anschluß an Matth. 7,18 f. der Gedanke, daß tüchtige Arbeit im Beruf Folge des durch den Glauben gewirkten neuen Lebens sei und sein müsse,[193]A: 161
77
ohne daß jedoch daraus der calvinistische Gedanke der „Bewährung“ entwickelt würde. – Die mächtige Stimmung, von welcher die Schrift getragen ist, erklärt die Verwertung heterogener begrifflicher Elemente. Vermutlich gemeint: Mt 7,18 ff. Luther zitiert Mt 7,18 und 20 (Luther, Von der Freiheit eines Christenmenschen, S. 191 und 193). – „Gute frumm Werk machen nimmer[194]mehr ein guten frummen Mann; sondern ein gut frumm Mann macht gute frumm Werk. […] Also, daß allweg die Person zuvor muß gut und frumm sein vor allen guten Werken, und gute Werk folgen und ausgahn von der frummen, guten Person“ (S. 191). Die Passage versah Weber im Exemplar der UB Heidelberg mit Randmarkierungen, einschließlich des darauf folgenden Zitats von Mt 7,18.
67
in seinen Konsequen[192]zen und mit dem dadurch gegebenen, mit steigender Schärfe betonten Gegensatz gegen die „vom Teufel diktierten“ katholischen „evangelischen Ratschläge“ des Mönchtums „sola fide“, zentraler Begriff Luthers reformatorischer Erkenntnis: Allein durch den Glauben, ohne verdienstliche Werke, werde dem Menschen Rechtfertigung zuteil. Vgl. auch das Glossar, unten, S. 839.
70
steigt die Bedeutung des Berufs. Die mönchische Lebensführung ist nun nicht nur zur Rechtfertigung vor Gott selbstverständlich gänzlich wertlos, [193]sondern sie gilt ihm auch als Produkt egoistischer, den Weltpflichten sich entziehender Lieblosigkeit. Im Kontrast dazu erscheint die weltliche Berufsarbeit als äußerer Ausdruck der Nächstenliebe, und dies wird in allerdings höchst weltfremder Art und in einem fast grotesken Gegensatz zu Adam Smiths bekannten [A 43]Sätzen[192]Hier deutsch wiedergegebene, oftmals paraphrasierte Formulierung (z. B. Seeberg, Dogmengeschichte II, S. 259) nach „De votis monasticis“ von 1521 (Luther, Opera latina varii argumenti, tomus VI, p. 234–376). Luther führt darin aus, daß das überkommene Mönchswesen und die mit ihm verbundene Scheidung in einen Stand der Vollkommenheit und einen Laienstand, basierend auf der Unterscheidung von consilia evangelica („evangelische Räte“) und praecepta (vgl. oben, S. 189, Anm. 59), keine biblische Grundlage habe: Das Evangelium enthalte keine besonderen „Räte“, wohl aber die Ermahnung an alle Getauften gleichermaßen, Gottes Gebote zu halten. Um zum Mönchsstand zu locken, habe der Satan ihn mit jenen perfectiones und consilia ausgeschmückt („Certe si rem tecum pensites, videri potest Satanas in hoc excogitasse figmentum de consiliis et statu perfectionis, ut adornaret istam perversam monasticen […]“, p. 256 [WA 8, S. 585, Z. 38 f., S. 586, Z. 1]).
44)
insbesondere durch den Hinweis darauf begründet, daß die Arbeitsteilung jeden einzelnen zwinge, für andere zu arbeiten. Indessen diese, wie man sieht, wesentlich scholastische Begründung „Nicht vom Wohlwollen des Fleischers, Bäckers oder Brauers erwarten wir unser Mittagessen, sondern von ihrer Rücksicht auf ihren eigenen Vorteil; wir wenden uns [194]nicht an ihre Nächstenliebe, sondern an ihre Selbstsucht, und sprechen ihnen nie von unseren Bedürfnissen, sondern stets nur von ihrem Vorteil.“ (W[ealth] of
m
N[ations] I,2.)[194]A: of.
n
A: 2).
78
Smith, Adam, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations I, zuerst 1776, 2. Kapitel. Weber benutzt die Übersetzung von Wilhelm Loewenthal: Smith, Natur und Ursachen I, S. 16. In seinem Zitat verändert er die Reihenfolge von Fleischer, Brauer oder Bäcker, und er schreibt „Nächstenliebe“ statt „Menschenliebe“ (engl. humanity).
73
ver[194]schwindet bald wieder, und es bleibt, mit steigendem Nachdruck betont, der Hinweis darauf, daß die Erfüllung der innerweltlichen Pflichten unter allen Umständen der einzige Weg sei, Gott wohlzugefallen, daß sie und nur sie Gottes Wille sei und daß deshalb jeder erlaubte Beruf vor Gott schlechterdings gleich viel gelte.[193]Vgl. das Zitat von Thomas von Aquin und Maurenbrechers Interpretation, oben, S. 190 f., Fn. 42, Anm. 66; auch unten, S. 194 f., Fn. 45 mit Anm. 83.
45)
Daß [195]diese sittliche Qualifizierung des weltlichen Berufslebens eine der folgenschwersten Leistungen der Reformation und also [A 44]speziell Luthers war, ist in der Tat zweifellos und darf nachgerade als ein Gemeinplatz gelten. Aber wie nun im einzelnen die praktische [196]Bedeutung jener Leistung vorzustellen sei, das wird im allgemeinen wohl mehr dunkel empfunden, als klar erkannt. Omnia enim per te operabitur (Deus), mulgebit per te vaccam et servilissima quaeque opera faciet, ac maxima pariter et minima ipsi grata erunt. (Exegese der Genesis, Op[era] lat[ina] exeg[etica] ed. Elsperger VIII, 12
o
.A: VII, 213
79
Der Gedanke findet sich vor Luther bei Tauler, der geistlichen und weltlichen „Ruf“ dem Wert nach prinzipiell gleichstellt. Bei Luther: „[…] ac maxima partiter et minima omnia ipsi grata erunt.“ Das Zitat von Luther, Genesisexegese VIII, p. 12 [WA 44, S. 6, Z. 23–25], entstammt seiner Genesis-Vorlesung, die er mit Unterbrechungen zwischen 1535 und 1545 hielt (zu Gen 31,3, vorgetragen ca. 1542/43; vgl. WA 42, S. VIII). Es findet sich paraphrasiert auch bei Eger im Kontext der Ausführungen über die letzte Entwicklungsstufe von Luthers Berufsanschauung: „Das in der treuen Berufserfüllung sich beweisende Gottvertrauen ist eben die stetige Quelle der Gewißheit göttlichen Wohlgefallens […]. Das Volk Gottes gefällt Gott auch in den kleinsten und geringsten Dingen. Er wirkt selber alles durch dich; er melkt durch dich die Kuh und thut die allerniedrigste Knechtsarbeit“ (Eger, Anschauungen Luthers vom Beruf, S. 155 f.). In der Auslassung findet sich bei Eger ein Zitat, dem der hier von Weber fälschlich verwendete Beleg gilt (vgl. oben, textkritische Anm. o).
80
Der Gegensatz gegen den Thomismus ist der deutschen Mystik und Luther gemeinsam. In den Formulierungen kommt er darin zum Ausdruck, daß Thomas – namentlich um den sittlichen Wert der Kontemplation festhalten zu können, aber auch vom Standpunkt des Bettelmönches aus Vgl. den oben, S. 184, Fn. 40 mit Anm. 35, wiedergegeben Inhalt der Predigt Taulers über Eph 4,1 ff. (Tauler, Predigten, Basler Ausg. 1521, fol. 116v–118r).
81
– sich genötigt fand, den paulinischen [195]Satz: „wer nicht arbeitet, soll nicht essen“ Thomas von Aquin gehörte den Dominikanern, einem Bettelorden, an. Die Dominikaner verzichteten aufgrund eines verschärften Armutsgelübdes auf persönlichen und gemeinschaftlichen Besitz sowie feste Einkünfte und lebten zumindest anfangs von Almosen und Schenkungen. Die Besitzlosigkeit wurde allerdings nie besonders hart [195]durchgesetzt und war seit 1425 (Aufhebung des Gütererwerbsverbots durch Papst Martin V.) de jure hinfällig. Auch auf die für das abendländische Mönchtum seit der Benediktsregel (cap. 48) geltende Verpflichtung zur körperlichen Arbeit der Mönche wurde verzichtet. Vgl. Grützmacher, [Georg,] Art. Dominikus, Dominikaner, in: RE3, Band 4, 1898, S. 768–781.
82
so zu deuten, daß den Menschen als Gattung, nicht aber allen einzelnen die Arbeit, die ja lege naturae unentbehrlich ist, auferlegt sei. 2 Thess 3,10 schreibt Paulus über sich und seine Mitarbeiter [1892]: „Und da wir bei euch waren, geboten wir euch solches, daß, so jemand nicht will arbeiten, der soll auch nicht essen.“ Die Stelle wurde als „neutestamentliches Arbeitsgebot“ im abendländischen Mönchtum immer wieder zitiert (schon bei Augustinus, De opere monachorum).
83
Die Gradation in der Schätzung der Arbeit, von den „opera servilia“ der Bauern Vgl. Maurenbrecher, Thomas von Aquino, S. 64–66, mit Bezug auf das oben, S. 190 f., Fn. 42, wiedergegebene Zitat: Bei Thomas diene körperliche Arbeit drei Zwecken: Müßigkeit zu vermeiden, den Leib zu kasteien und den Lebensunterhalt zu beschaffen. Das neutestamentliche Arbeitsgebot (vgl. vorherige Anm.) beziehe sich nur auf die Erwerbsarbeit, denn die ersten beiden Zwecke ließen sich auch durch das Studium der Heiligen Schrift oder durch Fasten erfüllen. Die Verpflichtung zur Erwerbsarbeit bestehe sowohl nach göttlichem Recht als auch nach dem Naturrecht. Bezüglich des Naturrechts unterscheidet Thomas solche Gebote, die das Individuum betreffen, wie Essen und Trinken, von solchen, die sich auf die Gattung (Menschheit) beziehen. Zu letzteren zähle etwa das biblische Vermehrungsgebot („Seid fruchtbar und mehret euch“) sowie das Gebot der Erwerbsarbeit. Denn ein Mensch vermöge hier nicht alles allein, sondern bedürfe der Unterstützung durch andere. Die Arbeitsteilung, die Thomas als Grundlage der Gesellschaft voraussetzt, ermöglicht ihm also den Schluß, daß nicht jeder körperlicher Erwerbsarbeit nachgehen müsse.
84
aufwärts, ist etwas, was mit dem spezifischen Charakter des aus materiellen Gründen an die Stadt als Domizil gebundenen Bettelmönchtums opera servilia (lat.), antike Bezeichnung für die körperliche Arbeit der Sklaven. Nach Maurenbrecher, Thomas von Aquino, S. 67, übernimmt Thomas die Bezeichnung von Aristoteles, bezieht den Begriff auf jegliche körperliche, zweckbezogene Arbeit und stellt sie der geistigen Arbeit, den „freien Künsten“, gegenüber.
p
zusammenhängt[195]A: Bettelmönchstums
85
und [196]den deutschen Mystikern wie dem Bauernsohn Luther, Geistige Arbeit beurteilt Thomas mit Bezug auf Aristoteles gegenüber körperlicher Arbeit als „vornehmer“ („nobilior“; vgl. Maurenbrecher, Thomas von Aquino, S. 67; zu Thomas’ Hierarchisierung der verschiedenen arbeitenden Klassen vgl. S. 68–75). Der geringe Wert, den er den Bauern und der Landbevölkerung zumesse (vgl. S. 71–73), liege in Thomas’ Anschauung von der „Stadt“ begründet: Sie gelte ihm als die vollkommenste Gemeinschaft, weil sie die bestmögliche Bedarfsdeckung sichere (vgl. S. 38–51, hier S. 40). Das städtische Leben sei darum im Unterschied zum Landleben das natürliche Leben („homo sit naturaliter civilis“, S. 40, Anm. 1).
87
welche bei gleicher Schätzung der Berufe die ständische Gliederung als gottgewollt betonten, gleich fern lag. – Die entscheidenden Stellen des Thomas s. bei Maurenbrecher, Th[omas] v[on] Aquinos Stellung zum Wirtschaftsleben seiner Zeit (Leipzig 1898, S. 65 f.). | Luther hob seine Herkunft aus einer (im Dorf Möhra, heute in Thüringen, beheimateten) Bauernfamilie hervor, obwohl sein (nicht erbberechtigter) Vater im Mansfelder Kupferbergbau Hüttenmeister wurde und gesellschaftliches Ansehen gewann: „Ich bin eines Bauern Sohn; mein Vater, Großvater, Ahnherr sind rechte Bauern gewest.“ In dieser Form oft zitiert, hier nach Köstlin, Julius, Martin Luther. Sein Leben und seine Schriften, 5. neubearb. Aufl., fortges. von Gustav Kawerau, 1. Band. – Berlin: Alexander Duncker 1903, S. 10 (eigentl. lat.-deutsch, WA.TR, Band 5, Nr. 6250, S. 557 f., Zitat S. 558, Z. 13 f.).
Zunächst ist kaum nötig zu konstatieren, daß nicht etwa Luther als mit dem „kapitalistischen Geist“ in dem Sinne, den wir hier bisher mit diesem Wort verbunden haben, innerlich verwandt angesprochen werden darf. Schon diejenigen kirchlichen Kreise, welche jene „Tat“ der Reformation am eifrigsten zu rühmen pflegen, sind im ganzen heute keineswegs Freunde des Kapitalismus in irgendeinem Sinne. Erst recht aber würde Luther selbst ohne allen Zweifel jede Verwandtschaft mit einer Gesinnung, wie sie bei Franklin zutage tritt,
86
abgelehnt haben. Zwar darf man hier nicht seine Klagen über die großen Kaufleute, die Fugger[196]Vgl. oben, S. 142–145.
46)
u. dgl.[,] als Symp[197]tom heranziehen. Denn der Kampf gegen die rechtlich oder faktisch privilegierte Stellung einzelner großer Handelskompagnien im 16. und 17. Jahrhundert kann am ehesten dem modernen Feldzug gegen die Trusts verglichen werden und ist ebensowenig wie dieser schon an sich Ausdruck traditionalistischer Gesinnung.[A 44]Bezüglich der Fugger meint er: es könne „nicht recht und göttlich zugehen, wenn bei eines Menschen Leben sollte so großes und königliches Gut auf einen Haufen gebracht werden“.
88
Das ist also wesentlich Bauernmißtrauen gegen das Kapital. Ebenso ist ihm (Gr[oßer] Sermon v[om] Wucher, Erl[anger] Ausg. 20 S. 109) der Rentenkauf sittlich bedenklich, weil er „ein neues, behendes erfunden Ding ist“, – also weil er ihm ökonomisch undurchsichtig ist, Das von Weber an das Deutsch seiner Zeit angepaßte und mit kleineren Änderungen versehene Zitat entstammt Luther, Christlicher Adel (1520), S. 357. Die Augsburger Kaufmannsfamilie Fugger machte ihre Finanzgeschäfte mit Papst, Kurie und Habsburgern und verdiente am Ablaßhandel. Hinweis auf die von Weber zitierte Stelle etwa auch bei Wiskemann, Nationalökonomische Ansichten, S. 61, Anm. 7.
89
ähnlich wie dem modernen Geistlichen etwa der Terminhandel. Als verbotener Zins oder Wucher (vgl. das Glossar, unten, S. 842) galt jede Leistung, die über die Rückerstattung der geliehenen Sache hinausreichte. Man versuchte, das Verbot z. B. mit dem Rentenkauf zu umgehen. Dieser wurde 1425 von Papst Martin V. gestattet: Der Schuldner überließ dem Gläubiger z. B. ein Grundstück zur Nutzung. Luther meinte, ob erlaubt oder nicht, der Renten- oder Zinskauf wirke dennoch wie „Wucher“, weil er Land und Leute beschwere (vgl. Luther, Großer Sermon [197]vom Wucher, S. 110 – ein weiterer gegenüber dem von Weber im Text zitierten Einwand, ebd., S. 109). Vgl. dazu die von Weber unten, S. 201, Fn. 50, zitierte Literatur: Schmoller, National-ökonomische Ansichten, S. 554–571; Wiskemann, Nationalökonomische Ansichten, S. 55 f.
90
Auch Cromwell schrieb nach der Schlacht von Dunbar (Sept. 1650) Weber dürfte auf die Antitrust-Bewegung in den USA anspielen (seit 1873), die Monopole und Wettbewerbsbeschränkungen unter Verbot gestellt sehen wollte, was mit der Sherman Act 1890 auch geschah.
91
an das Lange Parlament: „Bitte stellt die Mißbräuche aller Berufe ab, und gibt es einen, der viele arm macht, um wenige reich zu machen: das frommt einem Gemeinwesen nicht“, In der Schlacht bei Dunbar (3. September 1650) besiegte die englische Armee unter Führung Oliver Cromwells die Schotten.
q
[197]A: nicht,“
92
– und doch werden wir ihn andererseits von ganz spezifisch „kapitalistischer“ Denkweise erfüllt finden Am 4. September 1650 berichtet Oliver Cromwell dem Sprecher des Englischen Parlaments William Lenthall über die Schlacht. Wiedergegeben bei Carlyle, Cromwell’s Letters and Speeches II, p. 209–217, Zitat p. 215 f. („Be pleased to reform the abuses of all professions […]“; Zitat des Satzes auch bei Gardiner, Commonwealth I, p. 397; Ausschnitt in Übersetzung bei Hoenig, Cromwell III/4, S. 49). Weber übersetzt offensichtlich selbst aus dem Englischen, wobei er Carlyle folgen dürfte (Hoenig übersetzt abweichend: „Möge es Euch gefallen, die Mißbräuche aller Bekenntnisse zu reformiren […]“).
47)
. Unzweideutiger schon tritt in Luthers [198][A 45]zahlreichen Äußerungen gegen den Wucher und das Zinsennehmen[197]Was hier darunter verstanden wird, mag vorläufig an dem Beispiel des Manifestes an die Iren erläutert werden, mit dem Cromwell im Januar 1650 seinen Vernichtungskrieg gegen sie eröffnete und welches die Entgegnung auf die Manifeste des irischen (katholischen) Klerus von Clonmacnoise vom 4. u. 13. Dezember 1649 darstellte.
93
[198]Die Kernsätze lauten: „Englishmen had good inheritances (in Irland nämlich) which many of them purchased with their money … they had good leases from Irishmen for long time to come, great stocks thereupon, houses and plantations erected at their cost and charge. … You broke the union 1649 setzte Cromwell nach Irland über, um den dort ausgebrochenen Aufstand niederzuschlagen. Wie die Massaker von Drogheda und Wexford zeigen, ging er äußerst brutal vor und tötete zahlreiche Zivilisten. Mit dem ersten Manifest vom 4. Dezember 1649 rief der irische Klerus die Bevölkerung zum Widerstand auf. Er befürchtete zurecht, daß Cromwell die katholische Religion ausrotten wollte, was die Vernichtung oder Verbannung der irischen Bevölkerung bedeutet hätte. Im zweiten Manifest vom 13. Dezember 1649 wird eine „Union“ und damit der Zusammenhalt der zersplitterten Parteiungen Irlands gefordert. Vgl. zu den Manifesten Gardiner, Commonwealth I, p. 162 f.; Hoenig, Cromwell II/3, S. 373 f.
1
… [A 45]at a time when Ireland was in perfect peace and when through Vermutlich meint Cromwell die irische Rebellion, die im Oktober 1641 gegen die englische Herrschaft offen ausgebrochen war. Die katholischen Iren befürchteten weitere Übergriffe, nachdem ihnen bereits seit Jahrzehnten die besten Ländereien für englische und schottische Kolonisten (sog. Plantations) enteignet worden waren. Vgl. Gardiner, Samuel R., History of England from the Accession of James I. to the Outbreak of the Civil War 1603–1642, vol. X. – London: Longmans, Green, and Co. 1884, p. 43 ff.; Ranke, Englische Geschichte II, S. 505–513.
r
the example of English industry, through commerce and traffic, that which was in the natives’[198]A: trough
s
hands was better to them than if all Ireland had been in their possession … Is God, will God be with you? I am confident he will not.“A: nations’
2
Dies, an englische Leitartikel zur Zeit des Burenkrieges Weber zitiert den Auszug aus der Antwort Cromwells an die Iren – wie in derselben Fn. unten, S. 199, angegeben – nach Gardiner, Commonwealth I, p. 163 f.; dass. bei Carlyle, Cromwell’s Letters and Speeches II, p. 115 ff., Zitat p. 117 f. Bei Gardiner (und Carlyle) heißt es „natives’ hands“. Vollständig in deutscher Übersetzung bei Hoenig, Cromwell II/3, S. 373–394, Zitat S. 377.
3
erinnernde, Manifest ist nicht deshalb charakteristisch, weil hier das kapitalistische „Interesse“ der Engländer als Rechtsgrund des Krieges hingestellt wird, – das hätte, bei einer Verhandlung etwa zwischen Venedig und Genua über den Umfang ihrer Interessensphäre im Orient, als Argument sehr wohl ebenfalls gebraucht werden können. Ein auslösendes Moment für den (zweiten) Burenkrieg (oder Südafrikanischen Krieg), den Großbritannien von Ende 1899 bis Mai 1902 gegen den Oranje-Freistaat (Burenrepublik) und Transvaal (Südafrikanische Republik) führte (die nach dem Sieg Großbritanniens 1902 in das British Empire eingegliedert wurden) waren die Gold- und Diamantenvorräte. Als Beispiel für das Überlegenheitsgefühl der Engländer („ignorance and gullibility of the uneducated Boer“) vgl. den Leitartikel „How the ignorant masses of the Boers […]“ in: The Times [London] vom 9. April 1901, Ausg. 36 424, p. 7.
4
Sondern das Spezifische des Schriftstücks liegt darin, daß Cromwell – wie jeder, der seinen Charakter kennt, weiß, mit tiefster subjektiver [199]Überzeugtheit – den Iren selbst gegenüber die sittliche Berechtigung ihrer Unterjochung unter Anrufung Gottes auf den Umstand gründet, daß englisches Kapital die Iren zur Arbeit erzogen habe. – (Das Manifest ist, außer bei Carlyle, im Auszug in Gardiners Hist[ory] of the Commonw[ealth] I, S. 163 f. abgedruckt und analysiert, und in deutscher Übersetzung auch in Hönigs Cromwell zu finden.) Die beiden Seerepubliken Venedig und Genua konkurrierten seit dem letzten Viertel des 13. Jahrhunderts wegen des Orienthandels um die Vormachtstellung im östlichen Mittelmeer. Genua konnte sich zwar in der Seeschlacht bei Curzola (1298) behaupten, seit seiner Niederlage im Chioggia-Krieg (1378–1381) dominierte dann aber Venedig.
7
Vgl. oben, S. 198, Anm. 2.
94
überhaupt seine, gegenüber der Spätscholastik, direkt (vom kapitalistischen Standpunkt aus) „rückständige“ Vorstellungsweise [199]vom Wesen des kapitalistischen Erwerbes hervor.[198]Hauptsächlich in Luthers Schriften: Kleiner Sermon vom Wucher. 1519, in: Luther, Sämmtliche Werke. Erlanger Ausgabe, Band 20, S. 122–127 [WA 6, S. 1–8]; Luther, Großer Sermon vom Wucher (1520; in der Erlanger Ausgabe auf 1519 datiert); Von Kaufshandlung und Wucher. 1524, in: Luther, Sämmtliche Werke. Erlanger Ausgabe, Band 22, S. 199–226 [WA 15, S. 279–322]; An die Pfarrherrn, wider den Wucher zu predigen. 1540, in: ebd., Band 23, S. 282–338 [WA 51, S. 325–424].
48)
Speziell das z. B. bei Antonin von Florenz bereits überwundene Argument von der Unproduktivität des Geldes Dies näher auszuführen ist hier noch nicht der Ort. Vgl. die in der zweitfolgenden Note zit[ierten] Schriftsteller.
8
| Siehe unten, S. 201, Fn. 50. Vgl. z. B. eine ähnlich lautende Beurteilung Luthers bei Schmoller, National-ökonomische Ansichten, S. 563 f., 569, 713–715; Wiskemann, Nationalökonomische Ansichten, S. 56; Ward, Darstellung, S. 100 f.
5
gehört natürlich dahin.[199]Das kirchliche Zinsverbot wurde seit dem 13. Jahrhundert mit der Unproduktivität des Geldes (vgl. das Glossar, unten, S. 840) begründet, auch bei Luther, der sich dazu auf Aristoteles’ Politik 1 [cap. 6] berief. „Geld ist von Natur unfruchtbar, und mehret sich nicht, darumb, wo sichs mehret, als im Wucher, da ists wider die Natur des Geldes. Denn es lebt noch trägt nicht, wie ein Baum und Acker thut, der alle Jahr mehr gibt, denn er ist; denn er liegt nicht mußig, noch ohn Frucht, wie der Gulden thut von Natur.“ Zitat aus: An die Pfarrherrn, wider den Wucher zu predigen (wie oben, S. 198, Anm. 94), S. 300. Zitiert bei Schmoller, National-ökonomische Ansichten, S. 568, vgl. auch S. 564; Wiskemann, Nationalökonomische Ansichten, S. 52 und 139.
6
Doch brauchen wir hier auf „Pecunia ex se sola minime est lucrosa nec valet seipsam multiplicare; sed ex industria mercantium fit per eorum mercationes lucrosa.“ Zitat aus: Antonin von Florenz, Summa moralis, in: Opera omnia […], cura Thomae Mariae Mamachi et Dionysii Remedelli, tomus 2. – Florenz: P. C. Vivianus 1741, tit. 1 cap. 7 § 16, zit. bei Funk (s. u.), S. 151, Anm. 1. Weber verweist in seiner Vorlesung „Geschichte der Nationalökonomie“ (1896), MWG III/1, S. 682, unter anderem auf Funk, Franz Xaver, Über die ökonomischen Anschauungen der mittelalterlichen Theologen. Beiträge zur Geschichte der Nationalökonomie, in: Zeitschrift für die gesammte Staatswissenschaft, Band 25, 1869, S. 125–175, bes. S. 145–151. Funk hebt die entscheidende Einsicht hervor, wonach Antonins Geld nur in der Verbindung mit Arbeit fruchtbar werde.
t
Einzelheiten gar nicht einzugehen, – denn vor allem: der Gedanke des „Berufes“ im religiösen Sinn war in seinen Konsequenzen für die innerweltliche Lebensführung sehr verschiedener Gestaltungen fähig. Die Autorität der Bibel, aus der Luther ihn zu entnehmen glaubte, war im ganzen einer traditionalistischen Wendung günstiger. Speziell das Alte Testament, welches eine Überbietung der innerweltlichen Sittlichkeit nur in einzelnen asketischen Ansätzen kannte, hat einen ähnlichen religiösen Gedanken streng traditionalistisch gestaltet: ein jeder bleibe bei sei[200]ner „Nahrung“ und lasse die Gottlosen nach Gewinn streben:[199]A: in
9
das ist der Sinn aller der Stellen, welche direkt von weltlicher Hantierung handeln. Erst der Talmud steht darin teilweise – aber auch nicht grundsätzlich – auf anderem Boden.[200]Weber greift auf die besprochene Stelle Sir 11,20 f. zurück (vgl. oben, S. 178, Fn. 38 mit Anm. 2) und übersetzt „Beruf“ (Luther) in V. 20 mit „Nahrung“ (Ps 37,3, vgl. oben, S. 185, Fn. 40).
10
Die persönliche Stellung von Jesus ist mit dem „Unser täglich Brot gib uns heute“ in klassischer Reinheit gekennzeichnet, Vgl. die von Weber, Protestantische Ethik II, unten, S. 411, Fn. 69, genannten Beispiele aus dem Talmud.
11
und der Einschlag von radikaler Welt-Ablehnung, wie er in dem „μαμωνᾶς τῆς ἀδικίας“ zum Ausdruck gelangt, Die Brotbitte aus dem „Vaterunser“-Gebet, Mt 6,11 par. Lk 11,3.
12
schloß jede direkte Anknüpfung des modernen [A 46]Berufsgedankens an ihn persönlich aus. Griech., Tl. mamonās tḗs adikίas, „ungerechter Mammon“ (Lk 16,9.11). Jülicher, Gleichnisreden II, S. 109, übersetzt mamonās mit „Gewinn, Reichtum“, „hier personifiziert als eine Art Götze zu denken“. „Ungerecht“ kennzeichne sein Wesen; „es giebt eben keinen andern als ungerechten Mammon“ (S. 110).
49)
Das im Neuen Testament zum Wort gelangende „apostolische Zeitalter“ des Christentums, speziell auch Paulus, steht dem weltlichen Berufsleben, infolge der eschatologischen Erwartungen, die jene ersten Generationen von Christen erfüllten, entweder indifferent oder ebenfalls wesentlich traditionalistisch gegenüber: da alles auf das Kommen des Herrn wartet,[200][A 46]S[iehe] die Bemerkung in Jülichers schönem Buch über die „Gleichnisreden Jesu“ Band II S. 636, S. 108 f.
u
A: 636. S. 108 f. S.
16
Webers Seitenangaben betreffen Jülichers Exegese (1.) der Beispielerzählung „Vom reichen Mann und armen Lazarus“ (Lk 16,19–31; Jülicher, Gleichnisreden II, S. 617–641) und (2.) des Gleichnisses „Vom Doppeldienst“ (Mt 6,24 par. Lk 16,13; ebd., S. 108–115). Die Beispielerzählung zeige, daß Jesus Armut und Leid sowie die Gesinnung des Armseinwollens – eine Lebenshaltung – als unerläßlich für den Eintritt [201]ins Himmelreich erachtete (bes. S. 636 f.), und das Gleichnis vom Doppeldienst, daß Jesus eine kompromißlose, radikal-ablehnende Stellung zum Reichtum bezog (bes. S. 108–110).
13
so mag jeder in dem Stande und in der weltlichen Hantierung bleiben, in der ihn der „Ruf“ des Herrn gefunden hat[,] und arbeiten, wie bisher: Im Neuen Testament: die Erwartung der Wiederkunft Christi (Parusie), womit das Reich Gottes beginnt und die Heilsgeschichte vollendet wird.
14
so fällt er den Brüdern nicht als Armer lästig, und es ist ja nur noch eine kurze Weile. Nach 1 Kor 7,17–24.
15
Luther las die Bibel durch die Brille seiner jeweiligen Gesamtstimmung, und [201]diese ist im Lauf seiner Entwicklung zwischen etwa 1518 und etwa 1530 nicht nur traditionalistisch geblieben, sondern immer traditionalistischer geworden. Nach 1 Kor 7,29.
50)
[201]Zum folgenden vgl. wiederum vor allem die Darstellung bei Eger a. a. O.
17
Schon hier mag auch auf Schneckenburgers noch heute nicht veraltetes schönes Werk (Vergleichende Darstellung des lutherischen und reformierten Lehrbegriffes, herausgegeben von Güder, Stuttgart 1855) verwiesen werden. Vgl. Eger, Anschauungen Luthers vom Beruf; zitiert oben, S. 190, Fn. 41.
18
(Luthardts Ethik Luthers, S. 84 der ersten Auflage, die mir allein vorlag, gibt keine wirkliche Darstellung der Entwicklung.) Schneckenburger, Vergleichende Darstellung I, II; von Weber, Protestantische Ethik II, unten, S. 248, Fn. 4, S. 276, Fn. 32 u. ö., zitiert.
19
Vgl. ferner Seebergs Dogmengeschichte Bd. II, S. 262 unten. – Wertlos ist der Artikel „Beruf“ in der Realencyklopädie f[ür] prot[estantische] Theol[ogie] u[nd] Kirche, Dort heißt es summarisch: „Luther wird nicht müde, die Lehre vom Beruf zu predigen […]“ (Luthardt, Ethik Luthers, S. 84), dazu eine systematische Zusammenstellung der Zitate zu „Beruf“ aus dem Werk Luthers, S. 85–88 (Anm.).
20
der statt einer wissenschaftlichen Analyse des Begriffes und seiner Genesis allerhand ziemlich seichte Bemerkungen über alles mögliche, Frauenfrage u. dgl. enthält. – Aus der nationalökonomischen Literatur über Luther seien hier nur die Arbeiten Schmollers (Gesch[ichte] der nationalökon[omischen] Ansichten in Deutschland während der Reformationszeit, Z[eitschrift] f[ür] Staatswiss[enschaft] XVI, 1860), Wiskemanns Preisschrift (1861) und die Arbeit von Frank G. Ward Gemeint ist: Lemme, Art. Beruf.
a
(Darstellung und Würdigung von Luthers Ansichten vom Staat und seinen wirtschaftlichen Aufgaben, Conrads Abh[andlungen] XXI, Jena 1898) genannt.[201]A: Ward.
21
Vgl. Schmoller, National-ökonomische Ansichten; Wiskemann, Nationalökonomische Ansichten; Ward, Darstellung (dort im Titel: „[…] der Ansichten Luthers vom Staat […]“).
In den ersten Jahren seiner reformatorischen Tätigkeit herrscht bei ihm[,] infolge der wesentlich kreatürlichen Schätzung des Berufes, in bezug auf die Art der innerweltlichen Tätigkeit eine der paulinischen eschatologischen Indifferenz, wie sie 1. Kor. 7 zum Ausdruck kommt,
51)
entsprechende Anschauung vor: man [A 47]kann in [202]jedem Stande selig werden, es ist auf der kurzen Pilgerfahrt des Lebens sinnlos, auf die Art des Berufes Gewicht zu legen. Und das Streben nach materiellem Gewinn, der den eigenen Bedarf übersteigt und also nur auf Kosten anderer möglich erscheint, muß deshalb direkt als verwerflich gelten. Auslegung des 7. Kap. des ersten Korintherbriefes 1523 Erl[anger] Ausg. 51 S. 1 f.
22
Hier wendet Luther den Gedanken der „Freiheit allen Berufs“ vor Gott im Sinn [202]dieser Stelle noch so, daß damit 1. Menschen–Satzung habe verworfen werden sollen (Mönchsgelübde, Verbot der gemischten Ehen usw.), 2. die (vor Gott an sich indifferente) Erfüllung der übernommenen innerweltlichen Verpflichtungen gegen [A 47]den Nächsten als Gebot der Nächstenliebe eingeschärft werde. In Wahrheit handelt es sich freilich bei den charakteristischen Ausführungen z. B. S. 55, 56 um den Dualismus der lex naturae gegenüber der Gerechtigkeit vor Gott. Luther, 1 Korinther 7 (Erlanger Ausgabe, Band 51), S. 1–69, zielt in erster Linie darauf, das „Häuptstück“ (ebd., S. 3) der katholischen Ethik zu verwerfen – das biblische Kapitel diente der Kirche als Begründung der sittlichen Höherwertigkeit der Keuschheit gegenüber der Ehe („menschliche Satzunge“, S. 54) –, indem Luther die Ehe als natürlichen, gottgewollten Stand definiert. Selig mache nicht der Stand, sondern allein der Glaube (insbes. S. 48 f.). Die Ausweitung auf die „Freiheit aller Berufe“ [202]oder Stände vor Gott erfolgt im Mittelteil; dort gegen das Verbot der „Klösterei“ (S. 57) oder gegen das Verbot der Ehe von Christen mit Nicht-Christen (S. 54). – Nach Eger, Anschauungen Luthers vom Beruf, stand zu Beginn der 1520er Jahre im Mittelpunkt von Luthers Theologie der Glaube des einzelnen Christen, gleich welchen Standes oder Berufs; diese spielten zu diesem Zeitpunkt für ein Leben im Glauben noch keine Rolle, sondern seien „gleichgültige Naturgrundlage“ (Eger, ebd., S. 148). Eger zitiert dazu markante Sätze, die der hier von Weber genannten Lutherschrift, S. 47 f., entstammen (Eger, ebd., Anm. 2).
25
Auf den von Weber ausgewiesenen Seiten (Luther, 1 Korinther 7, S. 55 f.) geht es [203]um das Verhältnis des im Glauben freien Menschen zu Gott und zu seinen Mitmenschen: „Das ist Summa Summarum: Wir sind Niemand Nichts schüldig, denn lieben, und durch die Liebe dem Nähesten dienen. Wo Liebe ist, die macht zu eigen; also, daß kein Fahr des Gewissens oder Sund fur Gott sei, mit Essen, Trinken, Kleider, sonst oder so leben, ohn wo es wider den Nähesten ist: wider Gott kann man hie nicht sundigen, sondern wider den Nähesten“ (ebd., S. 56). – Zu „lex naturae“ vgl. oben, S. 190, Anm. 41.
52)
Mit steigender Verflechtung in die Händel der Welt geht steigende Schätzung der Bedeutung der Berufsarbeit Hand in Hand. Damit zugleich wird ihm nun der konkrete Beruf des einzelnen zunehmend zu einem speziellen Befehl Gottes an ihn, diese konkrete Stellung, in die ihn göttliche Fügung gewiesen hat, zu erfüllen. Und als nach den Kämpfen mit den „Schwarmgeistern“ Vgl. die von Sombart mit Recht als Motto vor seine Darstellung des „Handwerksgeistes“ (= Traditionalismus) gesetzte Stelle aus: „Von Kaufhandlung und Wu[203]cher“ (1524): „Darum mußt du dir fürsetzen, nichts denn deine ziemliche Nahrung zu suchen in solchem Handel, danach Kost, Mühe, Arbeit und Gefahr rechnen und überschlagen und also dann die Ware selbst setzen, steigern oder niedern, daß du solcher Arbeit und Mühe Lohn davon habst.“
26
Der Grundsatz ist durchaus in thomistischem Sinn formuliert. Sombart, Der moderne Kapitalismus I, S. 73, vorangestellt dem Ersten Buch „Die Wirtschaft als Handwerk“. Sombart zitiert Luther, Von Kaufshandlung und Wucher, nach WA 15, S. 296, Z. 33–36; von Weber hier wörtlich, aber modernisiert wiedergegeben. („Von Kaufshandlung und Wucher“ heißt die Schrift auch nach der von Weber benutzten Erlanger Ausgabe (vgl. oben, S. 198, Anm. 94), während sie andernorts auch als „Von Kaufhandlung […]“ zitiert wird.)
27
Vgl. dazu unten, S. 206 f., Fn. 57 mit Anm. 41.
23
und den Bauernunruhen Bezeichnung Luthers für spiritualistische Richtungen, mit denen er sich zwischen 1521 und 1525 auseinandersetzte, wie (1.) die „Zwickauer Propheten“, die die Kindertaufe ablehnten; (2.) Thomas Müntzer, der chiliastischen Vorstellungen anhing und 1524 die Reformation in Allstedt mit Gewalt durchsetzen wollte; (3.) Andreas Bodenstein, genannt Karlstadt, der schon 1521 in Wittenberg einen deutschsprachigen Gottesdienst eingeführt hatte, was Luther nach seinem Wartburgaufenthalt als zu „voreilig“ wieder rückgängig machte; 1524 hatte Karlstadt in Orlamünde eine ähnliche Gottesdienst- und Gemeindereformation durchgeführt. – Luther kritisierte an den „Schwarmgeistern“ oder „Schwärmern“ ihre falsch verstandene „evangelische Freiheit“, die „auf den Buchstaben der Schrift“ sehe und eine „neue religiöse Tyrannei“ errichte. Nach Müller, Kirchengeschichte II/1, S. 309–320, Zitate S. 311.
24
die objektive [203]historische Ordnung, in die der einzelne von Gott hineingestellt ist, für Luther immer mehr zum direkten Ausfluß göttlichen Willens wird, Die Bauernaufstände waren von Süddeutschland aus im Frühjahr 1525 bis nach Thüringen vorgedrungen. Luther mahnte zum Frieden. Nachdem Gewalt ausgebrochen war, wandte sich Luther an die Obrigkeit, die er zur Niederschlagung der „mörderischen Rotten der Bauern“ und Wiederherstellung der Ordnung berechtigt sah. Vgl. Müller, Kirchengeschichte II/1, S. 320–327, mit Betonung des Jahres 1525 als „Wendepunkt“ (S. 325; so auch andere) für Luther.
53)
führt die nunmehr immer stärkere Betonung des Providentiellen auch in den Einzelvorgängen des Lebens zunehmend zu einer dem „Schickungs“-Gedanken entsprechenden traditionalistischen Färbung: der einzelne soll grundsätzlich in dem Beruf und Stand bleiben, in den ihn Gott einmal gestellt hat, und sein irdisches Streben in den Schranken dieser seiner gegebenen Lebens[204]stellung halten. War der ökonomische Traditionalismus anfangs Ergebnis paulinischer Indifferenz, so ist er also später Ausfluß des immer intensiver gewordenen Vorsehungsglaubens, Schon in dem Brief an H[ans] v. Sternberg, mit dem er ihm 1530 die Exegese des 117. Psalms dediziert, gilt der „Stand“ des (niederen) Adels trotz seiner sittlichen Verkommenheit als von Gott gestiftet (Erl[anger] Ausg. 40 S. 282 unten). Die entscheidende Bedeutung, welche die Münzerschen Unruhen für die Entwicklung dieser Auffassung gehabt hatten, geht aus dem Brief (S. 282 oben) deutlich hervor.
28
Vgl. auch Eger a. a. O. S. 150. Der dem niederen Adel angehörende Ritter Hans von Sternberg war Pfleger der Veste Coburg, wo Luther 1530 während des Augsburger Reichstags die Auslegung von Ps 117 verfaßte. Für Luther folgt die göttliche Stiftung des Adelsstands daraus, daß er die von Müntzer ausgehenden Unruhen überdauert habe, während der geistliche Stand, der sich zu Beginn des reformatorischen Wirkens in einer vergleichbaren Situation befand, zu Fall gekommen sei (Luther, 117. Psalm, S. 282). Der Adel müsse darum seinen Standespflichten nachkommen und dem Volk vorbildlich begegnen; „Gott fordert es von ihnen“ (S. 283). Andernfalls drohe ihm Gefahr, „der Geistlichen Glück zu erben“ (S. 282).
29
Hinweis auf Luther, 117. Psalm, S. 282 f., bei Eger, Anschauungen Luthers vom Beruf, S. 150.
54)
der den bedingungslosen Gehorsam gegen [A 48]Gott[204]Auch in der Auslegung des 111. Psalms v. 5 u. 6 (Erl[anger] Ausg. 40 S. 215 u. 216) wird 1530 von der Polemik gegen die Überbietung der weltlichen Ordnung [A 48]durch Klöster usw. ausgegangen. Aber jetzt ist die lex naturae
30
(im Gegensatz zum positiven Recht, wie es die Kaiser und Juristen fabrizieren) direkt mit „Gottes Gerechtigkeit[“] identisch: sie ist Stiftung Gottes, und umfaßt insbesondere die ständische Gliederung des Volks (S. 215 Abs. 2 a[m] E[nde]),[204]Zu „lex naturae“ vgl. oben, S. 190, Anm. 41.
31
wobei nur die Gleichwertigkeit der Stände vor Gott scharf betont wird. Bei Luther, 111. Psalm, S. 216, heißt es: „Diese gottliche Stände und Ordnungen sind dazu von Gott geordnet, daß in der Welt ein beständig, ordenlich, friedlich Wesen sei, und das Recht erhalten werde. Darumb nennet ers hie Gottes Gerechtigkeit, die beständig ist und bleibt immer fur und fur; welchs die Juristen nennen das natürliche Recht“. – Zu Luthers Vorsehungsglaube vgl. Eger, der sich dabei auf Luthers Auslegung von Ps 111 (1530) bezieht: „Die Führungen Gottes vollziehen sich eben vorwiegend gerade in der Gestaltung bzw. Umgestaltung unserer natürlichen Lebensbedingungen und Lebensbeziehungen, und es ist Glaubenspflicht des Christen, diese Führungen auch in der Gestaltung seines äusseren Lebens anzuerkennen.“ Eger, Anschauungen Luthers vom Beruf, S. 151.
55)
mit der bedingungslosen Fügung in die gegebene Lage identifiziert. Zu einer auf grundsätzlich neuer oder überhaupt prinzipieller Grundlage ruhenden Verknüpfung der Berufsarbeit mit religiösen Prinzipien ist Luther auf diese Art überhaupt nicht gelangt, Wie er insbesondere in den Schriften „Von Konzilien und Kirchen“ (1539) und „Kurzes Bekenntnis vom heiligen Sakrament“ (1545) gelehrt wird.
32
Luther, Conciliis und Kirchen, und Luther, Kurzes Bekenntniß. Der Hinweis auf die beiden Schriften könnte durch Eger, Anschauungen Luthers vom Beruf, S. 127, angeregt sein. Eger führt aus, daß seit Ende der 1520er Jahre bei Luther neben der Verbindung von „Glaube und Liebe“ diejenige von „Glaube und Gehorsam gegen Gott“ und damit die formale Autorität des göttlichen Wortes in den Vordergrund tritt (S. 124 f.). In diesem Zusammenhang zitiert Eger aus den auch von Weber angegebenen Schriften (S. 127). „Summa, wenn dich Gott hieße einen Strohhalm aufheben, oder eine Feder reißen, mit solchem Gebot, Befehl und Verheißung, daß du dadurch solltest aller Sunde Vergebung, seine Gnade und ewiges Leben haben: solltest du das nicht mit allen Freuden und Dankbarkeit annehmen […]?“ (hier wiedergegeben nach Luther, Conciliis und Kirchen, 382). „Darumb heißts, rund und rein, ganz und Alles gegläubt, oder Nichts gegläubt!“ (wiedergegeben nach Luther, Kurzes Bekenntniß, S. 415).
56)
die Reinheit der Lehre als [205]einzig unfehlbares Kriterium der Kirche, wie sie nach den Kämpfen der 20er Jahre bei ihm immer unverrückbarer feststand, hemmte [206]an sich schon die Entwicklung neuer Gesichtspunkte auf dem ethischen Gebiet. Wie sehr namentlich der für uns so wichtige, den Calvinismus beherrschende Gedanke der Bewährung
33
des Christen in seiner Berufsarbeit und Lebensführung bei Luther im Hintergrunde bleibt, zeigt die Stelle in „Von Konzilien und Kirchen“ (1539. [205]Erl[anger] Ausg. 25 S. 376 unten): Vgl. dazu Weber, Protestantische Ethik II, unten, S. 296, u. ö.
34
„Über diese sieben Hauptstücke“ (an denen man die rechte Kirche erkennt) „sind nun mehr äußerliche Zeichen, dabei man die heilige christliche Kirche erkennt, … wenn wir nicht unzüchtig und Säufer, stolz, hoffärtig, prächtig; sondern keusch, züchtig, nüchtern … sind.“ Diese Zeichen sind nach L[uther] deshalb nicht so gewiß als „die droben“ (reine Lehre[,] Gebet usw.)[,] „weil auch etliche Heiden sich in solchen Werken geübt und wohl zuweilen heiliger scheinen als Christen“.[205]Luther, Conciliis und Kirchen, definiert das Wesen der Kirche oder das „christlich heilig Volk“ (in Gegenüberstellung zur päpstlichen Kirche) anhand von sieben äußerlichen Zeichen oder Merkmalen (sog. notae ecclesiae): Sie predigt Gottes Wort, spendet die Sakramente Taufe und Abendmahl, hat die Binde- und Lösegewalt (Schlüssel), bestellt ihre Kirchendiener (Bischöfe, Pfarrer etc.), gibt sich durch das öffentliche Gebet (Gottesdienst) und das Kreuz (Unglück und Verfolgung) zu erkennen (S. 359–376). Es handele sich um die Mittel des Heiligen Geistes, durch die nach der ersten Gesetzestafel Moses das Volk Gottes zum Glauben, zur Erkenntnis Gottes und zur Erfüllung seines Willens geführt werde (S. 376; darauf bezieht sich die erste Zitathälfte). – Der Heilige Geist heiligt das Volk Gottes auch nach der zweiten Tafel des Gesetzes. Die „Zeichen“, die sich hier auf den Lebensvollzug des Christen beziehen, faßt Luther summarisch zusammen. Weber zitiert nachfolgend in der zweiten Zitathälfte einen Ausschnitt der Aufzählung Luthers, Conciliis und Kirchen, S. 377.
35
– Calvin persönlich stand, wie weiterhin zu erörtern sein wird, nicht wesentlich anders, wohl aber der Puritanismus. Luther, ebd., S. 377. Darum bewertet Luther auch die Gebote der ersten Gesetzestafel höher: sie bewirkten größere Heiligkeit als die zweite (ebd.). – Weber ist hier möglicherweise angeregt von Eger, Anschauungen Luthers vom Beruf, S. 158, der sich auf Luther, Conciliis und Kirchen, S. 375 f., bezieht, um daraus den passiven Zug der Praxis der lutherischen Kirche zu folgern: „Es liegt in der Linie einer ganzen Anzahl anderer Aussprüche Luthers über die Leiden, denen die Bekenner des wahren Glaubens in der Welt ausgesetzt sein müssen, wenn er in der Schrift ,von Konzilien und Kirchen‘ (1539) das heilige Kreuz zu den unentbehrlichen Kennzeichen der Kirche Christi rechnet, während das religiös-sittliche Thun des Christen nach der andern Tafel Mosis als ein nicht so gewisses Zeichen angesehen werden muß.“
36
Jedenfalls dient der Christ bei Luther Gott nur „in vocatione“, nicht „per vocationem“ (Eger S. 117 ff.). Weber, Protestantische Ethik II, unten, bes. S. 272–276, auch S. 274, Fn. 27.
37
– Gerade für den Bewährungsgedanken (allerdings mehr in seiner pietistischen als in calvinistischer Wendung) finden sich dagegen bei den deutschen Mystikern wenigstens einzelne Ansätze (s. z. B. die bei Seeberg, Dogmengesch[ichte] S. 165 Gemeint sein dürfte: Eger, Anschauungen Luthers vom Beruf, S. 117 f. (Zitat S. 117). Dort ist die Unterscheidung auch Ausdruck dafür, daß der systematische Zusammenhang von christlichem Glauben und sittlichem Tun, Heilsgut und Heilsaufgabe, bei Luther nicht explizit hergestellt werde.
b
oben zitierte Stelle aus Suso, ebenso die früher zit[ierten] Äußerungen Taulers),[205]A: 195
38
wenn schon rein psychologisch gewendet. Seeberg, Dogmengeschichte II, S. 165, zitiert Heinrich Seuse (auch: Suso): „,Wem Innerkeit wird in Ausserkeit, dem wird Innerkeit innerlicher als dem Innerkeit wird in Innerkeit‘“ (es entstammt: Seuse, Heinrich, Die deutschen Schriften. Nach den älte[206]sten Handschriften in jetziger Schriftsprache, hg. von Heinrich Denifle. – München: Huttler 1880, S. 246). Das mystisch-ekstatische Moment der Einigung mit Gott im Grunde der Seele gelte es zu unterbrechen, wenn Not es erfordere. – Die Predigt Taulers – siehe oben, S. 184, Fn. 40 – bei Seeberg, ebd., Anm. 4.
So blieb also bei Luther der Berufsbegriff traditionalistisch gebunden.
57)
Der Beruf ist das, was der Mensch als göttliche [A 49]Fügung hinzunehmen, worin er sich „zu schicken“ hat, – diese Färbung übertönt den auch vorhandenen anderen Gedanken, daß die Berufsarbeit eine oder vielmehr die von Gott gestellte Aufgabe [207]sei.[206]Sein endgültiger Standpunkt ist dann wohl in einigen Ausführungen der Genesisexegese (in den Op[era] lat[ina] exeget[ica] ed. Elsperger) niedergelegt:
Vol. IV p. 109: Neque haec fuit levis tentatio, intentum esse suae vocationi et de aliis non esse curiosum … Paucissimi sunt, qui sua sorte vivant
39
Die Zitate entstammen Luther, Genesisexegese IV [WA 42, S. 639, Z. 11 f. und 28, S. 640, Z. 29 f. und 41 f.]. Bei Gen 17,9 stand Luther 1535 (vgl. WA 42, S. VII). Paraphrasiert ist die „Regel“ (p. 112), die man in Gehorsam gegenüber Gott halten soll, auch bei Eger, Anschauungen Luthers vom Beruf, S. 149: „Jeder muß in seinem Beruf bleiben und mit seiner Gabe zufrieden sein.“
Vol. IV p. 109: Neque haec fuit levis tentatio, intentum esse suae vocationi et de aliis non esse curiosum … Paucissimi sunt, qui sua sorte vivant
40
contenti … (p. 111 eod.) Nostrum autem est, ut vocanti Deo pareamus … (p. 112) Regula igitur haec servanda est, ut unusquisque maneat in sua vocatione et suo dono contentus vivat, de aliis autem non sit curiosus. Das entspricht im Ergebnis durchaus der Formulierung des Traditionalismus bei Thomas v. Aquin [A 49](Summa th[eologica] V, II-2 qu[aestio] Bei Luther: „vivunt“.
c
118 art. I c):[206]A: th. V, 2 gen. Summa fehlt in A; hier sinngemäß ergänzt.
41
Unde necesse est, quod bonum hominis circa ea consistat in quadam mensura, dum scilicet homo … quaerit habere exteriores divitias, prout sunt necessariae ad vitam ejus secundum suam conditionem. Et ideo in excessu hujus mensurae consistit peccatum, dum scilicet aliquis supra debitum modum vult eas vel acquirere vel retinere, quod pertinet ad avaritiam. Die Stelle nach: Thomas von Aquin, Summa theologica, tomus V (dass. in der Parmenser Ausg., Band 3, 1853; in der (neuen) Römischen Ausg., Band 9, 1897). Zitat auch bei Maurenbrecher, Thomas von Aquino, S. 48, Anm. 1, zum Kontext dort S. 48–50. In Summa theologica II-2, quaestio 118, art. 1, wird erörtert, ob Habsucht (avaritia) Sünde sei. Der Mensch bedürfe der äußeren Güter zum Lebensunterhalt und strebe darum naturhaft nach ihnen. Diese hätten einen Nutzwert oder „Zweck“, wie es im Satz vor Webers Zitat heißt: „Bona autem exteriora habent rationem utilium ad finem […].“ Der natürliche Erwerbstrieb in bezug auf äußere Güter soll sich nach Thomas von Aquin innerhalb der vorgegebenen Standesgrenzen bewegen, in die der Mensch durch die göttliche Vorsehung hineingeboren werde. Er schlage dagegen in Habsucht um, wenn der Mensch nach Überfluß, d. h. nach mehr als standesgemäßem Auskommen strebe. Dies aber sei Sünde, weil es sich gegen den Nächsten richte; denn der eine könne nicht Überfluß an zeitlichen Gütern haben, ohne daß ein anderer Mangel leide (ebd., q. 118, art. 1 c[onclusio]).
42
Das Sündliche der Überschreitung des durch den eigenen stan[207]desgemäßen Bedarf gegebenen Ausmaßes im Erwerbstrieb begründet Thomas aus der lex naturae, wie sie im Zweck (ratio) der äußeren Güter zutage trete, Luther aus Gottes Fügung. Über die Beziehung von Glaube und Beruf bei Luther s. noch vol. VII p. 222 Bei Thomas von Aquin: „[…] pertinet ad rationem avaritiae“.
d
:[207]A: 225
43
… quando es fidelis, tum placent Deo etiam physica, carnalia, animalia officia, sive edas, sive bibas, sive vigiles, sive dormias, quae mere corporalia et animalia sunt. Tanta res est fides … Verum est quidem, placere Deo[207]Das folgende Zitat entstammt Luther, Genesisexegese VII, p. 222 [WA 43, S. 620, Z. 2–4, 15–17 und 18 f.], Auslegung von Gen 29,1–3 (Vorlesung gehalten ca. 1542/43; vgl. WA 42, S. VIII). Eger zitiert ebenfalls Luther, Genesisexegese VII, p. 222 (eine Stelle kurz vor dem Zitat Webers) und folgert: „Aus dem Gesagten ergiebt sich aber von selbst, daß man, um auf Gott vertrauen zu können, an dem Platz sich halten muss, an den uns Gott gestellt hat“ (Eger, Anschauungen Luthers vom Beruf, S. 156).
e
etiam in impiis sedulitatem et industriam in officio (diese Aktivität im Berufsleben ist eine Tugend lege naturae).A: Dei
44
Sed obstat incredulitas et vana gloria, ne possint opera sua referre ad gloriam Dei (an calvinistische Wendungen anklingend) Zu „lex naturae“ vgl. oben, S. 190, Fn. 41 mit Anm. 65.
45
… Merentur igitur etiam impiorum bona opera in hac quidem vita praemia sua (Gegensatz gegen Augustins „vitia specie virtutum palliata“) Vgl. Weber, Protestantische Ethik II, unten, S. 266, Fn. 21, und S. 268.
46
sed non numerantur, non colliguntur in utre Bei Augustinus, De Civitate Dei XIX,25 (PL 41), heißt es über die Tugenden derer, die nicht nach Gott streben: „[…] vitia sunt potius quam virtutes“, und ders., Contra Julianum IV,20 (PL 44): „Ita omnibus virtutibus non solum sunt vitia manifesta discretione contraria […], verum etiam vicina quodam modo, nec veritate, sed quadam specie fallente, similia“. Möglicherweise als „geflügeltes Wort“ gedacht, das Weber auf Augustinus zurückführt. – Allerdings heißt es auch bei Jansenius, Cornelius, Augustinus […], tomus II. – Löwen: Zegerus 1641, p. 584 (De statu naturae lapsae IV, 8): „[…] Augustini doctrinam, qua Romanorum, Philosophorum, vel quorumcumque infidelium virtutes, non veras virtutes, sed vitia specie virtutum palliata fuisse tradit […]“ (zitiert auch bei Denifle, Luther, S. 386, Anm. 2).
f
. A: altro
58)
Und die Entwicklung des orthodoxen Luthertums unterstrich diesen Zug noch weiter. Etwas Negatives: Wegfall der Überbietung der innerweltlichen durch asketische Pflichten, verbunden aber mit [208]Predigt des Gehorsams gegen die Obrigkeit und der Schickung in die gegebene Lebenslage, war hier also zunächst der einzige ethische Ertrag. In der Kirchenpostille (Erl[anger] A[usgabe] 10, S. 233, 235/6)
g
heißt es: [„]Jeder ist in irgend einen Beruf berufen.“Klammer fehlt in A.
47
Dieses Berufes (S. 236 heißt es geradezu „Befehl“) [208]soll er warten und darin Gott dienen. Aus der Weihnachtspostille (enthalten in der Kirchenpostille von 1522). Luther verfaßte sie 1521 auf der Wartburg. Die angegebenen Seiten entstammen der Predigt: Am St. Johannistage. Evangelium Joh. 21,19–24 (Luther, Kirchenpostille, S. 232–247 [WA 10/I/1, S. 305–324]). Weber paraphrasiert S. 233 (dort mitgeteilt als „Lehre“ des Evangeliums): „Unangesehen aller heiligen Exempel und Leben, soll ein jeglicher [wie Petrus im Evangelium Joh 21] warten, was ihm befohlen ist, und wahrnehmen seines Berufs.“ Dies wird anschließend ausgeführt für den Beruf (hier: „Stand“) von Ehemann, Ehefrau, Sohn und Tochter, Knecht und Magd, Fürst, Herr, Bischof, Prälat (vgl. S. 234 f.). Zusammenfassend heißt es: „Siehe, wie nun niemand ohne Befehl und Beruf ist, so ist auch niemand ohne Werke, so er recht thun will. Ist nun einem jeglichen drauf zu merken, daß er in seinem Stande bleibe, auf sich selbst sehe, seines Befehls wahrnehme, und darinnen Gott diene […]“ (S. 235 f.). – Hinweis auf die Kirchenpostille bei Eger, [208]Anschauungen Luthers vom Beruf, S. 148 f. Eger spricht in diesem Zusammenhang von dem „angewandten Vorsehungsglauben“ bei Luther: „[W]ir haben in unserem Beruf auszuharren, weil wir so und nicht anders von Gott geführt worden sind“ (S. 149).
49
Nicht an der Leistung, sondern an dem darin liegenden Gehorsam hat Gott Freude. Vgl. Luther, Kirchenpostille, S. 236: „O nein, lieber Mensch, es ist Gott nicht um die Werke zu thun, sondern um den Gehorsam […]. Daher kommt’s, daß eine fromme Magd, so sie in ihrem Befehl hingehet, und nach ihrem Amt den Hof kehret, oder Mist austrägt […], stracks zu gen Himmel gehet […]“. – Paraphrasiert auch bei Eger, Anschauungen Luthers vom Beruf, S. 146.
59)
– Es war, wie [A 50]später Dem entspricht es, wenn – ein Gegenbild gegen das, was oben über die Wirkung des Pietismus auf die Wirtschaftlichkeit der Arbeiterinnen gesagt wurde
50
– von modernen Unternehmern zuweilen behauptet wird, daß z. B. streng lutherisch-kirchliche Hausindustrielle heute nicht selten, z. B. in Westfalen, in besonders hohem Maß traditionalistisch denken, Umgestaltungen der Arbeitsweise – auch ohne Übergang zum Fabriksystem – trotz des winkenden Mehrverdienstes abgeneigt seien und zur Begründung auf das Jenseits verwiesen, wo ja doch alles sich ausgleichen werde. Es zeigt sich, daß die bloße Tatsache der Kirchlichkeit und Gläubigkeit für die Gesamtlebensführung noch nicht von irgend wesentlicher Bedeutung ist: es sind viel konkretere religiöse Lebensinhalte, deren Wirkung [A 50]in der Zeit des Werdens des Kapitalismus ihre Rolle gespielt haben und – in beschränkterem Maße – noch spielen. Siehe oben, S. 161. Auch das folgende könnte über den Oerlinghauser Familienbetrieb vermittelt worden sein.
60)
noch zu erörtern sein wird, „Später“ heißt in diesem ganzen Abschnitt: bei der geschichtlichen Zurückverfolgung des puritanischen Berufsbegriffes nach dessen Darstellung.
51
D.h. Weber, Protestantische Ethik II, unten, S. 242–425.
48
dem Berufsgedanken in dieser lutherischen Prägung bei den deutschen Mystikern schon weitgehend vorgearbeitet, namentlich durch die prinzipielle Gleichwertung geistlicher und weltlicher Berufe bei Tauler und die geringere Bewertung der überlieferten Formen asketischen Werkverdienstes Weber, Protestantische Ethik II, unten, S. 277–279 mit Fn. 33.
61)
infolge der allein entschei[209]denden Bedeutung der ekstatisch-kontemplativen Aufnahme des göttlichen Geistes durch die Seele. Das Luthertum bedeutet sogar in einem bestimmten Sinne gegenüber den Mystikern einen Rückschritt, insofern bei Luther – und mehr noch bei seiner Kirche – die psychologischen Unterlagen für eine rationale Berufsethik gegenüber den Mystikern – deren Anschauungen über diesen Punkt mehrfach teils an die pietistische, teils an die quäkerische Glaubenspsychologie erinnern Vgl. Tauler, Basler Ausg. Fol[io]
h
161 f.[208]A: Bl.
52
Taulers Predigt (vgl. Tauler, Predigten, Basler Ausg. 1521, fol. 161r–163r) handelt von den äußerlichen und innerlichen Übungen der Frömmigkeit. Dabei bleibe man, so Tauler, nicht an den äußerlichen, asketischen Übungen haften (Tauler nennt Fasten, Wachen, Schweigen, deren Maß an den individuellen Bedürfnissen orientiert werden solle), sondern wende sich nach innen, denn nur in der Innerlichkeit könne die Einigung mit Gott geschehen. Dazu dienten das Gebet in stiller, abendlicher Ruhe, die Erkenntnis der eigenen Fehler und das Vertrauen auf Gott.
62)
–[209]Vgl. die eigentümlich stimmungsvolle Predigt Taulers a.a. O. und Fol[io] 17. 18v. 20.
54
| Die erste Angabe bezieht sich auf die oben, S. 208, Fn. 61, genannte Predigt Taulers. Die Folio-Angaben zur zweiten Predigt (fol. 17. 18v. 20) ließen sich in der Basler Ausgabe von 1521 nicht verifizieren, noch in einer anderen Ausgabe der Predigten Taulers wie angegeben ermitteln. Mit dem Thema in Verbindung bringen ließe sich jedoch Tauler, Basler Ausg. 1521, fol. 121r: „So sollen diese edlen Menschen, wenn sie sich des Nachts gar wohl in dieser innerlichen Einkehr und auch des Morgens ein wenig geübt haben, in gutem Frieden ihre Arbeit verrichten, jeder wie Gott es ihm fügt, und Gott während ihrer Tätigkeit im Sinn haben, denn man darf sicher sein: es kann dir bei deiner Arbeit mehr Gutes geschehen als bei jener Beschauung.“ Hier zit. nach: Johannes Tauler. Predigten. Vollst. Ausg. Übertragen und hg. von Georg Hofmann, Band II. – Einsiedeln: Johannes Verlag 1979, S. 540 f. – Möglicherweise ist auch die oben, S. 184, Fn. 40 (mit Anm. 35), erwähnte Predigt Taulers gemeint.
i
ziemlich unsichere geworden sind[,] und zwar, wie noch zu zeigen sein wird,[209]A: erinnern3),
53
gerade weil der Zug zur asketischen Selbstdisziplinierung ihm als Werkheiligkeit verdächtig war und daher in seiner Kirche immer mehr in den Hintergrund treten mußte. [209]Weber, Protestantische Ethik II, unten, S. 285 und S. 335 mit Fn. 109a.
Der bloße Gedanke des „Berufes“ im lutherischen Sinn also – das allein sollte schon hier festgestellt werden – war, soviel wir bisher sehen können, von jedenfalls nur problematischer Tragweite für das, was wir suchen. Damit ist nun nicht im mindesten gesagt, daß eine praktische Bedeutung auch der lutherischen Form der Neuordnung des religiösen Lebens für die Gegenstände unserer Betrachtung nicht bestanden hätte
k
. Nur ist sie offenbar nicht unmittelbar aus der Stellung Luthers und seiner Kirche zum weltlichen Beruf ableitbar und überhaupt nicht so leicht greifbar[,] wie dies vielleicht bei anderen Ausprägungen des Protestantismus der Fall sein könnte. Es empfiehlt sich daher für uns, zunächst solche Formen desselben zu betrachten, bei denen ein Zusammenhang der [210]Lebenspraxis mit dem religiösen Ausgangspunkt leichter als beim Luthertum zu ermitteln ist. Schon früher wurde nun die auffällige Rolle des Calvinismus und der protestantischen Sekten in der Geschichte der kapitalistischen Entwicklung erwähnt.A: hätten
55
[A 51]Wie Luther in Zwingli einen „anderen Geist“ lebendig fand als bei sich selbst,[210]Siehe oben, S. 123–140.
56
so seine geistigen Nachfahren speziell im Calvinismus. Und erst recht hat der Katholizismus von jeher, und bis in die Gegenwart, den Calvinismus als den eigentlichen Gegner betrachtet. Zunächst hat das ja nun politische Gründe: wenn die Reformation ohne Luthers ganz persönliche religiöse Entwicklung nicht vorstellbar und geistig dauernd von seiner Persönlichkeit bestimmt worden ist, so wäre ohne den Calvinismus sein Werk nicht von äußerer Dauer gewesen. – Aber der Grund des, Katholiken und Lutheranern gemeinsamen, Abscheues liegt doch auch in der ethischen Eigenart des Calvinismus begründet. Schon der oberflächlichste Blick lehrt, daß hier eine ganz andersartige Beziehung zwischen religiösem Leben und irdischem Handeln hergestellt ist, als sowohl im Katholizismus wie im Luthertum. Selbst in der spezifisch religiöse Motive verwendenden Literatur tritt das hervor. Man nehme etwa den Schluß der Divina Commedia, wo dem Dichter im Paradiese im wunschlosen Schauen der Geheimnisse Gottes die Sprache versagt, Oft zitiert, lat.: „Vos habetis alium spiritum quam nos.“ Luther bezieht sich mit „vos“ auf Zwingli und Johannes Oecolampad als Repräsentanten der Schweizer und Oberdeutschen, die eine abweichende, spiritualistische Abendmahlsauffassung vertraten. Zitat Martin Luthers im Brief an den Bremer Superintendenten Jakob Probst vom 1. Juni 1530 über das Marburger Religionsgespräch (1.–3.10.1529), hier nach: de Wette, Wilhelm Martin Leberecht (Hg.), Dr. Martin Luthers Briefe, Sendschreiben und Bedenken. Vierter Theil. – Berlin: G. Reimer 1827, S. 28 [WA.Br 5, Nr. 1577, S. 338–342, hier S. 340, Z. 54],
57
und halte daneben den Schluß jenes Gedichtes, welches man die „Göttliche Komödie des Puritanismus“ zu nennen sich gewöhnt hat. Vgl. Dante, Göttliche Komödie, 33. [= letzter] Gesang, S. 393–397. Dante Alighieris „La Commedia“ entstand in den ersten beiden Jahrzehnten des 14. Jahrhunderts (Erstdruck 1472).
58
Milton schließt den letzten Gesang des „Para[211]dise lost“ nach der Schilderung der Ausstoßung aus dem Paradiese wie folgt: Die Bezeichnung konnte nicht nachgewiesen werden. Miltons „Paradise Lost“ und Dantes „Divina Commedia“ werden allerdings häufig miteinander verglichen, z. B. bei Masson, Milton VI, p. 518–522 und 532–536; Stern, Milton II/4, S. 101–103. Auch Troeltsch, Art. Moralisten, S. 447, hält Milton für den „Dante“ des „protestantisch-reformierten Kulturideals“.
59
[211]Weber zitiert (nach der Übersetzung Adolf Böttgers) Milton, Das verlorene Paradies, zunächst S. 313, dann S. 311 f. Miltons Epos „Paradise Lost“ erschien zuerst 1667 und in zweiter, endgültiger, zwölf Gesänge umfassender Version 1674.
„Sie wandten sich und sah’n des Paradieses
Östlichen Teil, – noch jüngst ihr sel’ger Sitz, –
Von Flammengluten furchtbar überwallt,
Die Pforte selbst von riesigen Gestalten,
Mit Feuerwaffen in der Hand, umschart.
Sie fühlten langsam Tränen niederperlen, –
Jedoch sie trockneten die Wangen bald:
Vor ihnen lag die große weite Welt,
Wo sie den Ruheplatz sich wählen konnten
Die Vorsehung des Herrn als Führerin.
Sie wanderten mit langsam zagem Schritt
Und Hand in Hand aus Eden ihres Weges.“
Östlichen Teil, – noch jüngst ihr sel’ger Sitz, –
Von Flammengluten furchtbar überwallt,
Die Pforte selbst von riesigen Gestalten,
Mit Feuerwaffen in der Hand, umschart.
Sie fühlten langsam Tränen niederperlen, –
Jedoch sie trockneten die Wangen bald:
Vor ihnen lag die große weite Welt,
Wo sie den Ruheplatz sich wählen konnten
Die Vorsehung des Herrn als Führerin.
Sie wanderten mit langsam zagem Schritt
Und Hand in Hand aus Eden ihres Weges.“
l
[211]Petitdruck in A.
Und wenig vorher hatte Michael zu Adam gesagt:
„… Nur füge zu dem Wissen auch die Tat;
Dann füge Glauben, Tugend und Geduld
Und Mäßigkeit hinzu und jene Liebe,
Die einst als christliche gepriesen wird,
Und Seele wird von allen Tugenden.
Dann läßt du ungern nicht dies Paradies,
Du trägst in dir ja ein viel sel’geres.“
Dann füge Glauben, Tugend und Geduld
Und Mäßigkeit hinzu und jene Liebe,
Die einst als christliche gepriesen wird,
Und Seele wird von allen Tugenden.
Dann läßt du ungern nicht dies Paradies,
Du trägst in dir ja ein viel sel’geres.“
m
Petitdruck in A.
[A 52]Jeder empfindet sofort, daß dieser mächtigste Ausdruck der ernsten puritanischen Weltfreudigkeit, das heißt: Wertung des Lebens als Aufgabe, im Munde eines mittelalterlichen Schriftstellers unmöglich gewesen wäre. Aber auch dem Luthertum, wie es etwa in Luthers und Paul Gerhardts
n
Chorälen sich gibt,A: Gerhards
60
ist er ganz [212]ebenso wenig kongenial. An die Stelle dieser unbestimmten Empfindung gilt es nun hier eine etwas genauere gedankliche Formulierung zu setzen und nach den inneren Gründen dieser Unterschiede zu fragen. Die Berufung auf den „Volkscharakter“ ist nicht nur überhaupt lediglich das Bekenntnis des Nichtwissens, sondern in unserem Fall auch gänzlich hinfällig. Den Engländern des 17. Jahrhunderts einen einheitlichen „Volkscharakter“ zuzuschreiben wäre einfach historisch unrichtig. „Kavaliere“ und „Rundköpfe“ empfanden sich nicht einfach als zwei Parteien, sondern als radikal verschiedene Menschengattungen, Luther, der „Vater des evangelischen deutschen Kirchenliedes“, verfaßte für den von ihm eingerichteten deutschsprachigen Gottesdienst Lieder, aber auch für Schule und Öffentlichkeit, und gab Gesangbücher heraus. Seine Lieder dienten der Verbreitung der reformatorischen Lehre. – Paul Gerhardt gilt mit seinen über 130 Liedern als bedeutendster Kirchenlieddichter des Protestantismus nach Luther. Er dichtete nach den Erfahrungen des Dreißigjährigen Krieges und wollte seinen Zeitgenossen in seinen [212]Lob-, Dank- und Trostliedern gelassenes Gottvertrauen vermitteln. Vgl. Hering, Hermann, Art. Kirchenlied III, deutsches, in: RE3, 10. Band, 1901, S. 419–426, Zitat S. 421.
61
und wer aufmerksam zusieht, muß ihnen darin recht geben. Während des Englischen Bürgerkrieges (1642–1649) bezeichnete man die Anhänger der Parlamentspartei als „Roundheads“, die Royalisten als „Cavaliers“ des Königs. Die Bezeichnung „Roundheads“ rührte von der Kurzhaarfrisur her, die parlamentsparteiische Puritaner, besonders Lehrlinge, im Gegensatz zu den schulterlangen Locken(-Perücken) der „Cavaliers“ trugen.
63)
Und ein charakterologischer Gegensatz der englischen merchant adventurers gegen die alten Hanseaten ist ebensowenig auffindbar,[212][A 52]Wer freilich die Geschichtskonstruktion der Leveller teilte, wäre in der glücklichen Lage[,] auch dies wieder auf Rassendifferenzen zu reduzieren: sie glaubten als Vertreter der Angelsachsen ihr „birthright“ gegen die Nachfahren Wilhelms des Eroberers und der Normannen zu verfechten.
63
| Die politische Partei der Leveller (engl. Levellers; Näheres im Glossar, unten, S. 833 f.) vertrat unter Berufung auf das Naturrecht weitreichende Demokratie- und religiöse Toleranzvorstellungen. Ihrem Geschichtsverständnis nach wurden ihren angelsächsischen Vorfahren von den Normannen (Eroberung unter Wilhelm im Jahr 1066) ein fremdes Recht und eine neue Herrschafts- und Sozialordnung oktroyiert. Es gelte nun, das normannische Joch zu beseitigen und zur altenglischen Freiheit zurückzukehren. – Zur Berufung auf das „birthright“ vgl. z. B. John Lilburnes Manifest „Englands birth-right justified“ (London, Oktober 1645) die Putney Debates (1647) (vgl. dazu: The Clarke Papers. Selections from the Papers of William Clarke, ed. by C. H. Firth, vol. I. – London: Printed for the Camden Society 1891, p. lx ff.).
62
wie überhaupt kein Die Company of Merchant Adventurers of London, eine Art Gilde der Überseehändler, hatte während des 16. und 17. Jahrhunderts das Monopol des Tuchexports nach Nordeuropa inne. Ihre Hauptniederlassung auf dem Festland befand sich in Antwerpen. Nach Ausbruch des Niederländischen Krieges verlegte sie den Sitz ihrer Niederlassung in andere Städte, im Jahre 1567 nach Hamburg, wo die Engländer 1654 vom Senat dieselben Handelsrechte wie die Hansekaufleute erhielten und bis Anfang des 19. Jahrhunderts als „Hamburg Company“ aktiv waren. Vgl. Lingelbach, W[illiam] E[zra], The Merchant Adventurers of England. Their Laws and Ordinances with other Documents. – Philadelphia: Longman, Green & Co. 1902, p. xv–xxxix.
o
[213]anderer Unterschied englischer von deutscher Eigenart am Ende des Mittelalters zu konstatieren ist, als er sich durch die verschiedenen politischen Schicksale unmittelbar erklären läßt. Erst die Macht religiöser Bewegungen – nicht sie allein, aber sie zuerst – hat hier jene Unterschiede geschaffen, die wir heute empfinden. [212]A: ein
Wenn wir demgemäß bei der Untersuchung der Beziehungen zwischen der altprotestantischen Ethik und der Entwicklung des kapitalistischen Geistes von den Schöpfungen Calvins, des Calvinismus und der puritanischen Sekten ausgehen, so darf das nun aber nicht dahin verstanden werden, als erwarteten wir,
p
bei einem der Gründer oder Vertreter dieser Religionsgemeinschaften die Erweckung dessen, was wir hier „kapitalistischen Geist“ nennen, in irgend einem Sinn als Ziel seiner Lebensarbeit vorzufinden. Daß das Streben nach weltlichen Gütern als Selbstzweck gedacht, irgend einem von ihnen geradezu als ethischer Wert gegolten hätte, werden wir nicht wohl vermuten können. Aber es ist überhaupt vor allem eins ein für allemal festzuhalten: [A 53]ethische Reformprogramme sind bei keinem der „Reformatoren“ – zu denen wir für unsere Betrachtung auch Männer wie Menno, George Fox, Wesley zu rechnen haben[213]In A folgt: daß
64
– jemals der zentrale Gesichtspunkt gewesen. Sie sind keine Gründer von Gesellschaften für „ethische Kultur“[213]Menno Simons gab den gemäßigten Täufern ihre organisatorische Gestalt („Mennoniten“). – George Fox, Gründervater der „Society of Friends“ (Quäker). – John Wesley, (Mit-)Begründer des Methodismus. Vgl. auch das Personenverzeichnis, unten, S. 799, 782 und 817.
65
oder Vertreter humanitärer sozialer Reformprogramme oder Kulturideale. Das Seelenheil und dies allein ist der Angelpunkt ihres Lebens und Wirkens. Ihre ethischen Ziele und die praktischen Wirkungen ihrer Lehre sind alle hier verankert und Konsequenzen rein religiöser Motive. Und wir werden deshalb darauf gefaßt sein müssen, daß die Kulturwirkungen der Reformation zum guten Teil – vielleicht sogar für unsere speziellen Gesichtspunkte überwiegend – [214]unvorhergesehene und geradezu ungewollte Konsequenzen der Arbeit der Reformatoren waren, oft weit abliegend oder geradezu im Gegensatz stehend zu Allem, was ihnen selbst vorschwebte. Gesellschaften für ethische Kultur gründen in der „ethischen Bewegung“, deren Anliegen die Pflege einer Ethik in erklärter Unabhängigkeit und Selbständigkeit gegenüber einer Religion und einem persönlichen Bekenntnis war (Näheres im Glossar, unten, S. 829). Weber stand der Bewegung kritisch gegenüber (vgl. ders., Der Nationalstaat und die Volkswirtschaftspolitik. Akademische Antrittsrede, in: MWG I/4, S. 535–574, hier S. 573 mit Anm. 58; dazu S. 538, Anm. 12).
So könnten die nachfolgenden Studien an ihrem freilich bescheidenen Teil vielleicht auch einen Beitrag bilden zur Veranschaulichung der Art, in der überhaupt die „Ideen“ in der Geschichte wirksam werden.
66
Gerade aus diesem Zweck wird das Recht abgeleitet, sie in diese Zeitschrift, welche ihrem Programm gemäß an rein historischer Arbeit sich im allgemeinen nicht selbst beteiligt, aufzunehmen.[214]Weber, Protestantische Ethik II, unten, S. 242–425.
67
Damit aber nicht schon von vornherein Mißverständnisse über den Sinn, in dem hier ein solches Wirksamwerden rein ideeller Motive überhaupt behauptet wird, entstehen, mögen darüber als Abschluß dieser langwierigen Erörterungen noch einige wenige Andeutungen gestattet sein. Vgl. dazu das „Geleitwort“ der Herausgeber Werner Sombart, Max Weber und Edgar Jaffé zur Übernahme des „Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik“, in: AfSSp, 19. Band (N. F. 1. Band), 1904, S. I*–VII*, und Webers Interpretation der Aufgaben des „Archivs“ in Weber, Objektivität, S. 39–41.
Es handelt sich bei solchen Studien – wie vor allem ausdrücklich bemerkt sein mag – in keiner Weise um den Versuch, den Gedankengehalt der Reformation in irgend einem Sinn, sei es sozialpolitisch, sei es religiös zu werten. Wir haben es für unsere Zwecke stets mit Seiten der Reformation zu tun, welche dem religiösen Bewußtsein als peripherisch und geradezu äußerlich erscheinen müssen. Denn es soll ja lediglich unternommen werden, den Einschlag, welchen religiöse Motive in das Gewebe der Entwicklung unserer aus zahllosen historischen Einzelmotiven erwachsenen modernen materiellen Kultur geliefert haben, etwas deutlicher zu machen. Wir fragen lediglich, was von gewissen charakteristischen Inhalten dieser Kultur dem Einfluß der Reformation als historischer Ursache etwa zuzurechnen sein möchte. Dabei müssen wir uns freilich von der Ansicht emanzipieren, man könne [A 54]aus ökonomischen Verschiebungen die Reformation als „entwicklungsgeschichtlich notwendig“ deduzieren. Ungezählte historische Konstellationen, die nicht nur in kein ökonomisches „Gesetz“, sondern überhaupt in keinen ökonomischen Gesichtspunkt irgend welcher Art sich einfügen, namentlich rein politische Vorgänge, mußten Zusammenwirken, damit die neu geschaffenen Kirchen überhaupt fortzubeste[215]hen vermochten. Aber andererseits soll ganz und gar nicht eine so töricht-doktrinäre These verfochten werden wie etwa die: daß der „kapitalistische Geist“ (immer in dem provisorisch hier verwendeten Sinn dieses Wortes) oder wohl gar: der Kapitalismus überhaupt, nur als Ausfluß bestimmter Einflüsse der Reformation habe entstehen können. Schon daß gewisse wichtige Formen kapitalistischen Geschäftsbetriebs erheblich älter sind als die Reformation, stände einer solchen These im Wege. Sondern es soll nur festgestellt werden, ob und wieweit hier tatsächlich religiöse Einflüsse bei der qualitativen Prägung und quantitativen Expansion jenes „Geistes“ über die Welt hin mitbeteiligt gewesen sind und welche konkreten Seiten der kapitalistischen Kultur auf sie zurückgehen. Dabei kann nun angesichts des ungeheuren Gewirrs gegenseitiger Beeinflussungen zwischen den materiellen Unterlagen, den sozialen und politischen Organisationsformen und dem geistigen Gehalte der reformatorischen Kulturepochen nur so verfahren werden, daß zunächst untersucht wird, ob und in welchen Punkten bestimmte Wahlverwandtschaften zwischen gewissen Formen des religiösen Glaubens und der Berufsethik erkennbar sind. Damit wird zugleich die Art und allgemeine Richtung, in welcher infolge solcher Wahlverwandtschaften die religiöse Bewegung auf die Entwicklung der materiellen Kultur einwirkte, nach Möglichkeit verdeutlicht. Alsdann erst kann der Versuch gemacht werden, abzuschätzen, in welchem Maße moderne Kulturinhalte in ihrer geschichtlichen Entstehung jenen religiösen Motiven und inwieweit anderen zuzurechnen sind.