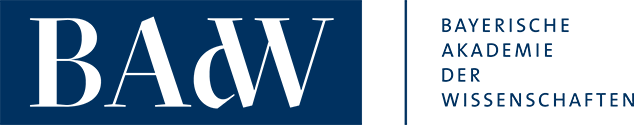[222][A 619][Machtprestige und Nationalgefühl]a[222] In A lautet die Überschrift: Kapitel III. Machtgebilde. „Nation“. Ihr folgt der Hinweis der Erstherausgeber: (Unvollendet). und die Überschrift: § 1. Machtprestige und „Großmächte“.
[222] In A lautet die Überschrift: Kapitel III. Machtgebilde. „Nation“. Ihr folgt der Hinweis der Erstherausgeber: (Unvollendet). und die Überschrift: § 1. Machtprestige und „Großmächte“.
Alle politischen Gebilde sind Gewaltgebilde. Aber Art und Maß der Anwendung oder Androhung von Gewalt nach außen, anderen gleichartigen Gebilden gegenüber, spielt für Struktur und Schicksal politischer Gemeinschaften eine spezifische Rolle. Nicht jedes politische Gebilde ist in gleichem Maße „expansiv“ in dem Sinn, daß es Macht nach außen, d. h. Bereithalten von Gewalt zwecks Erwerbs der politischen Gewalt über andere Gebiete und Gemeinschaften, sei es in Form von Einverleibung oder Abhängigkeit[,] anstrebt. Die politischen Gebilde sind also in verschiedenem Umfang nach außen gewendete Gewaltgebilde. Die Schweiz, als ein durch Kollektivgarantie der großen Machtgebilde „neutralisiertes“, außerdem auch teils (aus verschiedenen Gründen) nicht sehr stark zur Einverleibung begehrtes, teils und vor allem durch gegenseitige Eifersucht von unter sich gleich mächtigen Nachbargemeinschaften davor geschütztes politisches Gebilde
1
und das relativ wenig bedrohte Norwegen sind es weniger als das kolonialbesitzende Holland, dies weniger als Belgien wegen dessen besonders bedrohtem Kolonialbesitz[222] Seit der frühen Neuzeit dienten schweizerische Söldner in so bedeutendem Umfang in allen europäischen Armeen, daß keine Großmacht gewillt war, die Kontrolle über diesen Rekrutierungspool einer konkurrierenden Macht zu überlassen. Auf dem Wiener Kongreß 1815 garantierten die Großmächte die Neutralität der Schweiz, unter der Bedingung, daß eine nationale Armee aufgebaut würde, die in der Lage sei, ausländischen Truppen den Durchzug durch das Schweizer Staatsgebiet zu verwehren.
2
und eigener militärischen Bedrohtheit im Fall eines Kriegs seiner mächtigen Nachbarn, und auch als Schweden. Politische Gebilde können also in ihrem Verhalten nach außen mehr „autonomistisch“ oder mehr „expansiv“ gerichtet sein und dies Verhalten wechseln. Dies bezieht sich auf den belgischen Kongo, der 1908 in den Besitz des belgischen Staates überging. Frankreich besaß seit 1885 ein Vorkaufsrecht auf den belgischen Kongo. Gleichwohl bemühte sich Reichskanzler v. Bethmann Hollweg in Verhandlungen mit Großbritannien, einen eventuellen Erwerb des Kongo durch Deutschland anzubahnen.
[223]Alle „Macht“ politischer Gebilde trägt in sich eine spezifische Dynamik: sie kann die Basis für eine spezifische „Prestige“-Prätension ihrer Angehörigen werden, welche ihr Verhalten nach außen beeinflußt. Die Erfahrung lehrt, daß Prestigeprätensionen von jeher einen schwer abzuschätzenden, generell nicht bestimmbaren, aber sehr fühlbaren Einschlag in die Entstehung von Kriegen gegeben haben: ein Reich der „Ehre“, „ständischer“ Ordnung vergleichbar, erstreckt sich auch auf die Beziehungen der politischen Gebilde untereinander; feudale Herrenschichten, ebenso wie moderne Offiziers- oder Amtsbürokraten sind die naturgemäßen primären Träger dieses rein an der Macht des eigenen politischen Gebildes als solcher orientierten „Prestige“-Strebens. Denn Macht des eigenen politischen Gebildes bedeutet für sie eigene Macht und eigenes machtbedingtes Prestigegefühl, Expansion der Macht nach außen aber außerdem noch für die Beamten und Offiziere Vermehrung der Amtsstellen und Pfründen, Verbesserung der Avancementschancen (für den Offizier selbst im Fall eines verlorenen Krieges), für die Lehensmannen Gewinnung von neuen lehnbaren Objekten zur Versorgung ihres Nachwuchses: diese Chancen (nicht, wie man wohl gesagt hat, die „Übervölkerung“) rief Papst Urban in seiner Kreuzzugsrede auf.
3
Aber über diese naturgemäß und überall vorhandenen direkten ökonomischen Interessen der von der Ausübung politischer Macht lebenden Schichten hinaus ist dies „Prestige“-Streben eine innerhalb aller spezifischen Machtgebilde und daher auch der politischen verbreitete Erscheinung. Es [224]ist nicht [A 620]einfach mit dem „Nationalstolz“ – von dem später zu reden ist[223] Die These, daß die Kreuzzüge durch „Übervölkerung“ ausgelöst worden seien, geht wahrscheinlich auf Kugler, Bernhard, Geschichte der Kreuzzüge. Allgemeine Geschichte in Einzeldarstellungen, 2. Hauptabt., 5. Teil. – Berlin: G. Grote’sche Verlagsbuchhandlung 1880, S. 7, zurück. In der mediävistischen Forschung wurde diese Ansicht jedoch nicht rezipiert. Nach dem Bericht des Baldricus von Dôle, einem der vier Textzeugen der Kreuzzugspredigt, stellte Papst Urban II. den Kreuzfahrern Erwerbschancen im Heiligen Land in Aussicht. Vgl. Baldricus Episcopus Dolensis, Historia Jerosolimitana, in: Recueil des Historiens des Croisades. Historiens Occidentaux, tome quatrième. – Paris: Imprimerie Nationale 1879, S. 15 C. Allerdings wies Urban nach Robert dem Mönch darauf hin, daß das Heilige Land wegen seiner natürlichen Beschaffenheit gerade keinen materiellen Gewinn verspreche. Vgl. Robertus Monachus, Historia Iherosolimitana, ebd., tome troisième. – Paris: Imprimerie Impériale 1866, S. 728 E. Man kann aber aufgrund der Deutung der Texte durch andere Quellen davon ausgehen, daß der erste Kreuzzug vor allem für die französische Ritterschaft attraktiv war, die seit Beginn des 11. Jahrhunderts von erhöhten Abgabelasten, Hungersnöten, Rechtsunsicherheit und Preissteigerung besonders betroffen war.
4
– und auch nicht mit dem bloßen „Stolz“ auf wirkliche oder geglaubte Vorzüge oder auf den bloßen Besitz eines eigenen politischen Gemeinwesens identisch. Dieser Stolz kann, wie bei den Schweizern und Norwegern, sehr entwickelt, aber praktisch rein autonomistisch und von politischen Prestigeprätensionen frei sein, während das reine Machtprestige, als „Ehre der Macht“, praktisch: die Ehre der Macht über andere Gebilde, die Machtexpansion, wenn auch nicht immer in Form der Einverleibung oder Unterwerfung, bedeutet. Naturgegebene Träger dieser Prestigeprätension sind die quantitativ großen politischen Gemeinschaften. Jedes politische Gebilde zieht naturgemäß schon an sich die Nachbarschaft schwacher politischer Gebilde derjenigen starker vor. Und da überdies jede große politische Gemeinschaft, als potentieller Prätendent von Prestige, also eine potentielle Bedrohung für alle Nachbargebilde bedeutet, so ist sie zugleich selbst ständig latent bedroht, rein deshalb, weil sie ein großes und starkes Machtgebilde ist. Und vollends jedes Aufflammen der Prestigeprätensionen an irgendeiner Stelle – normalerweise die Folge akuter politischer Bedrohung des Friedens – ruft kraft einer unvermeidlichen „Machtdynamik“ sofort die Konkurrenz aller anderen möglichen Prestigeträger in die Schranken: die Geschichte des letzten Jahrzehnts[224] Siehe unten, S. 240 f.
b
, speziell der Beziehungen Deutschlands zu Frankreich,[224] In A bindet die Anmerkung der Erstherausgeber an: 1) Vor dem Weltkrieg. (Anm. d. Herausgeb.)
5
zeigt die eminente Wirkung dieses irrationalen Elements aller politischen Außenbeziehungen. Da das Prestigegefühl zugleich den für die Zuversichtlichkeit im Fall des Kampfs wichtigen pathetischen Glauben an die reale Existenz der eigenen Macht zu stärken geeignet ist, so sind die spezifischen Interessenten jedes politischen Machtgebildes geneigt, jenes Gefühl systematisch zu pflegen. Jene politischen Gemeinschaften, welche jeweilig als Träger des Macht[225]prestiges auftreten, pflegt man heute „Großmächte“ zu nennen. Innerhalb eines jeden Nebeneinanders Gemeint ist das Jahrzehnt seit der Jahrhundertwende mit der ersten Marokkokrise. Der deutsche Einspruch gegen die französische Machtausweitung in Marokko 1905, bei dem auf deutscher Seite keine konkreten territorialen Wünsche oder Kompensationsforderungen im Spiel waren, kann als ein typisches Beispiel von Prestigepolitik dienen, die einem anderen Staat gegenüber nur den Anspruch geltend machen will, in allen wichtigen weltpolitischen Fragen mitzusprechen.
c
politischer Gemeinschaften pflegen sich einzelne als „Großmächte“ eine Interessiertheit an politischen und ökonomischen Vorgängen eines großen, heute meist eines die ganze Fläche des Planeten umfassenden, Umkreises zuzuschreiben und zu usurpieren. Im hellenischen Altertum war der „König“, d. h. der Perserkönig, trotz seiner Niederlage die anerkannteste Großmacht.[225]A: Nebeneinander
6
An ihn wendete sich Sparta, um unter seiner Sanktion der hellenischen Welt den Königsfrieden (Frieden des Antalkidas) zu oktroyieren.[225] Dies bezieht sich auf die gescheiterten Versuche der Perserkönige Dareios und Xerxes in den Jahren 490 bzw, 480/479 v. Chr., das griechische Festland ihrem Reich einzugliedern.
7
Später, vor der Schaffung eines römischen Weltreichs, usurpierte das römische Gemeinwesen eine solche Rolle. Großmachtgebilde sind aus allgemeinen Gründen der „Machtdynamik“ allerdings rein als solche sehr oft zugleich expansive, d. h. auf gewaltsame oder durch Gewaltdrohung erzielte Ausdehnung des Gebietsumfangs der eigenen politischen Gemeinschaft eingestellte Verbände. Aber sie sind es dennoch nicht notwendig und immer. Ihre Haltung in dieser Hinsicht wechselt oft, und dabei spielen in sehr gewichtiger Art auch ökonomische Momente mit. Die englische Politik z. B. hatte zeitweise ganz bewußt auf weitere politische Expansion und selbst auf die Festhaltung der Kolonien durch Gewaltmittel verzichtet, zugunsten einer „kleinenglischen“, politisch autonomistischen, Beschränkung auf den für unerschütterlich gehaltenen ökonomischen Primat. Mit persischer Hilfe zwang Sparta seine Gegner, allen voran Athen, 386 v. Chr. zum Abschluß des nach dem spartanischen Verhandlungsführer benannten Antalkides- oder Königsfriedens, in dem allen griechischen Staaten ihre Unabhängigkeit garantiert wurde. Die Einhaltung der Friedensbestimmungen garantierte der persische Großkönig.
8
Gewichtige Repräsentanten der römischen Honoratiorenherrschaft hätten nach den punischen Kriegen gern ein ähnliches „kleinrömisches“ Programm: Beschränkung der politischen Unterwerfung auf Italien [226]und die Nachbarinseln, durchgeführt. Dies bezieht sich auf die Ära des sogenannten Freihandelsimperialismus der Zeit nach 1815, in der jegliche territoriale Erweiterung des britischen Empire abgelehnt und zeitweilig selbst die Ablösung der Dominions von der britischen Herrschaft begrüßt wurde, solange im Zeichen des Freihandels der uneingeschränkte wirtschaftliche Zugang zu den überseeischen Märkten gewährleistet war.
9
Die spartanische Aristokratie hat die politische Expansion ganz bewußt autonomistisch beschränkt, soweit sie konnte, und sich mit der Zertrümmerung aller ihrer Macht und ihrem Prestige bedrohlichen, anderen politischen Bildungen zugunsten des Städtepartikularismus begnügt. In solchen und den meisten ähnlichen Fällen pflegen mehr oder minder klare Befürchtungen der herrschenden Honoratiorenschichten – des römischen Amtsadels, der englischen und anderer liberalen Honoratioren, der spartiatischen Herrenschichten – gegen die mit dem chronisch erobernden „Imperialismus“ sehr leicht verbundenen Tendenzen zugunsten der Entwicklung eines „Imperator“, d. h. charismatischen Kriegsfürsten auf Kosten [A 621]der eigenen Machtstellung der Honoratioren, im Spiel zu sein. Die englische wie die römische Politik aber wurden nach kurzer Zeit, und zwar mit durch kapitalistische Expansionsinteressen[,] aus ihrer Selbstbeschränkung wieder herausgezwungen und zur politischen Expansion genötigt.[226] Bald nach Beendigung des 2. Punischen Krieges setzte in Rom eine Diskussion ein, ob eine weitere Expansion durchführbar sei. Cato trat 167 v. Chr. zwar für die Zerstörung des makedonischen Königreiches ein, lehnte aber eine Annexion ab, weil diese Provinz nicht zu verteidigen sei. Im 3. Punischen Krieg war die Zerstörung Karthagos umstritten und Cato mußte starke Widerstände in Teilen des römischen Senats überwinden, die sich auf den Erhalt des vorhandenen Reiches beschränken wollten. Vgl. Diodor, 34, 33, 4–6.
d
[226] In A folgt die Zwischenüberschrift: § 2. Die wirtschaftlichen Grundlagen des „Imperialismus“.
Man könnte geneigt sein zu glauben, daß überhaupt die Bildung und ebenso die Expansion von Großmachtgebilden stets primär ökonomisch bedingt sei. Am nächsten liegt die Generalisierung der in einzelnen Fällen in der Tat zutreffenden Annahme, daß ein bereits bestehender, besonders intensiver Güterverkehr in einem Gebiet die normale Vorbedingung und auch der Anlaß seiner politischen Einigung sei. Das Beispiel des Zollvereins
10
liegt äußerst nahe, und es gibt zahlreiche andere. Allein genaueres Zusehen verrät sehr oft, daß dieser Zusammenfall kein notwendiger und das [227]Kausalverhältnis keineswegs eindeutig gerichtet ist. Was z. B. Deutschland anbelangt, so ist es zu einem einheitlichen Wirtschaftsgebiet, d. h. einem Gebiet, dessen Insassen den Absatz der von ihnen erzeugten Güter in erster Linie auf dem eigenen Markt suchen, erst durch die in ihrem Verlauf rein politisch bedingten Zollinien an seinen Grenzen zusammengeschlossen worden. Das, bei einem gänzlichen Fortfall aller Zollschranken gegebene, also rein ökonomisch determinierte Absatzgebiet der kleberarmen Die am 1. Januar 1834 begonnene handelspolitische Einigung der deutschen Einzelstaaten durch den deutschen Zollverein führte zunächst vor allem zu einer Senkung der Warenzölle. Rückblickend wurde der Zollverein oft als Vorentscheidung für die Entstehung eines kleindeutschen Nationalstaats angesehen, obwohl mit Hamburg und Bremen erst 1888 die letzten Bundesstaaten beitraten und erst nach dem Austritt Luxemburgs 1919 seine Ausdehnung mit den Reichsgrenzen übereinstimmte.
11
ostdeutschen Getreideüberschüsse war nicht der deutsche Westen, sondern der englische Markt. Die Berg- und Hüttenprodukte und die schweren Eisenwaren des deutschen Westens hatten ihren rein ökonomisch determinierten Markt keineswegs im deutschen Osten und dieser seine rein ökonomisch determinierten Lieferanten von Gewerbeprodukten zumeist nicht im deutschen Westen. Vor allem wären und sind zum Teil auch noch nicht die inneren Verkehrslinien (Eisenbahnen) Deutschlands die ökonomisch determinierten Transportwege für spezifisch schwere Güter zwischen Osten und Westen. Der Osten wäre dagegen ökonomischer Standort für starke Industrien, deren rein ökonomisch determinierter Markt und Hinterland der ganze Westen Rußlands wäre und welche jetzt[227] „Kleber“ bezeichnet ein Gemenge von Eiweißstoffen im Getreide. Der Klebergehalt im Mehl ist entscheidend für die Backfähigkeit, wobei Roggenmehl wenig, Weizenmehl dagegen viel Kleber enthält.
e
durch die russischen Zollschranken unterbunden und unmittelbar hinter die russische Zollgrenze nach Polen verschoben sind.[227] In A bindet die Anmerkung der Erstherausgeber an: 1) Vor 1914 geschrieben. (Anm. d. Herausgeb.)
12
Durch diese Entwicklung ist bekanntlich der politische Anschluß der russischen Polen an die russische Reichsidee, der rein politisch eine Unmöglichkeit schien, in den Nach der Niederschlagung der polnischen Aufstandsbewegung im Jahre 1861 wurde den Polen Kongreßpolens ihr Sonderstatus innerhalb des zarischen Reichs, wie er in den Wiener Verträgen von 1815 garantiert worden war, genommen. Ihr Land wurde in den russischen Gesamtstaat integriert und damit auch die Zollgrenzen entsprechend vorverlegt. Als Folge dieser Entwicklung wurde Kongreßpolen ein integraler Bestandteil des zarischen Zollgebietes, mit entsprechenden Auswirkungen auf die Ausrichtung seiner außenwirtschaftlichen Beziehungen.
f
Bereich des Möglichen gerückt. Hier wirken also rein ökonomisch determinierte Marktbeziehungen politisch zusammenschließend. Aber Deutschland ist entgegen den rein ökonomischen Determinanten politisch geeinigt. Derarti[228]ge Sachverhalte: daß die Grenzen einer politischen Gemeinschaft mit den rein geographisch gegebenen Standortsbedingungen im Konflikt liegen und ein nach ökonomischen Determinanten auseinanderstrebendes Gebiet umfassen, sind nichts Ungewöhnliches. Gegenüber den durch solche Situationen allerdings fast stets entstehenden ökonomischen Interessenspannungen ist das politische Band, wenn es einmal geschaffen ist, nicht immer, aber doch bei sonst günstigen Bedingungen (Sprachgemeinschaft), sehr oft so ungleich stärker, daß, wie z. B. in Deutschland, aus Anlaß jener Spannungen niemand an eine politische Trennung auch nur denkt. A: das
Und
g
so ist es auch nicht richtig, daß Großstaatenbildung immer auf den Bahnen des Güterexportes wandert, obwohl es uns heute, wo der Imperialismus (der kontinentale, russische und amerikanische, ebenso wie der überseeische: englische und diesem nachgebildete) regelmäßig, zumal in politisch schwachen Fremdgebieten, den Spuren schon vorhandener kapitalistischer Interessen folgt, naheliegt, die Dinge so anzusehen[,] und obwohl er natürlich wenigstens für die Bildung der großen überseeischen Herrschaftsgebiete der Vergangenheit: im athenischen wie im karthagischen und römischen Überseereich[,] seine maßgebende Rolle spielte. Aber schon in diesen antiken Staatenbildungen sind doch andere ökonomische Inter[A 622]essen: namentlich das Streben nach Grundrenten-, Steuerpacht-, Amtssportel- und ähnlichem Gewinne mindestens von gleicher, oft weit größerer Bedeutung wie Handelsgewinnste. Innerhalb dieses letzteren Motivs der Expansion wiederum tritt sehr stark zurück das, im modern-kapitalistischen Zeitalter, vorwaltend beherrschende „Absatz“-Interesse nach den Fremdgebieten gegenüber dem Interesse an dem Besitz von Gebieten, aus welchen Güter (Rohstoffe) in das Inland importiert werden. Bei den großen Flächenstaatenbildungen des Binnenlandes vollends war in der Vergangenheit eine maßgebende Rolle des Güterverkehrs durchaus nicht die Regel. Am stärksten bei den orientalischen Flußuferstaaten,[228]g–g(bis S. 231: den Kapitalismus direkt erstickte.) Petitdruck in A.
13
besonders Ägypten, die darin den Überseestaa[229]ten ähnlich geartet waren. Aber etwa das „Reich“ der Mongolen, – in welchem für die Zentralverwaltung die Beweglichkeit der herrschenden Reiterschicht die fehlenden sachlichen Verkehrsmittel ersetzte,[228] Gemeint sind neben Ägypten, dessen Kernland sich entlang des Nils über das von der Nilschwemme betroffene, landwirtschaftlich nutzbare Gebiet erstreckte, das babylonische Reich sowie dessen Nachfolgestaaten im Zweistromland zwischen Euphrat und Tigris.
14
– ruhte gewiß nicht auf intensivem Güterverkehr. Auch das chinesische wie das persische und das römische Reich der Kaiserzeit nach seinem Übergang vom Küsten- zum Kontinentalreich, erstanden und bestanden nicht auf der Basis eines schon früher vorhandenen besonders intensiven Güterbinnenverkehrs oder besonders hochentwickelter Verkehrsmittel. Die römische kontinentale Expansion war zwar sehr stark durch kapitalistische Interessen mitbedingt (nicht etwa: ausschließlich kapitalistisch bedingt). Aber diese kapitalistischen Interessen waren vor allem doch solche von Steuerpächtern, Amtsjägern und Bodenspekulanten, nicht aber in erster Linie von Interessenten eines besonders hochentwickelten Güterverkehrs. Der persischen Expansion haben überhaupt keinerlei „kapitalistische“ Interessenten weder als Triebkraft oder Schrittmacher gedient, ebensowenig wie den Schöpfern des Chinesenreichs, noch denen der Karolingermonarchie. Natürlich fehlte auch hier die wirtschaftliche Bedeutung des Güterverkehrs keineswegs überhaupt; aber andere Motive: Vermehrung der fürstlichen Einkünfte, Pfründen, Lehen, Ämter und soziale Ehren für die Lehensmannen, Ritter, Offiziere, Beamten, jüngeren Söhne von Erbbeamten usw. haben bei jeder politischen Binnenlandsexpansion der Vergangenheit und auch bei den Kreuzzügen mitgespielt. Die hier zwar nicht ausschlaggebend, aber allerdings bedeutend mitwirkenden Interessen der Seehandelsstädte traten erst sekundär hinzu: der erste Kreuzzug war dem Schwerpunkt nach eine Überlandkampagne.[229] Die mongolische Gesellschaftsordnung basierte auch nach der Auflösung der ursprünglichen Sippen- und Stammesstruktur und der Einführung neuer Verwaltungseinheiten (1000 Haushalte) durch Činggis Qan auf dem mobilen Hirtennomadentum. Die Führer der einzelnen Bezirke hatten sich bei wichtigen Entscheidungen an zentralen Orten einzufinden. Vor allem zur Wahl des Großkhans mußte sich die gesamte Führungsschicht versammeln.
15
Zur Deutung des ersten Kreuzzuges als Instrument zur Versorgung der europäischen Ritter mit Ländereien vgl. oben, S. 223, Anm. 3.
Der Güterverkehr hat jedenfalls keineswegs der Regel nach der politischen Expansion die Wege gewiesen. Die Kausalbeziehung ist sehr oft umgekehrt. Diejenigen von den genannten Reichen, deren [230]Verwaltung dazu technisch imstand war, haben ihrerseits sich die Verkehrsmittel, mindestens im Landverkehr, für die Zwecke ihrer Verwaltung erst geschaffen. Dem Prinzip nach nicht selten nur für diese Zwecke und ohne Rücksicht darauf, ob sie vorhandenen oder künftigen Bedürfnissen des Güterverkehrs zustatten kamen. Unter den heutigen Verhältnissen ist wohl Rußland dasjenige politische Gebilde, welches die meisten nicht primär ökonomisch, sondern politisch bedingten Verkehrsmittel (heute: Eisenbahnen) geschaffen hat.
16
Doch ist die österreichische Südbahn (ihre Papiere heißen noch immer, politisch erinnerungsbelastet: „Lombarden“)[230] Seit 1892 begann das zarische Rußland unter der Regierung des Grafen Witte überwiegend mit französischem Kapital den Ausbau der sogenannten Westbahnen, die in erster Linie militärischen Zwecken dienten. Für den Fall eines europäischen Krieges sollte die russische Mobilmachung beschleunigt werden. Besondere strategische Bedeutung hatte die zwischen 1891 und 1916 errichtete Transsibirische Eisenbahn für die Eingliederung Sibiriens in das russische Reich.
17
ebenfalls ein Beispiel, und gibt es wohl kein politisches Gebilde ohne „Militärbahnen“. Immerhin sind zwar größere derartige Leistungen doch auch zugleich in der Erwartung eines auf die Dauer ihre Rentabilität garantierenden Verkehrs geschaffen. In der Vergangenheit lag es nicht anders. Bei den altrömischen Militärstraßen ist ein Verkehrszweck mindestens nicht beweisbar, bei den persischen und römischen Posten aber, die nur politischen Zwecken dienten, war es ganz sicher nicht der Fall. Trotzdem war auch in der Vergangenheit die Entwicklung des Güterverkehrs natürlich die normale Folge der politischen Einigung, welche ihn erst unter eine sichere Rechtsgarantie stellte. Ausnahmslos aber ist auch diese Regel nicht. Denn die Entwicklung des Güterverkehrs ist außer an Befriedung und formale Rechtssicherheit, auch an bestimmte wirtschaftliche Bedingungen (speziell die Entfaltung des Kapitalismus) gebunden, und es ist nicht ausgeschlossen, daß diese Entfaltung durch die Art der Staatsverwaltung eines politischen Einheitsgebil[231]des geradezu unterbunden wird, wie dies z. B. im späteren Römerreich der Fall war. Das an die Stelle des Städtebundes tretende, auf stark naturalwirtschaftlicher Basis ruhende Einheitsgebilde bedingte hier eine zunehmend leiturgische Aufbringung der Mittel fürs Heer und die Verwaltung, welche den Kapitalismus direkt erstickte. 1856 wurde die Lombardisch-Venetianische Staatsbahn privatisiert und entwickelte sich zur größten Eisenbahngesellschaft der k.u.k. Monarchie. Von der Abtretung der Lombardei an das Königreich Sardinien blieb die Bahngesellschaft zunächst unberührt, bis 1862 eine Trennung in nationale Gesellschaften und die Umbennung in „k.u.k. private Südbahngesellschaft“ erfolgte. Während in Italien die ehemaligen Südbahnstrecken 1875 verstaatlicht wurden, bestand die österreichische Gesellschaft als bedeutendster privater Eisenbahnbetrieb der k.u.k. Monarchie bis nach dem Ersten Weltkrieg fort. In Erinnerung an die Geschichte der Gesellschaft und ihre Bedeutung für die habsburgische Herrschaft über die Lombardei wurden ihre Aktien an der Börse als „Lombarden“ bezeichnet.
g
[231] g(von S. 228: Und so ist es)–g Petitdruck in A.
Bildet also der Güterverkehr als solcher keineswegs das ausschlaggebende Moment bei politischen Expansionen, so ist die Struktur der Wirtschaft im allgemeinen doch sowohl für das Maß wie für die Art der politischen Expansion sehr stark mitbestimmend. „Urwüchsiges“ Objekt der gewaltsamen Aneignung ist – neben Weibern, Vieh und Sklaven – vor allem der Grund und Boden, sobald er knapp wird. Bei erobernden bäuerlichen Gemeinschaften ist die direkte Landnahme unter Aus[A 623]rottung der bisherigen bodensässigen Bevölkerung das Natürliche. Die germanische Völkerwanderung ist nur zu einem im ganzen mäßigen Teil so verlaufen, in geschlossener Masse wohl bis etwas über die heutige Sprachgrenze hinaus, im übrigen aber nur strichweise. Wie weit dabei eine durch Übervölkerung bedingte „Landnot“ mitsprach oder der politische Druck anderer Stämme oder einfach die gute Gelegenheit, muß dahingestellt bleiben: jedenfalls haben einzelne dieser zur Eroberung ausziehenden Gruppen sich noch lange Zeit hindurch ihre Fluranteilsrechte in der Heimat für den Fall der Heimkehr reservieren lassen. Der Grund und Boden des in mehr oder minder gewaltsamer Form politisch einverleibten, bis dahin fremden Gebietes spielt aber auch bei anderen ökonomischen Strukturformen eine bedeutende Rolle für die Art, wie das Recht des Siegers ausgenützt wird. Die Grundrente ist, wie namentlich Oppenheimer mit Recht immer wieder betont hat, sehr oft Produkt gewaltsamer politischer Unterwerfung.
18
Bei naturalwirtschaftlicher und zugleich feudaler Struktur natürlich in der Art, daß die Bauernschaft des einverleibten Gebiets nicht ausgerottet, sondern umgekehrt geschont und den Eroberern als Grundherren [232]zinspflichtig gemacht wird. Überall, wo das Heer nicht mehr ein auf Selbstausrüstung der Gemeinfreien gestellter Volksheerbann und noch nicht ein Sold- oder bürokratisches Massenheer, sondern ein auf Selbstausrüstung gestelltes Ritterheer ist: bei Persern, Arabern, Türken, Normannen und überhaupt okzidentalen Lehensmannen, ist dies geschehen. Aber auch bei handelsplutokratischen, erobernden Gemeinwesen bedeutet das Grundrenteninteresse überall sehr viel, denn da Handelsgewinnste mit Vorliebe in Grundbesitz und Schuldknechten „angelegt“ wurden, so war die Gewinnung von fruchtbarem, grundrentefähigem Boden noch in der Antike das normale Ziel der Kriege. Der in der hellenischen Frühgeschichte eine Art von Epoche markierende „lelantische“ Krieg wurde fast gänzlich zur See zwischen Handelsstädten geführt, Streitobjekt der führenden Patriziate von Chalkis und Eretria war aber ursprünglich die fruchtbare lelantische Flur.[231] Vgl. besonders Oppenheimer, Grossgrundeigentum, S. 10–42; ders., Der Staat, S. 104–108; ders., David Ricardos Grundrententheorie. Darstellung und Kritik. – Berlin: Georg Reimer 1909, S. 149–153; ders., Rodbertus’ Angriff auf Ricardos Renten-Theorie und der Lexis-Diehl’sche Rettungsversuch. – Berlin: Georg Reimer 1908, S. 4–5.
19
Der attische Seebund bot dem Demos der herrschenden Stadt neben Tributleistungen verschiedener Art als eins der wichtigsten Privilegien offenbar die Durchbrechung des Bodenmonopols der Untertanenstädte: das Recht der Athener, überall Boden zu erwerben und hypothekarisch zu beleihen.[232] Die antiken Geschichtsschreiber betrachteten den Krieg zwischen Chalkis und Eretria um die zwischen diesen Städten auf der Insel Euboia gelegene lelantische Ebene als epochales Ereignis, weil außer am trojanischen Krieg und an den Perserkriegen nur an diesem Konflikt der Großteil der griechischen Staaten beteiligt gewesen sein soll. Vgl. Thukydides, 1, 15. Wegen der schlechten Überlieferungslage sind sowohl die Datierung (Ende 8./Anfang 7. Jahrhundert v. Chr.) wie auch der Kriegsverlauf und die Kriegsziele umstritten. Die Interpretation als Wirtschaftskrieg war zu Webers Zeit anerkannte Forschungsmeinung. Die These, daß der Konflikt überwiegend als Seekrieg geführt wurde, konnte nicht nachgewiesen werden. In den Quellen finden sich hingegen besondere Regelungen für den Landkrieg (vertraglicher Verzicht auf den Gebrauch von Fernwaffen), Vgl. Strabo, 10, 1, 12.
20
In erster Linie das gleiche bedeutet, praktisch genommen, die Herstellung des „commercium“ In Athen wurden die Mitglieder des attischen Seebundes weniger als Bundesgenossen, sondern als Untertanen angesehen, die durch Garnisonen bzw. Kolonien kontrolliert werden mußten. Das Gebiet der Kolonien wurde zum attischen Staatsgebiet erklärt, in dem Vollbürger ebenso wie in Attika Land erwerben konnten. Seit 476 v. Chr. wurde neu gewonnenes Land aus dem Bund herausgelöst und für die Besiedlung durch attische Bürger freigegeben. Vgl. Meyer, Geschichte des Altertums, Band 4 (wie oben, S. 87, Anm. 15), S. 15–20.
21
verbündeter [233]Städte mit Rom, und auch die Überseeinteressen der im römischen Einflußgebiet massenhaft verbreiteten Italiker waren sicherlich zum Teil Bodeninteressen wesentlich kapitalistischer Art, wie wir sie aus den verrinischen Reden kennen. Das Commercium bezeichnet die Fähigkeit, nach römischem Recht gültige Handelsverträge abzuschließen und die daraus erzielten Gewinne zu behalten. Das Commercium stand jedem römischen Bürger zu, konnte allerdings als Bestrafung aberkannt werden. Bis in das 4. Jahrhundert v. Chr. erhielten nur latinische Gemeinden das Commercium; später wurde es auch an andere verbündete Städte vergeben.
22
Kapitalistische Bodeninteressen können mit den bäuerlichen bei der Expansion in Konflikt geraten. Ein solcher hat in der langen Epoche der Ständekämpfe in Rom bis zu den Gracchen[233] In den sogenannten verrinischen Reden aus dem Jahre 70 v. Chr. beschuldigte Cicero den ehemaligen Statthalter von Sizilien, Verres, des Amtsmißbrauchs. Verres habe während seiner 3jährigen Prätur über 40 Mio. Sesterzen veruntreut und dabei besonders die Landwirtschaft geschädigt. Cicero weist an mehreren Stellen darauf hin, daß gerade in Sizilien viele römische Bürger Land verpachtet hatten. Vgl. Cicero, Verres, II, 2, 6–7, 149, 155; II, 3, 11, 59–61, 95 f.
23
bei der Expansionspolitik seine Rolle gespielt: die großen Geld-, Vieh- und Menschenbesitzer wünschten den neu gewonnenen Boden naturgemäß als öffentliches pachtbares Land (ager publicus) behandelt zu sehen, die Bauern, solange es sich um nicht zu entlegene Gebiete handelte, verlangten seine Aufteilung für die Landversorgung ihres Nachwuchses; die starken Kompromisse beider Interessen spiegeln sich in der im einzelnen gewiß wenig zuverlässigen Tradition doch deutlich wider Als „Ständekämpfe'' bezeichnet die Literatur die Auseinandersetzungen zwischen Patriziern und Plebejern im 5.–4. Jahrhundert v. Chr., in deren Verlauf die Plebejer das Volkstribunat und die Volksversammlung als verfassungsrechtliche Organe und die Zulassung von Plebejern zu den höchsten Ämtern durchsetzten. Im 3. Jahrhundert v. Chr. setzte eine Verarmung der durch den Kriegsdienst belasteten Bauern ein, die gegen die Großgrundbesitzer nicht konkurrenzfähig waren, was sich wegen der Selbstausrüstung negativ auf die Rekrutierungsmöglichkeiten auswirkte. Diese Entwicklung versuchten Tiberius Gracchus und sein jüngerer Bruder Gaius als Volkstribunen in der Zeit von 133–121 v. Chr. durch eine Umverteilung des Staatslandes aufzuhalten.
h
. [233]A: wieder
Die überseeische Expansion Roms zeigt, soweit sie ökonomisch bedingt ist, Züge – und zwar in so ausgeprägter Art und zugleich so gewaltigem Maßstabe zum erstenmal in der Geschichte –, welche seitdem, in den Grundzügen ähnlich, immer wiederkehrten und noch heute wiederkehren. Sie sind einem, bei aller Flüssigkeit der Übergänge zu anderen Arten, dennoch spezifischen Typus kapitalistischer Beziehungen eigen, – oder vielmehr: sie bieten ihm die Existenzbedingungen, – den wir imperialistischen Kapitalismus nennen wollen. Es sind die kapitalistischen Interessen von Steuerpächtern, Staatsgläubigern, Staatslieferanten, staatlich privilegierten Außenhandelskapitalisten und Kolonialkapitalisten. Ihre Pro[234]fitchancen ruhen durchweg auf der direkten Ausbeutung politischer Zwangsgewalten, und zwar expansiv gerichteter Zwangsgewalt. Der Erwerb überseeischer „Kolonien“ seitens [A 624]einer politischen Gemeinschaft gibt kapitalistischen Interessenten gewaltige Gewinnchancen durch gewaltsame Versklavung oder doch glebae adscriptio
24
der Insassen zur Ausbeutung als Plantagenarbeitskräfte (in großem Maßstab anscheinend zuerst von den Karthagern organisiert, in ganz großem Stil zuletzt von den Spaniern in Südamerika, den Engländern in den amerikanischen Südstaaten und den Holländern in Indonesien), ferner zur gewaltsamen Monopolisierung des Handels mit diesen Kolonien und eventuell anderer Teile des Außenhandels. Die Steuern der neu okkupierten Gebiete geben, wo immer der eigene Apparat der politischen Gemeinschaft nicht zu ihrer Beitreibung geeignet ist – wovon später zu reden sein wird [234] Persönliche oder territoriale Gebundenheit der Bauern an den Boden.
25
–, kapitalistischen Steuerpächtern Gewinnchancen. Die gewaltsame Expansion durch Krieg und die Rüstungen dafür schaffen, vorausgesetzt, daß die sachlichen Betriebsmittel des Kriegs nicht, wie im reinen Feudalismus, durch Selbstausrüstung, sondern durch die politische Gemeinschaft als solche beschafft werden, den weitaus ergiebigsten Anlaß zur Inanspruchnahme von Kredit größten Umfangs und steigern die Gewinnchancen der kapitalistischen Staatsgläubiger, welche schon im zweiten punischen Kriege der römischen Politik ihre Bedingungen vorschrieben. Siehe WuG1, S. 656, 705, 728 f. (MWG I/22-4).
26
Oder, wo das endgültige Staatsgläubigertum eine Massenschicht von Staatsrentnern (Konsolbesitzern) Im 2. Punischen Krieg (218–201 v. Chr.) sahen sich die Römer zu bis dahin nicht gekannten Rüstungsanstrengungen gezwungen, die nicht mehr alleine durch staatliche Mittel zu finanzieren waren. Im Jahr 215 erklärten sich daher 19 Privatpersonen bereit, die auf der iberischen Halbinsel kämpfenden Truppen auszurüsten. Dafür wollten sie für die Dauer der Staatsanleihe vom Kriegsdienst befreit werden, und der Staat sollte für alle Verluste während des Transportes der Rüstungsgüter aufkommen. Vgl. Livius XXIII 49, 1–4.
27
geworden ist – der für die Gegenwart charakteristische Zustand –, schaffen sie die Chancen für die [235]„emittierenden“ Banken. Besitzer einer bestimmten Form von Staatsanleihen, die ihren Ursprung in Großbritannien hat. „Consols“ ist eine Abkürzung für „Consolidated stocks“, die der Konsolidierung kurzfristiger Staatsanleihen dienen. Als Tilgungsschuldverschreibungen ohne festen Rückzahlungstermin waren sie einer „ewigen Rente“ sehr nahe und wurden nur gering verzinst. In Preußen wurden sie 1869 eingeführt und später vor allem bei der Verstaatlichung der Eisenbahn ausgegeben.
28
In der gleichen Richtung liegen die Interessen der Lieferanten von Kriegsmaterial. Es werden dabei ökonomische Mächte ins Leben gerufen, welche an dem Entstehen kriegerischer Konflikte als solchen, einerlei welchen Ausgang sie für die eigene Gemeinschaft nehmen, interessiert sind. Schon Aristophanes scheidet die am Krieg von den am Frieden interessierten Gewerben,[235] Die eigentliche Emissionstätigkeit bezieht sich auf den „Einzelvertrieb von größeren Beständen von Wertpapieren“. Großaktionäre übertrugen den Verkauf häufig Banken, um so in kürzester Zeit über das in Aktien gebundene Kapital verfügen zu können. Die Banken ihrerseits gaben entweder eine Anleihe auf das Aktienpaket und erhielten für den Verkauf eine Provision oder sie übernahmen die Aktien zu einem festen Preis. Im ausgehenden 19. Jahrhundert zeigten die Banken wenig Interesse, ihr Geld fest anzulegen, und bemühten sich daher, entsprechende Wertpapiere schnell zu veräußern. Vgl. Lotz, Walther, Emissionsgeschäft, in: HdStW2, Band 3, 1900, S. 602–611.
29
obwohl – wie auch in seiner Aufzählung zum Ausdruck kommt – der Schwerpunkt wenigstens für das Landheer damals noch in der Selbstausrüstung und daher in Bestellungen der einzelnen Bürger beim Handwerker: Schwertfeger, Panzermacher usw. liegt. Schon damals aber sind die großen privaten Handelslager, die man oft als „Fabriken“ anspricht, vor allem Waffenlager. Heute ist der annähernd einzige Auftraggeber für Kriegsmaterial und Kriegsmaschinen die politische Gemeinschaft als solche, und das steigert deren In der Komödie „Frieden“ wird die verborgene Friedensgöttin aus ihrem unterirdischen Versteck befreit. Bei der Beschreibung der Ausgrabungsarbeiten zählt Aristophanes Berufsgruppen auf, die die Arbeit fördern bzw. behindern. Später bedanken bzw. beschweren sich weitere Berufsgruppen bei der Hauptfigur wegen der Wiederherstellung des Friedens. Nach Aristophanes begrüßen Bauern, Händler, Künstler und verschiedene Handwerker den Frieden, während Waffenschmiede und -händler ihn ablehnen. Vgl. Aristophanes, Frieden, 295–297, 447 f., 480, 511, 545–550, 1199–1265.
i
kapitalistischen Charakter. Banken, welche Kriegsanleihen finanzieren, und heute große Teile der schweren Industrie, nicht nur die direkten Lieferanten von Panzerplatten und Geschützen, sind am Kriegführen quand même ökonomisch interessiert; ein verlorener Krieg bringt ihnen erhöhte Inanspruchnahme so gut wie ein gewonnener, und das eigene politische und ökonomische Interesse der an einer politischen Gemeinschaft Beteiligten an der Existenz großer inländischer Fabriken von Kriegsmaschinen nötigt sie, zu dulden, daß diese die ganze Welt, auch die politischen Gegner, mit solchen versorgen. [235]A: den
[236]Welche ökonomischen Gegengewichte die imperialistischen kapitalistischen Interessen finden, hängt – soweit dabei direkt rein kapitalistische Motive mitspielen – vor allem von dem Verhältnis der Rentabilität der ersteren zu den pazifistisch gerichteten kapitalistischen Interessen ab, und dies wieder steht mit dem Verhältnis zwischen gemeinwirtschaftlicher und privatwirtschaftlicher Bedarfsdeckung in engem Zusammenhang. Diese ist daher auch für die Art der von den politischen Gemeinschaften gestützten ökonomischen Expansionstendenzen in hohem Maße bestimmend. Der imperialistische Kapitalismus, zumal koloniale Beutekapitalismus auf der Grundlage direkter Gewalt und Zwangsarbeit, hat im allgemeinen zu allen Zeiten die weitaus größten Gewinnchancen geboten, weit größer, als, normalerweise, der auf friedlichen Austausch mit den Angehörigen anderer politischer Gemeinschaften gerichtete Exportgewerbebetrieb. Daher hat es ihn zu allen Zeiten und überall gegeben, wo irgendwelches erhebliche Maß von gemeinwirtschaftlicher Bedarfsdeckung durch die politische Gemeinschaft als solche oder ihre Unterabteilungen (Gemeinden) bestand. Je stärker diese, desto größer die Bedeutung des imperialistischen Kapitalismus. Verdienstchancen im politischen „Ausland“, zumal in Gebieten, welche politisch und ökonomisch neu „erschlossen“, d. h. in die spezifisch [A 625]modernen Organisationsformen der öffentlichen und privaten „Betriebe“ gebracht werden, entstehen heute wieder zunehmend in „Staatsaufträgen“ für Waffen, von der politischen Gemeinschaft besorgten oder mit Monopolen ausgestatteten Eisenbahn- und anderen Bauten, monopolistischen Abgabe-, Handels- und Gewerbeorganisationen und -konzessionen, Staatsanleihen. Das Vorwiegen derartiger Verdienstchancen steigert sich, auf Kosten der durch den gewöhnlichen privaten Güteraustausch zu erzielenden Gewinne, zunehmend mit zunehmender Bedeutung der Gemeinwirtschaft als Bedarfsdeckungsform überhaupt. Und durchaus parallel damit geht die Tendenz der politisch gestützten ökonomischen Expansion und des Wettbewerbs der einzelnen politischen Gemeinschaften, deren Beteiligte anlagefähiges Kapital zur Verfügung haben, dahin, sich derartige Monopole und Beteiligungen an „Staatsaufträgen“ zu verschaffen[,] und tritt die Bedeutung der bloßen „offenen Tür“ für den privaten Güterimport in den Hintergrund.
30
Da [237]nun die sicherste Garantie für die Monopolisierung dieser an der Gemeinwirtschaft des fremden Gebiets klebenden Gewinnchancen zugunsten der eigenen politischen Gemeinschaftsgenossen die politische Okkupation oder doch die Unterwerfung der fremden politischen Gewalt in der Form des „Protektorats“ oder ähnlicher ist, so tritt auch diese „imperialistische“ Richtung der Expansion wieder zunehmend an die Stelle der pazifistischen, nur „Handelsfreiheit“ erstrebenden. Diese gewann nur so lange die Oberhand[,] als die privatwirtschaftliche Organisation der Bedarfsdeckung auch das Optimum der kapitalistischen Gewinnchancen nach der Seite des friedlichen, nicht – wenigstens nicht durch politische Gewalt – monopolisierten Güteraustauschs verschoben hatte. Das universelle Wiederaufleben des „imperialistischen“ Kapitalismus, welcher von jeher die normale Form der Wirkung kapitalistischer Interessen auf die Politik war, und mit ihr des politischen Expansionsdrangs, ist also kein Zufallsprodukt und für absehbare Zeit muß die Prognose zu seinen Gunsten lauten. [236] Unter der Politik der „Offenen Tür“ wurde der freie Zugang der industrialisierten Staa[237]ten zu den Märkten in unterentwickelten Ländern verstanden. 1885 vereinbarten die Großmächte, daß der Kongostaat Leopolds II. ein international neutralisiertes Gebiet werden solle, unter der Bedingung, daß dieser den freien Zugang für den Handel aller Industriestaaten gewährte. Analoge Vereinbarungen wurden für China und das Osmanische Reich getroffen.
Diese Situation würde sich schwerlich grundsätzlich ändern, wenn wir für einen Augenblick als gedankliches Experiment die einzelnen politischen Gemeinschaften als irgendwie „staatssozialistische“, d. h. ein Maximum von ökonomischem Bedarf gemeinwirtschaftlich deckende Verbände denken. Jeder solche politische Gemeinwirtschaftsverband würde im „internationalen“ Austausch diejenigen unentbehrlichen Güter, welche in seinem Gebiet nicht erzeugt werden (in Deutschland z. B.: Baumwolle), so billig wie möglich von denjenigen zu erwerben suchen, die ein natürliches Monopol ihres Besitzes haben und auszunützen trachten würden, und keinerlei Wahrscheinlichkeit spricht dafür, daß, wo Gewalt am leichtesten zu günstigen Tauschbedingungen führen würde, sie nicht angewendet würde. Dadurch entstünde eine, wenn nicht formelle, doch tatsächliche Tributpflicht des Schwächeren, und es ist übrigens auch nicht abzusehen, warum die stärksten staatssozialistischen Gemeinschaften es verschmähen sollten, für ihre Teilhaber von schwächeren Gemeinschaften auch ganz ausdrückliche Tribu[238]te, ganz wie es in der frühen Vergangenheit überall geschah, zu erpressen, wo sie könnten. Die „Masse“ der Teilhaber einer politischen Gemeinschaft ist auch ohne „Staatssozialismus“ ökonomisch so wenig notwendig pazifistisch interessiert, wie irgendeine Einzelschicht. Der attische Demos – und nicht nur er – lebte ökonomisch vom Krieg, der ihm Sold und, im Fall des Sieges, Tribute der Untertanen einbrachte, welche faktisch in der kaum verhüllenden Form von Präsenzgeldern bei Volksversammlungen, Gerichtsverhandlungen und öffentlichen Festen unter die Vollbürger verteilt wurden.
31
Hier war das Interesse an imperialistischer Politik und Macht jedem Vollbürger handgreiflich. Die heutigen, von außerhalb einer politischen Gemeinschaft an deren Beteiligte fließenden Erträgnisse, auch diejenigen imperialistischen Ursprungs und faktisch „Tribut“artigen Charakters, ergeben eine so handgreifliche Interessenkonstellation für die Massen nicht. Denn die Tribute an die „Gläubigervölker“ erfolgen unter der heutigen Wirtschaftsordnung in der Form der Abführung von ausländischen Schuldzinsen oder Kapitalgewinnsten an die besitzenden Schichten des „Gläubigervolks“. Dächte [A 626]man sich diese Tribute gestrichen, so bedeutete das einen immerhin für Länder wie etwa England, Frankreich, Deutschland sehr fühlbaren Rückgang der Kaufkraft auch für Inlandsprodukte, welcher den Arbeitsmarkt zu ungunsten der betreffenden Arbeiter beeinflussen würde. Wenn trotzdem die Arbeiterschaft auch in Gläubigerstaaten in sehr starkem Maße pazifistisch gesonnen ist und insbesondere an dem Fortbestand und der zwangsweisen Beitreibung solcher Tribute von ausländischen zahlungssäumigen Schuldnergemeinschaften oder der Erzwingung der Anteilnahme an der Ausbeutung[238] In Athen galt jeder Einwohner über 18, dessen Vater (seit 451 v. Chr. beide Elternteile) attischer Bürger war, als Vollbürger, der zu fast allen staatlichen Aufgaben herangezogen werden konnte und dafür teilweise ein Entgelt erhielt. Neben den Vollbürgern gab es Personenkreise (z. B. Freigelassene), die zwar im Privatrecht gleichgestellt waren, aber keinerlei Ämter ausüben durften, und somit auch keine staatliche Entlohnung erhielten. Vgl. auch oben, S. 87, Anm. 15.
j
fremder Kolonialgebiete und Staatsaufträge meist keinerlei Interesse zeigt, so ist dies einerseits ein naturgemäßes Produkt der unmittelbaren Klassenlage und der sozialen und politischen Situation innerhalb der Gemeinschaften [239]in einer kapitalistischen Wirtschaftsepoche. Die Tributberechtigten gehören der gegnerischen Klasse an, welche zugleich die politische Gemeinschaft beherrscht, und jede erfolgreiche imperialistische Zwangspolitik nach außen stärkt normalerweise mindestens zunächst auch „im Innern“ das Prestige und damit die Machtstellung und den Einfluß derjenigen Klassen, Stände, Parteien, unter deren Führung der Erfolg errungen ist. Zu diesen mehr durch die soziale und politische Konstellation bedingten Quellen von pazifistischen Sympathien treten bei den „Massen“, zumal den proletarischen, ökonomische. Jede Anlage von Kapitalien in der Kriegsmaschinen- und Kriegsmaterialproduktion schafft zwar Arbeits- und Erwerbsgelegenheit, jede Staatsinstanz kann im Einzelfall ein Element direkter Konjunkturbesserung und erst recht indirekt durch Steigerung der Intensität des Erwerbsstrebens und durch Nachfragesteigerung eine Quelle gesteigerter Zuversicht in die ökonomischen Chancen der beteiligten Industrien und also einer Haussestimmung werden. Aber sie entzieht die Kapitalien anderen Verwendungsarten und erschwert die Bedarfsdeckung auf anderen Gebieten, und vor allem werden die Mittel in Form von Zwangsabgaben aufgebracht, welche – ganz abgesehen von den durch „merkantilistische“ Rücksichten gegebenen Schranken der Heranziehung des Besitzes – die herrschenden Schichten normalerweise kraft ihrer sozialen und politischen Macht auf die Massen abzuwälzen verstehen. Die mit Militärkosten wenig belasteten Länder (Amerika), namentlich auch die Kleinstaaten[,] haben nicht selten eine, relativ gemessen, stärkere ökonomische Expansion ihrer Angehörigen – so die Schweizer – als Großmachtgebilde und werden außerdem zuweilen leichter zur ökonomischen Ausbeutung des Auslandes zugelassen, weil ihnen gegenüber nicht die Befürchtung besteht, daß die politische der ökonomischen Einmischung folgen werde. Wenn die pazifistischen Interessen der kleinbürgerlichen und proletarischen Schichten trotz allem erfahrungsgemäß sehr oft und leicht versagen, so liegen – wenn wir von besonderen Fällen, wie der Hoffnung auf den Erwerb von Auswanderungsgebieten in übervölkerten Ländern absehen – die Gründe teils in der stärkeren Zugänglichkeit jeder nicht organisierten „Masse“ für Emotionen, teils in der unbestimmten Vorstellung von irgendwelchen, durch den Krieg entstehenden, unerwarteten Chancen, teils in dem Umstand, daß die „Massen“ im Gegensatz zu anderen Interessenten [240]subjektiv weniger auf das Spiel setzen. „Monarchen“ haben für ihren Thron einen verlorenen Krieg, die Machthaber und Interessenten einer „republikanischen Verfassung“ umgekehrt einen siegreichen „General“ zu fürchten, die Überzahl des besitzenden Bürgertums ökonomische Verluste infolge der Hemmung der Erwerbsarbeit, die herrschende Honoratiorenschicht unter Umständen eine gewaltsame Machtumstellung zugunsten der Besitzlosen im Fall einer Desorganisation durch Niederlage, die „Massen“ als solche, wenigstens in ihrer subjektiven Vorstellung, nichts direkt Greifbares außer äußerstenfalls dem Leben selbst, eine Gefährdung, deren Einschätzung und Wirkung eine gerade in ihrer Vorstellung stark schwankende Größe darstellt und durch emotionale Beeinflussung im ganzen leicht auf Null reduzierbar ist.[238]A: Ausbietung
k
[240] In A folgt die Zwischenüberschrift: § 3. Die „Nation“.
[Α 627]Das Pathos dieser emotionalen Beeinflussung aber ist dem Schwerpunkt nach nicht ökonomischen Ursprungs, sondern ruht auf dem Prestige-Empfinden, welches bei politischen Bildungen mit Erringen einer an Machtstellung reichen Geschichte oft tief in die kleinbürgerlichen Massen hinabreicht. Das Attachement an das politische
l
Prestige kann sich mit einem spezifischen Glauben an eine dem Großmachtgebilde als solchem eignenden Verantwortlichkeit vor den Nachfahren für die Art der Verteilung von Macht und Prestige zwischen den eigenen und fremden politischen Gemeinschaften vermählen. Es ist selbstverständlich, daß überall diejenigen Gruppen, welche innerhalb einer politischen Gemeinschaft sich im Besitze der Macht, das Gemeinschaftshandeln zu lenken, befinden, sich am stärksten mit diesem idealen Pathos des Macht-Prestiges erfüllen und die spezifischen und verläßlichsten Träger einer „Staats“-Idee als der Idee eines unbedingte Hingabe fordernden imperialistischen Machtgebildes bleiben. Ihnen zur Seite treten, außer den schon erörtertenA: all des politischen
32
direkt materiellen imperialistischen Interessen, die teils indirekt materiellen, teils ideellen Interessen der innerhalb eines politischen Gebildes und durch dessen Existenz irgendwie ideell privilegierten Schichten. Das sind vor allem diejenigen, welche sich als spezifische „Teilhaber“ einer spezifi[241]schen „Kultur“ fühlen, welche im Kreise der an einem politischen Gebilde Beteiligten verbreitet ist. Das nackte Prestige der „Macht“ wandelt sich jedoch unter dem Einfluß dieser Kreise unvermeidlich in andere, spezifische Formen ab, und zwar in die Idee der „Nation“. [240] Siehe oben, S. 231–235.
„Nation“ ist ein Begriff, der, wenn überhaupt eindeutig, dann jedenfalls nicht nach empirischen gemeinsamen Qualitäten der ihr Zugerechneten definiert werden kann. Er besagt, im Sinne derer, die ihn jeweilig brauchen, zunächst unzweifelhaft: daß gewissen Menschengruppen ein spezifisches Solidaritätsempfinden anderen gegenüber zuzumuten sei, gehört also der Wertsphäre an. Weder darüber aber, wie jene Gruppen abzugrenzen seien, noch darüber, welches Gemeinschaftshandeln aus jener Solidarität zu resultieren habe, herrscht Übereinstimmung. „Nation“ im üblichen Sprachgebrauch ist zunächst nicht identisch mit „Staatsvolk“, d. h. der jeweiligen Zugehörigkeit einer politischen Gemeinschaft. Denn zahlreiche politische Gemeinschaften (so Österreich)
m
umfassen Menschengruppen, aus deren Kreisen emphatisch die Selbständigkeit ihrer „Nation“ den anderen Gruppen gegenüber betont wird oder andererseits Teile einer von den Beteiligten als einheitliche „Nation“ hingestellten Menschengruppe (so ebenfalls Österreich).[241] In A bindet die Anmerkung der Erstherausgeber an: 1) Österreich vor 1918. (Anm. d. Herausgeb.)
33
Sie ist ferner nicht identisch mit Sprachgemeinschaft, denn diese genügt keineswegs immer (wie bei Serben und Kroaten, Amerikanern, Iren und Engländern), sie scheint andererseits nicht unbedingt erforderlich (man findet den Ausdruck „Schweizer Nation“ auch in offiziellen Akten neben „Schweizer Volk“),[241] Dies bezieht sich auf die nationalen Emanzipationsbewegungen der slawischen Bevölkerungsgruppen innerhalb der Donaumonarchie, insbesondere die Tschechen, Serben und galizischen Polen.
34
und manche Sprachgemeinschaften empfinden sich nicht als gesonderte „Nati[242]on“ (so, wenigstens bis vor kurzem, etwa die Weißrussen). Auf welche Akten hier speziell Bezug genommen wird, konnte nicht ermittelt werden. Die Begriffe „schweizerische Nation“ und „schweizerisches Volk“ finden sich häufig in offiziellen Dokumenten der Schweiz in nahezu synonymem Gebrauch. Vgl. z. B. Bundesverfassung der schweizerischen Eidgenossenschaft, vom 12. Herbstmonat 1848, in: Offizielle Sammlung der das schweizerische Staatsrecht betreffenden Aktenstücke, Bundesgesetze, Verträge und Verordnungen, seit der Einführung der neuen Bundesverfassung vom 12. September 1848 bis 8. Mai 1850, 2. Aufl. – Bern: Stämpflische Buchdruckerei 1850, S. 3 ff.
35
Allerdings pflegt die Prätension, als besondere „Nation“ zu gelten, besonders regelmäßig an das Massenkulturgut der Sprachgemeinschaft anzuknüpfen (so ganz überwiegend in dem klassischen Land der Sprachenkämpfe: Österreich[242] Nach der Niederschlagung des polnischen Aufstandes von 1863, an dem sich auch der polnisch-stämmige Landadel in Weißrußland sowie weißrussische bürgerliche Kreise beteiligt hatten, erfolgte 1867 ein Verbot von weißrussischen Publikationen. In den 1870er Jahren begannen weißrussische Studenten in den Städten nationalistische Zirkel aufzubauen, die aber alle ohne Einfluß blieben. Die Hauptträger des aufkeimenden Nationalismus waren Literaten und Intellektuelle. Erst 1902 entstand mit der „Weißrussischen Sozialistischen Partei“ (BSH) eine politische Organisation, die den weißrussischen Nationalismus nach außen vertrat und bis zur Oktoberrevolution 1917 der Hauptträger der Autonomiebestrebungen war. Dabei stützte sich die Partei vor allem auf das städtische Bürgertum, da der Landadel überwiegend polonisiert bzw. russifiziert war.
36
und ebenso in Rußland und im östlichen Preußen), Zu den Badenischen Sprachenverordnungen und den Sprachenkämpfen in Österreich vgl. oben, S. 186, Anm. 33.
37
aber sehr verschieden intensiv (z. B. mit sehr geringer Intensität in Amerika und Kanada). Aber ebenso kann auch den Sprachgenossen gegenüber die „nationale“ Zusammengehörigkeit abgelehnt und dafür an Unterschiede des anderen großen „Massenkulturguts“: der Konfession (so bei Serben und Kroaten), In den polnischen Gebieten Preußens gingen die preußische Regierung und die Reichsleitung seit 1881 unter dem Druck der öffentlichen Meinung, die sich der Idee eines kulturell und ethnisch homogenen Nationalstaates verschrieben hatte, schrittweise zu einer Politik der Germanisierung der polnischen Bevölkerung über, die mit der Ansiedlungspolitik und der Verschärfung der Sprachenpolitik 1906 einen Höhepunkt erreichte. Im Gegenzug entwickelte sich unter den in den östlichen Gebieten Preußens lebenden Polen eine aktive nationalpolnische Bewegung.
38
ferner an Differenzen der sozialen Struktur und der Sitten (so bei den Deutschschweizern und Elsässern gegenüber den Reichsdeutschen, bei den Iren gegenüber den Engländern), also an „ethnische“ Elemente, vor allem aber an Erinnerungen an politische Schicksalsgemeinschaft mit anderen [A 628]Nationen (bei den Elsässern mit den Franzosen seit dem Revolutionskriege, welche ihr gemeinsames Heldenzeitalter ist, wie bei den Balten mit den Russen, deren politische Geschicke sie mitgelenkt haben) angeknüpft werden. Daß „nationale“ Zugehörigkeit nicht auf realer Blutsgemeinschaft ruhen muß, versteht sich vollends von selbst: überall sind gerade besonders radikale „Nationalisten“ oft von fremder [243]Abstammung. Und vollends ist Gemeinsamkeit eines spezifischen anthropologischen Typus zwar nicht einfach gleichgültig, aber weder ausreichend zur Begründung einer „Nation“ noch auch dazu erforderlich. Wenn gleichwohl die Idee der „Nation“ gern die Vorstellung der Abstammungsgemeinschaft und einer Wesensähnlichkeit (unbestimmten Inhalts) einschließt, so teilt sie das mit dem – wie wir sahen Während die Serben in ihrer Mehrheit dem griechisch-orthodoxen Glauben anhängen, gehören die meisten Kroaten der römisch-katholischen Kirche an.
n
[243] In A bindet die Anmerkung der Erstherausgeber an: 1) Vgl. oben Kap. III.
39
– ebenfalls aus verschiedenen Quellen gespeisten „ethnischen“ Gemeinsamkeitsgefühl. Aber ethnisches Gemeinsamkeitsgefühl allein macht noch keine „Nation“. „Ethnisches“ Zusammengehörigkeitsgefühl haben auch die Weißrussen den Großrussen gegenüber zweifellos immer gehabt, aber das Prädikat einer besonderen „Nation“ würden sie selbst jetzt schwerlich für sich in Anspruch nehmen. Die Teilnahme für die Idee eines Zusammengehörigkeitsgefühls mit der „polnischen Nation“ fehlte den Polen Oberschlesiens bis vor nicht allzulanger Zeit fast ganz: sie fühlten sich als „ethnische“ Sondergemeinschaft[243] Siehe oben, S. 174–176.
o
gegenüber den Deutschen, waren aber preußische Untertanen und weiter nichts. Das Problem, ob wir die Juden als „Nation“ bezeichnen dürfen, ist alt; es würde meist negativ, jedenfalls aber nach Art und Maß verschieden beantwortet werden von der Masse der russischen Juden, den sich assimilierenden westeuropäisch-amerikanischen Juden, den Zionisten und vor allem sehr verschieden auch von den Umweltvölkern: z. B. den Russen einerseits, den Amerikanern (wenigstens denjenigen, die noch heute wie ein amerikanischer Präsident in einem offiziellen Schriftstück an der „Wesensähnlichkeit“ amerikanischer und jüdischer Art festhalten)A: Sondergemeinsamkeit
40
andererseits. Und dieje[244]nigen deutschredenden Elsässer, welche die Zugehörigkeit zur deutschen „Nation“ ablehnen und die Erinnerung an die politische Gemeinschaft mit Frankreich pflegen, rechnen sich deshalb doch nicht schlechtweg zur französischen „Nation“ Auf welches Schriftstück sich dies bezieht, konnte nicht eindeutig nachgewiesen werden. Nach dem Judenpogrom in der russischen Stadt Kischinev im April 1903 begann auf Druck der amerikanischen Öffentlichkeit ein diplomatischer Schriftwechsel zwischen den USA und Rußland, in dessen Verlauf der US-Botschafter in Sankt Petersburg McCormick den russischen Außenminister Lamsdorff am 22. August 1904 von der Entschließung des Repräsentantenhauses unterrichtet hat, daß Verhandlungen über die ungehinderte Reisemöglichkeit amerikanischer Bürger geführt werden sollen. In diesem Schreiben wird Präsident Roosevelt in bezug auf amerikanische Juden mit den Worten zitiert: „Whose intelligence and sterling moral qualities fit them to be typical repräsentatives of our people […]“. Siehe: Papers relating to the Foreign Relations of the United States, with the Annual Message of the President. – Washington: Government Printing Office 1905, S. 792.
41
Die Neger der Vereinigten Staaten werden sich selbst, zur Zeit wenigstens, zur amerikanischen „Nation“ rechnen, schwerlich aber jemals von den südstaatlichen Weißen dazu gezählt werden.[244] Vgl. den Text „Ethnische Gemeinschaften“, oben, S. 186 f.
42
Den Chinesen sprachen noch vor 15 Jahren gute Kenner des Ostens die Qualität der „Nation“ ab: sie seien nur eine „Rasse“; heute würde das Urteil nicht nur der führenden chinesischen Politiker, sondern auch ganz derselben Beobachter anders lauten, Zur Rassentrennung in den amerikanischen Südstaaten vgl. oben, S. 169, Anm. 1.
43
und es scheint also, daß eine Menschengruppe die Qualität als „Nation“ unter Umständen durch ein spezifisches Verhalten „erringen“ oder als „Errungenschaft“ in Anspruch nehmen kann, und zwar innerhalb kurzer Zeitspannen. Und andererseits finden sich Menschengruppen, welche nicht nur die Indifferenz, sondern direkt die Abstreifung der Bewertung der Zugehörigkeit zu einer einzelnen „Nation“ als „Errungenschaft“ in Anspruch nehmen, in der Gegenwart vor allem gewisse führende Schichten der Klassenbewegung des modernen Proletariats, mit übrigens je nach der politischen und sprachlichen Zugehörigkeit, und auch je nach den Schichten des Proletariats sehr verschiedenem, zur Zeit im ganzen eher wieder abnehmendem Erfolg. Nach dem verlorenen Krieg gegen Japan 1894 entstand in China eine Reformbewegung, deren Ziel es war, moderne westliche Staatsvorstellungen mit dem traditionellen chinesischen Konfuzianismus zu verbinden. Aus europäischer Sicht schufen diese Reformen die Voraussetzungen für eine chinesische Nationsbildung. Vgl. Franke, Ostasiatische Neubildungen (wie oben, S. 218, Anm. 2), S. 7, 41.
Zwischen der emphatischen Bejahung, emphatischen Ablehnung und endlich völliger Indifferenz gegenüber der Idee der „Nation“ (wie sie etwa der Luxemburger haben dürfte und wie sie den national „unerweckten“ Völkern eignet), steht eine lückenlose Stufenfolge sehr verschiedenen und höchst wandelbaren Verhaltens zu ihr bei den sozialen Schichten auch innerhalb der einzelnen Gruppe, denen der Sprachgebrauch die Qualität von „Nationen“ zuschreibt. Feudale Schichten, Beamtenschichten, erwerbstätiges [245]„Bürgertum“ der untereinander verschiedenen Kategorien, „Intellektuellen“-Schichten
p
verhalten sich weder gleichmäßig noch historisch kon[A 629]stant dazu. Nicht nur die Gründe, auf welche der Glaube, eine eigene „Nation“ darzustellen, gestützt wird, sondern auch dasjenige empirische Verhalten, welches aus der Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit zur „Nation“ in der Realität folgt, ist qualitativ höchst verschieden. Das „Nationalgefühl“ des Deutschen, Engländers, Amerikaners, Spaniers, Franzosen, Russen funktioniert nicht gleichartig. So – um den einfachsten Sachverhalt herauszugreifen – im Verhältnis zum politischen Verband, mit dessen empirischem Umfang die „Idee“ der „Nation“ in Widerspruch geraten kann. Dieser Widerspruch kann sehr verschiedene Folgen haben. Die Italiener im österreichischen Staatsverband würden sicherlich nur gezwungen gegen italienische Truppen fechten, große Teile der Deutschösterreicher heute nur mit äußerstem Widerstreben und ohne Verläßlichkeit gegen Deutschland, auch die ihre „Nationalität“ am meisten Hochhaltenden unter[245]A: „Intellektuellen“ Schichten
q
den Deutschamerikanern dagegen – wenn auch nicht gern, so doch gegebenenfalls – bedingungslos gegen Deutschland, die Polen im deutschen Staatsverband wohl gegen ein russisch-polnisches, schwerlich aber gegen ein autonom polnisches Heer, die österreichischen Serben mit sehr geteilten Gefühlen und nur in der Hoffnung auf Erreichung gemeinsamer Autonomie gegen Serbien, die russischen Polen verläßlicher gegen ein deutsches, als gegen ein österreichisches Heer. Daß innerhalb der gleichen „Nation“ die Intensität des Solidaritätsgefühls nach außen höchst verschieden stark und wandelbar ist, gehört zu den historisch bekanntesten Tatsachen. Im ganzen ist es gestiegen, auch wo die inneren Interessengegensätze nicht abgenommen haben. Die „Kreuzzeitung“ rief vor 60 Jahren noch die Intervention des Kaisers von Rußland in innerdeutsche Fragen an,A: von
44
was heute trotz gesteigerter Klassengegensätze schwer denk[246]bar wäre. Jedenfalls sind die Unterschiede sehr bedeutende und flüssige, und ähnlich findet auf allen anderen Gebieten die Frage: welche Konsequenzen eine Menschengruppe aus dem innerhalb ihrer mit noch so emphatisch und subjektiv aufrichtigem Pathos verbreiteten „Nationalgefühl“ für die Entwicklung der Art eines spezifischen Gemeinschaftshandelns zu ziehen bereit ist, grundverschiedene Antworten. Das Maß, in welchem eine „Sitte“, korrekter: eine Konvention als „national“ in der Diaspora festgehalten wird, ist ebenso verschieden wie die Bedeutung der Gemeinsamkeit von Konventionen es für den Glauben an den Bestand als einer gesonderten „Nation“ ist. Eine soziologische Kasuistik müßte, dem empirisch gänzlich vieldeutigen Wertbegriff „Idee der Nation“ gegenüber, alle einzelnen Arten von Gemeinsamkeits- und Solidaritäts-Empfindungen in ihren Entstehungsbedingungen und ihren Konsequenzen für das Gemeinschaftshandeln der Beteiligten entwickeln. [245] Die preußischen Konservativen wandten sich 1850 gegen die von General Joseph von Radowitz betriebene österreichfeindliche Unionspolitik Preußens, da sie befürchteten, daß die Liberalen von einer Konfrontation zwischen Preußen und Österreich profitieren könnten. Anläßlich der Zusammenkunft der Unionsvertreter in Erfurt im Frühjahr 1850 hofften sie, Nikolaus I. würde auch in diesem Konflikt – wie schon im Vorjahr in Ungarn – zugunsten der österreichischen Monarchie eingreifen. In der politischen Rundschau der [246]Kreuzzeitung hieß es: „Es ist wahrhaft patriotisch, es ist wahrhaft deutsch, lieber vom Kaiser Nicolaus befreit, als von Hecker und Struve, von Waldeck und Held, von Voigt und Ruge geknechtet zu werden.“ Neue Preußische Zeitung, Nr. 97 vom 30. April 1850, S. 1.
Das kann hier nicht versucht werden. Statt dessen ist hier noch etwas näher darauf einzugehen, daß die Idee der „Nation“ bei ihren Trägern in sehr intimen Beziehungen zu „Prestige“-Interessen steht. In ihren frühesten und energischsten Äußerungen hat sie, in irgendeiner, sei es auch verhüllten Form, die Legende von einer providentiellen „Mission“ enthalten, welche auf sich zu nehmen denen zugemutet wurde, an welche sich das Pathos ihrer Vertreter wendete, und die Vorstellung, daß diese Mission gerade durch die Pflege der individuellen Eigenart der als „Nation“ besonderten Gruppe und nur durch sie ermöglicht werde. Mithin kann diese Mission – sofern sie sich selbst durch den Wert ihres Inhaltes zu rechtfertigen sucht – nur als eine spezifische „Kultur“-Mission konsequent vorgestellt werden. Die Überlegenheit oder doch die Unersetzlichkeit der nur kraft der Pflege der Eigenart zu bewahrenden und zu entwickelnden „Kulturgüter“ ist es denn, an welcher die Bedeutsamkeit der „Nation“ verankert zu werden pflegt, und es ist daher selbstverständlich, daß, wie die in der politischen Gemeinschaft Mächtigen die Staatsidee provozieren, so diejenigen, welche innerhalb einer „Kulturgemeinschaft“, das soll hier heißen: [247]einer Gruppe von Menschen, welchen kraft ihrer Eigenart bestimmte, als „Kulturgüter“ geltende Leistungen in spezifischer Art zugänglich sind, die Führung usurpieren: die „Intellektuellen“ also, wie wir sie vorläufig genannt haben,
45
[A 630]in spezifischem Maße dazu prädestiniert sind, die „nationale“ Idee zu propagieren. Dann nämlich, wenn jene Kulturträger [247] Siehe oben, S. 245.
[Notiz im Manuskript]
Kultur-Prestige und Macht-Prestige sind eng verbündet. Jeder siegreiche Krieg fördert das Kultur-Prestige. (Deutschland, Japan usw.)
Kultur-Prestige und Macht-Prestige sind eng verbündet. Jeder siegreiche Krieg fördert das Kultur-Prestige. (Deutschland, Japan usw.)
46
Ob er der „Kulturentwicklung“ zu gute kommt[,] ist eine andre, nicht mehr „wertfrei“ zu lösende Frage. Sicher nicht eindeutig (Deutschland nach 1870!). Auch nach empirisch greifbaren Merkmalen nicht: Reine Kunst und Literatur von deutscher Eigenart sind nicht im politischen Zentrum Deutschlands entstanden. Dies bezieht sich auf den Sieg der deutschen Staaten unter preußischer Führung über Frankreich im deutsch-französischen Krieg von 1870/71 sowie auf den in Europa nicht erwarteten Sieg Japans im russisch-japanischen Krieg von 1904/05.
r
[247] In A geht der eingefügten Überschrift die Anmerkung der Erstherausgeber voran: 1) Hier bricht das Kapitel ab. Notizen auf dem Manuskriptblatt zeigen, daß Begriff und Entwicklung des Nationalstaats in allen historischen Epochen nachgegangen werden sollte. Auf dem Rande des Blattes befindet sich noch folgender Satz: