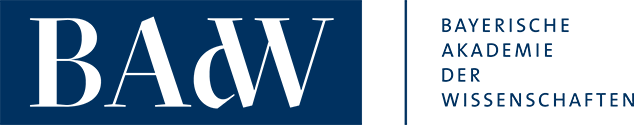[168][A 216]Ethnische Gemeinschaften.a[168] Über dem Titel steht in A: Kapitel III. In A folgt die Zwischenüberschrift: § 1. Die „Rasse“.
[168] Über dem Titel steht in A: Kapitel III. In A folgt die Zwischenüberschrift: § 1. Die „Rasse“.
Eine weit problematischere Quelle für Gemeinschaftshandeln als die bisher ermittelten Tatbestände ist der wirklich auf Abstammungsgemeinsamkeit beruhende Besitz gleichartiger ererbter und vererblicher Anlagen, die „Rassenzugehörigkeit“. Sie führt zu einer „Gemeinschaft“ natürlich überhaupt nur dann, wenn sie subjektiv als gemeinsames Merkmal empfunden wird, und dies geschieht nur, wenn örtliche Nachbarschaft oder Verbundenheit Rassenverschiedener zu einem (meist: politischen) gemeinsamen Handeln oder umgekehrt: irgendwelche gemeinsame Schicksale des rassenmäßig Gleichartigen mit irgendeiner Gegensätzlichkeit der Gleichgearteten gegen auffällig Andersgeartete verbunden ist. Das dann entstehende Gemeinschaftshandeln pflegt sich generell nur rein negativ: als Absonderung und Verachtung oder umgekehrt abergläubische Scheu gegenüber den in auffälliger Weise Andersgearteten zu äußern. Der seinem äußeren Habitus nach Andersartige wird, mag er „leisten“ und „sein“, was er wolle, schlechthin als solcher verachtet oder umgekehrt, wo er dauernd übermächtig bleibt, abergläubisch verehrt. Die Abstoßung ist dabei das Primäre und Normale. Nun ist aber 1. diese Art von „Abstoßung“ nicht nur den Trägern anthropologischer Gemeinsamkeiten gegeneinander eigen, und auch ihr Maß wird keineswegs durch den Grad der anthropologischen Verwandtschaft bestimmt, und 2. knüpft sie auch und vor allem keineswegs nur an ererbte, sondern ganz ebenso an andere auffällige Unterschiede des äußeren Habitus an.
Wenn man den Grad von objektiver Rassenverschiedenheit rein physiologisch unter anderem auch darnach bestimmen kann, ob die Bastarde sich in annähernd normalem Maße fortpflanzen oder nicht, so könnte man die subjektive gegenseitige rassenmäßige Anziehung und Abstoßung in ihrem Stärkegrade darnach bemessen wollen, ob Sexualbeziehungen gern oder selten, normalerweise als Dauerbeziehungen oder wesentlich nur temporär und irregulär, angeknüpft werden. Das bestehende oder fehlende Konnubium [169]wäre dann naturgemäß bei allen zu einem „ethnischen“ Sonderbewußtsein entwickelten Gemeinschaften eine normale Konsequenz rassemäßiger Anziehung oder Absonderung. Die Erforschung der sexuellen Anziehungs- und Abstoßungsbeziehungen zwischen verschiedenen ethnischen Gemeinschaften steht heute erst am
b
Anfang exakter Beobachtungen. Es ist nicht der mindeste Zweifel, daß für die Intensität des Sexualverkehrs und für die Bildung von Konnubialgemeinschaften auch rassenmäßige, also durch Abstammungsgemeinschaft bedingte Momente eine Rolle spielen, zuweilen die ausschlaggebende. Aber gegen die „Urwüchsigkeit“ der sexuellen Rassenabstoßung, selbst bei einander sehr fernstehenden Rassen, sprechen schließlich doch z. B. die mehreren Millionen Mulatten in den Vereinigten Staaten deutlich genug. Die, neben den direkten Eheverboten der Südstaaten,[169]A: im
1
jetzt von beiden Seiten, neuerdings auch von derjenigen der Neger, durchgeführte Perhorreszierung jeder sexuellen Beziehung zwischen den beiden Rassen überhaupt ist erst das Produkt der mit der Sklavenemanzipation entstandenen Prätentionen [A 217]der Neger, als gleichberechtigte Bürger behandelt zu werden, also: sozial bedingt durch die, uns dem Schema nach bekannten,[169] Die gesetzlichen Verbote von Ehen zwischen Angehörigen verschiedener Rassen bestanden um die Jahrhundertwende noch in den meisten Staaten der amerikanischen Union. Die ersten entsprechenden Gesetze, die vor allem Ehen zwischen Weißen und Nichtweißen untersagten, wurden 1661 in Maryland und 1691 in Virginia erlassen und in der Folgezeit in nahezu allen neuen Bundesstaaten übernommen. Nach Ende des Bürgerkrieges hoben zwar viele Nordstaaten die Eheverbote auf, aber noch 1950 waren Mischehen in ca. 30 Staaten gesetzlich verboten.
2
in diesem Fall an die Rasse anknüpfenden, Tendenzen zur Monopolisierung von sozialer Macht und Ehre. Das „Konnubium“ überhaupt, also der Tatbestand: daß Abkömmlinge aus sexuellen Dauergemeinschaften von einer politischen oder ständischen oder ökonomischen Gemeinschaft des Vaters zur gleichartigen Beteiligung am Gemeinschaftshandeln und seinen Vorteilen für die Beteiligten zugelassen werden, hängt von mannigfachen Umständen ab. Unter der Herrschaft der ungebrochenen väterlichen Hausgewalt, von der später zu reden sein wird, Siehe oben, S. 82–86.
3
lag es gänzlich im Ermessen des Vaters, beliebige Sklavinnenkinder [170]als gleichberechtigt zu behandeln. Die Verklärung des Frauenraubs des Helden vollends machte die Rassenmischung in der Herrenschicht direkt zur Regel. Erst die, uns dem Schema nach bekannte Tendenz Siehe WuG1, S. 388, 427 (MWG I/22-3), WuG1, S. 679 ff. (MWG I/22-4).
4
zur monopolistischen Abschließung politischer oder ständischer oder anderer Gemeinschaften und zur Monopolisierung der Ehechancen schränkt diese Macht des Hausvaters zunehmend ein und schafft die strenge Einschränkung des Konnubium auf die Abkömmlinge aus sexuellen Dauergemeinschaften innerhalb der eigenen (ständischen, politischen, kultischen, ökonomischen) Gemeinschaft, damit zugleich aber eine höchst wirksame Inzucht. Die „Endogamie“ einer Gemeinschaft – wenn man darunter nicht das bloße Faktum, daß geschlechtliche Dauerbeziehungen vorwiegend auf der Basis der Zugehörigkeit zu einem wie immer gearteten Verband zustande kommen, sondern einen Ablauf des Gemeinschaftshandelns[170] Siehe oben, S. 82–86.
c
versteht, derart, daß nur endogen gezeugte Abkömmlinge als gleichstehende Genossen des Gemeinschaftshandelns akzeptiert werden – ist wohl überall sekundäres Produkt solcher Tendenzen. (Von einer „Sippen“-Endogamie sollte man nicht reden; sie existiert nicht oder nur dann, wenn man Erscheinungen wie die Leviratsehe[170]A: Gemeinschaftshandeln
5
und das Erbtochterrecht, Abgeleitet vom lateinischen „levir“ (Mannesbruder). Die Leviratsehe bezeichnet die im Alten Testament gesetzlich vorgeschriebene Ehe eines Mannes mit der Witwe seines kinderlos verstorbenen Bruders. Der Sinn einer solchen Ehe bestand in der Zeugung eines Sohnes, der dem Verstorbenen zugerechnet wurde und als dessen Erbe galt. Vgl. 5. Mose 25,5 ff.
6
die sekundären, religiösen und politischen Ursprungs sind, mit diesem Namen bezeichnen wollte.) Die Reinzüchtung anthropologischer Typen ist sehr oft sekundäre Folge derartiger, wie immer bedingter Abschließungen, bei Sekten (Indien) sowohl wie bei „Pariavölkern“, d. h. Gemeinschaften, welche zugleich sozial verachtet und dennoch um einer unentbehrlichen, von ihnen monopolisierten Sondertechnik willen als Nachbarn gesucht werden. Bei einer auf Vaterrecht beruhenden Erbfolge bezeichnet das Erbtochterrecht die Möglichkeit der Vererbung von Vermögen und Titel an die nächste Verwandte des letzten männlichen Mitgliedes einer Familie.
Nicht nur die Tatsache, daß, sondern auch der Grad, in welchem das reale Blutsband als solches beachtet wird, ist durch andere [171]Gründe als das Maß der objektiven Rassenverwandtschaft mitbestimmt. Der winzigste Tropfen Negerblut disqualifiziert in den Vereinigten Staaten unbedingt, während sehr beträchtliche Einschüsse indianischen Blutes es nicht tun.
7
Neben dem zweifellos mitspielenden, ästhetisch gegenüber den Indianern noch fremdartigeren Gepräge der Vollblutneger wirkt dabei ohne alle Frage die Erinnerung mit, daß es sich bei den Negern im Gegensatz zu den Indianern um ein Sklavenvolk, also eine ständisch disqualifizierte Gruppe handelt. Ständische, also anerzogene Unterschiede und namentlich Unterschiede der „Bildung“ (im weitesten Sinn des Wortes) sind ein weit stärkeres Hemmnis des konventionellen Konnubium als Unterschiede des anthropologischen Typus. Der bloße anthropologische Unterschied entscheidet, von den extremen Fällen ästhetischer Abstoßung abgesehen, durchweg nur in geringem Maße. [171] Dies bezieht sich auf Erfahrungen, die Weber während seines USA-Aufenthaltes von September bis November 1904 anläßlich eines Vortrages gemacht hat. In den Briefen an Helene Weber finden sich wiederholt Hinweise, daß das Sozialprestige von Farbigen so gering gewesen sei, daß weißen Amerikanern private Kontakte unmöglich waren, ohne ihrerseits gesellschaftlich ausgeschlossen zu werden. Vgl. Briefe Marianne Webers an Helene Weber vom 12./27. Okt. 1904, GStA Berlin, Rep. 92, Nl. Max Weber, Nr. 6, Bl. 56–58, 75–78 [[MWG II/4, S. 332–334, 356–360]]. In dem Bericht über seinen Besuch von Indianer-Reservaten in Oklahoma hebt Weber dagegen den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Erfolg einzelner Personen indianischer Abstammung hervor. Vgl. Brief Max Webers an Helene Weber vom 28. Sept. 1904, ebd., Bl. 42–47 (MWG II/4) [[MWG II/4, S. 310–320]].
d
[171] in A folgt die Zwischenüberschrift: § 2. Entstehung der „Rassen“merkmale.
Die Frage aber, ob die als auffällig abweichend und also scheidend empfundenen Differenzen auf „Anlage“ oder „Tradition“ beruhen, ist für ihre Wirksamkeit auf die gegenseitige Anziehung oder Abstoßung normalerweise gänzlich bedeutungslos. Dies gilt für die Entwicklung endogamer Konnubialgemeinschaften, und es gilt natürlich erst recht für die Anziehung und Abstoßung im sonstigen „Verkehr“, dafür also, ob freundschaftliche, gesellige oder ökonomische Verkehrsbeziehungen und Gemeinschaftsbildungen aller Art zwischen solchen Gruppen leicht und auf [A 218]dem Fuße gegenseitigen Vertrauens und gegenseitiger Behandlung als gleichartig und gleichwertig oder nur schwer und unter Vorkehrungen, welche Mißtrauen bekunden, angeknüpft werden. Die größere oder gerin[172]gere Leichtigkeit des Entstehens einer sozialen Verkehrsgemeinschaft (im möglichst weiten Sinn des Wortes) knüpft erst recht an die größten Äußerlichkeiten der aus irgend einem zufälligen historischen Grunde eingelebten Unterschiede der äußeren Lebensgewohnheiten genau ebenso an, wie an das rassenmäßige Erbgut. Entscheidend ist vielfach neben der Ungewohntheit abweichender Gepflogenheiten rein als solcher, daß die abweichende „Sitte“ in ihrem subjektiven „Sinn“ nicht durchschaut wird, weil dazu der Schlüssel fehlt. Aber nicht alle Abstoßung beruht auf dem Fehlen von „Verständnis“-Gemeinschaft, wie wir bald sehen werden.
8
Unterschiede der Bart- und Haartracht, Kleidung, Ernährungsweise, der gewohnten Arbeitsteilung der Geschlechter und alle überhaupt ins Auge fallenden Differenzen, – zwischen deren „Wichtigkeit“ oder „Unwichtigkeit“ es für die unmittelbare Anziehungs- oder Abstoßungsempfindung ebensowenig Gradunterschiede gibt wie für naive Reisebeschreibungen oder für Herodot oder für die ältere vorwissenschaftliche Ethnographie [172] Siehe unten, S. 176–179.
9
–, können im Einzelfall Anlaß zur Abstoßung und Verachtung der Andersgearteten und, als positive Kehrseite, zum Gemeinsamkeitsbewußtsein der Gleichgearteten geben, welches dann ganz ebenso leicht Träger einer Vergemeinschaftung werden kann, wie andererseits jede Art von Gemeinschaft, von Haus- und Nachbarverband bis zur politischen und religiösen Gemeinschaft, Träger gemeinsamer Sitte zu sein pflegt. Alle Unterschiede der „Sitten“ können ein spezifisches „Ehr“- und „Würde“-Gefühl ihrer Träger speisen. Die ursprünglichen Motive der Entstehung von Verschiedenheiten der Lebensgepflogenheiten werden vergessen, und die Kontraste bestehen als „Konventionen“ weiter. Wie auf diese Art alle und jede Gemein[173]schaft sittenbildend wirken kann, so wirkt auch jede in irgendeiner Weise, in dem sie mit den einzelnen ererbten Qualitäten verschieden günstige Lebens-, Überlebens- und Fortpflanzungschancen verknüpft, auf die Auslese der anthropologischen Typen, also züchtend, ein, und zwar unter Umständen in höchst wirksamer Art. Wie bei der inneren Ausgleichung steht es auch bei der Unterscheidung nach außen. Die uns dem Schema nach bekannte Tendenz Welche Vertreter der „verwissenschaftlichen Ethnographie“ hier gemeint sind, konnte nicht ermittelt werden. Seit Bachofen, Mutterrecht (wie oben, S. 2, Anm. 4; 1. Aufl. von 1861) und dann vor allem Morgan, Ancient Society (wie oben, S. 135, Anm. 33) hatte sich in der Ethnographie die Theorie durchgesetzt, daß bei den heutigen Naturvölkern noch die Kulturformen zu beobachten seien, die in früherer Zeit auch die in der zeitgenössischen Literatur sogenannten Kulturvölker durchlaufen hätten. Diese Vorstellung eines geradlinigen einheitlichen Entwicklungsgangs der Menschheitsgeschichte wurde seit den 1890er Jahren zunehmend in Frage gestellt. Vgl. Starcke, Carl Nicolai, Die primitive Familie in ihrer Entstehung und Entwicklung. – Leipzig: Brockhaus 1888; Grosse, Formen der Familie (wie oben, S. 138, Anm. 41). Auch Weber hat sich in dem Text „Hausgemeinschaften“ mehrfach indirekt gegen die Annahme von allgemeingültigen Entwicklungsstufen ausgesprochen, vgl. oben, S. 135, 139 f.
10
zur monopolistischen Abschließung nach außen kann an jedes noch so äußerliche Moment anknüpfen. Die universelle Macht der „Nachahmung“ wirkt im allgemeinen dahin, daß ebenso wie durch Rassenmischung die anthropologischen Typen, so die bloß traditionellen Gepflogenheiten von Ort zu Ort nur in allmählichen Übergängen sich zu ändern pflegen. Scharfe Grenzen zwischen den Verbreitungsgebieten von äußerlich wahrnehmbaren Lebensgepflogenheiten sind daher entweder durch eine bewußte monopolistische Abschließung, welche an kleine Unterschiede anknüpfte, und diese dann geflissentlich pflegte und vertiefte, entstanden. Oder durch friedliche oder kriegerische Wanderungen von Gemeinschaften, welche bis dahin weit entfernt gelebt und sich an heterogene Bedingungen der Existenz in ihren Traditionen angepaßt hatten. Ganz ebenso also, wie auffällig verschiedene, durch Züchtung in der Isolierung entstandene Rassentypen entweder durch monopolistische Abschließung oder durch Wanderung in scharf abgegrenzte Nachbarschaft miteinander geraten. Gleichartigkeit und Gegensätzlichkeit des Habitus und der Lebensgewohnheiten sind, wie sich aus alledem ergibt, ganz einerlei, ob als Erb- oder Traditionsgut[,] beide im Prinzip in ihrer Entstehung und Änderung der Wirksamkeit durchaus den gleichen Bedingungen des Gemeinschaftslebens unterstellt und auch in ihrer eigenen gemeinschaftsbildenden Wirkung gleichartig. Der Unterschied liegt einerseits in der überaus großen Verschiedenheit der Labilität beider, je nachdem sie Erb- oder Traditionsgut sind, und andererseits in der festen (wenn auch im einzelnen oft unbekannten) Grenze der Anzüchtung von neuen Erbqualitäten überhaupt, – der gegenüber, trotz der immerhin auch starken Unterschiede der Übertragbarkeit von Traditionen, doch für die „Angewöhnung“ von „Sitten“ ein ungemein viel größerer Spielraum besteht. [173] Siehe oben, S. 82–86.
[174][A 219]Fast jede Art von Gemeinsamkeit und Gegensätzlichkeit des Habitus und der Gepflogenheiten kann Anlaß zu dem subjektiven Glauben werden, daß zwischen den sich anziehenden oder abstoßenden Gruppen Stammverwandtschaft oder Stammfremdheit bestehe. Nicht jeder Stammverwandtschaftsglaube zwar beruht auf Gleichheit der Sitten und des Habitus. Es kann auch trotz starker Abweichungen auf diesem Gebiet dann ein solcher bestehen und eine gemeinschaftsbildende Macht entfalten, wenn er durch die Erinnerung an reale Abwanderung: Kolonisation oder Einzelauswanderung gestützt wird. Denn die Nachwirkung der Angepaßtheit an das Gewohnte und an Jugenderinnerungen besteht als Quelle des „Heimatsgefühls“ bei den Auswanderern auch dann weiter, wenn sie sich der neuen Umwelt derart vollständig angepaßt haben, daß ihnen selbst eine Rückkehr in die Heimat unerträglich wäre (wie z. B. den meisten Deutschamerikanern). In Kolonien überdauert die innere Beziehung zur Heimat der Kolonisten auch sehr starke Mischungen mit den Bewohnern des Koloniallandes und erhebliche Änderungen des Traditionsguts sowohl wie des Erbtypus. Entscheidend dafür ist bei politischer Kolonisation das politische Rückhaltsbedürfnis; allgemein ferner die Fortdauer der durch Konnubium geschaffenen Verschwägerungen und endlich, soweit die „Sitte“ konstant geblieben ist, die Absatzbeziehungen, welche, solange diese Konstanz des Bedürfnisstandes dauert, zwischen Heimat und Kolonie, und zwar gerade bei Kolonien in fast absolut fremdartiger Umgebung und innerhalb eines fremden politischen Gebietes, in besonderer Intensität bestehen können. Der Stammverwandtschaftsglaube kann – ganz einerlei natürlich, ob er objektiv irgendwie begründet ist – namentlich für die politische Gemeinschaftsbildung wichtige Konsequenzen haben. Wir wollen solche Menschengruppen, welche auf Grund von Ähnlichkeiten des äußeren Habitus oder der Sitten oder beider oder von Erinnerungen an Kolonisation und Wanderung einen subjektiven Glauben an eine Abstammungsgemeinsamkeit hegen, derart, daß dieser für die Propagierung von Vergemeinschaftungen wichtig wird, dann, wenn sie nicht „Sippen“ darstellen, „ethnische“ Gruppen nennen, ganz einerlei, ob eine Blutsgemeinsamkeit objektiv vorliegt oder nicht. Von der „Sippengemeinschaft“ scheidet sich die „ethnische“ Gemeinsamkeit dadurch, daß sie eben an sich nur (geglaubte) „Gemeinsamkeit“, nicht aber „Gemeinschaft“ ist, wie die [175]Sippe, zu deren Wesen ein reales Gemeinschaftshandeln gehört. Die ethnische Gemeinsamkeit (im hier gemeinten Sinn) ist demgegenüber nicht selbst Gemeinschaft, sondern nur ein die Vergemeinschaftung erleichterndes Moment. Sie kommt der allerverschiedensten, vor allem freilich erfahrungsgemäß: der politischen Vergemeinschaftung, fördernd entgegen. Andererseits pflegt überall in erster Linie die politische Gemeinschaft, auch in ihren noch so künstlichen Gliederungen, ethnischen Gemeinsamkeitsglauben zu wecken und auch nach ihrem Zerfall zu hinterlassen, es sei denn, daß dem drastische Unterschiede der Sitte und des Habitus oder, und namentlich, der Sprache im Wege stehen.
Diese „künstliche“ Art der Entstehung eines ethnischen Gemeinsamkeitsglaubens entspricht ganz dem uns bekannten Schema
11
der Umdeutung von rationalen Vergesellschaftungen in persönliche Gemeinschaftsbeziehungen. Unter Bedingungen geringer Verbreitung rational versachlichten Gesellschaftshandelns attrahiert fast jede, auch eine rein rational geschaffene, Vergesellschaftung ein übergreifendes Gemeinschaftsbewußtsein in der Form einer persönlichen Verbrüderung auf der Basis „ethnischen“ Gemeinsamkeitsglaubens. Noch dem Hellenen wurde jede noch so willkürlich vollzogene Gliederung der Polis zu einem persönlichen Verband mindestens mit Kultgemeinschaft, oft mit künstlichem Ahn. Die 12 Stämme Israels sind Unterabteilungen der politischen Gemeinschaft, welche umschichtig monatsweise gewisse Leistungen übernahmen,[175] Ein sehr kurz und allgemein gehaltener Bezugspunkt findet sich in Weber, Kategorienaufsatz, S. 275.
12
die hellenischen Phylen Der unter Salomo erfolgte Aufbau der Administration im Königreich Israel umfaßte zwölf Verwaltungsbezirke in Anlehnung an die zwölf Stämme Israels. Diese Bezirke mußten in monatlichem Wechsel die notwendigen Lebensmittel für den königlichen Hof sowie das Futter für die Reitpferde und Zugtiere des Königs stellen. Vgl. 1. Könige 4, 7–19; 5, 7 f.
13
und ihre Unterabteilungen ebenfalls. Aber auch die letzteren gelten durchaus als ethnische Abstammungsgemeinsamkeiten. Sicherlich kann nun die ursprüngliche Einteilung sehr wohl an politische oder schon vorhandene ethnische Unterschiede angeknüpft haben. [A 220]Auch wo sie aber [176]unter Zerreißung alter Verbände und Verzicht auf lokalen Zusammenhalt ganz rational und schematisch konstruiert wurde – wie die kleisthenische Die Phyle war eine Unterabteilung der griechischen Gemeinwesen und hatte wahrscheinlich einen gentilen Ursprung. Allerdings wurde in historischer Zeit eine gemeinsame Abstammung verneint. Bedeutsam waren die Phylen in der Verfassungswirklichkeit als größte Heeresabteilung, für die Besetzung verschiedener staatlicher Gremien und als Vorinstanzen bei der Beamtenauswahl.
14
– wirkte sie ganz im gleichen Sinne ethnisch. Dies bedeutet also nicht, daß die hellenische Polis real oder der Entstehung nach in der Regel ein Stammes- oder Geschlechterstaat war, sondern es ist ein Symptom für den im ganzen geringen Grad der Rationalisierung des hellenischen Gemeinschaftslebens überhaupt. Umgekehrt ist es für die größere Rationalisierung der römischen politischen Gemeinschaftsbildung ein Symptom, daß ihre alten schematischen Unterabteilungen (curiae) jene religiöse, einen ethnischen Ursprung vortäuschende Bedeutsamkeit nur in geringerem Maße attrahiert haben. [176] Die Grundlage der kleisthenischen Reformen Ende des 6. Jahrhunderts v. Chr. in Athen war eine territoriale Neugliederung Attikas. Die alte 4 Phylen umfassende Ordnung wurde durch 10 neue Phylen ersetzt, deren Verwaltungsgebiete nicht mehr zusammenhängende Territorien bildeten. Die neue Einteilung erschien den Zeitgenossen willkürlich und Aristoteles vermutete die Anwendung eines Losverfahrens. Aristoteles, Politik, 21, 4.
e
[176]A: hat.
Der „ethnische“ Gemeinsamkeitsglaube ist sehr oft, aber nicht immer Schranke „sozialer Verkehrsgemeinschaften“; diese wiederum sind
f
nicht immer identisch mit endogamer Konnubialgemeinschaft, denn die von jeder von beiden umfaßten Kreise können sehr verschieden groß sein. Ihre nahe Verwandtschaft beruht nur auf dem gleichartigen Fundament: dem Glauben an eine spezifische, von den Außenstehenden nicht geteilte „Ehre“ – der „ethnischen Ehre“ – des Zugehörigen, deren Verwandtschaft mit der „ständischen“ Ehre wir später erörtern werden.A: ist
15
Hier begnügen wir uns mit diesen wenigen Feststellungen. Jede eigentlich soziologische Untersuchung müßte die Begriffe ungemein viel feiner differenzieren, als wir es hier für unseren begrenzten Zweck tun. Gemeinschaften können ihrerseits Gemeinsamkeitsgefühle erzeugen, welche dann dauernd, auch nach dem Verschwinden der Gemeinschaft, bestehen bleiben und als „ethnisch“ empfunden werden. Insbesondere kann die politische Gemeinschaft solche Wirkungen üben. Am unmittelbarsten aber ist dies bei derjenigen Gemeinschaft der Fall, welche Träger eines spezifischen „Massenkulturguts“ ist und das gegenseitige „Verstehen“ begründet oder erleichtert: die Gemeinschaft der Sprache. Siehe unten, S. 259–262.
[177]Unzweifelhaft ist da, wo die Erinnerung an die Entstehung einer auswärtigen Gemeinschaft durch friedliche Abspaltung oder Fortwanderung („Kolonie“,
16
„Ver sacrum“[177] Dies bezieht sich auf die Koloniegründungen in der Antike, als auf unterschiedliche Weise ausgewählte Kolonisten ihre Heimatstadt verließen, um anderswo eine neue Siedlung zu gründen.
17
und ähnliche Vorgänge) aus einer Muttergemeinschaft aus irgendwelchen Gründen dauernd lebendig geblieben ist, ein sehr spezifisches „ethnisches“ Gemeinschaftsgefühl von oft sehr großer Tragfähigkeit vorhanden. Aber dies ist dann durch die politische Erinnerungsgemeinschaft oder, in der Frühzeit noch stärker, durch die fortdauernde Bindung an die alten Kultgemeinschaften, ferner die fortdauernde Erstarkung der Sippenverbände und anderer Vergemeinschaftungen durch die alte wie neue Gemeinschaft hindurch oder durch andere fortdauernde, ständig fühlbare Beziehungen bedingt. Wo diese fehlen oder aufhören, fehlt auch das „ethnische“ Gemeinschaftsgefühl, einerlei, wie nahe die Blutsverwandtschaft ist. Das „ver sacrum“ bezeichnet den italischen Brauch, im Falle eines staatlichen Notstandes alle neugeborenen Tiere und Menschen des nächsten Frühjahrs einem Gott als Sühneopfer zu weihen. Dabei wurden die Tiere tatsächlich geopfert, während die Menschen im Alter von 21 Jahren ihre Heimatstadt verlassen und eine neue Gemeinde gründen mußten. Das „ver sacrum“ scheint bei der Besiedelung Italiens eine große Rolle gespielt zu haben, da sich zahlreiche Städte in ihren Gründungssagen darauf bezogen. Das einzige historisch belegte „ver sacrum“ wird aus dem Jahre 217 v. Chr. überliefert, nachdem Hannibal in Italien eingefallen war und Rom erste empfindliche Niederlagen hinnehmen mußte. Vgl. Livius, 22,9, 7 ff.; 22,10; 33,44, 1 f.; 34,44, 1 ff.
Versucht man generell zu ermitteln, welche „ethnischen“ Differenzen übrig bleiben, wenn man absieht von der keineswegs immer mit objektiver oder subjektiv geglaubter Blutsverwandtschaft zusammenfallenden Sprachgemeinschaft und von der ebenfalls davon unabhängigen Gemeinsamkeit des religiösen Glaubens, sowie vorläufig auch von der Wirkung gemeinsamer rein politischer Schicksale und der Erinnerungen daran, die wenigstens objektiv mit Blutsverwandtschaft nichts zu tun hat, – dann bleiben einerseits, wie erwähnt,
18
ästhetisch auffällige Unterschiede des nach außen hervortretenden Habitus, andererseits und zwar durchaus gleichberechtigt neben jenen, in die Augen fallende Unterschiede in der Lebensführung des Alltags. Und zwar, da es sich bei den Gründen der „ethnischen“ Scheidung stets um äußerlich erkenn[178]bare drastische Differenzen handelt, gerade solche Dinge, welche sonst von untergeordneter sozialer Tragweite erscheinen können. Es ist klar, daß die Sprachgemeinschaft und nächst ihr die, durch ähnliche religiöse Vorstellungen bedingte, Gleichartigkeit der rituellen Lebensreglementierung außerordentlich starke, überall wirkende Elemente von „ethnischen“ Verwandtschaftsgefühlen bilden, namentlich weil die sinnhafte „Verständlichkeit“ des Tuns des Anderen die elementarste Voraussetzung der Vergemeinschaftung ist. Aber wir [A 221]wollen diese beiden Elemente hier ausscheiden und fragen, was dann übrigbleibt. Und es ist ja auch zuzugeben, daß wenigstens starke Dialektunterschiede und Unterschiede der Religion die ethnischen Gemeinschaftsgefühle nicht absolut ausschließen. Neben wirklich starken Differenzen der ökonomischen Lebensführung spielten bei ethnischem Verwandtschaftsglauben zu allen Zeiten solche der äußerlichen Widerspiegelungen, wie die Unterschiede der typischen Kleidung, der typischen Wohn- und Ernährungsweise, der üblichen Art der Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern und zwischen Freien und Unfreien: – alle solche Dinge also, bei denen es sich fragt: was für „schicklich“ gilt und was, vor allem, das Ehr- und Würdegefühl des Einzelnen berührt –, eine Rolle. Alle diejenigen Dinge mit anderen Worten, welche wir später auch als Gegenstände spezifisch „ständischer“ Unterschiede wiederfinden werden. Siehe oben, S. 172 f.
19
In der Tat ist die Überzeugung von der Vortrefflichkeit der eigenen und der Minderwertigkeit fremder Sitten, durch welche die „ethnische Ehre“ gespeist wird, den „ständischen“ Ehrbegriffen durchaus analog. „Ethnische“ Ehre ist die spezifische Massenehre, weil sie jedem, der der subjektiv geglaubten Abstammungsgemeinschaft angehört, zugänglich ist. Der „poor white trash“, [178] Siehe unten, S. 259–262.
20
die besitzlosen und, bei dem Mangel an Arbeitsgelegenheit für freie Arbeit, sehr oft ein elendes Dasein fristenden, Weißen der amerikanischen Südstaaten waren in der Sklavereiepoche die eigentlichen Träger der den Pflanzern selbst ganz fremden [179]Rassenantipathie, weil gerade ihre soziale „Ehre“ schlechthin an der sozialen Deklassierung der Schwarzen hing. Und hinter allen „ethnischen“ Gegensätzen steht ganz naturgemäß irgendwie der Gedanke des „auserwählten Volks“, der nur ein in das horizontale Nebeneinander übersetztes Pendant „ständischer“ Differenzierungen ist und seine Popularität eben davon entlehnt, daß er im Gegensatz zu diesen, die stets auf Subordination beruhen, von jedem Angehörigen jeder der sich gegenseitig verachtenden Gruppen für sich subjektiv in gleichem Maße prätendiert werden kann. Daher klammert sich die ethnische Abstoßung an alle denkbaren Unterschiede der „Schicklichkeits“vorstellungen und macht sie zu „ethnischen Konventionen“. Neben jenen vorhin erwähnten, Der Ausdruck „poor white trash“ wurde Mitte des 19. Jahrhunderts von den Gegnern der Sklaverei im Zusammenhang mit der Diskussion über die Sklavenwirtschaft in den Vereinigten Staaten gebildet. Mit dem Begriff wurde die weiße Unterschicht der Südstaaten bezeichnet, die durch die Sklaverei am sozialen Aufstieg gehindert bzw. ins soziale Abseits gedrängt worden sei. Vgl. Helper, Hinton Rowan, The Impending Crisis of the South. How to meet it. – New York: A. B. Burdick 1860, S. 32.
21
immerhin noch näher mit der Wirtschaftsordnung zusammenhängenden Momenten wird etwa auch die Bart- und Haartracht und ähnliches von der Konventionalisierung – ein erst später zu erörternder Begriff [179] Siehe oben, S. 173 f.
22
– erfaßt und wirken Gegensätze darin nun „ethnisch“ abstoßend, weil sie als Symbole ethnischer Zugehörigkeit gelten. Nicht immer freilich wird die Abstoßung nur durch den „symbolischen“ Charakter der Unterscheidungsmerkmale bedingt. Daß die Skytinnen ihre Haare mit Butter, welche dann ranzig roch, einfetteten, die Helleninnen dagegen mit parfümiertem Öl, machte, nach einer antiken Überlieferung, einen gesellschaftlichen Annäherungsversuch vornehmer Damen von beiden Seiten unmöglich. Siehe WuG1, S. 374 ff., 397 (MWG I/22-3) und unten, S. 265 f.
23
Der Buttergeruch wirkte sicher intensiver trennend als selbst die drastischsten Rassenunterschiede, als etwa der – soviel ich selbst bemerken konnte Diese Anekdote konnte in bezug auf Skythen, bei denen die Butter nur für den Verzehr bestimmt war, nicht nachgewiesen werden. Plutarch berichtet jedoch von einer Begegnung der Galaterfürstin Beronice mit einer Spartanerin, in deren Verlauf sich beide Frauen wegen des Öl- bzw. Buttergeruchs der anderen voneinander abwandten. Vgl. Plutarch, Adversus Colotem, 4.
24
– fabulöse „Negergeruch“ es hätte tun können. Die „Ras[180]senqualitäten“ kommen für die Bildung „ethnischen“ Gemeinsamkeitsglaubens generell nur als Grenzen: bei allzu heterogenem, ästhetisch nicht akzeptiertem äußerem Typus, in Betracht, nicht als positiv gemeinschaftsbildend. Während seines Aufenthalts in den USA anläßlich der Weltausstellung in St. Louis im Jahre 1904 informierte sich Max Weber eingehend über die Lage der Afro-Amerikaner. Weber traf sich mit William Edward Burghardt Du Bois, der sich für eine weitergehende Ausbildung der Afro-Amerikaner einsetzte, und besuchte das von Booker Washington gegründete „College for Further Education for African Americans“ in Tuskegee im US-Staat Alabama. Vgl. Weber, Marianne, Lebensbild, S. 307–309; vgl. auch Mommsen, Wolfgang J., Max Weber und die Vereinigten Staaten von Amerika, in: Fiebig-von Hase, Ragnhild und Jürgen Heideking (Hg.), Zwei Wege in die Moderne. Aspekte der deutsch-amerikani[180]schen Beziehungen 1900–1918. – Trier: Wissenschaftlicher Verlag 1998, S. 91–103. Auf dem Ersten Deutschen Soziologentag 1910 berichtete Weber über den „Negergeruch“, der seiner Erfahrung nach eine Erfindung der amerikanischen Nordstaaten sei und in den Südstaaten keine Rolle bei der Rassentrennung spiele. Vgl. Weber, Diskussionsbeitrag zu dem Vortrag von Ploetz (wie oben, S. 163, Anm. 10), S. 154.
Starke Differenzen der „Sitte“, die hiernach bei der Bildung ethnischer Gemeinschaftsgefühle und Blutsverwandtschaftsvorstellungen eine dem ererbten Habitus durchaus gleichwertige Rolle spielen, sind, neben den sprachlichen und religiösen Unterschieden, ganz regelmäßig durch verschiedene ökonomische oder politische Existenzbedingungen, an die eine Menschengruppe sich anzupassen hat, hervorgerufen. Denken wir scharfe Sprachgrenzen, scharf begrenzte politische oder religiöse Gemeinschaften als Rückhalt von Unterschieden der „Sitte“ fort – wie sie ja in weiten Gebieten des afrikanischen und südamerikanischen Kontinents wirklich vielfach fehlen – so gibt es nur allmähliche Übergänge der „Sitte“ und auch keinerlei feste „ethnische Grenzen“, außer solchen
g
, die durch drastische Raumunterschiede bedingt sind. Scharfe Abgrenzungen des Geltungsgebiets von „ethnisch“ relevanten [A 222]Sitten, welche nicht entweder politisch oder ökonomisch oder religiös bedingt sind, entstehen regelmäßig durch Wanderungen oder Expansionen, welche bisher dauernd oder doch zeitweise weit voneinander getrennt lebende und daher an sehr heterogene Bedingungen angepaßte Menschengruppen in unmittelbare Nachbarschaft miteinander bringen. Der so entstehende deutliche Kontrast der Lebensführung pflegt dann auf beiden Seiten die Vorstellung gegenseitiger „Blutsfremdheit“ zu wecken, ganz unabhängig vom objektiven Sachverhalt. [180]A: solche
Die Einflüsse, welche die hiernach im spezifischen Sinn „ethnischen“ Momente, also: der auf Gemeinsamkeiten oder Unterschieden des äußeren Eindrucks der Person und ihrer Lebensführung ruhende Glaube an Blutsverwandtschaft oder das Gegenteil[,] in Gemeinschaftsbildungen hineintragen, ist natürlich generell sehr [181]schwer bestimmbar und auch in jedem Einzelfall von problematischer Bedeutung. Die „ethnisch“ relevante „Sitte“ wirkt generell nicht anders als Sitte – von deren Wesen anderwärts zu reden ist
25
– überhaupt. Der Glaube an die Abstammungsverwandtschaft ist geeignet, in Verbindung mit der Ähnlichkeit der Sitte, die Ausbreitung eines von einem Teil der „ethnisch“ Verbundenen rezipierten Gemeinschaftshandelns innerhalb des Restes zu begünstigen, da das Gemeinschaftsbewußtsein die „Nachahmung“ fördert. Dies gilt insbesondere für die Propaganda religiöser Gemeinschaften. Aber über derart unbestimmte Sätze kommt man nicht hinaus. Der Inhalt des auf „ethnischer“ Basis möglichen Gemeinschaftshandelns bleibt unbestimmt. Dem entspricht nun die geringe Eindeutigkeit derjenigen Begriffe, welche ein lediglich „ethnisch“, also durch den Glauben an Blutsverwandtschaft bedingtes Gemeinschaftshandeln anzudeuten scheinen: „Völkerschaft“, „Stamm“, „Volk“, – von denen jeder gewöhnlich im Sinn einer ethnischen Unterabteilung des folgenden (aber die beiden ersten auch umgekehrt) gebraucht wird. Ganz regelmäßig wird, wenn diese Ausdrücke gebraucht werden, entweder eine, sei es noch so lose, gegenwärtige politische Gemeinschaft oder Erinnerungen an eine früher einmal gewesene, wie sie die gemeinsame Heldensage aufbewahrt, oder Sprach- bzw. Dialektgemeinschaften oder endlich eine Kultgemeinschaft, mit hinzugedacht. Speziell irgendwelche Kultgemeinschaften waren in der Vergangenheit geradezu die typischen Begleiterscheinungen eines auf geglaubter Blutsverwandtschaft ruhenden „Stammes“-oder „Volks“-Bewußtseins. Aber wenn diesem eine politische, gegenwärtige oder vergangene, Gemeinschaft gänzlich fehlte, so war schon die äußere Abgrenzung des Gemeinschaftsumfangs meist ziemlich unbestimmt. Die Kultgemeinschaften germanischer Stämme, noch in später Zeit der Burgunder, waren wohl Rudimente politischer Gemeinschaften und daher anscheinend leidlich fest umgrenzt. Das delphische Orakel dagegen ist zwar das unbezweifelte kultische Wahrzeichen des Hellenentums als eines „Volkes“. Aber der Gott gibt auch Barbaren Auskunft und läßt sich ihre Verehrung gefallen, und andererseits sind an der vergesellschafteten Verwaltung seines Kultes nur kleine Teile der Hellenen, und gerade [182]die mächtigsten ihrer politischen Gemeinschaften gar nicht, beteiligt. [181] Siehe WuG1, S. 374 f. (MWG I/22-3).
26
Die Kultgemeinschaft als Exponent des „Stammesgefühls“ ist also im allgemeinen entweder Rest einer einst bestehenden engeren, durch Spaltung und Kolonisation zerfahrenen Gemeinschaft meist politischer Art, oder sie ist, – wie beim delphischen Apollon – vielmehr Produkt einer, durch andere als rein „ethnische“ Bedingungen, herbeigeführten „Kulturgemeinschaft“, welche ihrerseits den Glauben an Blutsgemeinschaft entstehen läßt. Wie außerordentlich leicht speziell politisches Gemeinschaftshandeln die Vorstellung der „Blutsgemeinschaft“ erzeugt – falls nicht allzu drastische [182] Während die eigentliche Orakeltätigkeit (Opfer, Gebete) in Händen der delphischen Priester lag, unterstand die Finanzverwaltung und der Schutz des Heiligtums der sogenannten pylaiisch-delphischen Amphiktyonie. Mitglieder der Amphiktyonie waren ursprünglich zwölf der alten Stammesverbände, die je zwei Vertreter entsandten. Mit zunehmender Erstarkung der Stadtstaaten wechselten sich die Städte bei der Entsendung der Mitglieder ab, wobei z. B. Athen zeitweise einen festen ionischen Sitz inne hatte. 346 v. Chr. entstand unter dem Einfluß Philipps von Makedonien eine Neuordnung, die u. a. Sparta aus dem Bund ausschloß.
h
Unterschiede des anthropologischen Typus im Wege stehen, – zeigt der ganze Verlauf der Geschichte.[182]A: allzudrastische
k
In A folgt die Zwischenüberschrift: § 3. Verhältnis zur politischen Gemeinschaft.
Eindeutig wird der „Stamm“ nach außen natürlich da begrenzt, wo er Unterabteilung eines politischen Gemeinwesens ist. Aber dann ist diese Abgrenzung auch [A 223]meist künstlich von der politischen Gemeinschaft her geschaffen. Schon die runden Zahlen, in denen er aufzutreten pflegt, weisen darauf hin, z. B. die schon erwähnte
27
Einteilung des Volkes Israel in 12 Stämme, ebenso die drei dorischen und die an Zahl verschiedenen „Phylen“ der übrigen Hellenen. Siehe oben, S. 175.
28
Sie wurden bei Neugründung oder Neuorganisation des Gemeinwesens künstlich neu eingeteilt, und der „Stamm“ ist hier also, obwohl er alsbald die ganze Symbolik der Blutsgemeinschaften, insbesondere den Stammeskult, attrahiert, erst Kunstprodukt der politischen Gemeinschaft. Die Entstehung eines spezifischen. [183]blutsverwandtschaftsartig reagierenden Gemeingefühls für rein künstlich abgegrenzte politische Gebilde ist noch heute nichts seltenes. Die allerschematischsten politischen Gebilde: die nach Breitengraden quadratisch abgegrenzten „Staaten“ der amerikanischen Union z. B., zeigen ein sehr entwickeltes Sonderbewußtsein: daß Familien von New York nach Richmond reisen, nur damit das erwartete Kind dort geboren und also ein „Virginier“ werde, ist nicht selten. Weber spielt hier darauf an, daß sich die Phyleneinteilung vermutlich ursprünglich an gentilistischen Abstammungen orientierte. Die drei alten dorischen Phylen hießen Hylleis, Dymanes und Pamphyloi, während sich die Zahl der ionischen Phylenordnung nicht mehr genau bestimmen läßt. Vgl. auch oben, S. 175, Anm. 13.
29
Das Künstliche solcher Abgrenzungen schließt nun gewiß nicht aus, daß z. B. die hellenischen Phylen ursprünglich einmal irgendwo und irgendwie selbständig vorhanden gewesen waren und dann jene Poliseinteilung bei ihrer ersten Durchführung schematisierend an sie angeknüpft hatte, als sie zu einem politischen Verband zusammengeschlossen wurden. Aber dann ist der Bestand jener vor der Polis existierenden Stämme (sie werden dann auch nicht „Phylen“, sondern „Ethnos“ genannt) entweder identisch mit den entsprechenden politischen Gemeinschaften gewesen, die sich dann zur „Polis“ vergesellschafteten oder, wenn dies nicht der Fall war, so lebte doch in vermutlich sehr vielen Fällen der politisch unorganisierte Stamm als geglaubte „Blutsgemeinschaft“ von der Erinnerung daran, daß er früher einmal Träger eines politischen Gemeinschaftshandelns, meist wohl eines nur gelegentlichen, eine einzelne erobernde Wanderung oder Verteidigung dagegen in sich schließenden, gewesen war, und dann waren eben diese politischen Erinnerungen das prius gegenüber dem „Stamm“. Dieser Sachverhalt: daß das „Stammesbewußtsein“ der Regel nach primär durch politisch gemeinsame Schicksale und nicht primär durch „Abstammung“ bedingt ist, dürfte nach allem Gesagten[183] Als Bewohner eines der ältesten weißen Siedlungsgebiete in den USA besaßen die Einwohner von Virginia vor allem in den Staaten der Ostküste ein außergewöhnlich hohes Sozialprestige.
30
eine sehr häufige Quelle „ethnischen“ Zusammengehörigkeitsglaubens sein. Nicht die einzige: denn die Gemeinsamkeit der „Sitte“ kann die verschiedensten Quellen haben und entstammt letztlich in hohem Grade der Anpassung an die äußeren Naturbedingungen und der Nachahmung im Kreise der Nachbarschaft. Praktisch aber pflegt die Existenz des „Stammesbewußtseins“ wiederum etwas spezifisch Politisches zu bedeuten: daß [184]nämlich bei einer kriegerischen Bedrohung von außen oder bei genügendem Anreiz zu eigener kriegerischer Aktivität nach außen, ein politisches Gemeinschaftshandeln besonders leicht auf dieser Grundlage, also als ein solches der einander gegenseitig subjektiv als blutsverwandte „Stammesgenossen“ (oder „Volksgenossen“) Empfindenden entsteht. Das potentielle Aufflammen des Willens zum politischen Handeln ist demnach nicht die einzige, aber eine derjenigen Realitäten, welche hinter dem im übrigen inhaltlich vieldeutigen Begriff von „Stamm“ und „Volk“ letztlich steckt. Dieses politische Gelegenheitshandeln kann sich besonders leicht auch trotz des Fehlens jeder darauf eingestellten Vergesellschaftung zu einer als „sittliche“ Norm geltenden Solidaritätspflicht der Volks- oder Stammesgenossen im Fall eines kriegerischen Angriffes entwickeln, deren Verletzung, selbst wenn keinerlei gemeinsames „Organ“ des Stammes existiert, den betreffenden politischen Gemeinschaften danach das Los der Sippen der Segestes und Inguiomar (Austreibung aus ihrem Gebiet) zuzieht. Siehe oben, S. 181 f.
31
Ist aber dieses Stadium der Entwicklung erreicht, dann ist der Stamm tatsächlich eine politische Dauergemeinschaft geworden, mag diese auch in Friedenszeiten latent und daher natürlich labil bleiben. Der Übergang vom bloß „Gewöhnlichen“ zum Gewohnten und deshalb „Gesollten“ ist auf diesem Gebiet auch unter günstigen Verhältnissen ganz besonders gleitend. Alles in allem finden wir in dem „ethnisch“ bedingten Gemeinschaftshandeln Erscheinungen vereinigt, welche eine wirklich exakte soziologische Betrachtung – wie sie hier gar nicht versucht wird – sorg[A 224]sam zu scheiden hätte: die faktische subjektive Wirkung der durch Anlage einerseits, durch Tradition andererseits bedingten „Sitten“, die Tragweite aller einzelnen verschiedenen Inhalte von „Sitte“, die Rückwirkung sprachlicher, religiöser, politischer Gemeinschaft, früherer und jetziger, auch die Bildung von Sitten, das Maß, in welchem solche einzelnen Komponen[185]ten Anziehungen und Abstoßungen und insbesondere Blutsgemeinschafts- oder Blutsfremdheitsglauben wecken, dessen verschiedene Konsequenzen für das Handeln, für den Sexualverkehr der verschiedenen Art, für die Chancen der verschiedenen Arten von Gemeinschaftshandeln, sich auf dem Boden der Sittengemeinschaft oder des Blutsverwandtschaftsglaubens zu entwickeln, – dies alles wäre einzeln und gesondert zu untersuchen. Dabei würde der Sammelbegriff „ethnisch“ sicherlich ganz über Bord geworfen werden. Denn er ist ein für jede wirklich exakte Untersuchung ganz unbrauchbarer Sammelname. Wir aber treiben nicht Soziologie um ihrer selbst willen und begnügen uns daher, in Kürze aufzuzeigen, welche sehr verzweigte Probleme sich hinter dem vermeintlich ganz einheitlichen Phänomen verbergen. [184] Die Cheruskerfürsten Segestes und Inguiomar gerieten im Rahmen der römisch-germanischen Auseinandersetzungen im zweiten Jahrzehnt n. Chr. in Konflikte mit Arminius. Während Segestes als Römerfreund Varus vor dem bevorstehenden germanischen Aufstand warnte und sich ab 15 n. Chr. mit seiner Familie nach einer mit römischer Hilfe überstandenen Belagerung durch Arminius im römischen Exil aufhielt, kämpfte Inguiomar zunächst auf germanischer Seite. Bei innergermanischen Auseinandersetzungen 17 n. Chr. stellte er sich und sein Gefolge jedoch gegen Arminius auf die Seite des später unterlegenen Markomannenkönigs Marbod.
Der bei exakter Begriffsbildung sich verflüchtigende Begriff der „ethnischen“ Gemeinschaft entspricht nun in dieser Hinsicht bis zu einem gewissen Grade einem der mit pathetischen Empfindungen für uns am meisten beschwerten Begriffe: demjenigen der „Nation“, sobald wir ihn soziologisch zu fassen suchen.
l
[185] In A folgt die Zwischenüberschrift: § 4. „Nation“ und „Volk“.
Die „Nationalität“ teilt mit dem „Volk“ im landläufigen „ethnischen“ Sinn wenigstens normalerweise die vage Vorstellung, daß dem als „gemeinsam“ Empfundenen eine Abstammungsgemeinschaft zugrunde liegen müsse, obwohl in der Realität der Dinge Menschen, welche sich als Nationalitätsgenossen betrachten, sich nicht nur gelegentlich, sondern sehr häufig der Abstammung nach weit ferner stehen, als solche, die verschiedenen und feindlichen Nationalitäten sich zurechnen. Nationalitätsunterschiede können z. B. trotz zweifellos starker Abstammungsverwandtschaft bestehen, nur weil Unterschiede der religiösen Konfessionen vorliegen, wie zwischen Serben und Kroaten.
32
Die realen Gründe des Glaubens an den Bestand einer „nationalen“ Gemeinsamkeit und des darauf sich aufbauenden Gemeinschaftshandelns sind sehr verschieden. Heute gilt vor allem „Sprachgemeinschaft“, im Zeitalter der Sprachenkämpfe, als ihre normale Basis. Was sie gegenüber der [186]bloßen „Sprachgemeinschaft“ inhaltlich mehr besitzt, kann dann natürlich in dem spezifischen Erfolg, auf den ihr Gemeinschaftshandeln ausgerichtet ist, gesucht werden, und dies kann dann nur der gesonderte politische Verband sein. In der Tat ist heute „Nationalstaat“ mit „Staat“ auf der Basis der Spracheinheitlichkeit begrifflich identisch geworden. In der Realität stehen neben politischen Verbänden und zwar solchen modernen Gepräges auf „nationaler“ Basis in diesem sprachlichen Sinn in erheblicher Zahl solche, die mehrere Sprachgemeinschaften umschließen und meist, aber nicht immer, für den politischen Verkehr eine Sprache bevorzugen.[185] Die Serben sind in der Mehrheit griechisch-orthodoxer Konfession, während die Kroaten überwiegend der römisch-katholischen Kirche angehören.
33
Aber auch für das sog. „Nationalgefühl“ – wir lassen es vorerst undefiniert – genügt Sprachgemeinschaft nicht – wie neben dem eben erwähnten Beispiel [186] So z. B. in Österreich-Ungarn, wo die Auseinandersetzungen über Amtssprache und Volkssprachen in den Badenischen Sprachenverordnungen kulminierten. Die Regierung des Grafen Casimir Badeni erließ am 5. April 1897 Sprachenverordnungen für die Kronländer Böhmen und Mähren, durch die Tschechisch als gleichberechtigte Amtssprache neben dem Deutschen eingeführt wurde. Mit diesem Schritt sollten tschechische Nationalisten an die Monarchie gebunden werden. Die deutschen Bevölkerungsteile der entsprechenden Gebiete reagierten empört und riefen u. a. durch ihre Forderung nach einer ethnischen Teilung der Kronländer eine Krise hervor, die die Monarchie in ihrer Existenz bedrohte. Am 14. Oktober 1897 wurden die Sprachenverordnungen wieder aufgehoben. Dies führte allerdings zu keiner Beruhigung der Situation, da die deutsche Agitation jetzt durch eine nationalistische tschechische abgelöst wurde.
34
die Iren, Schweizer und deutschsprachlichen Elsässer zeigen, welche sich nicht, mindestens nicht in vollem Sinn, als Glieder der durch ihre Sprache bezeichneten „Nation“ fühlen. Andererseits sind auch Sprachunterschiede kein absolutes Hindernis für das Gefühl einer „nationalen“ Gemeinschaft: die deutschsprachlichen Elsässer fühlten sich seinerzeit und fühlen sich zum großen Teil noch als Bestandteil der französischen „Nation“. Aber doch nicht in vollem Sinne, nicht so, wie der französisch redende Franzose. Also gibt es „Stufen“ der qualitativen Eindeutigkeit des „nationalen“ Gemeinsamkeitsglaubens. Bei den Deutsch-Elsässern ist die unter ihnen weit verbreitete Gemeinsamkeitsempfindung mit den Franzosen neben gewissen Gemein[Α 225]samkeiten der „Sitte“ und gewisser Güter der „Sinnenkultur“ – auf die namentlich Wittich hingewiesen hat Gemeint ist das Beispiel der Serben und Kroaten, oben, S. 185.
35
– durch politische Erinne[187]rungen bedingt, die jeder Gang durch das, an jenen für den Unbeteiligten ebenso trivialen, wie für den Elsässer pathetisch gewerteten Reliquien (Trikolore, Pompier- und Militärhelme, Erlasse Louis Philippe’s, vor allem Revolutionsreliquien) reiche, Kolmarer Museum zeigt. Gemeinsame politische, zugleich indirekt soziale, als Wahrzeichen der Vernichtung des Feudalismus Wittich unterscheidet zwischen „geistiger Kultur“, die er an Wissenschaft und Poesie messen will, und der „sinnlichen Kultur“, die „zu ihrem Objekt eine vielgestaltige Menge menschlicher Bethätigungen“ hat, „denen allen gemeinsam ist, dass sie sich zunächst [187]und hauptsächlich an unsere Sinne wenden.“ Dabei will die „sinnliche Kultur die möglichst vollkommene Befriedigung des betreffenden Bedürfnisses […] und ferner [die] Erregung eines sinnlichen Wohlgefallens“ erreichen. Neben der Musik und der bildenden Kunst zählt Wittich auch alle Bereiche des Alltags, wie Kleidung, Wohnung oder Speisen zur sinnlichen Kultur. Vgl. Wittich, Deutsche und Französische Kultur, S. 38.
m
von den Massen hochgewertete Schicksale haben diese Gemeinschaft gestiftet, und ihre Legende vertritt die Heldensage primitiver Völker. Die „grande Nation“ war die Befreierin von feudaler Knechtung, galt als Trägerin der „Kultur“, ihre Sprache als die eigentliche „Kultursprache“, das Deutsche als „Dialekt“ für den Alltag,[187]A: Feudalismus,
36
und das Attachement an die Kultursprechenden ist also eine spezifische, dem auf Sprachgemeinschaft ruhenden Gemeinschaftsgefühl ersichtlich verwandte, aber doch nicht mit ihm identische, sondern auf partieller „Kulturgemeinschaft“ und politischer Erinnerung ruhende innere Haltung. Bei den oberschlesischen Polen ferner war im allgemeinen bis vor kurzem kein bewußtes polnisches „Nationalgefühl“ in dem Sinne verbreitet – wenigstens nicht in relevantem Maße –, daß sie sich im Gegensatz zu dem, wesentlich auf der Basis einer deutschen Sprachgemeinschaft stehenden, preußischen politischen Verband gefühlt hätten. Sie waren loyale, wenn auch passive, „Preußen“, so wenig sie auch am Bestand des nationalen politischen Verbands des „Deutschen Reichs“ irgendwie interessierte „Deutsche“ waren und hatten, in ihrer Masse wenigstens, kein bewußtes oder doch kein starkes Bedürfnis der Absonderung von deutschsprachlichen Mitbürgern. Hier fehlte also das auf dem Boden der Sprachgemeinschaft sich entwickelnde „Nationalgefühl“ gänzlich, und von „Kulturgemeinschaft“ konnte bei dem Kulturmangel noch keine Rede sein. Bei den baltischen Deutschen ist [188]weder „Nationalgefühl“ im Sinne einer positiven Wertung der Sprachgemeinschaft mit den Deutschen rein als solcher, noch die Sehnsucht nach politischer Vereinigung mit dem „Deutschen Reich“ verbreitet, die sie vielmehr überwiegend perhorreszieren würden. Vgl. Wittich, Deutsche und Französische Kultur, S. 7; ders., Kultur und Nationalbewusstsein im Elsass. – Straßburg: Verlag der Illustrirten Elsässischen Rundschau 1909, S. 9. Darüber hinaus wird Weber auch über eigene diesbezügliche Erfahrungen aus seiner Militärzeit in Straßburg verfügt haben.
n
Dagegen sondern sie sich, teils und zwar sehr stark aus „ständischen“ Gegensätzen heraus, teils aus Gründen der Gegensätzlichkeit und gegenseitigen „Unverständlichkeit“ und Mißachtung der beiderseitigen „Sitten“ und Kulturgüter, von der slavischen Umwelt, einschließlich speziell auch der russischen, sehr schroff ab, obwohl und sogar zum Teil weil sie überwiegend eine intensive loyale Vasallentreue gegenüber dem Herrscherhause pflegen und an der Machtstellung der von diesem geleiteten, von ihnen selbst mit Beamten versorgten (und wiederum ihren Nachwuchs ökonomisch versorgenden) politischen Gemeinschaft sich so interessiert gezeigt haben, wie irgendein „Nationalrusse“.[188] In A bindet die Anmerkung der Erstherausgeber an: 1) Vor dein Krieg geschrieben. (Anm. d. Herausgeb.)
37
Hier fehlt also ebenfalls alles, was man im modernen, sprachlich oder auch kulturell orientierten Sinn „Nationalgefühl“ nennen könnte. Es ist hier, wie bei den rein proletarischen Polen: Loyalität gegenüber der politischen Gemeinschaft in Verschmelzung mit einem auf die innerhalb dieser vorhandene lokale Sprachgemeinschaft begrenzten, aber stark „ständisch“ beeinflußten und modifizierten Gemeinschaftsgefühl verbreitet. Auch ständisch ist freilich keinerlei Einheitlichkeit mehr vorhanden, wenn die Gegensätze auch nicht so krasse sind, wie sie innerhalb der weißen Bevölkerung der amerikanischen Südstaaten waren. Die inneren ständischen und Klassengegensätze treten aber vorerst, gegenüber der gemeinsamen Bedrohung der Sprachgemeinschaft zurück. Und schließlich gibt es Fälle, wo der Name nicht recht passen will, wie schon bei [189]dem Gemeinschaftsgefühl der Schweizer und Belgier oder etwa der Luxemburger und Liechtensteiner. Nicht die quantitative „Kleinheit“ des politischen Verbandes ist dafür maßgebend, daß wir den Namen auf ihn anzuwenden Bedenken tragen: – die Holländer sind uns eine „Nation“ –, sondern der bewußte Verzicht auf die „Macht“, den jene „neutralisierten“ politischen Gemeinwesen vollzogen haben, läßt uns unwillkürlich jenes Bedenken auftauchen. Die Schweizer sind keine [A 226]eigene „Nation“, wenn man auf die Sprachgemeinschaft oder auf die Kulturgemeinschaft im Sinne der Gemeinsamkeit literarischer oder künstlerischer Kulturgüter sehen will. Das trotzdem, auch trotz aller neuerdings auftauchenden Lockerungen, bei ihnen verbreitete starke Gemeinschaftsgefühl ist aber nicht nur durch Loyalität gegen das politische Gemeinwesen motiviert, sondern auch durch Eigenart der „Sitten“, die – gleichviel, welches der objektive Sachverhalt sein mag – subjektiv als weitgehend gemeinsam empfunden werden und ihrerseits sehr stark durch die sozialen Strukturgegensätze, namentlich gegen Deutschland, überhaupt aber gegen jedes „große“ und daher militaristische politische Gebilde mit seinen Konsequenzen für die Art der inneren Herrschaftsstruktur, bedingt, daher auch durch die Sonderexistenz allein garantiert erscheinen. [188] Im 13. Jahrhundert als Eroberer ins Baltikum gekommen, bildeten die Ritter des Deutschen Ordens bald den grundbesitzenden Adel, der die leitenden politischen und gesellschaftlichen Positionen überwiegend mit deutschen Einwanderern besetzte. Daher behauptete sich auch die deutsche Sprache, abgesehen von einigen Einflüssen durch die umliegenden Sprachen, bis zur Einführung des Russischen im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts als Verwaltungssprache. Seit Mitte des 18. Jahrhunderts dienten deutschstämmige Balten dem Zaren in hohen Positionen des Militärs und der Autokratie; sie waren im 19. und frühen 20. Jahrhundert auch in der regierenden Elite überproportional vertreten (Lamsdorff, Witte).
o
Die Loyalität der kanadischen Franzosen gegenüber der englischen politischen Gemeinschaft ist heute ebenfalls vor allem bedingt durch die tiefe Antipathie gegen die ökonomischen und sozialen Strukturverhältnisse und Sitten in der benachbarten amerikanischen Union, denen gegenüber die Zugehörigkeit zu Kanada als Garantie der überkommenen Eigenart gewertet wird. Die Kasuistik ließe sich leicht vermehren und müßte von jeder exakten soziologischen Untersuchung weiter vermehrt werden. Sie zeigt, daß die mit dem Sammelnamen „national“ bezeichneten Gemeinsamkeitsgefühle nichts Eindeutiges sind, sondern aus sehr verschiedenen Quellen gespeist werden können: Unterschiede der sozialen und ökonomischen Gliederung und der inneren Herrschaftsstruktur mit ihren Einflüssen auf die „Sitten“ können eine Rolle spielen, müssen es aber nicht – denn innerhalb des Deutschen Reichs sind sie so verschieden wie nur möglich – gemeinsame politische Erinnerungen, Kon[190]fession und endlich Sprachgemeinschaft können als Quellen wirken und endlich natürlich auch der rassenmäßig bedingte Habitus. Dieser oft in eigentümlicher Weise. Ein gemeinsames „Nationalgefühl“ verbindet in den Vereinigten Staaten, von der Seite des Weißen aus gesehen, diesen mit dem Schwarzen schwerlich, während die Schwarzen ein amerikanisches „Nationalgefühl“ zum mindesten in dem Sinn hatten und haben, als sie das Recht darauf prätendierten. Und doch ist z. B. bei den Schweizern das stolze Selbstbewußtsein auf ihre Eigenart und die Bereitschaft, sich rückhaltlos für sie einzusetzen, weder qualitativ anders geartet noch quantitativ unter ihnen weniger verbreitet als bei irgendeiner quantitativ „großen“ und auf „Macht“ abgestellten „Nation“. Immer wieder finden wir uns bei dem Begriff „Nation“ auf die Beziehung zur politischen „Macht“ hingewiesen und offenbar ist also „national“ – wenn überhaupt etwas Einheitliches – dann eine spezifische Art von Pathos, welches sich in einer durch Sprach-, Konfessions-, Sitten- oder Schicksalsgemeinschaft verbundenen Menschengruppe mit dem Gedanken einer ihr eigenen, schon bestehenden oder von ihr ersehnten politischen Machtgebildeorganisation verbindet, und zwar je mehr der Nachdruck auf „Macht“ gelegt wird, desto spezifischer. Dieser pathetische Stolz auf die besessene oder dies pathetische Sehnen nach der abstrakten politischen „Macht“ der Gemeinschaft als solcher kann in einer quantitativ „kleinen“ Gemeinschaft, wie der Sprachgemeinschaft der heutigen Ungarn, Tschechen, Griechen weit verbreiteter sein als in einer andern, qualitativ gleichartigen und dabei quantitativ weit größeren, z. B. der Deutschen vor anderthalb Jahrhunderten, die damals ebenfalls wesentlich Sprachgemeinschaft waren, aber keinerlei „nationale“ Machtprätension hatten. [189]A: erscheint.