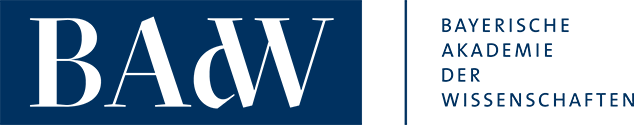[1]Einleitung
1. Die persönliche Ausgangslage: Gesundheitlicher Zusammenbruch und wissenschaftlicher Neubeginn, S. 1; 2. Logisch-methodische Selbstvergewisserung: Die ,Objektivität‘ sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis, S. 12; 3. Annäherungen an ein religionsgeschichtliches Projekt: Lebensgeschichtliche und politische Motive, S. 22; 4. Annäherungen an ein religionsgeschichtliches Projekt: Die wissenschaftliche Problemsituation, S. 26; 4.1. Wirtschaft und Religion aus sozialistischer Perspektive: Marx, Engels, Bernstein, S. 26; 4.2. Wirtschaft und Religion aus ,bürgerlicher‘ Perspektive: Gothein, Brentano, Jellinek, Sombart, Troeltsch, S. 30; 5. Max Webers religionsgeschichtlicher Ansatz, S. 43; 5.1. Die Problemstellung (der erste Aufsatz zur „Protestantischen Ethik“), S. 43; 5.2. Die Problemlösung (der zweite Aufsatz zur „Protestantischen Ethik“), S. 56; 6. ,Kirchen‘ und ,Sekten‘: Ein Vergleich zwischen den USA und Deutschland, S. 68; 7. Kritiken und Antikritiken, S. 71; 8. Ausblick: Über den asketischen Protestantismus hinaus? S. 83; 9. Zur Anordnung der Texte, S. 88.
1. Die persönliche Ausgangslage: Gesundheitlicher Zusammenbruch und wissenschaftlicher Neubeginn
Als Folge seiner schweren und langwierigen Krankheit, die ihn seit dem Ende des Sommersemesters 1898 daran hinderte, seine Lehrverpflichtung als ordentlicher Professor für Nationalökonomie und Finanzwissenschaft an der Philosophischen Fakultät der Universität Heidelberg zu erfüllen, beantragte Max Weber die Entlassung aus dem Amt, die zum 1. Oktober 1903 wirksam wurde. Man verlieh ihm zwar den Titel eines Ordentlichen Honorarprofessors, womit er Mitglied der Universität blieb, aber damit waren weder Sitz und Stimme in der Fakultät noch das Promotionsrecht verbunden. Das Ministerium hatte vorgeschlagen, Webers Honorarprofessur mit einem Lehrauftrag für kleine fachspezifische Vorlesungen zu versehen und ihm die aktive Fakultätsmitgliedschaft zu belassen, aber die Fakultät folgte dieser auch von Weber gewünschten Regelung nicht, weshalb er auch auf die Wahrnehmung eines Lehrauftrags verzichtete.
1
Obgleich das Ausscheiden aus dem Amt für [2]ihn subjektiv eine Befreiung war, kränkte ihn diese Fakultätsentscheidung. So berichtet Marianne Weber in ihrer Biographie: „Er war darüber doch recht erregt und wollte Titel und Lehrauftrag nun auch ablehnen.“ [1]Weber schrieb in diesem Zusammenhang an Franz Böhm, den zuständigen Referenten im Ministerium: „Für die Ablehnung eines Lehrauftrags mußte für mich bestimmend sein, daß bei einigen Mitgliedern der Fakultät formale Bedenken gegen eine Vermehrung der nationalökonomischen Stimmen bestanden. Unter diesen Verhältnissen konnte eine Kontinuation von Spezialvorlesungen und seminaristischer intensiver Arbeit, wie sie meiner Neigung u. Begabung am nächsten läge, wegen des mangeln[2]den Rechts der Teilnahme an den Promotionen nicht in Frage kommen.“ Brief Max Webers an Franz Böhm vom am 29. Juni 1903, GLA Karlsruhe, Nl. Franz Böhm, 52/XIV (MWG II/4). In einem Brief an Heinrich Rickert aus dem Januar 1916 kommt Weber auf den Vorgang zurück. Er habe an Friedrich von Duhn, den Dekan der Philosophischen Fakultät, der offenbar bei ihm angefragt hatte, ob er im Lehrbetrieb nicht aushelfen könne, unter anderem geschrieben, die Fakultät habe seinerzeit „mir das Verbleiben in der Seminardirektion und die Annahme der staatlichen Pension durch ihr Verhalten bei meinem Rücktritt unmöglich gemacht. Jetzt sei ich kein Nationalökonom mehr, übrigens auch nicht bereit, jene Vorgänge jemals zu vergessen. (Ich hatte natürlich beansprucht, daß mir das Recht, an Promotionen beteiligt zu sein, fest gegeben würde. Die Art wie (durch den Senior!) die Fakultät dies (mündlich) ablehnte und die Thatsache, daß sie es ablehnte, genügten, denke wenigstens ich!).“ Brief Max Webers an Heinrich Rickert, vor dem 28. Januar 1916, MWG II/9, S. 266 f.
2
Und in einem ihrer Briefe an Helene Weber, Max Webers Mutter, heißt es: „Ich habe den Eindruck, daß für Max die Wiederaufnahme dieser Lehrtätigkeit hier jetzt jeden Reiz verloren hat, weil man ihn nicht in der Fakultät behalten u. ihm nicht das Promotionsrecht gegeben hat.“ Weber, Marianne, Max Weber. Ein Lebensbild. – Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) 1926, S. 276 (hinfort: Weber, Marianne, Lebensbild).
3
Doch die Wogen scheinen sich nach einer Aussprache zwischen Max Weber und Karl Rathgen, seinem unmittelbaren Kollegen, der zu seiner Entlastung berufen worden war, einigermaßen geglättet zu haben. Brief Marianne Webers an Helene Weber vom 23. November 1903, Bestand Max Weber-Schäfer, Deponat BSB München, Ana 446.
4
Er selbst hatte ja seit dem Ausbruch seiner schweren Krankheit mehrere Anläufe unternommen, für sich eine Lösung jenseits des Ordinariats zu finden, weil er die damit verbundene Arbeitsbelastung nicht mehr glaubte tragen zu können. Andererseits scheute er auch den endgültigen Bruch mit seinem Beruf. So war die getroffene Lösung letztlich für ihn doch ein akzeptabler modus vivendi, denn sie stellte ihn von allen akademischen Pflichten frei, ohne ihn institutionell völlig zu isolieren. Weber wurde fürderhin im Personalverzeichnis der Universität Heidelberg zunächst als Ordentlicher Honorarprofessor, dann, ab 1908, unter der Rubrik „Ordentliche Honorarprofessuren“, als „Inaktiver Ordentlicher Professor“ geführt. Weber hätte übrigens gerne Sombart als Kollegen in Heidelberg gesehen, aber Rathgen machte das Rennen. Sombart galt höheren Orts als Sozialist.
5
Weber traf diese Entscheidung übrigens zu einem Zeitpunkt, als die ökonomische Situation des Ehepaars keineswegs gesichert war. Er hatte zwar Anteil am Weberschen Familienvermögen, aber erst durch das Erbe, das Marianne Weber wenig später zufiel, entspannte sich die finanzielle Lage des Ehepaars.
Weber hatte im Sommersemester 1897 die Nachfolge von Karl Knies auf dem Lehrstuhl für Nationalökonomie in Heidelberg angetreten, der seinerseits auf Karl Heinrich Rau gefolgt war. Beide rechnete man der älteren historischen [3]Schule der Nationalökonomie zu. Es gab also eine Art Heidelberger Tradition dieser Richtung. Zugleich hatte man im Lehrbetrieb die Rechtswissenschaft mit der Nationalökonomie verbunden. Neben seiner Lehrtätigkeit in der Abteilung „Staats- und Cameralwissenschaften“ der Philosophischen Fakultät und der Leitung des „Volkswirtschaftlichen Seminars“ hatte Weber deshalb zusammen mit Georg Jellinek denn auch die Leitung des „Staatswissenschaftlichen Seminars“ inne, das für diese Verbindung von Jurisprudenz und Nationalökonomie stand.
6
Das Programm seiner Lehrveranstaltungen in den drei Semestern bis zu seinem Zusammenbruch entsprach freilich dem Üblichen. Im Mittelpunkt standen die theoretische und die praktische Nationalökonomie sowie nationalökonomische Spezialvorlesungen, etwa über die Arbeiterfrage und über das Geld- und Bankwesen. [3]Das „Staatswissenschaftliche Seminar“ war 1871 von Johann Caspar Bluntschli und Karl Knies als fakultätsübergreifendes Seminar gegründet worden, um die juristische Ausbildung um einen nationalökonomischen Anteil zu ergänzen. Es wurde 1911 aufgelöst. Von diesem Seminar ist Webers eigenes „Volkswirtschaftliches Seminar“ zu unterscheiden, das man bei seiner Berufung auf sein Verlangen hin neu einrichtete und das mit den Seminaren in Karlsruhe und Freiburg bei den „Volkswirtschaftlichen Abhandlungen der badischen Hochschulen“ zusammenwirkte. Dazu unten, Anm. 8.
7
Zu den Lehrveranstaltungen Max Webers in der Zeit von 1892 bis 1903 (Berlin, Freiburg, Heidelberg) Anhang 1 zur Einleitung in MWG III/1, S. 52–63.
Bereits im Sommersemester 1898 verschlechterte sich Webers Gesundheitszustand so sehr, daß er seine Lehrtätigkeit am 25. Juli für den Rest des Semesters abbrechen mußte. Obgleich er in den folgenden Semestern bis zu seinem Verzicht auf das Ordinariat immer wieder Veranstaltungen ankündigte, konnte er diese krankheitsbedingt nicht abhalten.
8
Dieser ,veranstaltungslose‘ [4]Zustand in Heidelberg währte bis zum Jahre 1919, als er aus dem Lehrkörper der Universität ausschied, um eine Professur an der Universität München als Nachfolger von Lujo von Brentano zu übernehmen. Davor lag das Zwischenspiel Wien. Dies hinderte Weber freilich nicht daran, sich auch während dieser Zeit für das Fortkommen seiner Schüler und Doktoranden einzusetzen. Das zeigt sich insbesondere an der Art und Weise, wie er während seiner schweren Krankheit die Publikation ihrer Arbeiten förderte. Dafür standen ihm zwei Reihen zur Verfügung: Die „Volkswirtschaftlichen Abhandlungen der badischen Hochschulen“, die seit 1898 bei Mohr erschienen und die er zusammen mit Carl Johannes Fuchs (Freiburg), Heinrich Herkner (Karlsruhe), Gerhart von Schulze-Gaevernitz (Freiburg) herausgab (wobei Herkner, nach seinem Weggang nach Zürich, schnell aus dem Herausgeberkreis ausschied), sowie „Die Landarbeiter in den evangelischen Gebieten Norddeutschlands“, ebenfalls bei J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) und von Weber für die Publikation der Ergebnisse der Landarbeiterenquete des Evangelisch-sozialen Kongresses etabliert. Zu den „Volkswirtschaftlichen Abhandlungen“ und ihrer Zielsetzung siehe MWG I/4, S. 674 ff., bes. der vermutlich von Weber entworfene Werbetext, ebd., S. 677, zur Landarbeiterenquete des Evangelisch-sozialen Kongresses, ebd., S. 687–711. Über die veröffentlichten Arbeiten, die auf Webers Initiative zurückgehen, informiert Rita Aldenhoff-Hübinger in der Bandeinleitung zu MWG III/5, S. 19 ff. Im Laufe des Jahres 1902 entschied man sich, mit den „Volkswirtschaftlichen Abhandlungen“ von Mohr zu Braun in Karlsruhe zu wechseln. Alle Arbeiten, die aus der Verbindung mit Weber hervorgingen, erschienen in der Zeit von 1898 bis 1902, also im Mohr-Verlag.
9
[4]Weber übernahm zum Sommersemester 1919 als Nachfolger von Lujo von Brentano eine auf seine Interessen zugeschnittene Ordentliche Professur für Gesellschaftswissenschaft, Wirtschaftsgeschichte und Nationalökonomie an der Staatswirtschaftlichen Fakultät der Universität München. Eine Professur in Wien als Nachfolger des verstorbenen Eugen von Philippovich versah er im Sommersemester 1918 nur probeweise.
Weber war vor der Jahrhundertwende mit seinen rechts- und wirtschaftsgeschichtlichen Arbeiten zum Mittelalter und zur Antike, vor allem aber mit seinen Studien zum Agrarkapitalismus und zum Börsenwesen der Neuzeit im Fach und darüber hinaus bekannt geworden. Religionsgeschichtliche Arbeiten dagegen prägten sein wissenschaftliches Profil zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Jedenfalls ist kein veröffentlichter Text überliefert, der so einzuordnen wäre. Noch ging es ihm in erster Linie um Wirtschaft und Politik, nicht um Wirtschaft und Religion.
Max Weber behauptete allerdings später, die These, die er in der Aufsatzfolge „Die protestantische Ethik und der ,Geist‘ des Kapitalismus“ aus den Jahren 1904 und 1905 vorlegte, habe er bereits vor der Jahrhundertwende in seinen Vorlesungen erörtert.
10
Prüft man diese Vorlesungen darauf hin, so ergibt sich freilich kein eindeutiges Bild. In der Vorlesung über die „Geschichte der Nationalökonomie“, die er allerdings nur in Freiburg hielt und an die man in diesem Zusammenhang zunächst denken könnte, behandelt er zwar die wirtschaftlichen Auffassungen der Reformationszeit. So finden sich dort Stichworte zu Luther und Melanchthon mit dem Hinweis, sie stünden auf den Schultern von Thomas von Aquin und der Kanonisten. Jene beschäftigten sich wie diese mit dem Wucher und dem gerechten Preis. Weber erwähnt ausdrücklich Luthers „Sermon vom Wucher“ aus dem Jahre 1519, wertet Luthers Position gegenüber allem „Rechnende[n]“ aber als einen Rückschritt, verglichen mit der Auffassung der Kanonisten. Aber von den Reformierten, den asketischen Protestanten, wie er sie später nannte, spricht er in dieser Vorlesung nicht. Weber schreibt 1910: „Meine Arbeiten über diese Dinge, die ich z. T. schon vor 12 Jahren im Kolleg vortrug, sind nicht (wie Rachfahl nach Tröltsch annimmt) erst durch Sombarts ,Kapitalismus‘ veranlaßt worden (s. darüber meine ausdrückliche Bemerkung Archiv XX S. 19 Anm. 1.)“ Weber, Antikritisches zum „Geist“ des Kapitalismus, unten, S. 575. Diese Zeitangabe spricht für eine Vorlesung aus dem Wintersemester 1897/98 oder dem Sommersemester 1898. Wichtig dabei ist die Einschränkung „z[um] T[eil]“.
11
Weber, Geschichte der Nationalökonomie, in: MWG III/1, S. 665–702, hier S. 685.
Zieht man die Heidelberger Vorlesung „Allgemeine (,theoretische‘) Nationalökonomie“ heran, die zeitlich infrage kommt, so wird das Bild schon klarer. [5]Denn hier geht er in § 6, überschrieben „Verhältnis der Wirtschaft zu den anderen Culturerscheinungen, insbesondere Recht und Staat“, auf die Rolle der Religion für die Stellung des Menschen zu seiner Welt ein.
12
Dies geschieht im Zusammenhang mit einer Kritik am historischen Materialismus. Weber wehrt sich gegen dessen Vorstellung von Überbau und Basis: Die Kultur, insbesondere die Religion, etwa die Lehre von der Prädestination, sei kein bloßer Reflex der ökonomischen Existenzbedingungen. Denn zum einen produzierten dieselben ökonomischen Verhältnisse verschiedene ,Reflexe‘, zum andern seien die Bedürfnisse des Menschen als Träger der Kultur nicht allein durch ökonomische Verhältnisse bestimmt. Vielmehr seien für deren Entwicklung „zwar auch, aber nicht nur ökonomische Verh[ältnisse] wirksam, sondern die Gesamtauffassung seiner Stellung in der Welt“, wozu Weber hier ausdrücklich die Religion rechnet. [5]Weber, Allgemeine („theoretische“) Nationalökonomie § 6, MWG III/1, S. 363–370, hier S. 365.
13
Auch folge „die Gestaltung der Empfindungs- und Gedanken-Welt des Menschen […] ihren eigenen Gesetzen“, Ebd.
14
sei also schon deshalb mehr als nur Reflex des Ökonomischen. Zwar sei es methodisch durchaus zulässig, „vom Ökonomischen als dem Fundamentalen“ auszugehen, Ebd., S. 366.
15
nicht aber, es dabei zu belassen. Jeden Reduktionismus dieser Art weist Weber bereits in dieser Vorlesung zurück. Ebd., S. 367.
Prüft man schließlich die Vorlesung „Praktische Nationalökonomie“, die Weber zunächst in Freiburg, dann im Wintersemester 1897/98 in Heidelberg hielt, hier mit dem Zusatz: „Handels-, Gewerbe- und Verkehrspolitik“,
16
so kommt man der Aussage von 1910 dagegen schon ziemlich nahe. Denn Weber behandelt in dieser Vorlesung unter anderem die wirtschaftspolitischen Ideale der „Theokratien“. Weber, Max, Praktische Nationalökonomie: Handels-, Gewerbe- und Verkehrspolitik, 5-stündig, Wintersemester 1897/98, Vorlesungsnotizen (MWG III/2). Die Vorlesung ist in 5 Kapitel bzw. Bücher und 15 Paragraphen gegliedert, wobei Weber die typischen Vorstadien der Volkswirtschaftspolitik, dann die wirtschaftspolitischen Doktrinen des Altertums, des Mittelalters, des Merkantilismus und Protektionismus und des ökonomischen Liberalismus durchgeht. Die Vorlesung wurde von ihm auch für das Wintersemester 1898/99 angekündigt, aber wegen seines gesundheitlichen Zusammenbruchs nicht mehr gehalten. Man kann also mit Gründen vermuten, daß sich seine Bemerkung von 1910 („vor 12 Jahren“) auf die Vorlesung „Praktische Nationalökonomie“ aus dem Wintersemester 1897/98 bezieht.
17
In diesem Zusammenhang diskutiert er die Umbildung der „canonistischen Doktrinen“, wobei er zwei „auseinanderstrebende Richtungen“ unterscheidet: die der Jesuiten von der Calvins und seiner Anhänger. Während Luther in seinem wirtschaftspolitischen Denken rück[6]ständig geblieben sei, hätten „Calvin u. die Protestanten der Handelsstädte“ die Arbeit zum allgemeinen Lebenszweck erhoben. Zugleich hätten sie die kanonistischen Bedenken gegen den Handel und gegen das Zinsnehmen zerstreut. Erziehung zu produktiver Arbeit habe im Zentrum der calvinistischen Umbildung der kanonistischen Doktrinen gestanden. Weber spricht von der „Züchtung des Capitalismus u. der Geldwirtschaft“, von der „Züchtung des wirtsch[aftlichen] Eigennutzes“ und von der Theorie „der Produktivität niederer Löhne“. Nicht der Reichtum als solcher, sondern nur sein unsittlicher Erwerb, etwa mittels Glücksspiel, oder seine unproduktive Verwendung, etwa in Gestalt von Luxuskonsum, werde perhorresziert. Weber sieht darin gar eine „ethische Theorie des wirtsch[aftlichen] Geizes“, schränkt allerdings sofort ein, dieses Urteil sei wohl zu hart angesichts „der Lebensauffassung derjenigen tüchtigsten Elemente des emporstrebenden Capitalismus, dem die Gewinnung des Reichtums ethischer Beruf ist (Hansestädte)“. Die Zusammenfassung seiner Überlegungen lautet: „Also: Entfesselung u. ethische 〈Rechtfertigung〉 Sanktionierung des Erwerbstriebes, wirtsch[aftlichen] Eigennutzes[,] dag[e]g[en] Einschränkung des Genußtriebes.“ Die Stichworte finden sich ebd., § 3 „Der Merkantilismus und Protektionismus“, GStA PK, VI. HA, Nr. 31, Bd. 2, Bl. 36–59 (MWG III/2), hier Bl. 46r.
18
Später, im zweiten Aufsatz der Protestantismusstudien, spricht er vom asketischen Sparzwang, der auf dem asketischen Protestanten laste. [6]Ebd., Bl. 46v.
19
Auch die Formel vom „heroischen Zeitalter des Capitalismus“ verwendet er bereits in dieser Vorlesung. Weber, Protestantische Ethik II, unten, S. 412.
20
Das Spätere ist also tatsächlich im Jahre 1898 im Keim vorhanden. Bis zur Ausarbeitung des geschichtlichen Zusammenhangs zwischen asketischem Protestantismus und modernem Berufsmenschentum ist es freilich noch ein weiter Weg. Weber, Praktische Nationalökonomie § 3, Bl. 46v, sowie Weber, Protestantische Ethik II, unten, S. 276.
Es gibt zudem einen Brief von Max Weber an Paul Siebeck, aus dem hervorgeht, daß er damals schon mit Doktoranden über den Zusammenhang von Religion und Wirtschaft, insbesondere über die wirtschaftspolitischen Auffassungen Calvins, diskutierte. So schreibt er am 7. Dezember 1898 an den Verleger, als eine der Abhandlungen, die im Rahmen der „Volkswirtschaftlichen Abhandlungen der Badischen Hochschulen“ voraussichtlich publikationswürdig seien, könne er die Arbeit von „Kamm. Joh. Calvin als Wirtschaftspolitiker (mit einer Einleitung von mir, – auf Grund Genfer ungedruckten Materials) fertig Frühjahr 1900, ca 6 Bogen“ nennen.
21
Maximilian Kamm hatte im Sommersemester 1896 sein Studium an der Universität Heidelberg aufgenommen und im Sommersemester 1897 und im Wintersemester 1897/98 [7]intensiv bei Max Weber studiert. Brief Max Webers an Paul Siebeck vom 7. Dezember 1898, VA Mohr/Siebeck, Deponat BSB München, Ana 446 (MWG II/3).
22
Diese von Weber avisierte Arbeit ist allerdings nie erschienen. [7]Kamm belegte bei Weber im Sommersemester 1897 die Vorlesung „Allgemeine (,theoretische‘) Nationalökonomie“ und das Volkswirtschaftliche Seminar, im Wintersemester 1897/98 die Vorlesungen „Agrarpolitik“ und „Praktische Nationalökonomie“. Vgl. die Einträge in die Quästurlisten der Universität Heidelberg, UA Heidelberg, Rep. 27–1409.
23
Nimmt man aber die Dissertation von Martin Offenbacher hinzu, die im Jahre 1900 tatsächlich erschien und von Weber für seine Abhandlung verwendet wurde, Maximilian Kamm wechselte zum Sommersemester 1898 an die Universität Straßburg. Seine Dissertation schloß er nicht ab.
24
so spricht doch vieles dafür, daß er sich tatsächlich bereits vor der Jahrhundertwende mit dem Einfluß des Protestantismus, insbesondere der Reformierten, auf die Entwicklung der Wirtschaft beschäftigte, wenngleich dies zu diesem Zeitpunkt noch keinen literarischen Niederschlag in seinen veröffentlichten Arbeiten fand und auch kein Schwerpunkt der Dissertationen an seinem Heidelberger Volkswirtschaftlichen Seminar war. Offenbacher, Martin, Konfession und soziale Schichtung. Eine Studie über die wirtschaftliche Lage der Katholiken und Protestanten in Baden (Volkswirtschaftliche Abhandlungen der Badischen Hochschulen, hg. von Carl Johannes Fuchs, Gerhard von Schulze-Gävernitz, Max Weber, 4. Band, 5. Heft). – Tübingen und Leipzig: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) 1900 (hinfort: Offenbacher, Konfession); dazu: Weber, Protestantische Ethik I, unten, S. 124 ff. in den Fußnoten.
25
Aus den Arbeiten der Schüler, von denen wir wissen, geht hervor, daß der Schwerpunkt auf anderen Themen lag. Dazu die Einleitungen von Rita Aldenhoff-Hübinger in MWG III/4, S. 15 ff. und MWG III/5, S. 19 f.
Man kann an den aus der Theorievorlesung berichteten skizzenhaften Bemerkungen zur Rolle der Religion im wirtschaftlichen Leben allerdings bereits ein methodisches und theoretisches Credo erkennen. Methodisch geht es um die richtige Gewichtung der ökonomischen Faktoren bei der Analyse von Kulturphänomenen, theoretisch um die Rolle, die man den ideellen Interessen für das Handeln von Menschen und Menschengruppen zuerkennt. Weber verweist zudem auf die „ungeheure Bedeutung“ des Zufälligen, des Kontingenten, in der Geschichte. Es gibt für ihn keine Geschichtsgesetze nach Art des historischen Materialismus. Vor allem aber: Der Mensch ist nicht „allein Produkt seines ökon[omischen] Milieu[s].“
26
Weber, Allgemeine („theoretische“) Nationalökonomie § 6, MWG III/1, S. 366.
Wir wissen nicht im Detail, mit welchen Fragen und Stoffen sich Max Weber während der Zeit von Juli 1898, dem Ausbruch der Krankheit, bis Oktober 1903, als er sein Ordinariat niederlegte, beschäftigte. Zunächst mußte er auf jegliche geistige Arbeit verzichten.
27
Erst im Sommer 1901 liest er wieder ein [8]Buch, freilich keines aus seinem Fach. Weber, Marianne, Lebensbild, S. 255: „Alles und jedes ist zu viel: Er kann ohne Qualen weder lesen noch schreiben, noch reden, noch gehen und schlafen. Alle geistigen und ein Teil der körperlichen Funktionen versagen [den] Gehorsam. Zwingt er [8]sie dennoch zum Dienst, so bedroht ihn das Chaos, ein Gefühl, als könne er in den Wirbel eines den Geist verdunkelnden Erregungszustandes geraten.“
28
Nur allmählich dürfte er sich wieder mit Beiträgen seiner Fachkollegen im engeren Sinn beschäftigt haben, so zum Beispiel mit Georg Simmels großer Studie über die Psychologie oder Philosophie des Geldes. Marianne Weber berichtet, es sei ein Buch über Kunstgeschichte gewesen. Ebd., S. 264.
29
Aber das Interesse scheint zunächst noch relativ diffus. Marianne Weber berichtet, er habe ein „fabelhaftes Gemisch“ an Literatur zu sich genommen, bestehend aus „Geschichte, Verfassung und Wirtschaft der Klöster, dann Aristophanes, Rousseaus Emil[e], Voltaire, Montesquieu, Taines sämtliche Bände und englische Schriftsteller“. Ebd., S. 266.
30
Dies spricht jedenfalls nicht dafür, daß er zu diesem Zeitpunkt bereits gezielt für die Studien über den asketischen Protestantismus recherchiert. Ebd., S. 267.
31
Dies gilt auch für die dreibändige Geschichte des Neuen Testaments von Adolf Hausrath, die Marianne Weber erwähnt. Sie reicht von der Jesusbewegung bis zum Zeitalter Hadrians und den Anfängen der Gnosis, ist also für Webers Thema allenfalls indirekt relevant. Vgl. Hausrath, Adolf, Neutestamentliche Zeitgeschichte. – Heidelberg: Verlagsbuchhandlung von Fr. Bassermann. Erster Teil: Die Zeit Jesu, 1868; Zweiter Teil: Die Zeit der Apostel, 1872; Dritter Teil: Die Zeit der Märtyrer und das nachapostolische Zeitalter, 1874.
Mit der Rückkehr des Ehepaars nach Heidelberg zu Webers 38. Geburtstag nach nahezu zweijähriger Abwesenheit begann, wie Marianne Weber es formulierte, eine neue Produktionsphase.
32
Weber tastete sich vorsichtig in sein Fach zurück. Er tat es zunächst mit Auftragsarbeiten. Die erste größere schriftliche Äußerung nach dem Zusammenbruch ist eine Rezension. Sie gilt einem Buch, das sich mit dem Zusammenspiel von Rechtswissenschaft und Nationalökonomie, von normativen und empirischen Fragen, beschäftigt. Weber bespricht Philipp Lotmars Studie über den Arbeitsvertrag. Weber, Marianne, Lebensbild, S. 272. Marianne Weber fügt hinzu, sie sei „völlig anderen Charakters als die frühere.“ In die neue Wohnung in Heidelberg zogen sie wohl am 12. April 1902. Das Ehepaar hatte etwa zwei Jahre zuvor den Heidelberger Hausstand aufgelöst und war, nach einem längeren Aufenthalt in einer Klinik in Urach, auf Reisen gegangen. Es hielt sich in dieser Zeit überwiegend in Italien auf.
33
Die Universität Heidelberg wollte im Jahre 1903 das einhundertjährige Jubiläum ihrer ,zweiten Gründung‘ feiern. Weber, Max, Rezension von: Philipp Lotmar, Der Arbeitsvertrag, MWG I/8, S. 34–61. Auch der zweite Beitrag ist eine Rezension: Weber, Rezension von: Alfred Grotjahn, Über Wandlungen in der Volksernährung, MWG I/8, S. 62–72.
34
Dafür plante die Philosophische Fakultät eine Fest[9]schrift und bat Weber um einen Beitrag dazu, bezogen auf die Geschichte seines Fachs. Dies war der äußere Anlaß, der zu Webers Abhandlung „Roscher und Knies und die logischen Probleme der historischen Nationalökonomie“ führte. Den Teil über „Roschers ,historische Methode‘“ begann er wohl im Frühjahr 1902, und er konnte diesen „Seufzeraufsatz“ (Marianne Weber) Karl Friedrich Markgraf von Baden erneuerte am 13. Mai 1803 nach dem Reichsdeputationshauptschluß die 1386 ins Leben gerufene Universität mittels eines zweiten Stiftungsbriefs. Deshalb trägt sie auch den Doppelnamen Ruperto-Carola (Ruprecht I. von der Pfalz 1. Stifter, Karl Friedrich Markgraf von Baden 2. Stifter).
35
im Oktober 1903, allerdings nicht in der Festschrift, publizieren. [9]Brief Marianne Webers an Helene Weber vom 4. Juli 1903, Bestand Max Weber-Schäfer, Deponat BSB München, Ana 446.
36
Die Teile über Knies folgten erst 1905 bzw. 1906. Marianne Weber, Lebensbild, S. 278, spricht von einer „lastende[n] methodologische[n] Zufallsarbeit“. Diese wurde denn auch für die Festschrift nicht rechtzeitig fertig, und Weber fand, diese methodologische Betrachtung passe sowieso nicht dort hinein.
37
Für diese Arbeiten zur Logik und Methodik seines Faches mußte erst eine wichtige Voraussetzung geschaffen sein: Heinrich Rickert beendete 1902 seine vor der Jahrhundertwende begonnene große Studie über „Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung“ mit der Publikation der letzten beiden Kapitel. Gemeint sind: Weber, Roscher und Knies I–III.
38
Weber benutzte seine Auseinandersetzung mit Roscher nicht zuletzt dazu, „die Brauchbarkeit der Gedanken dieses Autors [nämlich Rickerts] für die Methodenlehre unserer Disziplin zu erproben.“ Rickert, Heinrich, Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung. Eine logische Einleitung in die historischen Wissenschaften. – Tübingen und Leipzig: Verlag J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) 1902. Die ersten drei Kapitel dieser Untersuchung waren bereits 1896 erschienen. Nun fügte Rickert zwei weitere Kapitel für die Veröffentlichung als Buch hinzu: 4. Kapitel: Die historische Begriffsbildung; 5. Kapitel: Naturphilosophie und Geschichtsphilosophie. Entscheidend für Weber ist das 4. Kapitel, in dem Rickert den logischen Begriff des absolut Historischen als ein durch Wertbeziehung konstituiertes „historisches Individuum“, als ein logisch Unteilbares (ln-dividuum), entwickelt, aber auch die naturwissenschaftlichen Bestandteile in den historischen Wissenschaften diskutiert (S. 480 ff.). Danach gibt es bei den historischen Begriffen eine Abstufung nach Graden der Allgemeinheit, ohne daß dies ihren Charakter, historische, d. h. genetische Begriffe zu sein, tangierte. Rickert spricht in diesem Zusammenhang von relativ historischen Begriffen, wie er auch in den naturwissenschaftlichen Begriffen, den „Gattungsbegriffen“, historische Bestandteile anerkennt. Die logischen Begriffe von Natur und Geschichte bedingten sich also wechselseitig. Weber hatte sich vor dem Zusammenbruch skeptisch zu Rickerts bis dahin vorliegendem Versuch geäußert. Nun zeigte er sich von Rickerts Lösung weitgehend überzeugt.
39
Denn mit Rickert hatte er einen logischen Standpunkt gewonnen, der ihm im Methodenstreit seines Faches zwischen der historischen und der theoretischen Richtung eine befriedigende Lösung versprach. Weber, Roscher und Knies I, S. 7, Fn. 1.
40
Im Sommer 1902 hatte Weber aus Florenz an seine Frau [10]geschrieben: „Rickert habe ich aus, er ist sehr gut, zum großen Teil finde ich darin Das, was ich selbst, wenn auch in logisch nicht bearbeiteter Form, gedacht habe. Gegen die Terminologie habe ich hie und da Bedenken.“ Der Methodenstreit war 1883 durch eine Rezension von Gustav Schmoller ausgelöst worden, in der er Bücher von Carl Menger und Wilhelm Dilthey besprach. Dabei benutzte er Dilthey auch dazu, seine mitunter sehr polemische Kritik an Menger phi[10]losophisch zu fundieren. Er bekennt ausdrücklich: „Nur bei Menger kann ich die Polemik nicht ganz zurückhalten, da seine Angriffe mich theilweise persönlich mitbetreffen“, heißt es zu Anfang der Rezension. Siehe Schmoller, Gustav, Zur Methodologie der Staats- und Sozial-Wissenschaften, in: Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirthschaft im Deutschen Reich, 7. Jg., 3. Heft, 1883, S. 239–258, hier S. 239. Menger antwortete mit einer Gegenpolemik. Seitdem schwelte im deutschsprachigen Raum der Konflikt zwischen der historischen Schule und der theoretischen Schule, wobei man mit der letzteren die Vertreter der sogenannten österreichischen Grenznutzenschule, vor allem Carl Menger, Eugen von Böhm-Bawerk und Friedrich von Wieser, meinte.
41
Dennoch schließt er sich zunächst nicht nur der Sache, sondern auch dieser Terminologie weitgehend an. Karte Max Webers an Marianne Weber vom [11. April 1902], Bestand Max Weber-Schäfer, Deponat BSB München, Ana 446 (MWG II/3).
Man gewinnt also den Eindruck, als wollte Weber, angestoßen durch äußere Anlässe, an seine literarische Produktion aus der Zeit vor dem Zusammenbruch anknüpfen. Dies gilt auch noch für die dritte wichtige literarische Äußerung nach dem Neubeginn: für seine Kritik an dem preußischen „Vorläufigen Entwurf eines Gesetzes über Familienfideikommisse nebst Begründung“, der im Frühsommer 1903 veröffentlicht worden war. In einer langen Abhandlung sucht Weber auf der Grundlage von vor Jahren erhobenen agrarstatistischen Daten die negativen sozial- und staatspolitischen Folgen dieses geplanten Gesetzes nachzuweisen.
42
Dabei wiederholte er bereits zuvor Gedachtes und Geschriebenes, wenn auch vielleicht in konziserer Form. Weber, Max, Agrarstatistische und sozialpolitische Betrachtungen zur Fideikommißfrage in Preußen, in: MWG I/8, S. 81–188 (hinfort: Weber, Fideikommißfrage).
43
Verglichen mit den Arbeiten vor dem Zusammenbruch bringt dieser Aufsatz aus dem Jahr 1904 mit seiner Kritik an den feudalen Prätentionen des Bürgertums aber nichts entscheidend Neues. Er ist zudem weniger wissenschaftlich als politisch motiviert. Weber hatte zu diesem Zeitpunkt noch den Plan, eine zusammenhängende und vergleichend angelegte Untersuchung über den Agrarkapitalismus zu schreiben, in der er wohl seine verschiedenen Beiträge zu diesem Thema zusammengefaßt hätte. Diesen Plan ließ er fallen, nicht zuletzt wohl deshalb, weil sich sein Erkenntnisinteresse verlagerte. In der Vorlesung „Abriß der universalen Sozial- und Wirtschaftsgeschichte“ aus dem Wintersemester 1919/20 kam er dann noch einmal auf diese Themen zurück. Dazu MWG III/6, S. 98 ff. (Erstes Kapitel. Haushalt, Sippe, Dorf und Grundherrschaft (Agrarverfassung).)
44
Dazu der Editorische Bericht zu Weber, Fideikommißfrage, MWG I/8, S. 80 ff. Entscheidend Neues bringen auch nicht der Vortrag in St. Louis (Weber, The Relations of the Rural Community to Other Branches of Social Science, MWG I/8, S. 200–243) und die zuletzt aufgefundenen Beiträge zu einer amerikanischen Enzyklopädie, die allerdings vermutlich in das Jahr 1905 fallen (Weber, Agriculture and Forestry, und Weber, [11]Industries, in: MWG I/8, Ergänzungsheft, dort auch die Einleitung, S. 1–15). Schließlich ist noch der Aufsatz „Der Streit um den Charakter der altgermanischen Sozialverfassung“ zu erwähnen, ein Nebenprodukt von Webers Vorbereitung auf den St. Louis-Vortrag, MWG I/6, S. 228–299. Auch dieser Aufsatz steht in einer Kontinuität mit den Arbeiten vor dem Zusammenbruch. Ob Kontinuität oder Neuanfang, es ist jedenfalls erstaunlich, was Weber nach den langen Jahren der Arbeitsunfähigkeit im Jahre 1904 leistete, zumal er auch noch für längere Zeit auf USA-Reise war.
[11]Zwei Publikationen aber, die ebenfalls 1904 erscheinen, rechtfertigen Marianne Webers Wort von der neuen Produktionsphase: der Aufsatz „Die ,Objektivität‘ sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis“ und der erste Aufsatz „Die protestantische Ethik und der ,Geist‘ des Kapitalismus“, dem dann 1905 der zweite Aufsatz gleichen Titels folgt.
45
Von beiden Publikationen läßt sich sagen, mit ihnen habe Weber trotz Vorläufern einen neuen wissenschaftlichen Weg begonnen. In beide Publikationen spielen auch Krisenerfahrungen hinein. Es ist die Krise des Fachs, in dem nach wie vor Vertreter der historischen und der theoretischen Richtung miteinander stritten, es ist aber auch die persönliche Krise, der Verlust der Arbeitsfähigkeit. In diesen Texten findet man deshalb auch nur lose Anknüpfungen an die Texte aus der Zeit vor dem Zusammenbruch, im Objektivitätsaufsatz zweifellos deutlicher als in den Protestantismus-Aufsätzen. Denn im Objektivitätsaufsatz ist der Bezug auf den Methodenstreit in der deutschsprachigen Nationalökonomie evident. Damit hatte sich Weber bereits vor dem Zusammenbruch beschäftigt, aber noch keine befriedigende Lösung für sich gefunden. Diese liefert er jetzt. Mit den Aufsätzen „Die protestantische Ethik und der ,Geist‘ des Kapitalismus“ aber scheint er sich auf ein von ihm zwar antizipiertes, aber neu zu erschließendes Gebiet zu begeben. Gemeint sind: Weber, Max, Die „Objektivität“ sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis, in: Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, 19. Band, Heft 1, 1904, S. 22–87 (hinfort: Weber, Objektivität; MWG I/7), sowie Weber, Protestantische Ethik I und II, unten, S. 97–215 und 222–425.
46
Sie verlangten die Erweiterung der bisher vorwiegend rechts- und wirtschaftsgeschichtlichen Betrachtungsweise um die religionsgeschichtliche. Denn Weber sucht eine religionsgeschicht[12]liche Erklärung für die moderne Idee der Berufspflicht, die Idee vom weltlichen Beruf als einer Berufung. Es geht ihm, wie er sich später ausdrückt, vor allem um die Herkunft, aber auch um die Zukunft des modernen Berufsmenschentums. Interessant sind in diesem Zusammenhang auch die Briefe, die Max Weber während seines kurzen Aufenthalts in Holland im Juni 1903 an seine Frau Marianne schreibt, in denen es allerdings vorwiegend um ästhetische Fragen geht. Weber zeigt sich besonders beeindruckt von den Arbeiten des späten Rembrandt, von seinem Alterswerk, das ihn, nicht zuletzt ,geläutert‘ durch sein persönliches Unglück, auf der Höhe seiner Kunst zeige, die Weber mit der von Rubens kontrastiert. Weber stellt fest, Rubens sei „doch überhaupt nicht neben Rembrandts in Freiheit u. Armuth gewachsener protestantischer Seele zu genießen, dieser Höfling, dessen Bildern man die Jesuiten-Erziehung anmerkt.“ Brief Max Webers an Marianne Weber vom [13. Juni 1903], Bestand Max Weber-Schäfer, Deponat BSB München, Ana 446 (MWG II/4). Darüber hinaus geht er auf die Kirchenarchitektur und auf den Ablauf des Gottesdienstes ein, immer im Vergleich zu den Erfahrungen, die er zusammen mit seiner Frau während ihres Italienaufenthalts mit dem dortigen Katholizismus gemacht hatte.
2. Logisch-methodische Selbstvergewisserung: Die ,Objektivität‘ sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis
Verweilen wir zunächst beim Objektivitätsaufsatz, welcher, neben dem Roscher-Aufsatz, der logisch-methodischen Selbstvergewisserung diente. Auch hierfür gab es einen äußeren Anlaß: die Umgründung des Braunschen Archivs in das Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik und Webers Aufnahme in den Herausgeberkreis. Nachdem er die Universität ,verlassen‘ hatte, wurde das 1904 gegründete Archiv für ihn ein wichtiges professionelles Forum.
47
Die Entstehung dieser neuen Zeitschrift war freilich nicht sein Werk. [12]Ein anderes blieb natürlich der Verein für Sozialpolitik. Die Mitarbeit im Archiv war für ihn freilich keine reine Freude. Immer wieder überlegte er im Laufe der Jahre, ob er die Mitherausgeberschaft nicht niederlegen solle. Er blieb dann doch bei der übernommenen Verpflichtung, meist, weil Paul Siebeck ihn darum bat.
48
Sie bot ihm aber die Möglichkeit, seiner Vorstellung von einer Sozialwissenschaft als einer Kulturwissenschaft Geltung zu verschaffen. Am 5. April 1905 heißt es in einem Brief an Willy Hellpach, daß „das Schwergewicht der Arbeit des ,Archiv‘ auf der ,kulturwissenschaftl[ichen]‘ Seite“ liege [13]und daß „wir programmatisch für den Grundsatz eintreten, die Eigenart der historischen Methodik neben dem Recht der ,Gesetzesbildung‘ zu wahren.“ Weber fügt in diesem Brief hinzu, daß er „die begriffliche Durchdringung des historischen Stoffs und die Vertretung des Rechts der ,Theorie‘ zur wesentlichen Aufgabe unsrer Zeitschrift gemacht zu sehen wünsche“, und dies gehe nicht zuletzt aus seinem Objektivitätsaufsatz hervor. Das Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik ging aus dem Archiv für soziale Gesetzgebung und Statistik hervor, einer „Vierteljahresschrift zur Erforschung der gesellschaftlichen Zustände aller Länder“, wie es im Untertitel heißt. Sie wurde von Heinrich Braun, übrigens unter tätiger Mitwirkung von Werner Sombart, herausgegeben, später an Edgar Jaffé für 60 000 Mark verkauft. Über die Beziehung zwischen Heinrich Braun und Werner Sombart u. a. vom Brocke, Bernhard, Werner Sombart 1863–1941. Eine Einführung in Leben, Werk und Wirkung, in: Sombarts ,Moderner Kapitalismus‘. Materialen zur Kritik und Rezeption, hg. von Bernhard vom Brocke. – München: Deutscher Taschenbuch Verlag 1987 (hinfort: Brocke, Materialien), S. 34–65. Daß die neue Zeitschrift schließlich beim Verlag J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) erschien, war wohl Max Webers Werk. In dem Vertrag, der am 23. August 1903 zwischen Paul Siebeck und Edgar Jaffé abgeschlossen wurde, heißt es: „§ 2 Dr. Jaffé übernimmt die Redaktion des Archivs, er hat allein das Recht sich Mitredakteure, Mitherausgeber oder Stellvertreter zu wählen. Er bestimmt die Mitarbeiter sowie die Zusammensetzung des Inhaltes des Archivs.“ (Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, Nl. 488 (Archiv des Verlages Mohr Siebeck), K. 950.) Jaffé entschied sich für Werner Sombart und Max Weber als Mitherausgeber. Das Titelblatt des 1. Bandes lautete: Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik. Neue Folge des Archivs für soziale Gesetzgebung und Statistik, begründet von Heinrich Braun, herausgegeben von Werner Sombart, Professor in Breslau, Max Weber, Professor in Heidelberg und Edgar Jaffé in Heidelberg. Neunzehnter Band (der neuen Folge 1. Band). – Tübingen: Verlag von J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) 1904.
49
Dieser Aufsatz enthält denn auch ein doppeltes Programm, eines für die neue Zeitschrift, eines für ihn selber. Zum einen sagt Weber darin Wichtiges über Ziel und Charakter dieser neuen Zeitschrift, in Ergänzung zum gemeinsamen „Geleitwort“ der Herausgeber und auch hier noch in deren Namen, [13]Brief Max Webers an Willy Hellpach vom 5. April 1905, GStA PK, VI. HA, Nl. Max Weber, Nr. 17, Bl. 8–10a (MWG II/4). Webers Korrespondenz mit Hellpach über wissenschaftstheoretische Fragen dreht sich vor allem um den Ansatz von Karl Lamprecht, dem Hellpach zuneigte und von dem Weber sagte, dieser sei wissenschaftlich doch nicht ernst zu nehmen. Lamprecht sei ein „Schwindler und Charlatan schlimmster Sorte“, „soweit er als Culturhistoriker und Culturtheoretiker auftritt“, es handle sich bei ihm um „Geschwätz ohne jeglichen wissenschaftlichen Werth“, um „reine[s] Dilettantentum“. Brief Max Webers an Willy Hellpach vom 31. März 1905, ebd., Nr. 17, Bl. 2–5 (MWG II/4).
50
zum anderen äußert er sich über sein eigenes kulturwissenschaftliches Forschungsprogramm. Dessen Realisierung beginnt er mit der Aufsatzfolge „Die protestantische Ethik und der ,Geist‘ des Kapitalismus“. Der Objektivitätsaufsatz und die „Protestantische Ethik“, beide im Archiv erschienen, gehören also in diesem Sinn zusammen, obgleich sie in voneinander unabhängigen Diskussionszusammenhängen stehen und wohl auch nacheinander geschrieben sind. [Sombart, Werner, Max Weber und Edgar Jaffé], Geleitwort, in: AfSSp, 19. Band, Heft 1, 1904, S. I–VII (hinfort: Geleitwort). Über die Autorschaft des „Geleitworts“ Ghosh, Peter, „Max Weber, Werner Sombart and the Archiv für Sozialwissenschaft: the authorship of the ,Geleitwort‘ (1904), in: History of European Ideas, Vol. 30, Issue 1, 2010, pp. 71–100.
51
Dazu der Brief Max Webers an Paul Siebeck vom 12. April 1904, VA Mohr/Siebeck, Deponat BSB München, Ana 446 (MWG II/4), in dem es heißt, erst müsse der Objektivitätsaufsatz für Heft 1 des Archivs abgeschlossen werden, dann folge die „Protestantische Ethik“, „von der ich mir viel verspreche.“ Weber schiebt dann noch den Aufsatz über die Fideikommißfrage in Preußen dazwischen. Alle drei erschienen im Archiv. Weber bestückte also die ersten Hefte der neuen Zeitschrift mit drei großen Aufsätzen. Sie addieren sich auf 181 Seiten.
Nicht zufällig gliedert Weber den Objektivitätsaufsatz auch äußerlich in zwei Teile. Im ersten Teil ergänzt er, wie gesagt, das „Geleitwort“ des Archivs für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, das von den drei Herausgebern verantwortet wurde, um einen dort aus seiner Sicht nur unzureichend entwickelten Gedankengang. Im zweiten Teil entwickelt er den Gedanken einer Sozialwissenschaft als Wirklichkeitswissenschaft und die Art der Begriffsbildung, die man dafür benötigt. Hier zeichnet er die Umrisse seines eigenen Forschungsprogramms.
[14]Fragen wir zunächst, welche Ergänzung des „Geleitworts“ Weber für notwendig erachtet. Ausgangspunkt dafür ist die Zusammenstellung der Begriffe, die die neue Zeitschrift im Titel führt. Wer sich außer zu sozialwissenschaftlichen auch zu sozialpolitischen Fragen äußern will, muß sich Klarheit darüber verschaffen, wie er das Verhältnis von Theorie und Praxis verstanden wissen möchte. Im „Geleitwort“ hatten sich die neuen Herausgeber in dieser Hinsicht zunächst an die Auffassung der Vorgängerzeitschrift angelehnt. Sie lobten deren internationalen und vor allem interfraktionellen Charakter, auch, daß sie sich „die kritische Verfolgung des Ganges der Gesetzgebung zur Aufgabe gemacht“ habe.
52
Dies setze freilich einen Wertungsstandpunkt voraus. Damit stelle sich die Frage, ob die Vorgängerzeitschrift „bei dieser ,praktischen‘ Kritik auch eine bestimmte ,Tendenz‘“ verfolgt habe. Und die Antwort lautet: ja, aber nur insofern, als diese „praktische ,Tendenz‘ in den entscheidenden Punkten nichts anderes als das Resultat bestimmter Einsichten in die historische sozialpolitische Situation“ gewesen sei. Es hätten also „gemeinsame theoretische Anschauungen über die tatsächlichen Voraussetzungen“ der sozialpolitischen Arbeit bestanden. Die neuen Herausgeber erwähnten davon drei: 1. daß der Kapitalismus schlechthin hinzunehmen sei, und dies die Rückkehr zu den patriarchalen Grundlagen der alten Gesellschaft ausschließe; 2. daß die alten Formen gesellschaftlicher Ordnung den neuen weichen müßten, was insbesondere bedeute, das Proletariat in die „Kulturgemeinschaft der modernen Staaten“ einzugliedern; 3. daß die damit geforderte gesellschaftliche Neugestaltung nur schrittweise erfolgen könne, also auf dem Wege der Reform, nicht der Revolution. Es ist nun bemerkenswert, daß sich auch die neuen Herausgeber ausdrücklich zu diesen ,Einsichten‘ bekennen. [14]Geleitwort, S. III.
53
Doch Max Weber genügte dieses Bekenntnis im „Geleitwort“ offensichtlich nicht. Wenn man sich überhaupt zu der ,Tendenz‘ äußern wolle, dann müsse man dies ausführlich begründen. Am 6. Januar 1904 heißt es in einer Karte an Edgar Jaffé: „Die Frage der ,Tendenz‘ des Archivs sollte m. E. aus den einleitenden Worten fortbleiben. Es läßt sich kurz etwas Adäquates darüber nicht sagen u. mein ganzer langer Artikel handelt ja davon.“ Ebd., S. III f.
54
Karte Max Webers an Edgar Jaffé vom 6. Januar 1904, Privatbesitz (MWG II/4). Es ist übrigens ein Kuriosum, daß Webers Artikel, obwohl er sachlich unmittelbar an das „Geleitwort“ anschließt, erst an zweiter Stelle, hinter dem Artikel von Werner Sombart, stehen durfte. Sombarts Artikel „Versuch einer Systematik der Wirtschaftskrisen“, mit dem die Rubrik „Abhandlungen“ der neuen Folge eröffnet wurde (in: AfSSp, Bd. 19, Heft 1, 1904, S. 1–21), ist eher schmalbrüstig und enthält wenig Programmatisches. Grund für diese ungewöhnliche Abfolge war offensichtlich eine Auseinandersetzung zwischen Sombart und Weber, bei der Sombart darauf beharrte, ihm gebühre der erste Platz aufgrund seiner engen Verbindung mit der Vorläuferzeitschrift. Sombart fühlte sich wohl von Weber an den Rand gedrängt und unterdrückt. Dazu der Brief [15]Marianne Webers an Helene Weber vom 29. Februar 1904, Bestand Max Weber-Schäfer, Deponat BSB München, Ana 446. Weber hatte an Marianne zuvor unter anderem über Sombart geschrieben: „Sombart ist einfach ein Kind, mit der Brutalität u. Ungezogenheit eines solchen, aber mehr noch mit seiner Unentwickeltheit, inneren Unsicherheit u. eigentlich der Sehnsucht nach irgend einem aufrichtigen Freunde. Man kämpft immer halb mit Mitleid halb mit Ärger und Degout, wenn er so Abends seine Bekenntnisse losläßt. – Er ist eben in einer ekelhaften Lage in Breslau in jeder Hinsicht.“ Brief Max Webers an Marianne Weber vom 19. September 1903, ebd. (MWG II/4). Weber begnügte sich schließlich mit Platz 2, bestand aber darauf, daß sein Artikel, immerhin dreimal so lang wie der von Sombart, nicht auf zwei Hefte verteilt werde, was dazu führte, daß das erste Heft der neuen Zeitschrift mit Überlänge erscheinen mußte. Die dadurch verursachten Mehrkosten übernahm der Verleger.
[15]Weber erörtert denn auch in dem ersten Teil des Objektivitätsaufsatzes ausführlich das Verhältnis von Tatsachenurteilen und Werturteilen, ein Thema, das ihn spätestens seit seiner Freiburger Antrittsvorlesung beschäftigte. Und er schwört seine Mitherausgeber auf eine werturteilsfreie Sozialwissenschaft als Kulturwissenschaft ein. Zwar wünscht er praktische Kritik, und er übt sie ja selbst wenig später am Beispiel der Fideikommißfrage in Preußen.
55
Aber er bindet sie an Regeln. Die wichtigste ist, daß man eine „prinzipielle Scheidung von Erkenntnis des ,Seienden‘ und des ,Seinsollenden‘“ vollzieht. Das Seinsollende ergebe sich weder aus dem angeblich „unabänderlich Seienden“, noch aus dem angeblich „unvermeidlich Werdenden“. Dazu Wolfgang Schluchter, Einleitung, MWG I/8, S. 4–15 sowie ders., Einleitung zu: MWG I/8, Ergänzungsheft, S. 1–15.
56
Mehr noch: Gefährlich sei nicht nur die Vermischung von Sein und Sollen, sondern der in der historischen Schule vertretene entwicklungsgeschichtliche Relativismus, weil dies beim Sollen zu einer Einebnung der Differenz zwischen Ethik und Kulturwerten führe. Dies ist natürlich ein frontaler Angriff auf die ethische Nationalökonomie, wie sie insbesondere von Gustav Schmoller vertreten wurde. Zusammenfassend heißt es bei Weber: „Unsere Zeitschrift als Vertreterin einer empirischen Fachdisziplin muß, wie wir gleich vorweg feststellen wollen, diese Ansicht grundsätzlich ablehnen, denn wir sind der Meinung, daß es niemals Aufgabe einer Erfahrungswissenschaft sein kann, bindende Normen und Ideale zu ermitteln, um daraus für die Praxis Rezepte ableiten zu können.“ Weber, Objektivität, S. 24.
57
Ebd., S. 25. Weber hielt an der hier vorgetragenen Kritik, die er schon in der Antrittsvorlesung von 1895, allerdings, wie er später sagt, noch in unreifer Weise, formuliert hatte, bis ins Spätwerk fest. Dazu auch seine spätere Auseinandersetzung mit Schmoller in dem Aufsatz „Der Sinn der ,Wertfreiheit‘ der soziologischen und ökonomischen Wissenschaften“, in: Logos. Internationale Zeitschrift für Philosophie der Kultur, 7. Band, Heft 1, 1917, S. 40–88 (hinfort: Weber, Wertfreiheit; MWG I/12).
Dennoch, so Weber weiter, könne auch eine Erfahrungswissenschaft für die Klärung von Fragen, die in die Wertungssphäre fallen, etwas leisten: zum einen technische Kritik, zum anderen Kenntnis der Bedeutung des Gewollten, [16]d. h. Selbstbesinnung auf die Wertmaßstäbe, denen man folgt. Es gebe deshalb zwei Pflichten, die diejenigen, die an der Zeitschrift mitarbeiten wollten, zu beachten hätten: 1. dem Leser und sich selbst klar zu machen, „welches die Maßstäbe sind, an denen die Wirklichkeit gemessen und aus denen das Werturteil abgeleitet wird“;
58
2. immer zu sagen, „daß und wo der denkende Forscher aufhört und der wollende Mensch anfängt zu sprechen, wo die Argumente sich an den Verstand und wo sie sich an das Gefühl wenden“. [16]Weber, Objektivität, S. 32.
59
Aber es wäre fatal, wenn nun an die Stelle der Vermischung der Ebenen ihre Beziehungslosigkeit träte: „Gesinnungslosigkeit und wissenschaftliche ,Objektivität‘ haben keinerlei innere Verwandtschaft“, heißt es explizit. Auch in der empirischen Wissenschaft lasse sich der stellungnehmende und damit wertende Mensch nicht entbehren. Beobachte man aber die beiden Pflichten, so könnten in der Zeitschrift „scharfe politische Gegner sich zu wissenschaftlicher Arbeit zusammenfinden.“ Die Zeitschrift sei in der Vergangenheit mit ihrem ,interfraktionellen‘ Charakters kein „sozialistisches“ Organ gewesen, und sie werde in Zukunft kein „bürgerliches“ sein. Ebd., S. 33.
60
Ebd.
Die Herausgeber hatten im „Geleitwort“ betont, die neue Zeitschrift müsse „die historische und theoretische Erkenntnis der allgemeinen Kulturbedeutung der kapitalistischen Entwicklung als dasjenige wissenschaftliche Problem ansehen“, mit dem sie sich vor allem zu beschäftigen habe. Und gerade weil sie deshalb die „ökonomische Bedingtheit der Kulturerscheinungen“ in den Mittelpunkt stelle, müsse sie den Kontakt zu den Nachbardisziplinen suchen, zu solchen, die Kulturerscheinungen unter einem anderen Gesichtspunkt sehen.
61
Im ersten Teil des Objektivitätsaufsatzes fügt Weber dem hinzu, daß es die Aufgabe einer Wissenschaft vom menschlichen Kulturleben sei, „,Ideen‘, für welche teils wirklich, teils vermeintlich gekämpft worden ist und gekämpft wird, dem geistigen Verständnis zu erschließen.“ Dies überschreite zwar die Grenzen der ökonomischen Fachdisziplin, nicht aber die einer empirischen Wissenschaft. Freilich berühre man damit auch sozialphilosophische Fragen. Entscheidend aber sei die angemessene empirische Behandlung von Ideen. Denn „die historische Macht der Ideen ist für die Entwicklung des Soziallebens eine so gewaltige gewesen und ist es noch, daß unsere Zeitschrift sich dieser Aufgabe niemals entziehen, deren Pflege vielmehr in den Kreis ihrer wichtigsten Pflichten einbeziehen wird.“ Geleitwort, S. V.
62
Weber, Objektivität, S. 26 f.
Weber unterstreicht also schon im ersten Teil des Objektivitätsaufsatz, daß man es bei der Erkenntnis von Kulturerscheinungen nicht bei der Erforschung ihrer ökonomischen Bedingtheit belassen sollte. Vielmehr seien die hand[17]lungsleitenden Ideen und Ideale von Menschen in eine solche Untersuchung mit einzubeziehen. Weber beginnt denn auch den zweiten Teil des Objektivitätsaufsatzes damit, zwischen ökonomischen, ökonomisch bedingten und ökonomisch relevanten Erscheinungen zu unterscheiden. Und er fügt hinzu, „daß eine Erscheinung überhaupt die Qualität einer ,wirtschaftlichen‘ nur in soweit und nur so lange behält, als unser Interesse sich der Bedeutung, die sie für den materiellen Kampf ums Dasein besitzt, ausschließlich zuwendet.“
63
Weber hält es also für nötig, neben dem ökonomischen auch andere Gesichtspunkte ins Spiel zu bringen, jedenfalls dann, wenn man neben dem materiellen Kampf ums Dasein auch den ideellen Kampf um Deutung, neben dem Klassenkampf auch den Weltanschauungskampf, betrachtet. [17]Ebd., S. 37 f., Zitat S. 38.
64
Dies aber müsse eine Sozialwissenschaft als Kulturwissenschaft tun. Ebd., S. 29.
Im zweiten Teil des Objektivitätsaufsatzes steht deshalb die Frage im Mittelpunkt, wie eine Sozialwissenschaft als Kulturwissenschaft angelegt sein müsse. Es geht, wie Weber sagt, um die „sachliche Abgrenzung unseres Arbeitsgebietes.“ Dafür aber müsse man das Ziel sozialwissenschaftlicher Erkenntnis bestimmen.
65
Im zitierten Brief an Hellpach hieß es, daß dabei „die Eigenart der historischen Methodik neben dem Recht der ,Gesetzesbildung‘ zu wahren“ sei. Ebd., S. 36.
66
Tatsächlich leitet Weber den zweiten Teil mit der Beobachtung ein, in der Nationalökonomie herrsche der „Kampf um Methode, ,Grundbegriffe‘ und Voraussetzungen“, und die „theoretische und historische Betrachtungsform“ stünden sich durch eine „scheinbare unüberbrückbare Kluft“ gegenüber. So könne man mit einem Wiener Examinanden stöhnen: „zwei Nationalökonomien“ – „Was heißt hier Objektivität?“ Oben, S. 13 mit Anm. 49.
67
Weber, Objektivität, S. 36.
Weber nimmt also den Methodenstreit in der deutschsprachigen Nationalökonomie auf, und zwar in der Absicht, die konstatierte Kluft zu überwinden. Das logische Rüstzeug dafür stellt ihm, wie gesagt, Rickert bereit. Weber selbst äußerte sich in einem Brief an Georg von Below in diesem Sinne: „Außer dem mir allerdings wichtigsten letzten Drittel enthält der Aufsatz ja eigentlich nur eine Anwendung der Gedanken meines Freundes Rickert.“
68
Dieses wichtige letzte Drittel betrifft vor allem die idealtypische Begriffsbildung. Brief Max Webers an Georg von Below vom 17. Juli 1904, GStA PK, VI. HA, Nl. Max Weber, Nr. 30, Bd. 4, Bl. 95–96a (MWG II/4).
69
Schon Thomas Burger konstatierte in seiner grundlegenden Studie über Webers methodologischen Standpunkt, der einzige Eigenbeitrag von Weber sei die idealtypische Begriffsbildung, der Rest sei Rickert. Siehe Burger, Thomas, Max Weber’s Theory of Concept Formation. History, Laws, and Ideal Types. – Durham, North Carolina: Duke University Press 1976, bes. Kapitel III.
[18]Weber hält sich im Methodenstreit offensichtlich zunächst an Carl Menger, weil er als „Erster und Einziger“ die „methodische Scheidung gesetzlicher und historischer Erkenntnis“ vollzogen zu habe,
70
dies freilich, wie es im Roscher-Aufsatz heißt, „mit teilweise unzutreffenden Folgerungen“. [18]Weber, Objektivität, S. 62. Menger hatte seine Untersuchung mit der Feststellung eröffnet. „Die Welt der Erscheinungen kann unter zwei wesentlich verschiedenen Gesichtspunkten betrachtet werden. Entweder sind es die concreten Phänomene in ihrer Stellung in Raum und Zeit und in ihren concreten Beziehungen zueinander. Oder aber die im Wechsel dieser letzteren wiederkehrenden Erscheinungsformen, deren Erkenntnis den Gegenstand unseres wissenschaftlichen Interesses bildet. Die erstere Richtung der Forschung ist auf die Erkenntnis des Concreten, richtiger des Individuellen, die letztere auf jene des Generellen der Erscheinungen gerichtet, und es treten uns demnach, entsprechend dieser beiden Hauptrichtungen des Strebens nach Erkenntnis, zwei große Classen wissenschaftlicher Erkenntnisse entgegen, von welchen wir die ersteren kurz die individuellen, die letzteren die generellen nennen werden.“ Menger, Carl, Untersuchungen über die Methode der Socialwissenschaften, und der Politischen Ökonomie insbesondere. – Leipzig: Duncker & Humblot 1883 (hinfort: Menger, Methode), S. 3, ähnlich S. 32. Er gliedert dann diese beiden Hauptrichtungen wiederum in Zweige: bei der Erforschung des Individuellen in Geschichte und Statistik, bei der Erforschung des Generellen in die genannten theoretischen Richtungen. Bei Menger sind diese Unterscheidungen übrigens unabhängig vom ,Stoff‘. Sie gelten für die Natur- und die Menschenwelt gleichermaßen.
71
Diese betreffen aber nicht die beiden Ziele, in der Sozialwissenschaft sowohl nach dem Generellen als auch nach dem Individuellen zu streben, sondern das Verhältnis, in dem sie bei Menger zueinander stehen. Weber möchte beide Ziele und ihr Verhältnis zueinander logisch sauber begründen. Dies geschieht mit Rickerts Unterscheidung zwischen generalisierender und individualisierender Begriffsbildung, zwischen Gesetzes- und Wirklichkeitswissenschaft. Weber, Roscher und Knies I, S. 4, Fn. 1.
72
Ebd., S. 3–7 und insbes. S. 7, Fn. 1.
Die Frage nach dem Ziel sozialwissenschaftlicher Erkenntnis, mit der Weber den zweiten Teil des Objektivitätsaufsatzes einleitet, wird also damit beantwortet, daß sich sozialwissenschaftliche Erkenntnis auf zwei Ziele richten müsse, auf die Erkenntnis des Generellen und des Individuellen. Die Resultate, die dabei erreicht werden, fordern sich offensichtlich wechselseitig und ergänzen sich. Der Methodenstreit, so kann man folgern, gründet für Weber in logischen Mißverständnissen auf beiden Seiten. Denn die historische Schule, in dieser Hinsicht von der theoretischen Schule zu Recht kritisiert, werde durch noch so intensive Durchforschung der Geschichte niemals zu mehr oder weniger strengen Gesetzen gelangen. Die theoretische Schule aber verstehe den Sinn ihrer „theoretischen Gedankengebilde“ falsch. Denn sie wolle in ihren exakten Begriffen „etwas den exakten Naturwissenschaften Verwandtes“ schaffen und daraus die Wirklichkeit deduzieren. Damit huldige sie aber einem „naturalistische[n] Vorurteil“.
73
Weber, Objektivität, S. 61–63, Zitate: S. 62 f.
[19]Weber sprengt den bisherigen Diskussionsrahmen im Methodenstreit, indem er ein gegenüber Menger und Schmoller anderes Theorieverständnis vorschlägt. Die Sozialwissenschaft sei zwar eine historische Wissenschaft, aber sie benötige theoretische Gedankengebilde, die von denen der exakten Naturwissenschaften verschieden seien. Weber nennt diese Gedankengebilde „Idealtypen“. Diese können, wie es später heißt, sowohl generellen wie individuellen Charakters sein. Die ökonomischen Gesetze der abstrakten Theorie sind für Weber Idealtypen generellen Charakters.
74
Damit aber verschwindet die Kluft, die zwischen den beiden Schulen bestand. Theoriebildung und historische Forschung sind zwei logisch verschiedene Betrachtungsweisen derselben Wirklichkeit, die wechselseitig aufeinander verweisen: „theoretische Konstruktionen unter illustrativer Benutzung des Empirischen – geschichtliche Untersuchung unter Benutzung der theoretischen Begriffe als idealer Grenzfälle“, [19]Weber, Roscher und Knies III, S. 105 f.
75
so formuliert es Weber im Objektivitätsaufsatz. Weber, Objektivität, S. 78.
Weber siedelt den Idealtypus deshalb jenseits von reiner Induktion und reiner Deduktion an, aber auch jenseits von Sein und Sollen.
76
Er gilt ihm als ein Grenzbegriff, der ausschließlich heuristischen Zwecken und Darstellungszwecken dient. Über den logischen Status des Idealtypus wurde freilich sehr bald gestritten, und dies bis heute. Weber führt den Idealtypus anhand der „Aufstellungen der abstrakten Theorie“ ein, bei denen es sich angeblich um Deduktionen aus psychologischen Grundmotiven handle. So hatte Menger die exakte Theorie definiert. In Wahrheit seien diese Aufstellungen aber nur der „Spezialfall einer Form der Begriffsbildung, welche den Wissenschaften von der menschlichen Kultur eigentümlich und in gewissem Umfange unentbehrlich ist.“ Ebd., S. 64. Der Idealtypus sei gebildet „durch einseitige Steigerung eines oder einiger Gesichtspunkte und durch Zusammenschluß einer Fülle von diffus und diskret, hier mehr, dort weniger, stellenweise gar nicht, vorhandenen Einzelerscheinungen, die sich jenen einseitig herausgehobenen Gesichtspunkten fügen, zu einem in sich einheitlichen Gedankengebilde.“ Ebd., S. 65. Man könnte das von Weber hier charakterisierte Vorgehen mit Peirce Abduktion nennen. In jedem Fall gelten ihm Idealtypen als genetische Begriffe, durch Wertbeziehung im Sinne Rickerts und unter Beachtung der Kategorie der objektiven Möglichkeit konstruiert. Als ideale Grenzbegriffe können sie zwar die Hypothesenbildung anleiten, selbst aber empirisch nicht falsifiziert werden. Denn sie formulieren einen idealisierten Zustand oder Ablauf und bilden ausschließlich einen heuristischen Maßstab, an dem die Wirklichkeit gemessen und ihre Abweichung davon festgestellt werden soll. Obgleich Idealtypen an der Wirklichkeit nicht scheitern können, können sie unzweckmäßig konstruiert sein. Ob man bereits konstruierte Idealtypen beibehält oder neue entwickelt, ist für Weber deshalb auch eine reine Zweckmäßigkeitsfrage.
77
Selbst Rickert scheint zumindest mit der [20]Wortwahl unzufrieden gewesen zu sein. Nicht zufällig schreibt Max Weber am 28. April 1905 an ihn: „Daß Sie sprachliche Bedenken bzgl. des ,Idealtypus‘ haben, betrübt meine väterliche Eitelkeit. Ich bin aber doch auch der Ansicht, daß wenn wir von Bismarck nicht als dem ,Ideal‘ der Deutschen, sondern als dem Idealtypus der D[eutschen] reden, wir damit nicht schon an sich etwas Vorbildliches meinen“. Und weiter: „Entschließen Sie Sich doch, hier auch zwischen ,Ideal‘ und ,Gattungs-Typus‘ diese Zwischenstufe, die sachlich doch gefordert ist, auch sprachlich so zu bezeichnen, wie es m. E. natürlich ist.“ Im Grunde gibt es zwei Positionen: Idealtypen sind zu verwerfen, weil sie per definitionem nicht falsifizierbar sind, oder Idealtypen sind Modelle, die der Hypothesenbildung dienen. Nicht die Modelle, wohl aber die daraus abgeleiteten Hypothesen lassen sich falsifizieren. Modelle sind also mehr oder weniger nützlich. Heute spricht man hier von ,non-statement-views‘. Dazu Albert, Gert, Max Webers non-statement-[20]view. Ein Vergleich mit Roland Gieres Wissenschaftskonzeption, in: Albert, Gert et al., Aspekte des Weber-Paradigmas. – Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften 2006, S. 60 ff.
78
Brief Max Webers an Heinrich Rickert vom 28. April 1905, GStA PK, VI. HA, Nl. Max Weber, Nr. 25, Bl. 15–18 (MWG II/4). Rickert ließ sich tatsächlich von Weber nicht überzeugen. Er ging zwar in der 2. Auflage seiner Schrift aus dem Jahre 1913 auf den Begriff Idealtypus ein, unterschied ihn aber in seinem logischen Status von seinen eigenen relativ historischen Begriffen. Dazu Rickert, Heinrich, Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung. Eine logische Einleitung in die historischen Wissenschaften, 2. Aufl. – Tübingen: Verlag J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) 1913, S. 431 ff.
Der Idealtypus als Zwischenstufe zwischen Ideal und Gattungsbegriff – dies verweist darauf, daß sich aus Webers Sicht das Ergebnis der Generalisierung in den Sozialwissenschaften von dem in den Naturwissenschaften unterscheidet. Man kann vermuten, der Unterschied bestehe darin, daß die Generalisierung in den Sozialwissenschaften zu Regelmäßigkeiten des Handelns, in den Naturwissenschaften zu Naturgesetzen führt. Insbesondere die Kenntnis von Regelmäßigkeiten des Handelns, mehr oder weniger explizit, bleibt nach Weber für den Forscher, der historische Zusammenhänge untersuchen will, unentbehrlich. Geschichtsforschung verlange kausale Zurechnung, erschöpfe sich nicht in schöner Narration. In einem langen Brief, in dem sich Weber mit Willy Hellpachs Habilitationsschrift auseinandersetzt, in der dieser sich von der methodologischen Lehre der südwestdeutschen Schule distanziert hatte, heißt es: „Daß (S. 33) Windelband u. Rickert (der letztere ist ja der eigentliche Systematiker der ,Richtung‘) den Verzicht auf Gesetzesbildung irgendwo auf irgend einem sachlich abzugrenzenden Gebiet lehrten, werden beide entschieden bestreiten. Nur darum handelt es sich, daß historische Arbeit im logischen Sinn Zurechnung konkreter ,Individuen‘, z. B. einer konkreten Culturerscheinung oder Culturgesamtheit zu ihren concreten Ursachen ist“. Dafür aber benötige man Gesetze als Mittel.
79
Um sie in den Dienst der kausalen Zurechnung stellen zu können, müssen sie zunächst erkannt sein, und zwar im Rahmen einer Sozialwissenschaft als Kulturwissenschaft. Brief Max Webers an Willy Hellpach vom 10. September 1905, GStA PK, VI. HA, Nl. Max Weber, Nr. 17, Bl. 19–25 (MWG II/4).
80
Dies heißt natürlich nicht, daß Naturgesetze im sozialen Leben keine Rolle spielten. Aber das für die Sozialwissenschaft Spezifische sind soziologische Gesetze, wie es später heißt.
[21]Weber verzichtet also keineswegs auf Theorie, sondern schränkt nur ein: Für einen Geschichtsforscher sei Theorie niemals Selbstzweck, sondern Mittel, um die Wirklichkeit zu erschließen. In diesem Sinne definiert er sein Forschungsprogramm als das einer theoriegeleiteten und auf Erklärung ausgerichteten Wirklichkeitswissenschaft. „Die Sozialwissenschaft“, so heißt es im Objektivitätsaufsatz, „die wir treiben wollen, ist eine Wirklichkeitswissenschaft. Wir wollen die uns umgebende Wirklichkeit des Lebens, in welches wir hineingestellt sind, in ihrer Eigenart verstehen – den Zusammenhang und die Kulturbedeutung ihrer einzelnen Erscheinungen in ihrer heutigen Gestaltung einerseits, die Gründe ihres geschichtlichen So-und-nicht-anders-Geworden-seins andererseits.“
81
An dieser Stelle spricht Weber nicht für seine Mitherausgeber, sondern für sich selber. Immerhin: Auch im „Geleitwort“ nahm ,Theorie‘ eine wichtige Stelle ein. So heißt es dort, Theorie im Sinne der „Bildung klarer Begriffe“ gehöre zu den wichtigsten Aufgaben der neuen Zeitschrift: „Denn soweit wir von der Meinung entfernt sind, daß es gelte, den Reichtum des historischen Lebens in Formeln zu zwängen, so entschieden sind wir davon überzeugt, daß nur klare eindeutige Begriffe, einer Forschung, welche die spezifische Bedeutung sozialer Kulturerscheinungen ergründen will, die Wege ebnen.“ [21]Weber, Objektivität, S. 46.
82
Geleitwort, S. VI.
Eine Sozialwissenschaft als Wirklichkeitswissenschaft ist also auf generalisierende und individualisierende Begriffsbildung angewiesen. Sie ist darüber hinaus eine Wissenschaft, die außer mit logischen (Generalisierung-Individualisierung) und ontologischen (sinnfrei-sinnhaft) auch mit pragmatischen Gesichtspunkten operiert. Einer dieser pragmatischen Gesichtspunkte, die immer einseitig und insofern ,unwirklich‘ bleiben müssen, ist der ökonomische. Aber der ökonomische Gesichtspunkt besitzt bei der Untersuchung von Kulturerscheinungen kein Monopol. Er kann und muß durch andere pragmatische Gesichtspunkte ergänzt werden, die freilich gleichfalls einseitig bleiben. Denn „die ,Einseitigkeit‘ und Unwirklichkeit der rein ökonomischen Interpretation des Geschichtlichen ist überhaupt nur ein Spezialfall eines ganz allgemein für die wissenschaftliche Erkenntnis der Kulturwirklichkeit geltenden Prinzips.“
83
Weber, Objektivität, S. 45.
Es sind also vor allem logisch-methodische Fragen, mit denen sich Weber im zweiten Teil des Objektivitätsaufsatzes beschäftigt. Sie betreffen zum einen den Methodenstreit in der deutschsprachigen Nationalökonomie, zum andern den Ansatz, den er selbst verfolgen will. Beides konvergiert in seinem Vorschlag, es gelte in der Sozialwissenschaft als Kulturwissenschaft Idealtypen individuellen und generellen Charakters zu bilden, die zwar auf Wertbeziehung, nicht aber auf Wertbeurteilung beruhen. Damit hatte Weber einen [22]logisch-methodischen Standpunkt erreicht, den er in der Folge nicht mehr verlassen sollte. Er findet seine reifste Ausformulierung im methodischen Teil der „Soziologischen Grundbegriffe“ in der neuen Fassung von Wirtschaft und Gesellschaft, seiner Soziologie.
84
Er ist die Voraussetzung dafür, daß er die Aufsatzfolge „Die protestantische Ethik und der ,Geist‘ des Kapitalismus“ als eine gesichtspunktabhängige und damit einseitige religionshistorische, er sagt mitunter auch: spiritualistische Studie [22]Weber, Soziologische Grundbegriffe, in: MWG I/23, S. 147–172.
85
unter Verwendung idealtypischer Begriffe anlegen kann, wobei er zunächst also nicht die materiellen Interessen und den Klassenkampf, sondern die ideellen Interessen und den Deutungskampf in den Mittelpunkt stellt. So etwa in dem Brief von Max Weber an Heinrich Rickert vom 2. April 1905, GStA PK, VI. HA, Nl. Max Weber, Nr. 25, Bl. 13–14 (MWG II/4), wo er von „eine[r] Art ,spiritualistischer‘ Construktion der modernen Wirtschaft“ spricht.
3. Annäherungen an ein religionsgeschichtliches Projekt: Lebensgeschichtliche und politische Motive
Was aber bewog Weber tatsächlich dazu, nahezu parallel zum Objektivitätsaufsatz ausgerechnet eine Studie über die Kulturbedeutung des asketischen Protestantismus zu beginnen? So wichtig logisch-methodische Fragen dabei gewesen sein mögen, sie konnten nicht den einzigen, nicht einmal den ausschlaggebenden Grund dafür abgegeben haben. Um zum Beispiel den historischen Materialismus als eine Theorie der letzten Instanz zu widerlegen und auf eine gesichtspunktabhängige und zugleich multikausale historische Forschung zu pochen, hätte er keine Studie über die Kulturbedeutung des asketischen Protestantismus schreiben müssen. Was also lenkte Webers Erkenntnisinteresse gerade auf diese Bahn? Man könnte zunächst an die religiöse Familienkonstellation denken, in der er aufwuchs und in der das hugenottische Erbe eine wichtige Rolle spielte. Schließlich hatten Webers Mutter Helene, seine Tante Ida Baumgarten und sein Vetter Otto Baumgarten, der spätere Professor für Praktische Theologie an der Universität Kiel, auf das religiöse Empfinden des jungen Max Weber eine beträchtlichen Einfluß ausgeübt. Vor allem über diese Personen aus dem engeren Familienkreis kam er mit Autoren wie William Ellery Channing und Theodore Parker, aber auch mit Frederick William Robertson und Charles Kingsley in Berührung. Die literarische Begegnung mit Channing löste gar, wie zuvor bereits bei der Mutter und der Tante, emotionale Reaktionen aus. So heißt es in einem Brief an die Mutter vom 8. Juli 1884: „Seit verschiedenen Jahren, die ich zurückdenken kann, ist es das erstemal, daß etwas Religiöses für mich ein mehr als objek[23]tives Interesse gewonnen hat“. Freilich war Channing Unitarier und als solcher dem Calvinismus abhold.
86
[23]Brief Max Webers an Helene Weber vom 8. Juli 1884, GStA PK, VI. HA, Nl. Max Weber, Nr. 3, Bl. 80–84 (MWG II/1), dass. auch (mit kleinen Abweichungen) in: Weber, Max, Jugendbriefe. – Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) o. J. [1936], S. 119–126, Zitat: S. 121. – Dazu die ausgewogene Darstellung bei Roth, Guenther, Max Webers deutsch-englische Familiengeschichte 1800–1950 mit Briefen und Dokumenten. – Tübingen: Mohr Siebeck 2001, Kap. VIII. Religiöse Familienkonstellationen, S. 257–282 (hinfort: Roth, Familiengeschichte).
Guenther Roth stellt in seiner Weberschen Familiengeschichte in diesem Zusammenhang die Frage: „Wie weit war nun Weber von seiner Kenntnis angelsächsischer religiöser Literatur […] geformt?“ Seine Antwort lautet: „Er war ganz offensichtlich von der existentiellen Bedeutung beeindruckt, welche diese Literatur für seine Mutter, seine Tante und seinen Cousin hatte, aber er behielt eine objektivierende Distanz.“
87
Diese objektivierende Distanz kommt schon in der Stellungnahme des gerade Achtzehnjährigen zur Religion zum Ausdruck: „Im übrigen bin ich ziemlich tief in die Theologie geraten, meine Lektüre besteht aus Strauß, Schleiermacher und Pfleiderer (,Paulinismus‘) und außerdem nur Platon. Strauß’s ,der alte und der neue Glaube‘ enthält nicht sehr viel neues, nichts, was man nicht ungefähr selbst wüßte […]. Schleiermachers ,Reden über die Religion‘, in die ich freilich erst wenig hineingelesen habe, machen mir vorläufig gar keinen Eindruck“. Roth, Familiengeschichte, S. 281 f.
88
Diese früh praktizierte objektivierende Distanz gegenüber allem Religiösen aber scheint Weber für den Rest seines Lebens beibehalten zu haben. Dazu Max Webers Briefe an Helene Weber vom 2. Mai und 16. Mai 1882, GStA PK, VI. HA, Nl. Max Weber, Nr. 3, BI. 2–5 und 7–10, Zitat: Bl. 9 f. (MWG II/1); dass. (mit Abweichungen) in: Weber, Jugendbriefe, S. 40–44, bes. S. 44, und S. 45–49, bes. S. 48 f.
89
Das Interesse am aske[24]tischen Protestantismus läßt sich also nur sehr bedingt als eine Selbstverständigung über die eigene Familiengeschichte verstehen. Das zeigt besonders eindrucksvoll der Briefwechsel, den Max Weber im Frühjahr 1909, also nach Abfassung der Studie über den asketischen Protestantismus, mit Ferdinand Tönnies führte. Der Anlaß dafür war Webers Artikel „Die Lehrfreiheit der Universitäten“, in dem es auch um die These von der Werturteilsfreiheit in den empirischen Wissenschaften ging. Weber betont gegenüber Tönnies zwar die Möglichkeit technischer Kritik in den empirischen Wissenschaften, auch die Notwendigkeit, sich an Werten zu orientieren, darunter an ethischen, bei denen Kants kategorischer Imperativ immerhin eine formale Gesinnungskritik erlaube. Aber eine materiale Gesinnungskritik verlange eine Metaphysik. Weber formuliert den bemerkenswerten Satz: „Das Denken ist nicht an die Grenzen der Wissenschaft gebunden“, aber, so kann man diesen Satz fortsetzen, die empirische Wissenschaft hat Grenzen, die einzuhalten sind. Weber unterstreicht also den Hiatus zwischen wissenschaftlichem Wissen und religiösem Glauben, wehrt sich aber entschieden gegen ein „metaphysisch-naturalistisch orientiertes Anti-Pfaffentum.“ Ein inkonsequent Gläubiger sei ihm lieber als ein pharisäischer Naturalist à la Haeckel. Zwar verwerfe auch er, Weber, für sich alle religiöse Dogmatik und Apologetik, doch er gehe nicht so weit wie Tönnies, Theologie für Unsinn zu halten. Er unterstreicht also seinen Respekt vor der Religion. Aber er [24]bekennt sich, auf Schleiermacher anspielend, als religiös „unmusikalisch“, freilich sei er deshalb „weder antireligiös noch irreligiös.“ In Hinblick auf Religion fühle er sich vielmehr als ein Krüppel, als ein verstümmelter Mensch, nicht in der Lage, sich als ein wahrhaft Gläubiger aufzuspielen. Das Erkenntnisinteresse an der Kulturbedeutung der Religionen: ja, das praktische Interesse an einer religiösen Lebensführung: nein. Zu den Briefen Webers an Ferdinand Tönnies vom 19. Februar und 2. März 1909, MWG II/6, S. 63–66 und S. 69–70, Zitate: S. 64 f.
Wichtiger ist vermutlich das persönliche Schicksal. Weber wurde aufgrund seiner Krankheitserfahrung der Sinn einer auf Berufspflicht gegründeten Lebensführung zum Problem. Als Berufsmensch hatte er zunächst äußere und vor allem innere Sicherheit gefunden. Doch der Absturz in die Krankheit zerstörte diese Sicherheit. Weber sah jetzt offensichtlich auch das Einseitige an dieser Lebensführung, sah die Unterdrückung der emotionalen Seite. Weber sah sich in eine Welt gestellt, in der vermeintlich nur das berufliche Funktionieren des Menschen zählte. Es gibt dazu Äußerungen von ihm aus der Phase vor der Niederlegung des Lehramts, als er wieder einmal einen Rückschlag auf dem mühsamen Weg der Rekonvaleszenz erlitten hatte. Darüber berichtet Marianne Weber Helene Weber am 10. Dezember 1902 wie folgt: „Inzwischen hat er dem, was ihn am meisten quält, vorhin wieder Ausdruck gegeben, es ist immer dasselbe, der psychische Druck der ,unwürdigen Situation‘ Geld zu beziehen u. in absehbarer Zeit nichts leisten zu können, u. dazu das Gefühl[,] daß uns allen[,] Dir u. mir u. allen Menschen[,] nur der Berufsmensch u. der, der irgend etwas machen könnte[,] für voll gälte. Dazu allerlei unangenehme Reminiszenzen aus früheren Jahren, wo wir alle u. die Ärzte eben doch immer gemeint hätten, er müßte die Krankheit willensmäßig überwinden u. das sei das allerschrecklich belastendste für sein Ehrgefühl.“
90
Brief Marianne Webers an Helene Weber vom 10. Dezember 1902, Bestand Max Weber-Schäfer, Deponat BSB München, Ana 446. Über Webers Krankheit wurde viel spekuliert. Alle Dokumente dazu, insbesondere die ärztlichen Diagnosen, sind verloren. Es bleibt einzig der Briefwechsel zwischen Marianne und Helene Weber während der Krankheit, der ein wenig Aufschluß über die Art dieser schweren Erkrankung gibt. Marianne berichtet Helene kurz nach Ausbruch der Krankheit über das Gespräch mit einem Arzt in einer Konstanzer Klinik, in der sich Weber vorübergehend aufhielt, dieser habe von einer krankhaften, perversen Anlage gesprochen, die Weber in seiner Jugend und in seinen Studententagen willentlich unterdrückt habe, was sie, Marianne, freilich nicht glaube, denn die krankhaften Erscheinungen seien „doch erst Folge der moralischen Selbstüberwindung“ gewesen. Jedenfalls äußerten sich diese „krankhaften Erscheinungen“ in nächtlichen mechanischen Erektionen und Pollutionen, begleitet von Alpträumen und schweren Schlafstörungen. Phasenweise konnte Weber weder sprechen noch schreiben, noch gehen. Zu dem Zitat der Brief Marianne Webers an Helene Weber vom 4. September 1898, ebd. Zur Studie über den asketischen Protestantismus auch als eine Art Selbstzeugnis Hartmut Lehmann, „Max Webers ,Protestantische Ethik‘ als Selbstzeugnis“, in: ders., Max Webers ,Protestantische [25]Ethik‘. – Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1996, S. 109–127 (hinfort: Lehmann, Protestantische Ethik).
[25]Freilich dürften neben solchen lebensgeschichtlichen auch politische Motive eine Rolle gespielt haben. Weber haderte mit der Lebensführung des deutschen Bürgertums. Es hatte in seinen Augen weder den Übergang vom Agrarstaat zum Industriestaat selbstbewußt vollzogen
91
noch den von der Autokratie zum Parlamentarismus. Nicht nur in höfischen und agrarischen, sondern auch in bürgerlichen Kreisen nahm er eine aus Angst vor dem Proletariat geborene antiparlamentarische Stimmung wahr. Weber machte dafür vor allem das „Epigonengeschlecht“ verantwortlich, das nach Bismarcks Abgang das politische Ruder im Reich übernommen hatte, Dazu besonders Weber, Diskussionsbeiträge zum Vortrag von Karl Oldenberg: „Über Deutschland als Industriestaat“, in: MWG I/4, S. 626–640.
92
aber auch die Allianz von Thron und Altar in Preußen, von einem autoritätshörigen Luthertum gestützt. Hierzu aus dieser Zeit Webers Zuschrift an die Frankfurter Zeitung vom 3. Juni 1904, überschrieben „Die ,Bedrohung‘ der Reichsverfassung“, MWG I/8, S. 76–80, Zitat: S. 79. Darin unterstützt er seine Heidelberger Kollegen Georg Jellinek und Gerhard Anschütz in ihrer Kritik an Eugen von Jagemann, der die These vertreten hatte, das Reich sei ein Bund der Fürsten und damit ein Vertrag, der jederzeit den Austritt einzelner Vertragspartner oder gar die Auflösung des Reiches erlaube. Dagegen stellten sie eine Auffassung vom Reich als einer eigenen Rechtspersönlichkeit mit eigener, genuiner Rechtsqualität. Weber forderte bei aller Anerkennung der Monarchie, der Parlamentarismus müsse gleichrangig behandeln werden.
93
Weber beklagte die Erziehungswirkung des Luthertums in Deutschland. Es fördere die Anpassung an die scheinkonstitutionellen Verhältnisse, widerstehe ihnen nicht. Im Jahre 1906, als die beiden Protestantismus-Aufsätze bereits veröffentlicht und die Erfahrungen aus der USA-Reise bereits verarbeitet waren, formulierte Weber gegenüber Adolf Harnack folgendes bemerkenswerte Urteil: „So turmhoch Luther über allen Anderen steht, – das Luthertum ist für mich, ich leugne es nicht, in seinen historischen Erscheinungsformen der schrecklichste der Schrecken und selbst in der Idealform, in welcher es sich in Ihren Hoffnungen für die Zukunftsentwicklung darstellt, ist es mir, für uns Deutsche, ein Gebilde, von dem ich nicht unbedingt sicher [26]bin, wie viel Kraft zur Durchdringung des Lebens von ihm ausgehen könnte.“ Und weiter: „Aber daß unsre Nation die Schule des harten Asketismus niemals, in keiner Form, durchgemacht hat, ist, auf der andren Seite der Quell alles Desjenigen, was ich an ihr (wie an mir selbst) hassenswerth finde, und vollends bei religiöser Wertung steht eben – darüber hilft mir nichts hinweg – der Durchschnitts-Sektenmensch der Amerikaner ebenso hoch über dem landeskirchlichen ,Christen‘ bei uns, – wie, als religiöse Persönlichkeit, Luther über Calvin, Fox e tutti quanti steht.“ Man hat behauptet, die Aufsatzfolge sei eine kulturprotestantische Kampfschrift: „Nur wenig zugespitzt kann man sagen, es handle sich bei der ,Protestantischen Ethik‘ um eine Kampfschrift des ,Kulturprotestantismus‘ im Gewand einer wissenschaftlichen Untersuchung.“ So Steinert, Heinz, Max Webers unwiderlegbare Fehlkonstruktion. Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus. – Frankfurt, New York: Campus 2010, S. 20, ähnlich auch S. 277 (hinfort: Steinert, Fehlkonstruktion). Zur Rolle des Kulturprotestantismus in Webers Entwicklung differenzierter Lehmann, Hartmut, Max Webers Weg vom Kulturprotestantismus zum asketischen Protestantismus, in: Schluchter, Wolfgang und Graf, Friedrich Wilhelm (Hg.), Asketischer Protestantismus und der ,Geist‘ des modernen Kapitalismus. Max Weber und Ernst Troeltsch. – Tübingen: Mohr Siebeck 2005 (hinfort: Schluchter/Graf, Asketischer Protestantismus), S. 33–47.
94
[26]Brief Max Webers an Adolf Harnack vom 5. Februar 1906, MWG II/5, S. 32 f. Dazu auch Webers Ausführungen in dem Aufsatz „,Kirchen‘ und ,Sekten‘ in Nordamerika“, wo er die religiöse Durchdringung des Lebens vergleichend darstellt (USA-Deutschland) und zum Landeskirchentum Stellung nimmt. Unten, S. 426–462.
Doch sosehr bei der Themenwahl logisch-methodische, lebensgeschichtliche und politische Motive eine Rolle gespielt haben mögen, entscheidend waren doch die wissenschaftlichen Motive. Weber hielt sich an das Programm der neuen Zeitschrift – Untersuchung der allgemeinen Kulturbedeutung des Kapitalismus –, und er reagierte dabei auf eine wissenschaftliche Problemsituation. Denn die Frage, welche Rolle der Religion, speziell dem Protestantismus und hier wieder den Reformierten, für die Entstehung des modernen Kapitalismus als einer Teilerscheinung der modernen Welt zukomme, spielte in der wissenschaftlichen Diskussion der Zeit eine prominente Rolle. Weber betonte denn auch zu Recht, der Zusammenhang zwischen asketischem Protestantismus und kapitalistischem ,Geist‘, dem er in seinen Aufsätzen nachgehe, sei keineswegs erst von ihm entdeckt worden. Dies sei gewissermaßen Gemeingut, bei den Gläubigen sowohl wie in der Wissenschaft. Neu an seinen Studien sei lediglich die Art und Weise, wie er diesen Zusammenhang interpretiere. Bevor wir darauf eingehen, müssen wir uns diese wissenschaftliche Problemsituation vergegenwärtigen. Wie sah sie aus?
4. Annäherungen an ein religionsgeschichtliches Projekt: Die wissenschaftliche Problemsituation
4.1. Wirtschaft und Religion aus sozialistischer Perspektive: Marx, Engels, Bernstein
Hegels Versuch in seiner Religionsphilosophie, Religion und Vernunft zu versöhnen und die Religionsentwicklung der Menschheit im Christentum als der vollendeten Religion, der Religion der Freiheit, gipfeln zu lassen,
1
war bereits [27]bei seinen unmittelbaren Schülern umstritten. Ludwig Feuerbach etwa behauptete in seinen „Vorläufigen Thesen zur Reformation der Philosophie“ und in seinen „Grundsätzen einer Philosophie der Zukunft“, beide 1843 veröffentlicht, nicht nur Hegels Religionsphilosophie, seine Philosophie insgesamt sei letztlich rationale Theologie. Hegel hielt seine Vorlesungen über Religionsphilosophie mehrmals, so daß auch verschiedene Fassungen überliefert sind. Zu den verschiedenen Fassungen der „vollendeten Religion“ Hegel, G. W. F., Vorlesungen über die Philosophie der Religion, Teil 3: Die vollendete Religion, neu hg. von Walter Jaschke. – Hamburg: Felix Meiner [27]1995. In der Fassung von 1827 findet sich der Stufenbau der Religion, von der natürlichen bis zur vollendeten Religion, auf S. 191 ff.
2
Stattdessen gelte es, die Theologie in Anthropologie zu überführen. Feuerbach, Ludwig, Werke in sechs Bänden, Band 3. – Frankfurt a.Μ.: Suhrkamp 1975, S. 223 ff. bzw. S. 247 ff. S. 238 heißt es, Hegels Philosophie sei „der letzte Zufluchtsort, die letzte rationelle Stütze der Theologie.“
3
Die Religion projiziere nur in ein Jenseits, was der Mensch im Diesseits zu verwirklichen habe. Er müsse die Verheißungen des Christentums hier und jetzt realisieren, in der liebenden Verbindung zwischen Ich und Du. Denn „das Wesen des Menschen ist nur in der Gemeinschaft, in der Einheit des Menschen mit dem Menschen enthalten – eine Einheit, die sich aber nur auf die Realität des Unterschieds zwischen Ich und Du stützt.“ Ebd., S. 248.
4
Aus dieser Hegelkritik entstand eine Religionskritik auf der Grundlage einer Projektionstheorie, die den jungen Marx prägte. Aus ihrer Radikalisierung entwickelte dieser eine allgemeine Ideologiekritik. In der zusammen mit Friedrich Engels verfaßten Deutschen Ideologie etwa heißt es: „Die Moral, Religion, Metaphysik und sonstige Ideologie und die ihnen entsprechenden Bewußtseinsformen behalten hiermit nicht länger den Schein der Selbständigkeit. Sie haben keine Geschichte, sie haben keine Entwicklung, sondern die ihre materielle Produktion und ihren materiellen Verkehr entwickelnden Menschen ändern mit dieser ihrer Wirklichkeit auch ihr Denken und die Produkte ihres Denkens.“ Ebd., S. 321.
5
Mit anderen Worten: Die religiöse Entwicklung ist, wie die aller Ideen und Ideale, eine unselbständige Begleiterscheinung der wirtschaftlichen. Wenn sich die Struktur der Wirtschaft ändert, ändert sich auch mehr oder weniger schnell die Religion. So kann Marx in dem berühmten Abschnitt über den „Fetischcharakter der Ware“ aus dem 1. Band seines Hauptwerks behaupten, für eine Gesellschaft von Warenproduzenten, die die Produkte ihrer Privatarbeiten auf einem Markt austauschen, sei das „Christentum, mit seinem Kultus des abstrakten Menschen, namentlich in seiner bürgerlichen Entwicklung, dem Protestantismus, Deismus usw., die entsprechendste Religionsform“. Marx, Karl, Werke – Schriften – Briefe, hg. von Hans-Joachim Lieber, Band II. – Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1971, S. 23 (hinfort: Marx, Werke – Schriften – Briefe I–VI, 1963–1971).
6
Danach ist der Protestantismus also bestimmten kapitalistischen Entwicklungen adäquat. Friedrich Engels präzisiert dies dahin, man müsse innerhalb des Protestantismus zwischen der Wirkung des [28]Luthertums und der des Calvinismus unterscheiden. In der von Karl Kautsky redigierten Zeitschrift „Die Neue Zeit“ veröffentlicht er einen Aufsatz, in dem er dem Leser die religiösen Tendenzen der englischen Mittelklasse im 17. und 18. Jahrhundert aus Sicht des historischen Materialismus auseinandersetzt. Ebd., Band IV, S. 56.
7
Dabei greift er auf die Reformation zurück und auf ihre Spaltung in Luthertum und Calvinismus. Das Luthertum habe in Deutschland gesiegt, aber daran mitgewirkt, aus den sich erhebenden Bauern wieder Leibeigene zu machen; der Calvinismus dagegen in England, wo er zur „Kampftheorie“ des sich erhebenden Bürgertums geworden sei: „[…] wo Luther fehlschlug, da siegte Calvin. Sein Dogma war den kühnsten der damaligen Bürger angepaßt. Seine Gnadenwahl war der religiöse Ausdruck der Thatsache, daß in der Handelswelt der Konkurrenz Erfolg oder Bankrott nicht abhängt von der Thätigkeit oder dem Geschick des Einzelnen, sondern von Umständen, die von ihm unabhängig sind.“ [28]Hier ist die zweite Folge relevant. Es handelt sich übrigens um die deutsche Fassung der Einleitung in die englische Übersetzung von Engels’ Schrift Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft. Siehe Engels, Friedrich, Über historischen Materialismus, in: Die Neue Zeit, 11. Jg., 1892/93, S. 42 ff.
8
Zudem habe die Kirchenverfassung des Calvinismus die politische Entwicklung beeinflußt. Sie sei demokratisch und republikanisch gewesen. Das habe der Emanzipation des Bürgertums von feudaler Bevormundung gedient: „Wurde das deutsche Lutherthum ein gefügiges Werkzeug in den Händen deutscher Kleinfürsten, so gründete der Calvinismus eine Republik in Holland und starke republikanische Parteien in England und namentlich in Schottland.“ Ebd., S. 43.
9
Man sieht: Engels gelten der Calvinismus und die protestantischen Sekten im Vergleich zum Luthertum als religiöse Bewegungen mit emanzipatorischer Kraft. Ebd.
10
Seine eigentliche Sympathie galt freilich weder dem Luthertum noch dem Calvinismus, sondern dem Frankreich von 1789, weil die Revolution „den religiösen Mantel gänzlich abgeworfen hatte und auf unverhüllt politischem Boden ausgekämpft wurde.“ Ebd., S. 45.
11
Erst dies habe zu einem „vollständigen Bruch mit den Traditionen der Vergangenheit“ geführt. Ebd.
12
Ebd., S. 46. Für Engels bedeutete die Einführung des Code civil durch Napoleon eine meisterhafte Anpassung an die kapitalistischen Verhältnisse.
Auch andere Sozialisten faszinierte die englische religiöse Konstellation wegen ihres Zusammenhangs mit der wirtschaftlichen und vor allem der politischen Entwicklung. So widmete zum Beispiel Eduard Bernstein den „kommunistischen und demokratisch-sozialistischen Strömungen während der englischen Revolution des 17. Jahrhunderts“ eine lange und detaillierte Stu[29]die.
13
Bernstein vergleicht die englische Revolution von 1648 mit der französischen von 1789. Beide gelten ihm, wie auch Marx und Engels, als wichtige bürgerliche Revolutionen, wobei er zwischen ihnen eher Parallelen als Differenzen sieht. So heißt es bei ihm, die englische Revolution habe „in den Presbyterianern ihre Girondisten, in den Independenten ihre Jakobiner, bezw. ihre Bergpartei, und in den Levellers ihre Hébertisten und Babouvisten. Cromwell war ihr Robespierre und Bonaparte in einer Person, und ihr Marat und Hébert in einer Person war John Lilburne, der Leveller.“ [29]Diese Geschichte des Sozialismus in Einzeldarstellungen wurde von E. Bernstein, C. Hugo, K. Kautsky, P. Lafargue, Franz Mehring und G. Plechanow herausgegeben und behandelte unter anderem die Vorläufer des Neueren Sozialismus. Der zweite Teil des Ersten Bandes trug die Überschrift: Von Thomas Morus bis zum Vorabend der französischen Revolution. Im V. Abschnitt behandelte Eduard Bernstein die „Kommunistischen und demokratisch-sozialistischen Strömungen während der englischen Revolution des 17. Jahrhunderts“. – Stuttgart: J. H. W. Dietz 1895, S. 507–718 (hinfort: Bernstein, Kommunistische Strömungen).
14
Auch Bernstein sieht im Calvinismus eine religiöse Bewegung, die den Bedürfnissen „des erstarkten städtischen Bürgerthums und des bürgerlichen Grundbesitzes“ in England wirtschaftlich und politisch am meisten entsprochen habe. Ebd., S. 509.
15
Er behauptet, während der Regierungszeit Karls I. sei die Zahl der Puritaner ständig gestiegen: „Die reichen Kaufleute der City waren fast alle Puritaner, desgleichen eine große Zahl der niederen Landadeligen und der bürgerlichen Grundbesitzer, ja, immer mehr Mitglieder der hohen Aristokratie kehrten der Staatskirche den Rücken.“ Ebd., S. 527, Anm.
16
Ebd., S. 535.
Bernstein verwendet hier eine Definition von Puritanismus, die äußerst weit ist. Wegen der Bedeutung, die sie möglicherweise für Max Weber hatte, sei sie hier ausführlich zitiert: „Wer waren die Puritaner? (,Purits‘ oder ,Puritans‘, von pure = rein.) Der Name bezeichnet nicht eine bestimmte kirchliche Sekte, er bezeichnet eine ganze religiös-soziale Strömung. Es ist zunächst ein Sammelname für alle Diejenigen, denen die Reformation in Bezug auf die Reinigung der Kirche von römischen Gebräuchen und römischen Einrichtungen nicht weit genug ging, weiterhin aber für Diejenigen, die zugleich mit der Reinigung der Religion eine solche der Sitten, des sozialen Körpers, verbanden, und schließlich deckt er später auch eine politische Strömung, den Widerstand gegen den Absolutismus in Staat und Kirche. Er ist nicht die Bewegung einer einzelnen Klasse, er hat seine Anhänger im hohen und niederen Adel, in der Geistlichkeit, im Bürgerthum und bei Handwerkern und Bauern. Als Sitten- oder soziale Bewegung entsprach er dem Geist einer Zeit, wo das Erwerbsleben unter dem Einfluß des steigenden Weltverkehrs unsicherer, die Sucht, und je nachdem die Notwendigkeit, Geld, das Tauschmittel [30]par excellence, aufzuhäufen, zu ,sparen‘, immer allgemeiner wurde.“
17
Es seien soziale Tugenden, die diese religiöse Bewegung gefördert habe, vor allem Sparsamkeit und Enthaltsamkeit. Bernstein spricht von christlicher Askese. [30]Ebd., S. 524.
18
Er entwirft also das Bild einer religiös bestimmten Lebensführung, die insbesondere der kapitalistischen Entwicklung förderlich war. Ebd., S. 525.
19
Weber, Protestantische Ethik II, unten, S. 244, Fn. 2, zitiert beim Begriff Puritanismus allerdings nicht Bernstein, sondern Sanford und bezieht sich auf die populäre Sprache des 17. Jahrhunderts. Dazu Sanford, John Langton, Studies and Illustrations of the Great Rebellion. – London: John W. Parker and Son 1858 (hinfort: Sanford, Great Rebellion). Die religiösen Bewegungen, die er unter diesem ,historischen‘ Begriff subsumiert, sind identisch mit jenen, für die er den Kunstbegriff ,asketischer Protestantismus‘ gebraucht. Dazu unten mehr. Zum Begriff Puritanismus auch die Darstellung bei Ghosh, Peter, A Historian Reads Max Weber. Essays on the Protestant Ethic. – Wiesbaden: Harrassowitz 2008 (hinfort: Ghosh, A Historian Reads Max Weber), S. 5 ff., bes. S. 27 ff. – Weber bestätigte später ausdrücklich diesen weiten Begriff von Puritanismus. In seiner Konfuzianismusstudie, zuerst publiziert 1915 und dann in erweiterter Form 1920, betont er, der Begriff Puritanismus sei keineswegs eindeutig: „Die ,Ecclesia pura‘ bedeutete praktisch, im eigentlichsten Sinne, vor allem die zu Gottes Ehre von sittlich verworfenen Teilnehmern gereinigte christliche Abendmahlsgemeinschaft, ruhe sie nun auf calvinistischer oder baptistischer Grundlage, und sei sie demgemäß in der Kirchenverfassung mehr synodal oder mehr kongregationalistisch geartet. Im weiteren Sinne aber kann man darunter verstehen die sittlich rigoristischen, christlich-asketischen Laiengemeinschaften überhaupt, mit Einschluß also der von pneumatisch-mystischen Anfängen ausgegangenen täuferischen, mennonitischen, quäkerischen, der asketisch-pietistischen und der methodistischen.“ MWG I/19, S. 464.
Wir wissen aus verschiedenen Äußerungen Max Webers, wie sehr er Eduard Bernstein schätzte. So ist es nicht verwunderlich, daß bereits im ersten Heft des Archivs für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik ein Beitrag von Eduard Bernstein erschien.
20
Auch wenn Weber bei seinen eigenen Studien nicht explizit auf diese Definition von Puritanismus zurückgegriff, so sah er in Bernsteins Untersuchung jedoch einen wichtigen Beitrag zu dem Thema, dem er sich selbst gerade widmete. Bernstein, Eduard, Die britischen Arbeiter und der zollpolitische Imperialismus, in: AfSSp, 19. Band, 1. Heft, 1904, S. 112–139. Das erste Heft umfaßte außer den bereits genannten Abhandlungen von Sombart, Weber und Bernstein auch noch solche von Ferdinand Tönnies und Moritz Julius Bonn.
4.2. Wirtschaft und Religion aus ,bürgerlicher‘ Perspektive: Gothein, Brentano, Jellinek, Sombart, Troeltsch
Aber nicht nur im ,sozialistischen‘, auch im ,bürgerlichen‘ Lager war man auf die Zusammenhänge zwischen Calvinismus und kapitalistischer Entwicklung [31]aufmerksam geworden.
21
So hatte etwa Eberhard Gothein, der schließlich in Heidelberg Webers Nachfolger werden sollte, 1892 eine Städte- und Gewerbegeschichte des Schwarzwalds und der angrenzenden Gebiete vorgelegt, die ein Kapitel über die Geschichte der Industrie und darin wiederum einen Abschnitt über die Erziehung zur Industrie enthält. Im 17. Jahrhundert habe es, nach den Handels- und Handwerkermonopolen in den Städten, einen Wechsel in den Anschauungen gegeben. Holland habe dabei als Vorbild gedient. Nach Gothein war Holland aber nur dadurch zu seiner herausgehobenen Stellung gelangt, weil „es sich den Flüchtlingen aller Nationen geöffnet hatte.“ Diese kamen vor allem aus katholisch dominierten Gebieten, in denen Andersgläubige besonders heftig verfolgt wurden. Gothein formuliert: „Wer den Spuren der kapitalistischen Entwickelung nachgeht, in welchem Lande Europas es auch sei, immer wird sich ihm die Thatsache aufdrängen: Die calvinistische Diaspora ist zugleich die Pflanzschule der Kapitalwirtschaft. Die Spanier drückten sie mit bitterer Resignation dahin aus: ,Die Ketzerei befördert den Handelsgeist‘.“ [31]Zum Folgenden allgemein auch Voigt, Friedemann, Vorbilder und Gegenbilder. Zur Konzeptualisierung der Kulturbedeutung der Religion bei Eberhard Gothein, Werner Sombart, Georg Simmel, Georg Jellinek, Max Weber und Ernst Troeltsch, in: Schluchter/Graf, Asketischer Protestantismus, S. 155–184; Lenger, Friedrich, Sozialwissenschaft um 1900. Studien zu Werner Sombart und einigen seiner Zeitgenossen. – Frankfurt a.Μ.: Peter Lang 2009; vom Bruch, Rüdiger et al. (Hg.), Kultur und Kulturwissenschaften um 1900. Krise der Moderne und Glaube an die Wissenschaft. – Stuttgart: Steiner 1989.
22
Gothein, Eberhard, Wirtschaftsgeschichte des Schwarzwaldes und der angrenzenden Landschaften, hg von der Badischen Historischen Kommission, 1. Band: Städte- und Gewerbegeschichte. – Straßburg: Karl J. Trübner 1892, S. 674 (hinfort: Gothein, Wirtschaftsgeschichte des Schwarzwaldes). Einschlägig ist das zehnte Kapitel, überschrieben: Geschichte der Industrie, darin: Die Erziehung zur Industrie, S. 673 ff. Gothein diskutiert dabei die Fälle Mannheim, Calw und Pforzheim. Er bezeichnet die Calvinisten als wandernde Pioniere der Industrie (S. 695), betont aber zugleich ihre Tendenz zu religiöser Intoleranz, sobald sie sich in der Diaspora etabliert hätten: „Auch die religiöse Unduldsamkeit des Calvinismus macht sich geltend: diese Auswanderer, die selber Schutz vor der religiösen Intoleranz ihres Königes suchen, machen zur Bedingung, daß an den Orten, wo sie wohnen, keine Juden geduldet werden.“ Ebd., S. 693. Ziel ist auch bei ihnen das Monopol. Zu Calw auch die Studie von Hartmut Lehmann, Pietismus und Wirtschaft in Calw am Anfang des 18. Jahrhunderts. Ein lokalhistorischer Beitrag zu einer universalhistorischen These von Max Weber, in: Lehmann, Protestantische Ethik (wie oben, S. 24 f., Anm. 90), S. 66–93.
Gotheins Fallbeispiel ist die Stadt Mannheim im 17. Jahrhundert. Auch sie bot den Flüchtlingen Aufnahme und günstige Bedingungen. Hier habe man wie in Holland gehandelt, zum Beispiel Steuerfreiheit für 20 Jahre gewährt und keine Zölle erhoben. Aber entscheidend sei gewesen, daß außer Gewerbefreiheit vor allem auch Religionsfreiheit bestand. Letztere galt es hier allerdings nicht nur für die Calvinisten, sondern auch gegen sie zu verteidigen, [32]weil diese selbst zu Intoleranz, etwa gegenüber den Juden, neigten, sobald sie sich einmal etabliert hatten. So wurde Mannheim zu einer Musterstadt der Freiheit, allerdings nur für kurze Zeit.
23
[32]Ebd., S. 680.
Ein besonders interessanter Fall ist in diesem Zusammenhang Lujo Brentano, der später zu einem der schärfsten Kritiker von Webers Studie wurde. Er hielt im Jahre 1901 eine Rede aus Anlaß der Übernahme des Rektorats an der Universität München, in der er sich mit den geistigen Grundlagen der Volkswirtschaftslehre und dem historisch sich wandelnden Verhältnis von Wirtschaftsordnung und Sittengesetz beschäftigte. Dabei schlug er einen großen Bogen von der stoischen Philosophie bis zu Adam Smith, den er den „größten Meister“ der Volkswirtschaftslehre nannte. In diesem Zusammenhang ging er auch auf die Rolle der Reformation, des Calvinismus und der englischen Revolution für die Wiederherstellung der in der Antike erreichten, dann verlorengegangenen Übereinstimmung von „der natürlichen Wirtschaftsordnung mit dem Sittengesetz“ ein.
24
Brentano, Lujo, Ethik und Volkswirtschaft in der Geschichte. Rede beim Antritt des Rektorats der Ludwig-Maximilians-Universität, gehalten am 23. November 1901. – München: Kgl. Hof- und Universitäts-Buchdruckerei von Dr. G. Wolf & Sohn 1901, S. 34, dass., in: ders., Der wirtschaftende Mensch in der Geschichte (1923), hg. von Richard Bräu und Hans G. Nutzinger. – Marburg: Metropolis-Verlag 2008, S. 53 ff., hier S. 77 (hinfort: Brentano, Wirtschaftender Mensch).
Brentano sieht den Verlust dieser Übereinstimmung in erster Linie als eine Folge der Wirtschaftsethik der Kirchenväter.
25
Sie hätten die Lehre vom Zinsverbot und vom gerechten Preis geschaffen und insbesondere den Handel diskriminiert. Trotz mancher Modifikationen hätten sie letztlich die heilsgefährdende Wirkung von Gewinn und Reichtum gepredigt. Besonders den Handel und damit den Händler habe dies getroffen: „Erscheint somit der Reichtum als eine so große Gefahr für die Seele, so war es nur folgerichtig, wenn die Kirchenväter mit ihrer kraftstrotzenden Beredsamkeit den Handel verurteilten. Denn der Handel erschien von Anfang an als Träger des verpönten Strebens nach dem größtmöglichen Gewinn.“ Brentano wurde vor allem wegen seiner Darstellung der mittelalterlichen Schriftsteller von katholischer Seite angegriffen. Er antwortete darauf in einem weiteren Beitrag: Brentano, Lujo, Die wirtschaftlichen Lehren des christlichen Altertums. – München: Verlag der k. Akademie 1902, dass., in: Brentano, Wirtschaftender Mensch (wie oben, Anm. 24), S. 83 ff.
26
Brentano, Wirtschaftender Mensch, S. 56.
Brentano sucht nun zu zeigen, wie im Mittelalter die wachsende Diskrepanz zwischen einer religiös begründeten Wirtschaftsethik und den natürlichen Grundlagen der Gesellschaft, wie er sich ausdrückt, zu einer schrittweisen Emanzipation von dieser Wirtschaftsethik führte. Dabei unterscheidet er eine innerreligiöse von einer außerreligiösen Entwicklung, eine religiöse von einer [33]„heidnischen“, wie er sagt. Diese heidnische Emanzipation habe in Italien begonnen und mit dem „Aufblühen des Handels im Gefolge der Kreuzzüge“ zur Auflösung der ständisch gegliederten Gesellschaft beigetragen.
27
Die intellektuelle Speerspitze dieser Entwicklung sei Machiavelli gewesen. [33]Ebd., S. 67.
28
Ebd., S. 68. Dort heißt es: „Was Machiavelli und seine Schriften in Gegensatz zu den mittelalterlichen Schriftstellern stellt, ist sein völliges Absehen von vorgefaßten ethischen Urteilen.“
Interessant für unseren Zusammenhang ist der von Brentano geschilderte innerreligiöse Vorgang. Diesen hat er in der Reformation und besonders deutlich im Calvinismus entdeckt. Die Reformation habe zwei Auffassungen bewirkt, „daß der Mensch von Gott in die Welt gesetzt sei, nicht damit er die Welt fliehe, sondern damit er in der Welt Gott diene; die andere, daß das Individuum in seiner innersten Überzeugung sich keiner äußeren Autorität zu beugen habe, sondern allein der selbsterkannten göttlichen Wahrheit.“
29
Aus diesen Auffassungen habe der Calvinismus eine radikale institutionelle Konsequenz gezogen: Seine Kirchenverfassung beruhe auf der absoluten Souveränität der Kirchengemeinde, von der jede weltliche Gewalt fernzuhalten sei: „In der katholischen Kirche herrschten Autorität und Tradition über den Glauben; sie strebte nach Herrschaft über den Staat, damit er die einzelnen zwinge, ihre Autorität anzuerkennen. Nach Calvin ist aber der Glaube Sache des Gewissens und der göttlichen Erleuchtung des Einzelnen und die Kirche die Summe dieser Einzelnen. Der Schwerpunkt also lag nach ihm beim Einzelnen.“ Ebd., S. 70.
30
Ebd., S. 71.
Brentano interpretiert nun die politische Entwicklung im 17. Jahrhundert als einen Kampf zwischen den beiden emanzipatorischen Strömungen, der heidnischen und der religiösen. In England sei dieser Kampf zwischen Machiavellismus und Calvinismus in Karl I. und Cromwell personifiziert. Der vorübergehende Sieg Cromwells und die von ihm durchgesetzte übertriebene Sittenzucht hätten aber am Ende zur Emanzipation des wirtschaftlichen Denkens von religiöser Bindung überhaupt beigetragen. Doch für unseren Zusammenhang ist nicht dies wichtig, sondern Brentanos Behauptung, der Kampf um die calvinistische Kirchenverfassung und die damit ausgelöste Debatte um das Verhältnis von Kirche und Staat habe langfristige Wirkungen gezeitigt. Der Konflikt sei zunächst in Genf selbst ausgetragen worden. Daraus habe sich eine religiöse Bewegung entwickelt, „die Frankreich erschütterte, über die spanische Herrschaft in den Niederlanden triumphierte, Schottland und England beherrschen sollte und die amerikanischen Staaten ins Leben rief.“
31
Ebd., S. 72.
[34]Hier läßt sich nun eine weitere Betrachtung anschließen, die vor Brentanos Rektoratsrede angestellt wurde. Sie findet sich in Georg Jellineks Studie über die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte, einer verfassungsgeschichtlichen Untersuchung, die aber gleichfalls im Zusammenhang mit religionsgeschichtlichen Überlegungen steht.
32
Georg Jellinek, Max Webers Heidelberger Kollege im Staatswissenschaftlichen Seminar, fragte darin, wie es historisch zu den subjektiven öffentlichen Rechten gekommen sei, die heute in fast allen Verfassungen auftauchten. Und er blickt dafür auf die französische und auf die amerikanische Revolution, also auf die Jahre 1789 und 1776 zurück. Der Vergleich der französischen Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte mit den zeitlich davor liegenden entsprechenden Deklarationen der amerikanischen Staaten ergebe, daß die französische Verfassung die bis dahin geltenden Rechtsgrundlagen zerstört habe, die amerikanischen Verfassungen aber diese erhalten und weiterentwickelt hätten. Diese Grundlagen seien allerdings nicht, wie man denken könnte, einfache Übernahmen aus dem englischen Mutterland. [34]Jellinek, Georg, Die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte. Ein Beitrag zur modernen Verfassungsgeschichte. – Leipzig: Duncker & Humblot 1895 (hinfort: Jellinek, Menschen- und Bürgerrechte1).
33
Denn im Unterschied zu den Regeln in England seien die amerikanischen solche, „die über dem normalen Gesetzgeber stehen.“ Jellinek denkt hier an die Bill of Rights (1689), die Habeas-Corpus-Akte (1679), die Petition of Rights (1627) und die Magna Charta (1215–1225), betont aber zugleich, die amerikanischen Erklärungen trennten eine tiefe Kluft von diesen englischen Vorläufern. Ebd., S. 29.
34
Sie zögen eine Grenzlinie zwischen Individuum und Staat. Das Individuum sei kein Rechtssubjekt durch den Staat, sondern ein Rechtssubjekt von Natur aus, ausgestattet mit unveräußerlichen und unantastbaren Rechten. Das sei im englischen Recht noch nicht der Fall. Es bleibe letztlich Untertanenrecht, das amerikanische dagegen werde zum Menschen- und Bürgerrecht fortentwickelt. Der Vorrang dieser unveräußerlichen und unantastbaren Rechte des Individuums vor allen staatlich verliehenen Rechten aber könne auch nicht aus dem Naturrecht abgeleitet werden. Wenn weder aus englischem Recht noch aus Naturrecht, woraus dann? Ebd., S. 25.
An dieser Stelle vollzieht Jellinek in seiner Analyse eine religionsgeschichtliche Wende. Es sei die Verfassung der reformierten Kirchen gewesen, die den Menschen- und Bürgerrechten den Weg in die politische Arena ebnete. Entscheidend dafür waren nach Jellinek zwei Grundgedanken der reformierten Kirchen: die radikale Trennung von Staat und Kirche und die Autonomisierung der einzelnen Kirchengemeinde, der institutionelle Ausdruck für einen radikalen Individualismus auf religiösem Gebiet. Dies habe die Anerkennung unbeschränkter Gewissensfreiheit eingeschlossen sowie den [35]Gedanken, diese sei nicht von einer irdischen Macht, sondern von Gott verliehen. Es bedurfte dann nur noch der Übertragung dieser religiösen Auffassung auf politisches Gebiet.
Für Jellinek ist also die Idee der unveräußerlichen und unantastbaren Menschen- und Bürgerrechte, die dem Individuum qua Individuum zustehen, nicht politischen, sondern religiösen Ursprungs. „Was man bisher für ein Werk der Revolution gehalten hat, ist in Wahrheit eine Frucht der Reformation und ihrer Kämpfe“ heißt es in seiner Schrift.
35
Es handle sich bei den Menschen- und Bürgerrechten also nicht um staatlich verliehene Rechte, sondern um vorstaatliche Rechte, die vom Staat anerkannt werden müßten und die seine Macht begrenzten. Damit seien aus objektiven subjektive öffentliche Rechte geworden. Jellinek behauptet, daß die Prinzipien von 1789, die manche als eine „weltgeschichtliche Offenbarung“, als „das kostbarste Geschenk“ Frankreichs an die Menschheit, auffaßten, [35]Ebd., S. 42.
36
in Wahrheit die von 1776 seien. Ebd., S. 1. Jellinek eröffnet seine Untersuchung mit dem Hinweis auf die unterschiedlichen Einschätzungen der Erklärung vom 26. August 1789 und stellt neben den negativen diese positiven Einschätzungen heraus.
Wir diskutieren hier nicht, wie überzeugend sich solche Analysen aus heutiger Sicht ausnehmen. Es geht ausschließlich darum, zu zeigen, wie verbreitet die Vorstellung eines Zusammenhangs zwischen dem reformierten Protestantismus und wirtschaftlichen, politischen und rechtlichen Entwicklungen in der Neuzeit sowohl im ,sozialistischen‘ wie im ,bürgerlichen‘ Lager war. Doch damit ist die wissenschaftliche Problemsituation, auf die Max Weber reagierte, noch nicht voll ausgeleuchtet. Zwei weitere Autoren aus Webers Umkreis sind wichtig: Werner Sombart und Ernst Troeltsch.
Beginnen wir mit Werner Sombart, über den wir bereits im Zusammenhang mit der Gründung des Archivs für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik sprachen. Er veröffentlichte im Jahre 1902 eine zweibändige Studie über den modernen Kapitalismus, wobei der erste Band eine Genesis, der zweite eine Theorie der kapitalistischen Entwicklung bietet.
37
Ihr ließ er im Jahre 1903 ein eher populär gehaltenes Buch über die Wirtschafts- und Sozialgeschichte Deutschlands im 19. Jahrhundert folgen, in dem er, um mit Weber zu sprechen, Deutschlands Umbau vom Agrarstaat zum Industriestaat, also die deutsche kapitalistische Entwicklung, nachzuzeichnen sucht. Dabei greift er auf die Erkenntnisse in seiner großen Studie zurück. Sombart, Werner, Der moderne Kapitalismus, 1. Band: Die Genesis des Kapitalismus, 2. Band: Die Theorie der kapitalistischen Entwicklung. – Leipzig: Duncker & Humblot 1902 (hinfort: Sombart, Der moderne Kapitalismus I und II).
38
Sombart, Werner, Die deutsche Volkswirtschaft im Neunzehnten Jahrhundert.– Berlin: Georg Bondi 1903 (hinfort: Sombart, Volkswirtschaft). Sombart stellte dem Buch unter der Überschrift „Literaturhinweis“ folgende Bemerkung voran: „Dieses Buch ist das erste, das das im Titel genannte Problem wissenschaftlich behandelt. [36]Eine Literatur gibt es deshalb nicht, nur Aufsätze dazu. Sie finden demgemäß, verehrte Freundin, an verschiedenen Stellen dieses Werkes Hinweise auf Einzelschriften, meist mit dem Vermerke, in welcher Hinsicht sie Ihnen von Nutzen sein können. Ehe ich jedoch meine Darstellung beginne, muß ich im vornherein bemerken, daß gleichsam im Hintergrund dieses Buches mein Hauptwerk steht: Der moderne Kapitalismus. 2 Bände. Leipzig, Duncker & Humblot 1902. Ohne in jedem Augenblicke die Darstellung in den folgenden Blättern auf jenes Werk ausrichten zu können, würde ich sie nicht unternommen haben. Sie werden bei der Lektüre verstehen lernen, was ich damit sagen will.“ Im Stil dieser Vorbemerkung ist das ganze Buch, unter Verzicht auf einen wissenschaftlichen Apparat, gehalten. In der 4. Auflage verlängerte Sombart seine Untersuchung bis zum Ende des Weltkriegs und änderte den Titel entsprechend: „Die deutsche Volkswirtschaft im neunzehnten und im Anfang des 20. Jahrhunderts“. Er fügte jetzt den Untertitel „Eine Einführung in die Nationalökonomie“ hinzu. Anders, als es dieser Untertitel nahelegen könnte, handelt es sich bei der Darstellung aber nicht etwa um eine Dogmengeschichte der Nationalökonomie, sondern um eine Wirtschafts- und Sozialgeschichte, in der er übrigens bereits den Juden eine wichtige Rolle für die kapitalistische Entwicklung in Deutschland zuweist. Dazu „Sechstes Kapitel: Das Volk“. Er bemerkt in der 4. Auflage, sein späteres Buch „Die Juden und das Wirtschaftsleben“ von 1911 sei eine Art Ergänzung zu diesem Werk. Ebd., S. 113, Fn.
[36]Sombarts umfangreiches Werk fand zunächst ein geteiltes Echo.
39
Außerhalb seines Faches überwog die Anerkennung, innerhalb des Faches dagegen die Kritik, wenn man es nicht überhaupt vorzog, es gänzlich zu ignorieren. Insgesamt war Sombart ein ungewöhnlich erfolgreicher Schriftsteller. Fast alle seine Werke erreichten mehrere Auflagen und wurden in viele Sprachen übersetzt.
40
Möglicherweise hatte dies außer mit Sombarts Neigung zum Feuilletonismus mit seinem Grenzgängertum zwischen Nationalökonomie, Geschichtswissenschaft und Soziologie zu tun. Max Weber ärgerte die mangelnde Beachtung des Werkes im Fach, und er machte mehrere Versuche, einen der führenden Nationalökonomen für eine Rezension im Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik zu gewinnen. Doch keiner erklärte sich dazu bereit. Dabei hoffte er insbesondere auf Brentano, Weber charakterisiert die Situation gegenüber Lujo Brentano wie folgt: Es komme darauf an, „daß dem Buche gegenüber der kritiklosen Bewunderung Einzelner und gegenüber dem abgünstigen Neide sehr Vieler, deren Auge allein an den Geschmacksentgleisungen Sombarts haftet u. die vor lauter Schadenfreude über mancherlei Thörichtes, was es enthält, jede Anerkennung des Tüchtigen, was auch darin steckt, vergessen, – daß, gegenüber all’ diesem subjektiv befangenen Aburteilen, von einer Seite, welche die nötige Autorität dazu besitzt u. die Sombart selbst als solche unbedingt anerkennt, dem Buche sein richtiger Platz innerhalb der wissenschaftlichen Arbeit der letzten Zeit zugewiesen wird.“ Brief Max Webers an Lujo Brentano vom 4. Oktober 1903, BA Koblenz, Nl. Lujo Brentano, Nr. 67, Bl. 161–164 (MWG II/4).
41
der aber nur Ironie für [37]Sombart übrig hatte. Dazu der eben genannte Brief Max Webers an Lujo Brentano vom 4. Oktober 1903 und die ausführliche Editorische Vorbemerkung dazu in MWG II/4. Weitere Briefe Webers an Brentano in dieser Angelegenheit sind überliefert vom 10. Oktober 1903, vom 9. März, 28. März 1904 und vom 22. Mai [1904], alle in BA Koblenz, Nl. Lujo Brentano, Nr. 67 (MWG II/4). Dazu auch der Brief Max Webers an Gustav Schmoller vom 14. Dezember 1904, GStA PK, VI. HA, Nl. Gustav von Schmoller, [37]Nr. 196b, Bl. 133–134 (MWG II/4). Ferner die Einleitung von Wolfgang Schluchter in MWG III/6, S. 24 ff.
42
In Webers Augen dagegen war Sombarts Untersuchung trotz mancher Schwächen im Einzelnen ein großer Wurf. Er entnahm ihr die Formulierung, welche das Explanandum seiner Aufsatzfolge bezeichnet: „Geist des Kapitalismus“ oder „kapitalistischer Geist“. Typisch dafür ist die kleine Kontroverse, die sich zwischen Brentano und Sombart im Jahr 1905 in der Wochenschrift Die Nation entspann. Brentano eröffnete mit der Frage an Marxisten und andere „Ist der Handel an sich Parasit?“ (Nr. 18 vom 28. Jan. 1905), Sombart antwortete an Herrn Geheimrat Brentano und andere: „Der Kaufmann – ein Parasit?“ (Nr. 20 vom 11. Febr.). Schließlich folgte von Brentano „Die Produktivität des Handels noch einmal“ (Nr. 21 vom 18. Febr.), mit dem Untertitel: „Insipiens an Sapiens“. Weber kommentierte in einem Brief an Brentano, der ihm offenbar die Artikel zugeschickt hatte: „Bei dem ,sokratischen‘ Frage- und Antwortspiel sind [so], psychologisch, die Rollen etwas ungerecht verteilt[.] Sie haben Ihr Vergnügen dabei, während ich S[ombart]s Nerven schlecht kennen müßte, oder er ärgert sich erklecklich.“ Brief Max Webers an Lujo Brentano vom 19. Februar 1905, BA Koblenz, Nl. Lujo Brentano, Nr. 67, Bl. 179–180 (MWG II/4).
43
Sombart, Der moderne Kapitalismus I, Kap. 14 und 15 (S. 378–397).
Dabei interessiert sich Weber nicht in erster Linie für Sombarts Ableitung der Kapitalakkumulation aus der Grundrente, die er für falsch hält. Er interessiert sich hauptsächlich für Sombarts Antwort auf die Frage nach der Herkunft des kapitalistischen Geistes. Diesen sieht Sombart mit einer neuen Einstellung des Wirtschaftens entstehen. Im Verhältnis von Wirtschaften und Leben verkehrten sich Zweck und Mittel. Was bisher Mittel war, nämlich Geld zu verdienen, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, werde nun zum Zweck an sich.
44
Nicht mehr der Standpunkt der ,Nahrung‘ sei für das Wirtschaften maßgebend, auch nicht mehr die rasche, mehr oder weniger gewaltsame Bereicherung, sondern das langfristige, kalkulatorisch-spekulative Geldverdienen um des Geldverdienens willen. Eine planmäßige, zweckmäßige und rechnungsmäßige Wirtschaftsführung breche sich damit Bahn. Das nötige Hilfsmittel sei die im 12., 13. und 14. Jahrhundert in Italien entwickelte und praktizierte doppelte Buchführung gewesen. So entstand ein ökonomischer Rationalismus, ein rationaler Erwerbstrieb, den man mit Gründen „Geist des Kapitalismus“ nennen könne. Der von diesem Geist beseelte kapitalistische Unternehmer betreibe das Geldverdienen als Geschäft, d. h. mittels Vertragsabschlüssen über geldwerte Leistungen und Gegenleistungen verwerte er sein Sachvermögen mit dem Ziel, es zu vermehren. Das unterscheide diese Art von Geldvermehrung etwa von „Raubrittertum und Bauernschinderei, Goldgräberei und Alchemisterei“. Hier folgt Sombart übrigens in Grenzen Georg Simmel.
45
Sombart, Der moderne Kapitalismus I, S. 388.
Sombart ist nun der Meinung, dieser Geist des Kapitalismus sei nicht erst, wie etwa Gothein in seiner Studie nahegelegt hatte, in der calvinistischen [38]Diaspora entstanden.
46
Er habe überhaupt keinen religiösen Ursprung. Ob Calvin oder der Calvinismus, ob Ideen wie Individualismus oder Freiheit, sie alle könnten allenfalls als „nachfolgende Ursachen“ betrachtet werden, als solche also, die eine bereits eingetretene Entwicklung verstärkten, nicht aber als „die primär wirkenden Ursachen der modernen Wirtschaft“. Sie müßten auch schon deshalb als abgeleitet gelten, weil die wirtschaftliche Revolution längst im Gange war, als sie ins Leben traten. [38]Sombart bezieht sich explizit auf Gothein. Sombart, Der moderne Kapitalismus I, S. 378 ff., bes. S. 381, Fn. 1. Dem geht die Feststellung voraus: „Unzureichend erscheint mir auch eine Begründung modern-kapitalistischen Wesens mit der Zugehörigkeit zu bestimmten Religionsgemeinschaften. Daß der Protestantismus, zumal in seinen Spielarten des Calvinismus und Quäkertums, die Entwicklung des Kapitalismus wesentlich gefördert hat, ist eine zu bekannte Tatsache, als daß sie des weiteren begründet zu werden brauchte.“ Man kann Webers Aufsatzfolge geradezu als eine Widerlegung dieser Stelle lesen.
47
Sombart verlegt die Geburtsstunde des modernen Kapitalismus in die Zeit der Erfindung der doppelten Buchführung. Sombart, Der moderne Kapitalismus II, S. 5 f.
Nicht zufällig präsentiert er uns Jakob Fugger als das Modell des neuen Wirtschaftsmenschen, der in rationaler Manier Geld häuft um des Geldhäufens willen. Sein Leitspruch laute: „Er wollte gewinnen, dieweil er könnte“,
48
er lasse also keine Chance zum Geldverdienen aus. Er habe seine wirtschaftliche Tätigkeit tatsächlich als Geschäft verstanden, als ein Kalkulieren, aber auch als ein Spekulieren, doch dies alles in Form der Rechenhaftigkeit. Sombart, Der moderne Kapitalismus I, Kap. 15, S. 397.
Sombart, und dies unterscheidet ihn von den bisher besprochenen Positionen, ist also gegenüber einer religionsgeschichtlichen Erklärung des kapitalistischen Geistes skeptisch.
49
Aber er gibt für diesen Geist eine richtungweisende Definition. Was er ökonomischen Rationalismus nennt, ist eine historisch geprägte Gestalt der Lebensführung. Man dürfe die treibenden Kräfte des Wirtschaftslebens nicht nur in äußere Bedingungen setzen. Auf die Zwecksetzungen der Menschen komme es vielmehr entscheidend an. Es gehe deshalb darum, die „prävalenten Motivreihen“ als primäre Ursachen aufzudecken. Sombart modifizierte diese Position später. Dazu die Einleitung in MWG I/18.
50
Und weiter: „Wir wissen, daß wir uns hüten müssen vor der Zurückführung auf nichtssagende, weil völlig allgemeine seelische Kräfte wie den ,Egoismus‘, den ,wirtschaftlichen Sinn‘ oder dergleichen, daß wir uns vielmehr nach den eine bestimmte Zeitepoche beherrschenden, also historisch bedingten Motivreihen umsehen müssen, wollen wir zu einigermaßen brauchbaren Kausalerklärungen gelangen. Welche Kräfte also waren es, die die moderne Wirtschaft geschaffen haben: so lautet genauer die Frage, die wir [39]stellen wollen.“ Sombart, Der moderne Kapitalismus II, S. 4.
51
Nach den von Sombart so genannten „prävalenten Motivreihen“ fragt Max Weber dann auch. [39]Ebd., S. 5.
Nach Sombart ist also eine religionsgeschichtliche Erklärung des Geistes des Kapitalismus nicht überzeugend. Allenfalls den Juden will er einen wichtigen Anteil an dessen Zustandekommen zusprechen, aber nicht in erster Linie wegen ihrer Religion, sondern wegen ihres „Nationalcharakters“.
52
Allerdings rekurriert er bei seiner Erklärung auf die Prägung von Motiven, auf die seelische Seite des Wirtschaftslebens, und darin ist er für Weber ein Vorbild. Doch er sagt nicht genauer, woher diese Prägung und damit der kapitalistische Unternehmergeist stammen. Besonders deutlich im Sechsten Kapitel von Sombart, Volkswirtschaft, S. 128 ff., wo er sich teilweise an die Charakterisierung der Juden bei Karl Marx anschließt. Dazu Marx, Karl, Zur Judenfrage, in: Marx, Werke – Schriften – Briefe I (wie oben, S. 27, Anm. 5), S. 451 ff.
Mit seiner Definition des Geistes des Kapitalismus und seiner Vorstellung vom ökonomischen Rationalismus ging Sombart, wirtschaftsgeschichtlich gesehen, über das hinaus, was wir bisher gehört haben. Hinzu kommt die Unterscheidung, die er zwischen kapitalistischem Unternehmer und kapitalistischer Unternehmung trifft. Die kapitalistische Unternehmung verselbständige sich gegenüber dem kapitalistischen Unternehmer, und dies bedeute zugleich eine Verselbständigung des Sachvermögens. Im kapitalistischen Unternehmer bleibe die neue Zwecksetzung subjektiviert und begrenzt, in der kapitalistischen Unternehmung werde sie objektiviert und entgrenzt.
53
Sombart, Volkswirtschaft, S. 76 ff.
Man kann vermuten, Weber habe Sombarts Interesse an der historischen Prägung von Motiven für eine neue Art des Wirtschaftens geteilt,
54
sich aber mit dessen religionsgeschichtlicher Skepsis nicht abgefunden. Daß er sich eher der überwiegenden Ansicht anschloß, die der Reformation und ihrer Verzweigung in Luthertum und Calvinismus die größte Bedeutung zumaß, ist vermutlich auch dem Dialog zu verdanken, den er mit Ernst Troeltsch in Heidelberg unterhielt. Dies läßt sich auch aus dem Brief ersehen, den Weber an Brentano am 22. Mai 1904 schreibt, um ihn doch noch für eine Rezension von Sombart Kapitalismusbuch zu gewinnen. Interessanterweise betont er jetzt die Bedeutung von Band II. Band I mit der Grundrentenhypothese sei ja weitgehend erledigt. Aber Band II enthalte doch „noch eine ganze Reihe recht geistvoller, aber hie u. da auch anfechtbarer Theorien, und der Werth der ganzen Methode, der Grundgedanke des Werks für das mächtige Problem der Entstehung des modernen wirtschaftlichen Geistes, welches Ihnen immer so nahe lag, lassen uns den größten Werth auf Ihre Stellungnahme legen.“ Brief Max Webers an Lujo Brentano vom 22. Mai [1904], BA Koblenz, Nl. Lujo Brentano, Nr. 67, Bl. 159–160 (MWG II/4).
Ernst Troeltsch war zum Sommersemester 1894 an die Theologische Fakultät der Universität Heidelberg gekommen. Er fand das Milieu, in das er gera[40]ten war, zunächst eher steril. Erst als Adolf Deißmann der Fakultät beitrat, änderte sich das Klima. Auch die Berufung Max Webers war für Troeltsch ein großer Gewinn.
55
Es entwickelte sich ein intellektueller Kreis, in dem, disziplin- und fakultätsübergreifend, vor allem auch über die Kulturbedeutung von Christentum und Protestantismus diskutiert wurde. Hinzu kam der Einfluß des südwestdeutschen Neukantianismus, der mit der Berufung von Wilhelm Windelband an die Philosophische Fakultät noch an Intensität gewann. Aus alldem entstand schließlich der Eranos-Kreis, dessen Diskussionen, kulturwissenschaftlich ausgerichtet, hauptsächlich den Einfluß der Religionen auf die Gestaltung der Welt behandelten. [40]Dazu die Darstellung von Graf, Friedrich Wilhelm, Einleitung, in: Ernst Troeltsch. Kritische Gesamtausgabe, Band 4: Rezensionen und Kritiken (1901–1914). – Berlin, New York: Walter de Gruyter 2004, S. 1–70, bes. der Abschnitt 3: „Das Heidelberger liberale Gelehrtenmilieu“, S. 52–68, hier S. 52 (hinfort: Graf, Einleitung).
56
Weber trug in diesem Kreis zweimal vor: am 5. Februar 1905 über den Kapitalismus der Neuzeit Zum Eranos-Kreis: Lepsius, Μ. Rainer, Der Eranos-Kreis Heidelberger Gelehrter 1904–1908. Ein Stück Heidelberger Wissenschaftsgeschichte anhand der neuaufgefundenen Protokollbücher des Eranos, in: Jahrbuch der Heidelberger Akademie der Wissenschaften für das Jahr 1983. – Heidelberg: Winter, S. 46 ff. Ferner Treiber, Hubert, Der „Eranos“ – Das Glanzstück im Heidelberger Mythenkranz?, in: Schluchter/ Graf, Asketischer Protestantismus, S. 75–153.
57
und am 23. Februar 1908 über den Kapitalismus des Altertums. Der Vortragstitel lautete: „Die protestantische Askese und das moderne Erwerbsleben“, unten, S. 216–221.
58
Weber, Kapitalismus im Altertum, MWG I/6, S. 748–753. Ernst Troeltsch trug am 15. Januar 1905 über den „Zusammenhang des Protestantismus mit dem Mittelalter“ und am 3. November 1907 über „Soziallehren der alten Kirche“ vor, beide im Eranos-Protokollbuch, UA Heidelberg, KE 94; ersterer auch gedruckt in: Graf, Friedrich Wilhelm und Trutz Rendtorff (Hg.), Ernst Troeltschs Soziallehren. Studien zu ihrer Interpretation (Troeltsch-Studien, Band 6). – Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus Gerd Mohn 1993, S. 49 f.
Troeltsch, dessen Interessen weit über die Theologie im engeren Sinne hinausreichten, sah insbesondere in Max Weber einen kongenialen Gesprächspartner. Man prägte für diese Beziehung den Begriff der „Fachmenschenfreundschaft“.
59
In Troeltschs Denken spielte der Unterschied zwi[41]schen Luthertum und Calvinismus eine wichtige Rolle. Der Altprotestantismus insgesamt habe dazu beigetragen, die relative christliche Einheitskultur des Mittelalters als eine kirchlich geleitete Zwangskultur zu überwinden, an die Stelle der Sakramentsreligion die Glaubensreligion zu setzen und über den Gedanken des religiösen Individualismus den Weg in die moderne Welt zu bahnen. Aber dann sei der reformatorische Gedanke in sehr verschiedene Richtungen weiterentwickelt worden. Während sich das Luthertum „mit seiner antidemokratisch-absolutistischen Staatsgesinnung, seiner Nichtresistenz und Gehorsamsverklärung, seiner wirtschaftlich-traditionalistischen Haltung und seiner Verherrlichung des gegebenen Systems ständischer Berufsgliederungen“ den außerkirchlichen autoritären Entwicklungen weitgehend eingeordnet habe, sei es dem Calvinismus gelungen, „die demokratischen, modern staatsrechtlich-politischen und die modernen wirtschaftlich-fortschrittlichen Prinzipien sich anzueignen“, Graf, Friedrich Wilhelm, Fachmenschenfreundschaft. Bemerkungen zu ,Max Weber und Ernst Troeltsch‘, in: Mommsen, Wolfgang J. und Schwentker, Wolfgang (Hg.), Max Weber und seine Zeitgenossen. – Göttingen, Zürich: Vandenhoeck & Ruprecht 1988, S. 313–336. Daß diese Fachmenschenfreundschaft allerdings von komplexen Unterströmungen begleitet war und sich nicht zufällig schließlich in eine Fachmenschenkonkurrenz, ja Fachmenschengegnerschaft verwandelte, zeigen Graf, Friedrich Wilhelm, Wertkonflikt oder Kultursynthese?, in: Schluchter/Graf, Asketischer Protestantismus, S. 257–279, sowie Graf, Friedrich Wilhelm und Schluchter, Wolfgang, Einleitung, ebd. S. 1–7. Schon vor Webers Zusammenbruch, im Jahre 1898, schrieb Troeltsch in einem Brief: „Den meisten Umgang pflege ich außerhalb der Fakultät. Max Weber, Hensel, Carl Neumann u. mehrere andere sind mir sehr liebe Freunde.“ Auch Georg Jellinek, obgleich einer älteren Generation angehörend, rech[41]nete Troeltsch wohl zu seinem Freundeskreis. Brief zitiert nach Graf, Einleitung (wie oben, S. 40, Anm. 55), S. 52; zu der Beziehung Troeltsch-Jellinek, ebd., S. 55 f.
60
ein Urteil übrigens, das von dem Engels gar nicht so verschieden ist. Troeltsch, Ernst, Calvinismus und Luthertum (1909), in: Troeltsch-KGA 8, S. 99–107, Zitate: S. 101.
Diese besondere Bedeutung des Calvinismus für das Entstehen der modernen Welt hatte Ernst Troeltsch bereits in einem Beitrag aus dem Jahr 1903 unterstrichen, von dem er im Rückblick freilich sagte, er gehöre zu seinen „höchst peniblen und schwerfälligen Artikeln“, die in dem „großen Massengrabe der ,Realencyklopädie für prot. Theologie und Kirche‘ beigesetzt“ seien.
61
Dieser Artikel war Weber bei der Konzeption seiner Studie bekannt. Troeltsch, Ernst, Gesammelte Schriften, Band 4: Aufsätze zur Geistesgeschichte und Religionssoziologie, hg. von Hans Baron. – Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) 1925, S. 7 f. (hinfort: Troeltsch, Gesammelte Schriften IV).
62
Es handelt sich um Troeltschs Untersuchung über die englischen Moralisten des 17. und 18. Jahrhunderts. Brief Max Webers an Lujo Brentano vom 10. Oktober 1903, BA Koblenz, Nl. Lujo Brentano, Nr. 67, Bl. 157–158 (MWG II/4). Dazu ausführlicher unten, S. 44 f.
63
Darin zeigt er, wie sich das Verhältnis von Gnadenethik und lex naturae, von lex divina und natürlicher Sittlichkeit des politischen, ökonomischen und sozialen Lebens, im Übergang vom mittelalterlichen Katholizismus zum Protestantismus veränderte und wie innerhalb des Protestantismus der Calvinismus radikalere Folgerungen aus dieser Veränderung als das Luthertum zog. Während der mittelalterliche Katholizismus die Gnadenethik und die lex naturae, die übernatürliche und die natürliche Ethik, dualistisch und hierarchisch aufgefaßt sowie die Gnadenethik in die abgestufte Ethik der Mönche, Priester und Laien überführt habe, sei im Pro[42]testantismus diese Abstufung der Gnadenethik beseitigt und die lex naturae ihr gegenüber in Grenzen verselbständigt worden. Dies habe zu einem Nebeneinander, teilweise auch zu einer wechselseitigen Durchdringung von lex divina und lex naturae geführt. Daraus aber habe eine neue Idee der christlichen Kultur entstehen können, von der des katholischen Mittelalters verschieden. Sie, so Troeltsch, wurde freilich nicht so sehr vom Luthertum als vielmehr vom Calvinismus realisiert. Das Luthertum habe zwar auch die Abstufung der Gnadenethik beseitigt, sei aber letztlich bei dem Nebeneinander der beiden Sphären, der lex divina und der lex natura, stehen geblieben. Nur der Calvinismus habe, hauptsächlich in der englischen Revolution, eine neue Idee einer christlichen Kultur umzusetzen versucht. Entscheidend hierfür aber sei die gegenüber dem Luthertum andere Stellung des Prädestinationsgedankens gewesen. Er habe den Calvinismus auf den Weg der Demokratie und der Kapitalwirtschaft geführt. Troeltsch formuliert: „Im Gegensatz zu dem Patriarchalismus und naturalwirtschaftlichen Konservatismus der Lutheraner huldigen die Reformierten einem politischen und wirtschaftlichen Utilitarismus, der den Staat auf die Höhe seiner natürlichen Leistungsfähigkeit bringen und damit ihn auch leistungsfähiger für seine christliche Bestimmung machen will; und diesen Utilitarismus unterstützen die christlichen Forderungen der Mäßigkeit, Rechtlichkeit und Arbeitsamkeit, in denen sich das Evangelium als auch dem materiellen Gedeihen förderlich erweist. So werden die reformierten Länder Träger der Kapitalwirtschaft, des Handels, der Industrie und eines christlich temperierten Utilitarismus, der ihre Kulturtheorien wie ihre thatsächliche Kraft bedeutsam beeinflußt hat.“ Troeltsch, Ernst, Art. Moralisten, englische, in: RE3, 13. Band, 1903, S. 436–461 (hinfort: Troeltsch, Art. Moralisten), sowie dass, in: Troeltsch, Gesammelte Schriften IV (wie oben, Anm. 61), S. 374–429.
64
Dies aber gelte nicht nur für die wirtschaftliche, sondern auch für die politische Entwicklung. In beiden Hinsichten sei der Calvinismus im Vergleich zum Luthertum spezifisch modern. [42]Troeltsch, Art. Moralisten, S. 444; der letzte Satz ist in der Vorlage durch Fettdruck hervorgehoben (dass., in: Troeltsch, Gesammelte Schriften IV, S. 393). Für Troeltsch kumuliert diese Entwicklung zu einer neuen christlichen Kultur in Cromwell, mit dem aber zugleich ihr Scheitern eingeleitet werde. Übrigens zitiert Troeltsch in diesem Artikel überwiegend Literatur, die auch Weber dann verwendet.
Hinzu kommt: Troeltsch arbeitete in den folgenden Jahren an seiner großen Studie „Protestantisches Christentum und Kirche in der Neuzeit“, deren Gedanken er dann auf dem Historikertag 1906 vortrug und später erweiterte.
65
Dabei untersuchte er die Mitbeteiligung des Protestantismus in seinen [43]verschiedenen Verzweigungen nicht allein, wie Weber, am Entstehen der modernen Wirtschaft, sondern an der modernen europäisch-amerikanischen Kultur insgesamt. Dabei wußte er sich im Grundtenor mit Weber einig, wenngleich er mehr die Lehren, dieser mehr die praktischen Wirkungen der Religionsarten in den Mittelpunkt stellte. Troeltsch, Ernst, Protestantisches Christentum und Kirche in der Neuzeit, in: Die Kultur der Gegenwart, Teil I, Abt. IV, hg. von Paul Hinneberg. – Berlin und Leipzig: B. G. Teubner 1906, S. 253–458 (hinfort: Troeltsch, Protestantisches Christentum), dass. (1906/1909/1922), in: Ernst Troeltsch. Kritische Gesamtausgabe, Band 7. – New York, Berlin: Walter de Gruyter 2004, S. 81 ff.; ein Sonderabdruck von 1905 ist in der Handbibliothek Max Webers, Max Weber-Arbeitsstelle, Bayerische Akademie der Wissenschaften München, überliefert, ebenso ein Sonderabdruck der 2. Aufl. von 1909. – Der Vortrag des Historikertags erschien in 1. Aufl. 1906 und in 2. Aufl. 1911, Troeltsch, Ernst, Die Bedeutung des Protestantismus für die Entstehung der moder[43]nen Welt, in: Ernst Troeltsch. Kritische Gesamtausgabe, Band 8. – New York, Berlin: Walter de Gruyter 2001, S. 199–316 (hinfort: Troeltsch, Bedeutung des Protestantismus), sowie zu den beiden Auflagen der Editorische Bericht, ebd., S. 197.
Überblickt man diese wissenschaftliche Problemsituation, so liegen drei Folgerungen nahe. 1. Es existiert eine Diskussion über den Einfluß der Reformation und ihrer Verzweigung in Luthertum und Calvinismus auf politische und wirtschaftliche Entwicklungen. 2. Dabei werden die Kirchenverfassungen und ihre Wirkung und, nur bei Troeltsch, dogmatische Lehren und ihre Wirkung betont. 3. Sombart sieht auf die seelische Seite der Wirtschaftsentwicklung, auf den neuen ,Geist‘, zeigt sich aber skeptisch gegenüber der Vorstellung, dieser sei religiös verursacht. Wollte man etwas Neues zu dieser Diskussion beitragen, so lag es nahe, Sombart zu folgen und die seelische Seite der Wirtschaftsentwicklung zu betrachten, diese aber, gegen Sombart, auf religiöse Ursachen zurückzuführen, dabei aber zunächst auf die Prägekraft religiöser Ideen, nicht auf die der Kirchenverfassungen und ihrer Sanktionsmittel zu achten. So legte Weber seine Studie denn auch an.
Wir vermuten also, daß für die Wahl von Thema und Konzeption von Webers Aufsatzfolge „Die Protestantische Ethik und der ,Geist‘ des Kapitalismus“ mehrere Motive eine Rolle spielten: logisch-methodische, lebensgeschichtliche, politische und wissenschaftlich-sachliche, daß aber den letzten der Primat gehört. Sombart hatte gefordert, „mit Hilfe eines empirischen Nachweises konkret-historischer Zusammenhänge“ die primären Ursachen für den Geist des modernen Kapitalismus aufzuspüren.
66
Weber entscheidet sich – ermutigt nicht zuletzt durch Gothein, Jellinek, Troeltsch und andere, aber auch durch eigenes Quellenstudium –, mit diesem Ziel die Reformierten zu studieren, weil man ihnen, im Vergleich zu den Lutheranern, allgemein eine größere Nähe zur modernen Welt zugesprochen hatte. Sombart, Der moderne Kapitalismus I, S. 381, dort auch die Bemerkung, es gelte z. B. dazu die asketisch-protestantischen Religionsgemeinschaften zu erforschen.
5. Max Webers religionsgeschichtlicher Ansatz
5.1. Die Problemstellung (der erste Aufsatz zur „Protestantischen Ethik“)
Wie bereits gesagt, behauptete Weber im Rückblick, er habe Gedanken, die schließlich zu seiner Aufsatzfolge über „Die protestantische Ethik und der [44],Geist‘ des Kapitalismus“ führten, zum Teil bereits vor seinem Zusammenbruch in der Lehre vorgetragen. Sombart kann also, um dessen Unterscheidung zu verwenden, nicht die primär wirkende, sondern nur eine nachfolgende Ursache für die Wahl von Thema und Konzeption der Studie gewesen sein. Auch wissen wir nicht, wann genau Weber damit begann, gezielt dafür zu lesen. Selbst Marianne Weber vermag es nicht zu sagen. Sie kann nur vermuten, er habe sich wohl schon länger, „jedenfalls seit beginnender Genesung, mit der Idee dieses Werkes getragen. Vorstudie dazu mag u. a. die intensive Versenkung in Geschichte und Verfassung der mittelalterlichen Klöster und Orden während des römischen Aufenthalts gewesen sein.“
67
Vorstudien in einem weiteren Sinne gewiß, doch kaum zu der in Rede stehenden Sache. Sie vermutet ferner, er habe in der zweiten Hälfte des Jahres 1903, nach Abschluß des Roscher-Aufsatzes, mit seiner Aufsatzfolge begonnen, läßt aber offen, ob sich dies auf das Studium der Literatur und der Quellen oder bereits auf die Niederschrift bezieht. Allerdings berichtet sie schon Ende 1901 von Webers intensivierter Lektüre: „Max liest u. liest u. liest u. wenn er nicht laufen braucht, ist er behaglich u. vergnüglich“, heißt es in einem Brief an Helene Weber vom 21. Dezember 1901. [44]Weber, Marianne, Lebensbild, S. 340.
68
Und am 1. Mai 1902 teilt sie mit, er lese regelmäßig, am 7. Juni schließlich, er habe eine Masse von Büchern aus der Bibliothek zusammengeschleppt. Brief von Marianne Weber an Helene Weber vom 21. Dezember 1901, Bestand Max Weber-Schäfer, Deponat BSB München, Ana 446.
69
Aber auch hier erfährt man nicht, um welche Bücher es sich handelt. Auch die Hollanderfahrung dürfte eine Rolle spielen. Briefe von Marianne Weber an Helene Weber vom 1. Mai und 7. Juni 1902, ebd.
70
Aber greifbar ist dies nicht. Instruktiver ist da schon ein Brief, den Weber am 10. Oktober 1903 an Brentano schreibt. Aus ihm geht hervor, daß sich beide über Literatur zur englischen Entwicklung im 17. Jahrhundert ausgetauscht hatten und auch weiter austauschen wollten. Weber schreibt im Juni 1903 an Marianne Weber aus Scheveningen: „– ich war im Haag, die Rembrandt’s in der Galerie sind z. T. wunderbar: die ,Anatomie‘, dann ,Saul u. David‘ (ganz großartig ergreifend, obwohl er zwei häßliche Juden darstellt) –“. Brief vom [7. Juni 1903], Bestand Max Weber-Schäfer, Deponat BSB München, Ana 446 (MWG II/4). Ähnlich in den Briefen vom 8. und 10. Juni 1903, ebd.
71
So empfiehlt [45]Weber Brentano den Artikel von Troeltsch über die englischen Moralisten, der allerdings, wie er betont, wenig über die ökonomische Seite der Sache enthalte, aus dem aber hervorgehe, daß Troeltsch „das Wesentliche richtig gesehen“ habe. Und weiter: „Gute Arbeiten – aber, wie Alles, nur mittelbar für das Ökonomische der Sache von Werth – sind: Das Buch von Weingarten über die englischen Revolutionskirchen und Gooch’s ,Democratic Ideas‘[,] außerdem Bernsteins Aufsatz in der Geschichte des Sozialismus.“ Dann schränkt er ein, er kenne aber „von der kolossalen Literatur über die Puritaner nur einen Theil“. Dies spricht dafür, daß Weber sich zu diesem Zeitpunkt mit Teilen der für seine Aufsatzfolge einschlägigen Literatur bereits beschäftigt hatte, und wohl noch weitere Quellen durcharbeiten wollte. Am Schluß des Briefes heißt es, er werde „im Laufe dieses Winters für meinen Louis’er Vortrag und einen Aufsatz für das Archiv die Quellen erneut durcharbeiten“. Mit dem Aufsatz im Archiv ist offensichtlich die Protestantismusstudie gemeint. Anlaß für diesen Austausch war wohl ein Gespräch auf Helgoland am 17. oder 18. September, bei dem, wie es in dem Brief vom 4. Oktober 1903 heißt, Brentano Weber „eine ganze und eine halbe Zusage gegeben“ hatte: „die erstere bezüglich einer kurzen Notiz über eine Arbeit über die franziskanischen Eigentumstheorien, die letztere bezüglich einer eventuellen Besprechung von Sombart’s Kapitalismus“. (Brief Max Webers an Lujo Brentano vom 4. Oktober 1903, BA Koblenz, Nl. Lujo Brentano, Nr. 67, Bl. 161–164; MWG II/4). Bei der kurzen Notiz handelt es sich um eine Besprechung von Glaser, Friedrich, Die franziskanische Bewegung. Ein Beitrag zur Geschichte sozialer Reformideen im Mittelalter, Stuttgart 1903, die in den von Brentano und Lotz herausgegebenen Münchener Volkswirtschaftlichen Studien erschienen war und die Brentano zum Anlaß nahm, sich allgemein über dieses Thema zu äußern. Die [45]Notiz erschien in der Rubrik „Literatur-Übersichten“: Brentano, Lujo, Zur Genealogie der Angriffe auf das Eigentum, in: AfSSp, Band 19, Heft 1, 1904, S. 251–271. Offenbar wollte sich auch Brentano mit dem Calvinismus beschäftigen.
72
Brief Max Webers an Lujo Brentano vom 10. Oktober 1903, BA Koblenz, Nl. Lujo Brentano, Nr. 67, Bl. 157–158 (MWG II/4, dort auch die Kommentierung).
Ein erster literarischer Niederschlag von Webers Beschäftigung mit dem Komplex Calvinismus/Puritanismus findet sich denn auch bereits im Roscher-Aufsatz. Es heißt dort, die ältere historische Schule der Nationalökonomie habe die Tendenz, eine Trennung zwischen der von Eigennutz regierten privatwirtschaftlichen und der von Gemeinsinn regierten öffentlichen Sphäre vorzunehmen; eine eingehende Untersuchung dieses Sachverhalts würde ergeben, „daß diese Scheidung auf ganz bestimmte puritanische Vorstellungen zurückgeht, die für die ,Genesis des kapitalistischen Geistes‘ von sehr großer Bedeutung gewesen sind.“
73
Im Objektivitätsaufsatz findet sich gleichfalls eine Passage, die auf eine Beschäftigung mit dieser Materie hindeutet. Sie steht zudem in einem für die Aufsatzfolge zentralen logisch-methodischen Zusammenhang. Weber unterscheidet zwischen der materialistischen Geschichtsauffassung und der ökonomischen Geschichtsinterpretation, wobei er jene ablehnt, diese aber befürwortet Weber, Roscher und Knies I, S. 32, Fn. 2. Vgl. auch ebd., S. 23, Fn. 1.
74
– sofern ihre Vertreter den logisch-methodischen Sinn gesichtspunktabhängiger Erkenntnis richtig verstehen. Denn es gibt nach Weber bei der kausalen Zurechnung von Kulturerscheinungen überhaupt keine letzten Instanzen, was nicht nur historische Materialisten, sondern häufig auch „rabiate wissenschaftliche Ressortpatrioten“ vergäßen. Und so richtet er gegen beide seine Kritik: „Die Reduktion auf ökonomische Ursachen allein ist auf keinem Gebiete der Kulturerscheinungen je in irgend einem Sinn erschöpfend, auch nicht auf demjenigen der ,wirt[46]schaftlichen‘ Vorgänge. Prinzipiell ist eine Bankgeschichte irgend eines Volkes, die nur die ökonomischen Motive zur Erklärung heranziehen wollte, natürlich ganz ebenso unmöglich, wie etwa eine ,Erklärung‘ der Sixtinischen Madonna aus den sozial-ökonomischen Grundlagen des Kulturlebens zur Zeit ihrer Entstehung sein würde, und sie ist in keiner Weise prinzipiell erschöpfender als es etwa die Ableitung des Kapitalismus aus gewissen Umgestaltungen religiöser Bewußtseinsinhalte, die bei der Genesis des kapitalistischen Geistes mitspielten, oder etwa irgend eines politischen Gebildes aus geographischen Bedingungen sein würden.“ Weber, Objektivität, S. 42.
75
[46]Ebd., S. 44 f.
An dieser Stelle läßt sich bereits sagen, was die Konsequenz dieser logisch-methodischen Kritik am historischen Materialismus für die Aufsatzfolge sein muß: die Überführung des Basis-Überbau-Modells in das Form-Geist-Modell und die Ersetzung der gesetzlichen Abhängigkeit zwischen den beiden Ebenen durch die Adäquanzbeziehung, durch das, was Weber, wie in der Zeitdiskussion keineswegs unüblich, auch Wahlverwandtschaft nennt.
76
Der nationalökonomische Spezialist habe selbstverständlich das Recht, die Kulturwirklichkeit einseitig unter einem ökonomischen Gesichtspunkt zu analysieren. Dafür sei er schließlich trainiert. Aber dieses Recht gelte auch für jene, die wirtschaftliche Vorgänge unter nichtökonomischen Gesichtspunkten betrachten wollen, zum Beispiel unter religiösen, je nachdem, „welcher Klasse von Ursachen diejenigen spezifischen Elemente der betreffenden Erscheinung, denen wir im einzelnen Falle Bedeutung beilegen, auf die es uns ankommt, zuzurechnen sind.“ Die Metapher findet sich zum Beispiel bei Gothein. Auch Schopenhauer verwendet sie. Man hat viel in diese Metapher hineingeheimnist, sie auf Goethes Roman zurückgeführt, der wiederum die Chemie bemühte. Methodisch ist der Sachverhalt eigentlich recht schlicht. Es handelt sich um zwei Faktoren (Entwicklungen), die verschiedene Ursachen haben und zusammenkommen. Dies ist aber keine kausale Erklärung des Einen aus dem Andern. Typisch die folgende Formulierung: „Die ,kapitalistische‘ Form einer Wirtschaft und der Geist, in dem sie geführt wird, stehen zwar generell im Verhältnis adäquater Beziehung, nicht aber in dem einer ,gesetzlichen‘ Abhängigkeit voneinander“. Weber, Protestantische Ethik I, unten, S. 164. Dies ist übrigens ein weiterer Differenzpunkt zu Sombart, der tendenziell beide Seiten fusioniert, und dies je länger, je mehr. Dazu die Einleitung von Wolfgang Schluchter in: MWG III/6, S. 24 ff.
77
Die Erscheinung, um die es in der Aufsatzfolge zur „Protestantischen Ethik“ geht, ist der von Sombart so genannte Geist des Kapitalismus. Wie das vorletzte Zitat zeigt, ist Weber der Meinung, religiöse Bewußtseinsinhalte hätten bei seiner Genese zumindest mitgewirkt. Weber, Objektivität, S. 45.
Doch wir greifen vor. Denn zunächst ist noch von einer weiteren Vorstudie zu berichten, die allerdings nicht von Max Weber selbst stammt, sondern von einem seiner Schüler. Noch vor seiner Krankheit hatte er seinen Doktoranden Martin Offenbacher an Konfessions-, Bildungs- und Berufsstatistiken gesetzt. [47]Er sollte empirisch den Zusammenhang zwischen Konfessionszugehörigkeit und wirtschaftlichem Erfolg ermitteln.
78
Und die analysierten Daten schienen zu ergeben, daß in konfessionell gemischten Gebieten Kapitalbesitz und Unternehmertum, aber auch die „oberen gelernten Schichten der Arbeiterschaft“, vorwiegend protestantisch waren. [47]Offenbacher, Konfession.
79
Weber nimmt dieses Ergebnis der Dissertation zum Ausgangspunkt, um seine Problemstellung zu formulieren. Woher, so fragt er, rührt dieser Umstand? Er scheint auf eine historische Erbschaft hinzudeuten, deren Ursprung aber weit zurückliegt. Und Weber nähert sich diesem Ursprung, näherliegende Erklärungen widerlegend, Schritt für Schritt. Weber, Protestantische Ethik I, unten, S. 124.
80
Er führt den Leser zurück in das 17. Jahrhundert. Und die Frage ist jetzt nicht mehr, weshalb Protestanten in konfessionell gemischten Gebieten wirtschaftlich erfolgreicher sind als Katholiken, sondern die gänzlich andere, auf die man durch noch so akkurate statistische Untersuchungen nicht gekommen wäre: Wie ist es zu erklären, daß damals, an der Wende vom 16. zum 17. Jahrhundert und während des 17. Jahrhunderts, die „ökonomisch entwickeltsten Länder, und, wie wir noch sehen werden, innerhalb ihrer grade die damals ökonomisch aufsteigenden ,bürgerlichen‘ Klassen jene puritanische Tyrannei nicht etwa nur über sich ergehen ließen, sondern in ihrer Verteidigung ein Heldentum entwickelten, wie gerade bürgerliche Klassen als solche es selten vorher und niemals nachher gekannt haben: ,the last of our heroisms‘, wie Carlyle nicht ohne Grund sagt?“ Man kann dieses Vorgehen geradezu als beispielhaft bezeichnen. Weber prüft mögliche Hypothesen über die Ursachen des behaupteten Zusammenhangs zwischen Konfession und wirtschaftlichem Erfolg und hält sie alle für unbefriedigend, etwa die Diaspora-Hypothese, die ja auch Gothein, allerdings eingeschränkt auf den Diaspora-Calvinismus, vertreten hatte. Mit dieser Qualifikation hält Weber sie durchaus für relevant. Vor allem aber: Er verwirft auch indirekt die Sombart-Hypothese, daß die „konfessionelle Zugehörigkeit nicht als Ursache ökonomischer Erscheinungen, sondern, bis zu einem gewissen Grade, als Folge von solchen erscheint.“ Weber, Protestantische Ethik I, unten, S. 126.
81
Ebd., unten, S. 127.
Man stritt viel über den wissenschaftlichen Wert der von Weber aus Offenbachers Dissertation übernommenen Zahlen. Sie seien unvollständig und unzuverlässig, die behaupteten Korrelationen verschwänden, sobald man Drittvariablen, etwa Bildung, kontrolliere. Auch hätte angesichts dessen, was folgt, bei den Protestanten viel schärfer zwischen Lutheranern und Reformierten unterschieden werden müssen. Tatsächlich sind die empirischen Ergebnisse von Offenbachers Dissertation aus heutiger Sicht fragwürdig, und Webers Übernahmen bessern die Sache natürlich nicht.
82
Doch es spricht vieles dafür, daß Weber das von Offenbacher präsentierte Zahlenmaterial vor [48]allem dazu benutzen wollte, beim Leser Aufmerksamkeit zu wecken. Weber übernimmt sogar eine fehlerhafte Tabelle von Offenbacher. Siehe ebd., unten, S. 128, Fn. 7, sowie der Kommentar.
83
Denn es gab ja am Ende des 19. Jahrhunderts in Deutschland, in den Nachwehen des Kulturkampfs, die Debatte um die Inferiorität des Katholizismus, und sie wurde den Katholiken nicht nur von außen, sondern auch von innen, von führenden Katholiken und katholischen Einrichtungen, aufgedrängt. [48]Weber bezeichnet später die statistisch ,untermauerten‘ Beziehungen zwischen Konfession und wirtschaftlichem Erfolg explizit als „Anknüpfungspunkt“: „Der Umstand, daß trotz alle dem selbst heute noch Unterschiede des ökonomischen Verhaltens der Konfessionen zu bemerken sind […], gab mir ausgesprochenermaßen (a. a. O. [Archiv, Bd. XX], S. 24) lediglich den Anknüpfungspunkt und den Anlaß, die Frage als berechtigt hinzustellen, wie sich wohl Konfession und wirtschaftliches Gebahren in der Frühzeit des Kapitalismus zu einander gestellt haben möchten.“ Weber, Kritische Bemerkungen, unten, S. 482.
84
Weber geht zwar von dieser aktuellen Diskussionslage aus, sucht aber, wie die folgenden Passagen zeigen, weiterzukommen, gleichsam hinter sie zu blicken. Er möchte die zeitgenössische Kulturkampfrhetorik, aber auch die „vagen Allgemeinvorstellungen“, welche selbst in der Wissenschaft über Religion und Welt bestehen, überwinden. Deshalb soll mit der Aufsatzfolge auch nicht, wie mitunter behauptet, die wirtschaftliche Überlegenheit des Protestantismus gegenüber dem Katholizismus bewiesen, sondern „in die charakteristische Eigenart und die Unterschiede jener großen religiösen Gedankenwelten einzudringen versucht werden, die in den verschiedenen Ausprägungen der christlichen Religion uns geschichtlich gegeben sind.“ Siehe die Kommentare unten, S. 124.
85
Zitate aus: Weber, Protestantische Ethik I, unten, S. 140.
Man sollte diese Formulierung, die am Ende des ersten Abschnittes der Aufsatzfolge zur „Protestantischen Ethik“ steht, auf dem Hintergrund des ersten Teils des Objektivitätsaufsatzes, der Ergänzung des „Geleitworts“, lesen. Dort hatte Weber sowohl die (zwar wertbezogene, aber) werturteilsfreie Untersuchung von Kulturerscheinungen gefordert als auch die historische Macht der Ideen (neben der der Klasseninteressen) betont. Weber will, wie er ausdrücklich sagt, mit seiner Aufsatzfolge auch empirisch zeigen, wie Ideen in der Geschichte wirken können.
86
Man kann sagen: Sie entfalten eine Eigengesetzlichkeit und in diesem Zusammenhang eine Wirkung, die sich weder auf ökonomische Klassenkonstellationen noch auf historisch-politische Lagen, noch auf institutionelle Konstellationen reduzieren läßt. Ebd., unten, S. 214. Weber fügt sogar hinzu, dies sei der Hauptgrund, weshalb die Aufsatzfolge im Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik veröffentlicht werde, das seinem Programm gemäß „an rein historischer Arbeit sich im allgemeinen nicht selbst beteiligt.“ Man sieht daran, wie Weber seine Studie verstanden wissen wollte. Denn gemäß „Geleitwort“ widersprach eine Studie über die Entstehung des Geistes des Kapitalismus dem Programm der Zeitschrift eigentlich nicht.
87
Dazu ausführlich Schluchter, Wolfgang, ,Wie Ideen in der Geschichte wirken‘: Exemplarisches in der Studie über den asketischen Protestantismus, in: Schluchter/ [49]Graf, Asketischer Protestantismus, S. 49–73, und Schluchter, Wolfgang, Religiöse Wurzeln frühkapitalistischer Berufsethik. Die Weber-These in der Kritik, in: ders., Die Entzauberung der Welt. Sechs Studien zu Max Weber. – Tübingen: Mohr Siebeck 2009, S. 40–62, bes. S. 60 f. (hinfort: Schluchter, Entzauberung).
[49]Nachdem also klar ist, daß es um die „dauernde innere Eigenart“ der Konfessionen gehen soll und um deren Folgen für das wirtschaftliche Handeln, was zugleich bedeutet, die Untersuchung auf die nachreformatorische Phase, auf das konfessionelle Zeitalter (Troeltsch), zu beschränken, müssen Gegenstand und Methode der Untersuchung genauer bestimmt werden. Es geht also um das Explanandum und um die Frage, wie sein Entstehen erklärt werden kann. Weber sagt denn auch ausdrücklich, bevor es nach der Exposition des Problems weitergehen könne, seien „noch einige Bemerkungen erforderlich, zunächst über die Eigenart des Objektes, um dessen geschichtliche Erklärung es sich handelt, dann über den Sinn, in welchem eine solche Erklärung überhaupt im Rahmen dieser Untersuchungen möglich ist.“
88
Weber, Protestantische Ethik I, unten, S. 140.
An dieser Stelle besteht nun die engste Verbindung mit dem Objektivitätsaufsatz und damit auch mit der Methodologie von Heinrich Rickert. Was in den Kulturwissenschaften Erklärung heißen kann, haben wir diskutiert. Man braucht einen Gesichtspunkt, unter dem man die Wirklichkeit betrachtet, und darin ein Objekt, dessen So-und-nicht-anders-Gewordensein man erklären will. Weber wählt einen religionsgeschichtlichen Gesichtspunkt und als das zu erklärende Objekt den „Geist des Kapitalismus“. Es geht ihm also von vornherein nicht um den modernen Kapitalismus als solchen, sondern um die Entstehung einer bestimmten Mentalität.
89
Wie Sombart beschäftigt ihn also die Genese des neuen Wirtschaftsmenschen, und zwar seine seelische Seite. Dieser neue Wirtschaftsgeist, so Weber, sei aber vom Betrachter nur als ein „,historisches Individuum‘“ konstituierbar, also als ein „Komplex von Zusammenhängen in der geschichtlichen Wirklichkeit, die wir unter dem Gesichtspunkte ihrer Kulturbedeutung begrifflich zu einem Ganzen zusammenschließen.“ Weber spricht ausdrücklich vom „Geist des (modernen) Kapitalismus“. Ebd., unten, S. 147.
90
So hatte es Rickert gelehrt. Ebd., unten, S. 141.
Weber schränkt allerdings sofort ein: Dieses ,historische Individuum‘ lasse sich nicht einfach definieren, sondern zunächst nur provisorisch veranschaulichen. Eine endgültige Definition könne nur am Ende der Untersuchung stehen. Diese Feststellung ist deshalb ungewöhnlich, weil eine Erklärung das zu Erklärende, das Explanandum, voraussetzt. Die Definition des zu Erklärenden kann also nicht erst am Ende einer Untersuchung stehen. Tatsächlich scheint sich im Verlauf der Untersuchung Webers Erklärungsobjekt leicht zu verschie[50]ben: Statt des ,Geistes des Kapitalismus‘ die ,Idee der Berufspflicht‘, statt des kapitalistischen Neuerers der moderne Berufsmensch ganz allgemein.
Weber wählt nun zu dieser provisorischen Veranschaulichung des ,Geistes des Kapitalismus‘ interessanterweise nicht, wie Sombart, den Großkaufmann Fugger. Dieser repräsentiere gerade nicht den neuen, sondern einen alten Geist des Wirtschaftens, den es historisch immer schon gegeben habe, den des ökonomischen Übermenschentums, wie es später heißt.
91
Denn Fugger handle beim Wirtschaften nach Klugheitsregeln, nicht nach moralischen Maximen. Der neue Geist des Kapitalismus, den er, Weber, im Auge habe, aber sei mit einer „ethisch gefärbten Maxime der Lebensführung“ verbunden. [50]Weber, Antikritisches zum „Geist“ des Kapitalismus, unten, S. 596, und Weber, Antikritisches Schlußwort, unten, S. 686 f. und 700. Weber verwendet den Ausdruck „Übermensch“ übrigens bereits in seiner Vorlesung „Praktische Nationalökonomie", und zwar bei der Besprechung der antiken Wirtschaft. Dabei spricht er von der Emanzipation des Individuum von der Polis: „Emporwachsen jener eigentüml[ichen] ,Übermenschen‘ des Altertums: Alkibiades, Lysandros – vaterlandslos“. Weber, Praktische Nationalökonomie, 1. Buch, § 2, GStA PK, VI. HA, Nl. Max Weber, Nr. 31, Bd. 2, Bl. 24r (MWG III/2).
92
Deshalb könnten Fugger und seine Aussagen über sein Geschäftsgebaren diesen Geist auch nicht veranschaulichen. Weber, Protestantische Ethik I, unten, S. 147.
Man sieht bereits an dieser Stelle die Differenz zu Sombart. Doch wer oder was taugt dann für diese provisorische Veranschaulichung? Weber präsentiert uns dazu Benjamin Franklin und seine Aussage über sein Geschäftsgebaren, und zwar in einer Textmontage.
93
Aus ihr gehe „der Gedanke der Verpflichtung des einzelnen gegenüber dem als Selbstzweck vorausgesetzten Interesse an der Vergrößerung seines Vermögens“ hervor. Ebd., unten, S. 142–145 und die Kommentare.
94
Verpflichtung, Selbstzweck, daran ließen sich die bei Franklin allerdings schon weitgehend abgestorbenen religiös-ethischen Wurzeln dieses Geschäftsgebarens erkennen. Es gehe um Ethik, nicht nur um Klugheit, um Lebensführung, nicht nur um Lebenstechnik, um ein Leben, in dem gelebte Tugenden auch das wirtschaftliche Handeln bestimmen. Ebd., unten, S. 146.
Weber sieht also den neuen ,Geist des Kapitalismus‘ mit einer ethischen Komponente verbunden.
95
Mehr noch: Er sieht ihn durch eine Ethik in seinem Ursprung mit bewirkt. Dies sei die „gegenüber Sombart etwas andere Problemstellung“. Lujo Brentano wird später sagen, Weber habe bereits hier eine petitio principii begangen, weil er das in die Definition aufnehme, was erst zu erklären sei. Die gesamte Argumentation sei zirkulär. Dazu Brentano, Wirtschaftender Mensch (wie oben, S. 32, Anm. 24), S. 284.
96
Dieser habe zwar die ethische Seite des kapitalistischen Unternehmers nicht völlig unterschlagen, sie aber als durch den sich entwic[51]kelnden Kapitalismus bewirkt gedeutet. Dies aber ist nach Weber falsch. Am Ursprung des neuen Geistes habe eine Ethik Pate gestanden. Diesen Zusammenhang zu erschließen, darauf komme es ihm an. Weber, Protestantische Ethik I, unten, S. 147, Fn. 22.
97
[51]Man sieht daran, daß es Weber in der Aufsatzfolge in erster Linie um den Ursprung, nicht um die Säkularisierung und die Verbreitung des neuen Geistes geht. Zur Unterscheidung zwischen Ursprungs-, Säkularisierungs- und Verbreitungsthese Schluchter, Entzauberung, S. 59.
Das bei Sombart bloß Bewirkte soll also als das Wirkende nachgewiesen werden, und zwar in einer historischen, man kann auch sagen: in einer wirklichkeitswissenschaftlichen Untersuchung. Dies ist die Aufgabe, die sich Weber explizit stellt. Es ist freilich die Frage: War Weber gut beraten, ausgerechnet Franklins Ratschläge über das Wirtschaften für die provisorische Veranschaulichung zu benutzen? Schon früh äußerte man Zweifel, und sie sind bis heute nicht verstummt.
98
Der Erste, der Zweifel an Webers Franklin-Interpretation anmeldete, war sein Neffe Eduard Baumgarten, der in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts eine zweibändige Studie über die geistigen Grundlagen des US-amerikanischen Gemeinwesens vorlegte. Siehe Baumgarten, Eduard, Benjamin Franklin: der Lehrmeister der amerikanischen Revolution. – Frankfurt a.Μ.: Klostermann 1936, und ders., Der Pragmatismus: R. W. Emerson, W. James, J. Dewey. – Frankfurt a.Μ.: Klostermann 1938. Einschlägig ist der erstgenannte Band, S. 93 ff. Baumgarten argumentiert, Weber habe Franklins Geldeifer als asketisches Arbeitsethos mißverstanden, denn in demselben Jahr, als er seine Anweisungen an den „young salesman“ formulierte, sei er aus seinem Geschäft ausgestiegen, um der Muße zu leben: „Statt eines Asketen kommt ein Epikuräer voll übermütigen Witzes zum Vorschein“, ebd., S. 95. Und zusammenfassend folgert er: „Wenn irgendeine Pathetik bei dem jüngeren Franklin zu finden ist, so ist es die Pathetik des Freiheitskampfes, einerseits als selbstsichere Verachtung gegen das feudale Europa, andererseits als unruhig leidenschaftlicher Eifer, Europas Glanz und überlegenes Ansehen durch eine eigene zugleich gediegenere und loyalere Ritterlichkeit zu überwinden. Dies ist der letzte ,Wertgesichtspunkt‘ der Franklinschen Geldpredigt.“ Ebd., S. 100. Ähnlich Heinz Steinert, der behauptet, Weber sei die Ironie völlig entgangen, mit der Franklin seine Traktate über das Geld gewürzt habe. Schließlich erteile darin ein „old salesman“ einem „young salesman“ Ratschläge, wie man im Geschäftsleben erfolgreich sei. Außerdem konstruiere er durch Zusammenlegung und Auslassungen einen korrupten Franklin-Text, der im Original gar nicht existiere, Steinert, Fehlkonstruktion (wie oben, S. 25, Anm. 93), S. 59. Freilich dringt Steinert selbst nicht allzu tief in die Konstitution dieses ,korrupten Textes‘ ein. Vgl. dazu die Kommentare zu Weber, Protestantische Ethik I, unten, S. 142–145.
Nun sagt Weber selbst, bei Franklin würden die moralischen Maximen, deren Befolgung er empfiehlt, nicht in erster Linie religiös, sondern utilitarisch begründet. Die geforderten Tugenden im Geschäftsgebaren seien nützlich, und weil sie nützlich seien, solle man sie befolgen: honesty is the best policy. Aber dies ändert natürlich nichts daran, daß es sich um Tugenden, nicht um bloße Klugheitsregeln handelt, und daß sie deshalb auch um ihrer selbst willen geübt werden sollten. Ob Tugenden von der Art, wie Franklin sie etwa mit [52]seinem Projekt der moralischen Perfektion anstrebt, oder ob Tugenden überhaupt jemals das wirtschaftliche Handeln aufsteigender bürgerlicher Mittelklassen im 17. Jahrhundert maßgeblich bestimmt haben, das ist die entscheidende Frage, nicht aber, ob Weber Franklin in jeder Hinsicht richtig interpretiert.
1
[52]Franklin entwarf dieses Projekt in seiner Autobiographie, die Weber schon früh las. Franklin nennt es „den kühnen und ernsten Vorsatz, nach sittlicher Vollkommnung zu streben“, das er mit 13 Tugenden unterfüttert: Mäßigkeit, Schweigen, Ordnung, Entschlossenheit, Genügsamkeit, Fleiß, Aufrichtigkeit, Gerechtigkeit, Mäßigung, Reinlichkeit, Gemütsruhe, Keuschheit, Demut. Vorbilder sind Sokrates und Jesus. Siehe Benjamin Franklin. Sein Leben, von ihm selbst beschrieben. Mit einem Vorwort von Berthold Auerbach und einer historisch-politischen Einleitung von Friedrich Kapp. – Stuttgart: Aug. Berth. Auerbach 1876, S. 284 ff. (hinfort: Franklin, Sein Leben).
Es ist natürlich auch Weber nicht entgangen, daß Franklin ein, wie er selbst notiert, „konfessionell farbloser Deist“ war,
2
also gerade kein Vertreter jenes asketischen Protestantismus, der im zweiten Aufsatz der Aufsatzfolge ins Zentrum der Betrachtung gestellt wird. Dennoch läßt sich mit Weber vermuten, Franklins Denken und Handeln sei von der religiösen Atmosphäre seiner Herkunftsfamilie und seines Herkunftslandes mit geprägt. Hätte ein reiner Utilitarist seinen Eltern einen Grabstein mit der folgenden Inschrift gewidmet? „Hier ruhen Josias Franklin und Abiah seine Gattin. Sie lebten innig und einträglich zusammen neunundfünfzig Jahre und ernährten ohne Vermögen, ohne gewinnbringendes Gewerbe anständig eine zahlreiche Familie und erzogen mit gesegnetem Erfolge dreizehn Kinder und sieben Enkel. Laß’, Leser, dieses Beispiel dich ermuthigen, den Pflichten deines Berufes fleißig nachzukommen und der Vorsehung zu vertrauen. Er war ein frommer und weiser Mann, Sie ein kluges und tugendsames Weib. Im Gefühle kindlicher Pflichtschuldigkeit Weiht diesen Stein ihrem Gedächtnisse. Ihr jüngster Sohn.“ Weber, Protestantische Ethik I, unten, S. 149.
3
Franklin, Sein Leben, S. 121.
Weber ist deshalb zu Recht der Meinung, bei allen Wandlungen in Franklins Leben seien seine Aussagen über tugendhaftes Handeln in der Wirtschaft mehr als „eine Verbrämung rein egozentrischer Maximen“.
4
Letztlich sei es die Tüchtigkeit im Beruf, die er mit seinen Handlungsanweisungen stützt. Der Kern seiner moralisch imprägnierten Predigt kreise letztlich um den Gedanken der Berufspflicht und lasse sich nicht auf das wirtschaftliche Handeln im engeren Sinn einschränken. Dieser Gedanke von der Berufspflicht aber sei dem sich entwickelnden Kapitalismus kongenial. Weber, Protestantische Ethik I, unten, S. 149.
5
Weber stützt sich bei seinen Ausführungen hauptsächlich auf Franklins Autobiographie.
Weber stellt, wie schon Sombart, dem Geist des Kapitalismus den des Traditionalismus gegenüber. Er erläutert diesen am Beispiel von Arbeitern und [53]Unternehmern und geht dabei auch auf die ökonomische Theorie der Anreize ein. Er antizipiert hier bereits Studien, die er erst später ausführen sollte, etwa über die Psychophysik der industriellen Arbeit.
6
Aber wichtiger ist die These, daß für die Erklärung einer Revolution der Gesinnung, der Mentalität, des Habitus, die Theorie der ökonomischen Anreize für sich allein nicht genügt. Wolle man eine so fundamentale Veränderung erklären, wie sie der Geist des Kapitalismus gegenüber dem des Traditionalismus darstelle, so müsse man auf stärkere psychische Hebel setzen, als es materielle Anreize sein könnten. Dazu würden ideelle Anreize verlangt. Diese aber entstünden durch Erziehung. Die Vorstellung etwa, der Beruf sei Selbstzweck, sei eben nichts „Naturgegebenes“. Eine solche Gesinnung könne „weder durch hohe noch durch niedere Löhne unmittelbar hervorgebracht werden, sondern nur das Produkt eines lang andauernden ,Erziehungsprozesses‘ sein.“ [53]Dazu Schluchter, Einleitung, in: MWG I/11.
7
Weber, Protestantische Ethik I, unten, S. 159.
Wenn aus dem Beruf als Mittel zum Zweck des standesgemäßen Lebens ein Selbstzweck wird, dann ändert sich der Sinn der Berufsarbeit selber: Sie wird für die Sinnstiftung des Lebens zentral. Sie wird es zunächst einmal unabhängig davon, ob auch schon die Form existiert, die ihr kongenial ist. Und hier sehen wir noch einmal die beiden Punkte, an denen sich Weber von Sombart distanziert. Die Revolution der Wirtschaftsgesinnung läßt sich weder auf technische Erfindungen wie die doppelte Buchführung noch auf einen wie immer gearteten Erwerbstrieb zurückführen, sondern nur auf innere Antriebe, die in einer entsprechenden Kultur verankert sein müssen. Und eine solche Revolution der Wirtschaftsgesinnung ist unabhängig von der gerade herrschenden Wirtschaftsform.
8
Weber sagt denn auch, wie man historisch erklären könne, „daß im Zentrum der ,kapitalistischen‘ Entwicklung der damaligen Welt, in Florenz im 14. und 15. Jahrhundert, dem Geld- und Kapitalmarkt aller politischen Großmächte, als sittlich bedenklich galt, was in den hinterwäldlerisch-kleinbürgerlichen Verhältnissen von Pennsylvanien im 18. Jahrhundert, wo die Wirtschaft aus purem Geldmangel stets in Naturaltausch zu kollabieren drohte, von größeren gewerblichen Unternehmungen kaum eine Spur, von Banken nur die vorsintflutlichen Anfänge zu bemerken waren, als Inhalt einer sittlich löblichen, ja gebotenen Lebensführung gelten konnte?“ Weber, Protestantische Ethik I, unten, S. 174.
Weber spricht ausdrücklich von einem Rationalisierungs-, gar von einem Revolutionierungsprozeß, den der „neue Geist“ ausgelöst habe.
9
Er sei Ausdruck einer kühnen Neuerung, die das Wirtschaftsleben ergreift. Der Unternehmer ,alten Stils‘ habe selbst bei Existenz einer kapitalistischen Organisationsform von dem traditionalistischen Geist, der sein Wirtschaften beseelte, nicht lassen können und wollen: „die traditionelle Lebenshaltung, die traditionelle Höhe des Profits, das traditionelle Maß von Arbeit, die traditionelle Art der [54]Geschäftsführung und der Beziehungen zu den Arbeitern und dem wesentlich traditionellen Kundenkreise, die traditionelle Art der Kundengewinnung und des Absatzes beherrschten den Geschäftsbetrieb“. Ebd., unten, S. 168.
10
Dieser traditionellen Wirtschaftsethik sei der Unternehmer ,neuen Stils‘ mit einer neuen Ethik, mit einem neuen ,Geist‘, entgegengetreten. Und der Kampf der neuen mit der alten Ethik sei keineswegs nur friedlich erfolgt. Er habe auf der Seite der Neuerer Persönlichkeiten von „ungewöhnlich feste[m] Charakter“ verlangt, mit „Klarheit des Blickes und Tatkraft“, mit „nüchterne[r] Selbstbeherrschung“, mit „sehr ausgeprägte[n] ,ethische[n]‘ Qualitäten“, die aber andere gewesen seien als diejenigen, die den im Traditionalismus befangenen Unternehmer auszeichneten. [54]Ebd., unten, S. 167. Weber nimmt dabei auch indirekt zum Problem der ursprünglichen Akkumulation Stellung. Vermutlich im Gegenzug zu Marx (Raub) und Sombart (Grundrente) heißt es: „Die Frage nach den Triebkräften der Entwicklung des Kapitalismus ist nicht in erster Linie eine Frage nach der Herkunft der kapitalistisch verwertbaren Geldvorräte, sondern nach der Entwicklung des kapitalistischen Geistes. Wo er auflebt und sich auszuwirken vermag, da schaffte er sich die Geldvorräte als Mittel seines Wirkens, nicht aber umgekehrt.“ Ebd., unten, S. 168.
11
Die Ausbildung dieser anderen Qualitäten aber konnten nach Weber nicht mit der Anpassung an äußere wirtschaftliche Verhältnisse erklärt werden. So sehr solche Anpassung, zudem gesteuert über materielle Anreize, heute im Wirtschaftsleben vorherrschend sein mag, so wenig gelte dies für das 17. Jahrhundert und für das „aufsteigende Kleinbürgertum“, das Träger dieser neuen Berufsauffassung und der damit verbundenen „kapitalistische[n] Ethik“ gewesen sei. Ebd., unten, S. 168 f.
12
Dies führt Weber zu der alles entscheidenden Frage: „Welchem Gedankenkreise entstammt also die Einordnung einer äußerlich rein auf Gewinn gerichteten Tätigkeit unter die Kategorie des ,Berufs‘, dem gegenüber sich der einzelne verpflichtet fühlt?“ Ebd., unten, S. 165, Fn. 33.
13
Ebd., unten, S. 174 f.
Weber stellt also von Beginn an im Zusammenhang mit Sombarts Frage nach dem Geist des Kapitalismus den Berufsbegriff und die Berufsauffassung in den Mittelpunkt der Betrachtung: Berufsarbeit als Berufung, Berufsarbeit als Pflicht. Daß hier religiöse Faktoren mit hineingespielt haben dürften, vermutlich calvinistisch-puritanische, das hatten, wie wir sahen, viele Zeitgenossen Webers in einer allgemeinen Form behauptet, wenngleich bei ihnen oft ein historisch befriedigender Nachweis fehlte. Diesen will Weber leisten. Ihm geht es in der Folge hauptsächlich um Herkunft der modernen Berufsidee und des mit ihr verbundenen Berufsmenschentums.
Weber bereitet diesen Nachweis vor, indem er eine semantische Untersuchung des Berufsbegriffs in den Bibeln verschiedener europäischer Länder durchführt. Er behauptet, die besondere Konnotation, die ihn interessiere, sei ein Produkt der Reformation und der Nachreformationszeit und weder im [55]„klassische[n] Altertum“ noch bei den „lateinisch-katholische[n] Völkern“ nachweisbar.
14
Sie entstamme dem Geist der Bibelübersetzer, die den Geist des Originals dem Empfinden der Zeit anverwandelt hätten. In einem Text, in dem die Fußnoten überhand nehmen und nahezu unüberschaubar werden, will er zeigen, daß Luther für diese Entwicklung den Anstoß gab. [55]Ebd., unten, S. 178.
15
Ihm seien andere gefolgt, ohne in seinen Grenzen zu bleiben. Denn sein Berufsverständnis bleibe letztlich traditionalistisch, also von „nur problematischer Tragweite“ für Webers Projekt. Weber hält sich dabei in erster Linie an die Untersuchung von Eger, Karl, Die Anschauungen Luthers vom Beruf. Ein Beitrag zur Ethik Luthers. – Gießen: J. Ricker (Alfred Töpelmann) 1900 (hinfort: Eger, Anschauungen Luthers vom Beruf), geht aber immer auch auf die Originalquellen zurück. Siehe Weber, Protestantische Ethik I, unten, S. 190 mit Fn. 41, und die entsprechenden Kommentare.
16
Überhaupt stünden sich hier Katholizismus und Luthertum näher als Luthertum und Calvinismus. Weber greift dabei auf die bei Kirchenhistorikern verbreitete Unterscheidung zwischen einer religiösen Kultur der Schickung (Luthertum) und einer der Bewährung im Handeln (Calvinismus) zurück. So findet er an dieser Stelle Anschluß an die allgemeine Diskussion über Calvinismus und Kapitalismus, über die wir berichtet haben. Und er findet zugleich Anschluß an seinen eigenen Ausgangspunkt. Denn es gehe darum, die inneren Ursachen der Unterschiede festzustellen, welche die religiösen Bewegungen der vorreformatorischen von denen der nachreformatorischen Zeit trennten, und in der nachreformatorischen Zeit den Calvinismus und andere „puritanische Sekten“ vom Luthertum. Katholizismus, Luthertum, Calvinismus und puritanische Sekten, aber auch der Anglikanismus, repräsentierten unterschiedliche ,Programme‘ religiöser Erziehung mit charakterologischen Folgen: „Erst die Macht religiöser Bewegungen – nicht sie allein, aber sie zuerst – hat hier jene Unterschiede geschaffen, die wir heute empfinden.“ Ebd., unten, S. 209.
17
Ebd., unten, S. 213.
Diesen ersten Aufsatz „Die Protestantische Ethik und der ,Geist‘ des Kapitalismus“, überschrieben „I. Das Problem“, gab Weber in Druck und las Korrektur, bevor er Mitte August 1904 gemeinsam mit seiner Frau und Ernst Troeltsch in die USA aufbrach. Wie wir aus der Korrespondenz mit dem Verlag wissen, war der Druckvorgang für ihn eine Qual. Weber hatte das Manuskript auf Wunsch der Druckerei nicht gänzlich druckfertig abgeliefert, um Zeit zu gewinnen.
18
Der Setzer, der seine handschriftlichen Korrekturen und Zusätze [56]kaum entziffern konnte, machte ständig Fehler. Weber beschwerte sich darüber bei Siebeck. Möglicherweise hatte Weber den Artikel Mitte April 1904 so weit gefördert, daß er an den Druck denken konnte. Am 15. April 1904 schreibt er an Paul Siebeck von einer Arbeit, die er fertig gemacht habe, und zwar neben dem Fideikommiß. Es heißt dort: „Mir geht es ganz erträglich, ich habe eine umfangreiche recht schwierige Arbeit fertig machen können.“ Brief Max Webers an Paul Siebeck vom 15. April 1904, VA Mohr/ Siebeck, Deponat BSB München, Ana 446 (MWG II/4).
19
Viele Fehler in der Druckfassung erklären sich so. [56]Brief Max Webers an Paul Siebeck vom 17. August 1904 (ebd.; MWG II/4): „Die Correkturen sind Gott sei Dank erledigt[.] Die Druckerei hat dabei constant neue Fehler gemacht, z. B. wenn ein Wort in der Correktur eingeschoben war, ein andres stattdessen weggelassen, beim Neu-Umbrechen von Zeilen diese durcheinandergebracht etc., so daß ich finde, es war wirklich etwas arg. Richtig ist ja, daß die Sache, da ich das Mscr. auf Wunsch nicht ganz druckfertig einlieferte, diesmal recht schwierig war.“ Dazu auch den Editorischen Bericht zu Weber, Protestantische Ethik I, unten, S. 100 f.
20
Es ist aus späteren Drucklegungen bekannt, daß Weber noch während der Fahnenkorrektur mitunter große Erweiterungen in den gesetzten Text handschriftlich einfügte. Dies dürfte hier, wo es sich um ein nicht ganz druckfertiges Manuskript handelte, ähnlich gewesen sein. Bereits am 20. Juli 1904, als er mit den Korrekturen des Fideikommiß-Aufsatzes beschäftigt war, hatte er an Siebeck geschrieben: „ich soll noch den Aufsatz über ,Protestantische Ethik und Geist des Kapitalismus‘ vor meiner Abreise (15. August) in mindestens zwei Correkturen lesen, muß das auch – da ich bis Ende November fortbleibe – wenn er in Band XX Heft 1 soll und habe daran sehr viel zu bessern u. zu corrigieren, da ich ihn auf Wunsch der Druckerei vorzeitig einschickte.“ Brief Max Webers an Paul Siebeck vom 20. Juli 1904, VA Mohr/Siebeck, Deponat BSB München, Ana 446 (MWG II/4).
5.2. Die Problemlösung (der zweite Aufsatz zur „Protestantischen Ethik“)
Wir wissen nicht, ob ein Entwurf oder gar Teile eines ausgearbeiteten Textes für den zweiten Aufsatz, überschrieben „Die protestantische Ethik und der ,Geist‘ des Kapitalismus. II. Die Berufsethik des asketischen Protestantismus“, vorlag, als Weber in die USA reiste. Interessant ist, daß er noch vor seinem Aufbruch eine Ergänzung von Georg Jellineks Studie über die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte erwog. Am 19. Juli 1904, also wohl mitten in den Korrekturen des Aufsatzes über die Fideikommißgesetzgebung und des ersten Aufsatzes der Aufsatzfolge, schreibt er an Georg von Below: „Ich möchte Jellineks ,Erklärung der Menschenrechte‘ gern in einer kurzen Besprechung – nicht: Kritik, das würde kaum passen – ergänzen, in Bezug auf die für den Inhalt der im Cromwellschen Zeitalter geforderten Individualrechte maßgebende geschichtliche Situation.“ Es gehe ihm dabei um die „Staatsdoktrin des Anabaptismus“ und ähnlicher Bewegungen.
21
Die Ergänzung blieb ungeschrieben, warum, sagt er im Rückblick in einem Brief an von Below: Er hoffte auf Troeltsch. Brief Max Webers an Georg von Below vom 19. Juli 1904, GStA PK, VI. HA, Nl. Max Weber, Nr. 30, Bd. 4, Bl. 96–97 (MWG II/4). Below gab die Vierteljahresschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte heraus.
22
Brief Max Webers an Georg von Below vom 23. Aug. 1905, GStA PK, VI. HA, Nl. Max Weber, Nr. 30, Bd. 4, Bl. 130 (MWG II/4): „Ich habe s. Zt. meinen Artikel über Jellinek nicht geliefert, da ich annahm, daß Trö[ltsch] die Sache ganz so wie ich behandeln würde.“
[57]Dieser Plan zeigt aber ohne Zweifel: Weber hatte sich bereits vor der Reise in die USA mit der Literatur und den Themen des zweiten Aufsatzes beschäftigt. Dennoch dürfte dieser erst nach seiner Rückkehr aus den USA niedergeschrieben sein.
23
Während der USA-Reise wird er zwar für den zweiten Aufsatz recherchiert, nicht aber an ihm geschrieben haben. Dazu war wohl das selbstauferlegte Programm zu dicht. [57]Dazu der Editorische Bericht zu Weber, Protestantische Ethik II, unten, S. 222 und 224.
24
Im Text schlägt sich jedenfalls die USA-Erfahrung an mehreren Stellen nieder. Allerdings könnten diese Passagen auch in einen bereits vorhandenen Text später eingefügt worden sein. Dennoch deutet alles darauf hin, daß Weber den zweiten Aufsatz nach der USA-Reise verfaßte. Dies bestätigt auch Marianne Weber in ihrer Biographie. Sie schreibt: „Die Abhandlung über den ,Geist‘ des Kapitalismus reift nun schnell zur Vollendung. Ende März, nach kaum dreimonatlicher Arbeit, ist der zweite Teil fertig“. Zur USA-Reise allgemein Scaff, Lawrence A., Max Weber in America. – Princeton: Princeton University Press 2011 (hinfort: Scaff, Max Weber in America).
25
Im April 1905 las Weber Korrektur, übrigens mit noch größerem Ärger über den Setzer als beim ersten Aufsatz. Weber, Marianne, Lebensbild, S. 359. Dazu auch der Brief Max Webers an Alfred Weber vom 8. März 1905, GStA PK, VI. HA, Nl. Max Weber, Nr. 30, Bd. 4, Bl. 59–60 (MWG II/4): „Mir geht es mir verschieden. Ich habe unter ziemlichen Qualen immerhin wenigstens meinen dicken Artikel (Prot[estantische] Ethik u. Capitalismus) für das Juniheft fertig gemacht, das Diktieren in die Schreibmaschine jetzt ist eine rechte Strapaze.“ Am 30. März heißt es in einem Brief an Paul Siebeck: „Zugleich hiermit sende ich Ihnen das Mscr. für den 1ten Artikel von Band XXI Heft I des Archivs.“ Die Fußnoten lieferte er im separaten Umschlag. Brief Max Webers an Paul Siebeck vom 30. März 1905, VA Mohr/Siebeck, Deponat BSB München, Ana 446 (MWG II/4).
26
Für diese zeitliche Abfolge spricht auch ein interessantes begriffliches Detail. Offensichtlich kam der Setzer mit den vielen Fremdwörtern und englischen Zitaten überhaupt nicht zurecht. Dazu das Faksimile der Fahnenkorrektur unten, S. 230 f.
Weber wählt nämlich für die Überschrift des zweiten Aufsatzes den Begriff „asketischer Protestantismus“,
27
um eine Vielzahl religiöser Strömungen zusammenzufassen, die für die Idee der Berufspflicht aus seiner Sicht wichtig wurden. Der Begriff „asketischer Protestantismus“ kommt im ersten Aufsatz aber noch nicht vor. Man könnte ihn geradezu als einen Idealtypus bezeichnen, der in begrifflicher Reinheit das formuliert, was in den untersuchten religiösen Bewegungen immer nur in Annäherungen realisiert ist. Was diese Bewegungen bei allen Unterschieden im Einzelnen verbindet und sie sowohl von Katholizismus als auch von Luthertum, aber auch dem Anglikanismus markant unterscheidet, ist die ,innerweltliche Askese‘, die praktizierte Askese im weltlichen Beruf. Weber, Protestantische Ethik II, unten, S. 242.
Weber sagt am Ende des zweiten Aufsatzes, die moderne Berufsidee und die damit verbundene Lebensführung seien aus dem Geist der christlichen [58]Askese geboren.
28
Diese habe ihren Ursprung zwar nicht in der Reformation, sondern im mittelalterlichen Mönchtum, wo sie bereits Arbeitsaskese war. Doch erst mit der Reformation sei sie aus den Klostermauern heraus in die Welt, in den Alltag, getreten, am konsequentesten bei den Reformierten, weil sie hier, vermittelt über den Bewährungsgedanken, zur Ausbildung einer aktiven Handlungskultur beitragen konnte. Darin sieht Weber das Gemeinsame dieser religiösen Strömungen, jenseits der dogmatischen und organisatorischen Unterschiede, die zwischen ihnen bestehen. Es geht also letztlich gar nicht mehr nur um den ,Geist des Kapitalismus‘, sondern, viel allgemeiner, um das Entstehen der modernen Berufskultur, in der man den Beruf als Berufung auffassen sollte. Erst sie habe ein Berufsmenschentum ermöglicht, das Sinnerfüllung in Tätigkeit und Selbstbeschränkung findet. Tat und Entsagung, dies sei das „asketische Grundmotiv des bürgerlichen Lebensstils“. [58]Ebd., unten, S. 420.
29
Ebd., unten, S. 421. Weber zitiert Goethe, und zwar sowohl Wilhelm Meister als auch Faust II, weil hier dieses Motiv, seiner religiösen Fundierung entkleidet, im Mittelpunkt steht.
Weber versammelt unter dem Begriff des asketischen Protestantismus Calvinismus, Pietismus, Methodismus und die aus der täuferischen Bewegung hervorgegangenen Sekten.
30
Er spannt den Bogen weit und dehnt die Untersuchung von den primären auch auf die sekundären, späteren Bewegungen aus. Ebd., unten, S. 242–244.
31
Den Begriff Puritanismus verwendet er in ähnlicher Breite, wie wir dies bei Bernstein kennengelernt haben. Auf ihn hätte Weber freilich verzichten können, denn der Begriff asketischer Protestantismus erfüllt bereits den Zweck. Dieser ist zudem ein wissenschaftlicher Begriff, nicht mit falschen historischen Assoziationen verbunden. Dazu die Übersicht in Schluchter, Entzauberung, S. 48.
32
Überhaupt muß man fragen, ob Weber bei der Wahl des Gesamttitels der Aufsatzfolge „Die protestantische Ethik und der ,Geist‘ des Kapitalismus“ gut beraten war. Weder der erste noch der zweite Teil des Titels treffen exakt die gemeinte Sache. Es geht ja nicht um die „Protestantische Ethik“, sondern, viel eingeschränkter, um die sittliche Lebensführung der Reformierten, und es geht letztlich nicht allein um den Geist der modernen Kapitalisten, sondern, viel allgemeiner, um den Geist des modernen, auf Facharbeit gegründeten Berufmenschen. Weber sagt ausdrücklich, er verwende den Begriff „Puritanismus“ in dem Sinn, „den er in der populären Sprache des 17. Jahrhunderts angenommen hatte.“ Diese Verwendung schließe „,Independenten“, Kongregationalisten, Baptisten, Mennoniten und Quäker“, also holländische und englische Strömungen, ein. Siehe Weber, Protestantische Ethik II, unten, S. 244, Fn. 2 mit der Kommentierung.
33
Hier gibt es einen Zusammenhang zwischen dieser frühen Analyse des Berufsbegriffs und Max Webers späteren Reden über „Wissenschaft als Beruf“ und „Politik als Beruf“. Auch in diesen beiden Reden geht es um den Beruf als Berufung sowie um die Moral des Wissenschaftlers bzw. des Politikers. Dazu inbes. die Einleitung [59]in MWG I/17. Anders sieht dies Jack Barbalet, der einen Unterschied zwischen den Protestantismusstudien und den beiden Reden erkennt. Er findet ihn hauptsächlich in der unterschiedlichen Rolle, welche die Leidenschaft in den beiden Textgruppen spielt. Dazu Barbalet, Jack Μ., Weber, passion and profit: ,the Protestant ethic and the spirit of capitalism‘ in context. – Cambridge: Cambridge University Press 2008.
[59]Wir sehen das Explanandum damit klarer. Weber möchte letztlich einen konstitutiven Bestandteil der modernen Kultur erklären. Wir erkennen auch die Umrisse der Theorie, mit der er diese Erklärung leisten möchte. Es ist eine Motivationstheorie. Es geht Weber um die Prägung des Menschen durch religiöse Glaubensvorstellungen und religiöse Praktiken, um die Entwicklung einer durch Heilsprämien gestützten Gesinnung, um eine Formung innerer Antriebe, man kann auch sagen: um den Aufbau einer Persönlichkeit mit intrinsischer Motivation. Heute würde man von einer Theorie der Verinnerlichung institutionalisierter kultureller Muster durch die Gläubigen sprechen. Weber geht dabei davon aus, daß im 17. Jahrhundert, sieht man von einzelnen ,Übermenschen‘ ab, eine Gesinnungsrevolution oder auch nur eine sittliche Erneuerung ganzer Bevölkerungsgruppen nicht außerhalb religiöser Lebensordnungen zustande kommen konnte.
34
Zu sehr habe auch den Alltagsmenschen die Frage nach dem eigenen Seelenheil, nach dem eigenen Erlösungsschicksal, umgetrieben. Wie diese Frage von den einzelnen Religionsgemeinschaften beantwortet wurde, dies habe die Lebensführung der Menschen mit bestimmt. Dies kann man auch als eine Kritik an Brentanos These von der heidnischen Emanzipation lesen.
Eine historisch und vergleichend angelegte Untersuchung dieser Zusammenhänge müsse die dogmatischen Grundlagen der verschiedenen Strömungen des asketischen Protestantismus prüfen und nachzeichnen, wie sie von den Gläubigen rezipiert wurden. Wir erinnern uns der Aussage in der Vorlesung von 1898, die Gedanken- und Empfindungswelt der Menschen folge ihren eigenen Gesetzen. In welchem Sinn dies gilt, darum geht es auch hier. Weber verzichtet deshalb ausdrücklich darauf, die Wirkung der ,Kirchenverfassungen‘ mit ihren Sanktionsmechanismen oder die Wirkung der sozialen Schicht mit ihren materiellen Interessen auf die Lebensführung zu erörtern. Beides behält er sich ausdrücklich für eine nachfolgende Betrachtung vor.
35
Er wählt also einen einseitigen innerreligiösen Gesichtspunkt, entlang dessen er seine Untersuchung anordnet, und er begibt sich damit auf ein für ihn bisher fremdes Arbeitsgebiet. Dazu etwa die Bemerkungen bei Weber, Protestantische Ethik II, unten, S. 374, Fn. 14, S. 382, Fn. 27, S. 405, Fn. 59, S. 411, Fn. 69, S. 413, Fn. 71, und S. 415, sowie die Zusammenstellung im Anhang zur Einleitung, unten, S. 90–96.
Weber ist denn auch mit dem Anspruch, den er mit seiner religionsgeschichtlichen Betrachtung erhebt, sehr bescheiden. Gerade auf dogma[60]tischem Gebiet habe er sich „an die Formulierungen der kirchen- und dogmengeschichtlichen Literatur, also an die ,zweite Hand‘ angelehnt“. Darüber hinaus habe er versucht, so weit als möglich in die reformationsgeschichtlichen Quellen einzudringen.
36
Diese Selbstbeschreibung konnte die Kommentierung des Textes in vollem Umfang bestätigen. Weber orientierte sich an wenigen Werken der Sekundärliteratur, denen er weitgehend folgt, wobei er immer wieder auf die meist dort schon benutzten Quellen zurückgeht, um sie am Original zu überprüfen und unter Umständen anders zu akzentuieren oder auch zu ergänzen. Deshalb entsteht nicht zufällig mitunter der Eindruck, er habe passagenweise Ausführungen anderer nur paraphrasiert. [60]Ebd., unten, S. 245, Fn. 3. Zu Webers theologischen Quellen und zu der Art ihrer Verwendung informieren die Editorischen Berichte, unten, S. 109 ff. bzw. S. 233 ff. Diese Berichte zeigen, wie tief sich Weber in die für sein Thema relevante theologische Literatur eingearbeitet hat.
37
Daneben steht freilich das eigenständige Erschließen von Quellen. Dies gilt etwa für Calvin, Baxter, Spener und Barclay, wie die Kommentierung zeigt, in der auch die von Weber in der Heidelberger Universitätsbibliothek benutzten Bücher mit seinen Randbemerkungen und Unterstreichungen berücksichtigt sind. Die für ihn wichtigsten Autoren sind Max Scheibe, Matthias Schneckenburger, Gustav Hoennicke und Albrecht Ritschl (dazu auch die Einträge im Verzeichnis der von Max Weber zitierten Literatur, unten, S. 852 und 860 f.), wobei er zwar nicht die historischen Ausführungen, wohl aber die eingestreuten Werturteile des Letzteren perhorresziert. Charakteristisch ist dieses Urteil über Ritschl: Er vertrete einen „theologischen ,Bourgeoisstandpunkt‘“ (Weber, Protestantische Ethik II, unten, S. 347, Fn. 123). Er verachte die kleinen radikalen Sektenbewegungen und sehe überall nur den Kollaps in den Katholizismus, wobei er auch die Katholiken falsch zeichne. Weber nennt dies eine „positivistische (um nicht zu sagen: philiströse) Kritik“. Ebd., unten, S. 318 f., Fn. 83.
38
Daß die Calvin-Kenntnisse eher peripherer Natur sind, beklagen Calvin-Experten. Dazu etwa Lienemann, Wolfgang, Calvin, Calvinismus, Puritanismus – und Max Weber, in: Hofheinz, Marco et al. (Hg.), Calvins Erbe. Beiträge zur Wirkungsgeschichte Johannes Calvins. – Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2011, S. 308 ff. Weber betont allerdings selbst, er behandle nicht Calvin, sondern den Calvinismus. Zu der Entwicklung von Calvins Lehre in die verschiedenen Varianten des Calvinismus Benedict, Philip, „Von Calvin zu den Calvinismen“, in: Campi, Emidio, Opitz, Peter, Schmid, Konrad (Hg.), Johannes Calvin und die kulturelle Prägekraft des Protestantismus. – Zürich: vdf Hochschulverlag 2012, S. 27 ff. Benedict bestätigt die von Weber behauptete wachsende Bedeutung der Prädestinationslehre im Calvinismus, relativiert aber die Folgerungen, die Weber aus dieser historisch richtigen Einsicht zieht. Dazu insbes. S. 33 ff. Ferner der Hinweis auf die Bedeutung der populären Autoren Lewis Bayly, Richard Baxter und John Bunyan für die englischen Entwicklung, auf die sich ja auch Weber bezieht, ebd. S. 35.
Weber entscheidet sich, übrigens mit weitreichenden Folgen für die Rezeption seiner Studie, den dogmatischen Kern der von ihm als asketischem Protestantismus zusammengefaßten Strömungen zunächst an der radikalen Prädestinationslehre im Calvinismus zu erläutern. Dies ist deshalb überraschend, [61]weil, wie der Fortgang die Untersuchung zeigt, Weber in einem Gutteil der von ihm behandelten Strömungen diese radikale Lehre nicht findet. Der asketische Protestantismus spaltet sich auch in seiner Darstellung in eine prädestinatorische und eine nichtprädestinatorische Richtung.
39
Trotz dieser dogmatischen Unterschiede seien aber, so seine Einlassung bereits in der Eröffnungspassage seines zweiten Aufsatzes, die ethischen Maximen, denen die Gläubigen folgen sollten, bei all diesen Strömungen ähnlich. [61]Weber sagt ausdrücklich: „die Prädestinationslehre des Calvinismus ist nur eine von verschiedenen Möglichkeiten.“ Weber, Protestantische Ethik II, unten, S. 307. Es sei jene Möglichkeit, bei der nicht die „Gefühlsseite der Religion“ und der Genuß der Seligkeit bereits im Dieseits, sondern der rational-asketische Kampf um die Seligkeit „für die jenseitige Zukunft“ im Mittelpunkt stehe. Ebd., unten, S. 316. Bei vielen der nichtprädestinatorischen Richtungen falle die Gefühlsseite der Religion schon deshalb stärker ins Gewicht, weil sie meist mit einem Erweckungs- oder Bekehrungserlebnis oder gar mit einem „bis zu den fürchterlichsten Ekstasen gesteigerte[n] Bußkampf“ des Gläubigen, also mit seiner emotional geprägten Wiedergeburt, einsetzten. Ebd., unten, S. 340. Hier sei denn auch die Gefahr, nach dem Höhepunkt des spirituellen Erlebnisses in den status naturalis abzugleiten, besonders groß. Diese Gefahr teilten diese Strömungen mit dem Luthertum, doch entwickelten sie zugleich im Unterschied zu diesem eine religiös motivierte methodische Lebensführung: „Ganz offenbar enthielt also die Ausrichtung des religiösen Bedürfnisses auf eine gegenwärtige innerliche Gefühlsaffektion ein minus an Antrieb zur Rationalisierung des innerweltlichen Handelns gegenüber dem nur auf das Jenseits ausgerichteten Bewährungsbedürfnis der reformierten ,Heiligen‘, während sie freilich gegenüber der traditionalistisch an Wort und Sakrament haftenden Gläubigkeit des orthodoxen Lutheraners immerhin ein plus an methodischer religiöser Durchdringung der Lebensführung zu entwickeln geeignet war.“ Ebd., unten, S. 336. Weber illustriert diese Spannung zwischen der emotionalen und der asketisch-rationalen Seite bei nichtprädestinarorischen Strömungen hauptsächlich am Beispiel des deutschen Pietismus und des Methodismus. Zusammenfassend heißt es: „Der Methodismus erscheint danach für unsere Betrachtung als ein in seiner Ethik ähnlich schwankend fundamentiertes Gebilde wie der Pietismus.“ Ebd., unten, S. 343 f.
40
Dies ändert aber nichts daran, daß er das Täufertum neben dem Calvinismus als einen „selbständige[n] Träger protestantischer Askese“ bezeichnet und dabei unterstreicht, daß die aus dieser Bewegung hervorgegangenen Sekten gegenüber der reformierten Lehre auf „heterogenen Grundlagen“ ruhen. Ebd., unten, S. 244 f.
41
Ebd., unten, S. 346 f. Weber formuliert diesen Sachverhalt später in seiner Konfuzianismusstudie wie folgt: „Die Menschen waren von Natur alle gleich sündhaft, aber ihre religiösen Chancen waren dennoch nicht gleich, sondern höchst ungleich, und zwar nicht nur zeitweilig, sondern definitiv. Entweder direkt kraft grundloser Prädestination (wie bei den Calvinisten, den Partikularbaptisten, den Whitefieldschen Methodisten und den reformierten Pietisten). Oder doch kraft ihrer verschiedenen Qualifikation zu den pneumatischen Geistesgaben. Oder endlich kraft der verschiedenen Intensität und also auch des verschiedenen Erfolgs ihres Strebens, den bei den alten Pietisten entscheidenden Akt der Bekehrung, den ,Bußkampf‘ und ,Durchbruch‘, oder wie die Wiedergeburt sonst geartet sein mochte, zu erringen. Immer waltete aber in diesen Unterschieden Vorsehung und grundlose, unverdiente, ,freie‘ Gnade eines [62]überweltlichen Gottes. Deshalb war der Prädestinationsglaube zwar nur eine, aber doch die weitaus konsequenteste dogmatische Formung dieser Virtuosenreligiosität.“ MWG I/19, S. 465.
[62]Es sind denn auch heuristische Gründe, aus denen er diesen Ausgangspunkt wählt. Denn diese calvinistische Lehre sei „von ganz einzigartiger Konsequenz“. Sie habe eine „eminente psychologische Wirksamkeit“ entfaltet. Und weiter: „Die nichtcalvinistischen asketischen Bewegungen erscheinen danach, rein unter dem Gesichtspunkt der religiösen Motivierung ihrer Askese betrachtet, für uns als Abschwächungen der Konsequenz des Calvinismus.“
42
Der Calvinismus dient also wiederum als heuristischer Maßstab, an dem Weber die übrigen reformierten Strömungen mißt. Weber, Protestantische Ethik II, unten, S. 307.
Der Calvinismus im späten 16. und im 17. Jahrhundert kommt also dem Idealtypus des asketischen Protestantismus aus Webers Sicht am nächsten. Freilich denkt er hier nicht nur heuristisch, sondern auch historisch. Es seien vor allem die Synoden von Dordrecht und Westminster gewesen, in denen die radikalisierte partikularistische Gnadenwahllehre gegen widerstreitende Interpretationen durchgesetzt worden sei. Insbesondere in Dordrecht habe man gegen die mildere Interpretation des Arminianismus die Verbindlichkeit der partikularistisch interpretierten Gnadenwahllehre festgelegt. Der Arminianismus wurde dann auch tatsächlich als heterodox gebrandmarkt und verbannt.
43
Die Beschlüsse der beiden Synoden wurden, zusammen mit anderen Schriften der Reformierten, von E. F. Karl Müller, Die Bekenntnisschriften der reformierten Kirche. In authentischen Texten mit geschichtlicher Einleitung und Register. – Leipzig: A. Deichert’sche Verlagsbuchhandlung Nachf. (Georg Böhme) 1903 (hinfort: Müller, E. F. Karl, Bekenntnisschriften), zusammengestellt, eine Sammlung, auf die sich Weber stützt, siehe unten, S. 251, Fn. 6. Diese Sammlung ist nun wieder verfügbar als Müller, E. F. Karl (Hg.), Die Bekenntnisschriften der reformierten Kirche. In authentischen Texten mit geschichtlicher Einleitung und Registern. Theologische Studientexte. – Waltrop: Hartmut Spenner 1999. Dort die Dordrechter Canones von 1619 S. 843 ff., die Westminster-Confession von 1647 (mit den Abweichungen der kongregationalistischen Savoy-Declaration von 1658 und der Cumberland-Confession von 1829) S. 542 ff. Weber stellt, ähnlich wie bei Franklin, Textpassagen in eigener Übersetzung eigenwillig zusammen. Die Gnadenwahllehre findet sich in der Westminster Confession in Chapter III, 1–8, überschrieben „Of God’s Eternal Decree“. Besonders interessant, auf dem Hintergrund von Webers Interpretation, ist Nr. 8: „The Doctrine of the high Mystery of Predestination is to be handled with special Prudence and Care, that men attending the Will of God revealed in his Word, and yielding Obedience thereunto, may, from the Certainty of their effectual Vocation, be assured of their eternal Election. So shall this Doctrine afford Matter of Praise, Reverence, and Admiration of God, and of Humility, Diligence, and abundant Consolation to all that sincerely obey the Gospel.“ Ebd., S. 552 f. Die Dordrechter Canones stellen als „Primum doctrinae caput“ „de divina praedestinatione“ heraus. Zu den Arminianern und ihrem Schicksal Weber, Protestantische Ethik II, unten, S. 242 f., Fn. 1, sowie das Glossar, unten, S. 822.
[63]Weber versucht nun eine kurzgefaßte Geschichte der Gnadenwahllehre, die ja keine Erfindung des Calvinismus darstellt.
44
Hier, so seine These, werde ein Bestandteil der christlichen Überlieferung nur zugespitzt. Dies bedeute, die Kluft zwischen Gott und den Menschen unüberbrückbar zu machen und dem Gott des Alten Testaments gegenüber dem des Neuen Testaments ,den Vorrang‘ zu geben: statt des gnädigen und gütigen, weil liebenden Vaters der strafende und verborgene Herrscher, der deus absconditus. Gott werde dadurch zu einem Wesen, „welches von Ewigkeit her nach gänzlich unerforschlichen Ratschlüssen jedem einzelnen sein Geschick zugeteilt und über alles Kleinste im Kosmos verfügt hat. Gottes Gnade ist, da seine Ratschlüsse unwandelbar feststehen, ebenso unverlierbar für die, welchen er sie zuwendet, wie unerreichbar für die, welchen er sie versagt.“ [63]Bezugspunkt ist Römer 9, 11–24. Interpretationen auch bei Augustin, bei Luther und natürlich bei Calvin.
45
Weber, Protestantische Ethik II, unten, S. 259.
Hier wird also das Heilsgeschehen tatsächlich zum Heilsschicksal. Dem Menschen widerfährt etwas, was er nicht beeinflussen kann. Weber verbindet dies mit der Vermutung, dies habe diejenigen Gläubigen, die an diese Lehre glaubten, in eine innere Vereinsamung gestoßen, ein Gefühl, das ihm selbst, seit seiner Krankheit und dann sein Leben lang, nur allzu vertraut war.
46
Vielleicht ist dies die lebensgeschichtliche Erfahrung, aus der heraus er die Gefühlslage der „Helden der ,ecclesia militans‘“ Dazu vor allem die späteren Briefe an Mina Tobler und Else Jaffé, in denen immer wieder von dieser Einsamkeit die Rede ist, die ihn von allem Gesunden trenne. Das Bild vom anderen Ufer, an dem er, von allem Normalen geschieden, stehe, wird von ihm mehrmals benutzt. Dazu die Einleitung, in: MWG II/10, S. 32.
47
so einfühlsam beschreiben kann. Denn einsam, so Weber, habe der Gläubige seine Straße ziehen müssen, nicht wissend, wohin sie führe. Kein Prediger, kein Sakrament, keine Kirche, nicht einmal Christus habe ihm helfen können, denn auch Christus war ja nur für die Erlösten, nicht aber für die Verdammten gestorben. Für Weber hat der radikale Individualismus der vom Calvinismus mitgeprägten Kulturen hier seine religiösen Wurzeln. Vielleicht hatte er dies im Auge, als er an von Below schrieb. Weber, Protestantische Ethik II, unten, S. 251.
Weber entwickelt nun sein Erklärungsmodell, indem er fragt, wie man eine solche Lehre ertragen konnte, „in einer Zeit, welcher das Jenseits nicht nur wichtiger, sondern in vieler Hinsicht auch sicherer war, als alle Interessen des diesseitigen Lebens“.
48
Es geht ihm dabei nicht um diejenigen, die er später religiöse Virtuosen nennt, sondern um die Alltagsmenschen. Webers Behauptung lautet nun, man habe, auf Drängen der Gläubigen, diese harte Lehre in der seelsorgerischen Praxis uminterpretiert. Zwei Typen seelsorgerischer Ratschläge seien hier zu nennen: 1. die Pflicht, sich für erwählt zu halten; 2. durch [64]rastlose Berufsarbeit die religiösen Zweifel zu verscheuchen und schließlich im Berufserfolg ein Zeichen der Erwählung zu sehen. Dies habe die Persönlichkeitsbildung beeinflußt. Statt des demütigen und reuigen Sünders des Luthertums seien jene „selbstgewissen ,Heiligen‘“ entstanden, „die wir in den stahlharten puritanischen Kaufleuten jenes heroischen Zeitalters des Kapitalismus und in einzelnen Exemplaren bis in die Gegenwart wiederfinden.“ Ebd., unten, S. 270–272.
49
[64]Ebd., unten, S. 276.
Weber vergleicht also die Sozialisationsmuster, wie sie in Luthertum und Calvinismus vorherrschen. Sie lassen sich danach charakterisieren, wie man jeweils die certitudo salutis, die Heilsgewißheit, erringt. Angelehnt an die Ausführungen von Matthias Schneckenburger,
50
stellt er eine eher kontemplative Gefühlskultur (Luthertum) einer asketischen Handlungskultur (Calvinismus) in ihrer Wirkung auf die Persönlichkeitsbildung gegenüber. Schneckenburger, Matthias, Vergleichende Darstellung des lutherischen und reformirten Lehrbegriffs. Aus dem handschriftlichem Nachlasse zusammengestellt und hg. durch Eduard Güder, 2 Theile. – Stuttgart: J. B. Metzler 1855 (hinfort: Schneckenburger, Vergleichende Darstellung I, II). Weber sagt ausdrücklich, daß er hier Schneckenburger folge.
51
Der Katholizismus kommt nur beiläufig vor. Weber, Protestantische Ethik II, unten, S. 276–279.
52
Im Calvinismus habe der Gläubige seinen Glauben nicht in einer Art unio mystica mit Gott oder in einzelnen guten Werken, sondern in einer zum System gesteigerten Werkheiligkeit bewähren müssen, wissend, daß die geforderten Werke nicht nur gottgewollt, sondern gottgewirkt seien. Ebd., unten, S. 285–288.
53
Der Mensch als Werkzeug Gottes in dieser Welt, dies sei es letztlich, was der calvinistischen Persönlichkeitsbildung zugrunde liege. Ebd., unten, S. 288: „Der Gott des Calvinismus dagegen verlangt von den Seinigen nicht einzelne ,gute Werke‘, sondern ein ,heiliges Leben‘, d. h. eine zum System gesteigerte Werkheiligkeit. Die ethische Praxis des Alltagsmenschen wird ihrer Plan- und Systemlosigkeit entkleidet und zu einer konsequenten Methode der ganzen Lebensführung ausgestaltet.“
54
Ebd., unten, S. 292. Zum Persönlichkeitsbegriff unten, S. 289 ff. Ähnlich dann auch in Weber, Roscher und Knies II, vom Oktober 1906.
Daran wird deutlich: Es ist gar nicht in erster Linie die Gnadenwahllehre, sondern die Lehre von der Bewährung, der „fundamentale Bewährungsgedanke“,
55
der die verschiedenen Richtungen des asketischen Protestantismus miteinander verbindet und sie vom Luthertum unterscheidet. Auch dort, wo die Gnadenwahllehre keine zentrale Rolle spielt, wie etwa bei den Täufern und den aus ihnen hervorgegangenen Bewegungen der Baptisten, Mennoniten und Quäker, wirkt sich der Bewährungsgedanke disziplinierend und zugleich sektenbildend aus. Weber, Protestantische Ethik II, unten, S. 303 f.
56
Freilich, gerade in Verbindung mit der Gnaden[65]wahllehre, der Vorstellung vom Gnadenpartikularismus, habe dieser eine „rationale Gestaltung des ethischen Gesamtlebens“ bewirkt. Dies sei im Luthertum anders gewesen, weil hier die „unbefangene Vitalität triebmäßigen Handelns und naiven Gefühlslebens ungebrochener“ weiterlebte. Weber verwendet übrigens bereits hier den Sektenbegriff in Abgrenzung vom Kirchenbegriff in einem technischen Sinne (die Täufer „sind für unsere Terminologie [65],Sekte‘“). Ausgangspunkt für diesen kurzen Ausflug in die ansonsten ausgeklammerte Organisationsfrage ist der Gedanke der „believers’ church“. Daran anschließend heißt es: „Das heißt, daß die religiöse Gemeinschaft, die ,sichtbare Kirche‘ nach dem Sprachgebrauch der Reformationskirchen, nicht mehr aufgefaßt wird als eine Art Fideikommißstiftung zu überirdischen Zwecken, eine, notwendig Gerechte und Ungerechte umfassende, Anstalt, – sei es zur Mehrung des Ruhmes Gottes (calvinistisch), sei es zur Vermittlung von Heilsgütern an die Menschen (katholisch und lutherisch), – sondern ausschließlich als eine Gemeinschaft der persönlich Gläubigen und Wiedergebornen und nur dieser: mit anderen Worten nicht als eine ,Kirche‘, sondern als eine ,Sekte‘.“ Der Bewährungsgedanke und die Sektenorganisation sind sich gewissermaßen kongenial. Siehe Weber, Protestantische Ethik II, unten, S. 349, sowie Fn. 126.
57
Die Verbindung von Gnadenwahllehre und Bewährungsgedanken habe Glauben und Sittlichkeit in einmaliger Weise miteinander verbunden, mit der Folge einer „penetranten Christianisierung“ des Alltagslebens, Ebd., unten, S. 304–306.
58
wie niemals zuvor und, so kann man hinzufügen, auch nicht mehr danach. Ebd., unten, S. 301 f.
Weber schlägt also mittels des Bewährungsgedankens die Brücke zu den übrigen Strömungen des asketischen Protestantismus. Der Gläubige werde als das Werkzeug Gottes verstanden, der seinen Willen in der Welt zu erfüllen und sich darin zu bewähren hat. Keine Handlungssphäre bleibe davon ausgenommen. Auch die Berufsarbeit werde so religiös geheiligt. Von der Werkheiligkeit zur Werkgerechtigkeit sei freilich nur ein kurzer Weg.
Tatsächlich sieht Weber die Gesamtentwicklung ähnlich wie im Fall von Franklin: Die religiöse Ethik kollabiert in den Utilitarismus. Aus dem Berufserfolg als Erkenntnisgrund des Heilsschicksals werde der Realgrund des Heils und dieser dann bald nicht mehr religiös, sondern utilitarisch verstanden, wobei dann der philosophische Utilitarismus die Rechtfertigung dafür gibt. In dessen Nachfolge entwickelt dann die ökonomische Theorie die Kunstfigur des homo oeconomicus, an der sie ihre Analysen ausrichtet. Er ist der kalkulierende Rechner, der seine Handlungspläne an einer Kosten-Nutzen-Bilanz orientiert.
Weber hatte am Ende des ersten Aufsatzes versprochen, er werde im zweiten Aufsatz zeigen, wie Ideen in der Geschichte wirksam werden.
59
Hat er dieses Versprechen erfüllt? Man kann dies wohl bejahen, denn er beschreibt den Prozeß, in dem Ideen als Teil kultureller Muster internalisiert werden und dabei ihre Wirkungsrichtung verändern, weil die Ideen in Spannung mit den ideellen Interessen der Rezipienten geraten, was zur Reinterpretation dieser [66]Ideen selbst führt. Weber sucht diesen Vorgang anhand der seelsorgerischen Literatur nachzuweisen, einer Art Responsenliteratur, wie er später sagt, in der sich die Beschwernisse der Gläubigen spiegeln. Auch hier geht er wieder idealtypisch und exemplifizierend vor. Er behandelt die verschiedenen Strömungen des asketischen Protestantismus als eine „Gesamtmasse“ und den englischen Puritanismus als „die konsequenteste Fundamentierung der Berufsidee“, wobei er Richard Baxters „Christian Directory“ als das „umfassendste Kompendium der puritanischen Moraltheologie“ bezeichnet, das „überall an den praktischen Erfahrungen der eigenen Seelsorge orientiert“ sei. Speners „Theologische Bedenken“ und Barclays „Apology“ wolle er nur unter dem Strich vergleichend heranziehen. Wie im Fall der Gnadenwahllehre, wird also auch hier eine Ausprägung, Weber sagt: „unserem Prinzip gemäß“, in den Mittelpunkt gestellt. Weber, Protestantische Ethik I, S. 214; dazu oben, S. 48 mit Anm. 86.
60
[66]Weber, Protestantische Ethik II, unten, S. 366. Zu den vollständigen Titelangaben das Verzeichnis der von Max Weber zitierten Literatur, unten, S. 843 f. und 863.
Man kann auch hier wiederum zweifeln, ob Weber bei der Auswahl dieser Literatur eine glückliche Hand hatte. Man fragte beispielsweise, ob angesichts der Tatsache, daß er in seiner Untersuchung hauptsächlich die Erziehungswirkungen der Glaubensvorstellungen im Auge hatte, die puritanische Erziehungsliteratur nicht die bessere Quelle sei.
61
Wie auch immer: Die formale Struktur des Erklärungsmodells für Ideenkausalität ist auch heute noch von Interesse. Denn Ideen wirken in der Regel nicht direkt, sondern indirekt. Die Analyse ihrer Wirkung verlangt ein Mehr-Ebenen-Modell mit Sequenzialisierung. Beides ist bei Webers Analyse des innerreligiösen Vorgangs und seines Übergangs zum außerreligiösen tatsächlich nachweisbar. Lenhart, Volker, Protestantische Pädagogik und der ,Geist‘ des Kapitalismus. – Frankfurt a.Μ.: Peter Lang 1998.
62
Näheres in Schluchter, Entzauberung, S. 62.
Wer im Jahre 1905 die beiden Aufsätze las, durfte eine Fortsetzung erwarten. Denn Weber hatte im zweiten Aufsatz an mehreren Stellen eine Fortsetzung avisiert.
63
Ein Diskussionsstrang, der ergänzend hätte eingegliedert werden müssen, betraf zweifellos die Wirkung unterschiedlicher ,Kirchenverfassungen‘ auf den Erziehungsprozeß, also die institutionelle Seite, ein weiterer die materiellen Interessen, also die Klassenverhältnisse der Gläubigen. Weber entwickelte am Ende des zweiten Aufsatzes gar ein ganzes Programm, aus dem hervorgeht, wie er die Aufsatzfolge tatsächlich fortsetzen wollte. Vgl. dazu oben, S. 59, Anm. 35, sowie im Anhang zur Einleitung, unten, S. 90–96.
64
Bisher habe er ja nur die Beziehungen behandelt, „in welchen eine Einwirkung religiöser Bewußtseinsinhalte auf das ,materielle‘ Kulturleben wirklich zweifellos ist“. Weber, Protestantische Ethik II, unten, S. 423–425.
65
Natürlich sei die kapitalistische Entwicklung auch vor dem [67]17. Jahrhundert in vielfältiger Weise vom Christentum beeinflußt, doch dies gehöre „in ein späteres Kapitel.“ Ebd., unten, S. 424, Fn. 86.
66
Auch was aus der innerweltlichen Berufsaskese wurde – man sollte dabei die Ursprungs- von der Säkularisierungs- und Verbreitungsthese unterscheiden –, [67]Ebd.
67
das zu untersuchen gehörte wohl zu diesem Plan. Dazu die Übersicht in Schluchter, Entzauberung, S. 59.
Der interessante Sachverhalt ist nun: Es ging nicht weiter, jedenfalls nicht so, wie der Leser es erwarten durfte. Weber schreibt zwar am 24. November 1905 an Carl Neumann, der ihm die 2. Auflage seines Buches über Rembrandt übersandt hatte: „ich komme in diesen Wochen zu meinen Studien über Calvinismus p.p. zurück, dann muß ich es erneut lesen, auch wenn ich es nicht ohnehin wollen würde“.
68
Aber dies scheint nicht der Beginn einer Fortsetzung der Artikelserie zu sein. Acht Monate später, als Paul Siebeck, aufgrund des Erfolgs der Aufsatzfolge, zum ersten Mal eine „Sonderausgabe des Artikels über ,Protest[antismus] u. Kapit[alismus]‘“ anregt, was er in den folgenden Jahren oft wiederholt, antwortet Weber gar: „ich muß mir erst überlegen, ob der Art[ikel] nicht umgearbeitet werden müßte.“ Brief Max Webers an Carl Neumann vom 24. November 1905, GStA PK, VI. HA, Nl. Max Weber, Nr. 30, Bd. 4, Bl. 148–149 (MWG II/4).
69
Am 24. März 1907 heißt es denn auch in einem Brief an Paul Siebeck: „irgendwann möchte ich die Sache fortsetzen und dann einmal das Ganze ev. als Buch herausgeben, wenn Sie dazu bereit sind.“ Brief Max Webers an Paul Siebeck vom 24. Juli 1906, MWG II/5, S. 119. Weitere Äußerungen in diesem Zusammenhang ebd., S. 273, 276, 280, 285, 300, 426, 435 und S. 609.
70
Brief Max Webers an Paul Siebeck vom 24. März 1907, MWG II/5, S. 273.
Irgendwann, aber eben nicht gleich, was man erwartet hätte. Weber setzt die kulturgeschichtliche Analyse der Entstehung des modernen Kapitalismus, seine „(stark theologisch angehauchte) entwicklungsgeschichtliche Arbeit“, wie er gegenüber Willy Hellpach formuliert,
71
offensichtlich zunächst nicht fort. Statt dessen arbeitet er an den begonnenen logisch-methodischen Betrachtungen weiter, kommentiert ausführlich die bürgerliche Revolution in Rußland, faßt seine agrargeschichtlichen Studien zur Antike in einer großen Abhandlung zusammen und legt seine Überlegungen zur Psychophysik der industriellen Arbeit vor. Brief Max Webers an Willy Hellpach vom 11. August 1905, GStA PK, VI. HA, Nl. Max Weber, Nr. 17, Bl. 50–51 (MWG II/4).
72
Schließlich läßt er sich gar zum Ersatz des Handbuchs der politischen Ökonomie von Schönberg überreden, ganz zu schweigen von seiner Bereitschaft, die Deutsche Gesellschaft für Soziologie mit zu gründen und weiterzuentwickeln. Es scheint, als sei er nach der Anstrengung auf einem fremden Gebiet erleichtert, sich wieder auf vertrautem wissen[68]schaftlichem Terrain zu bewegen. Bereits am 8. März 1905, also zu einem Zeitpunkt, als der zweite Aufsatz gerade erst in Druck ging, heißt es in dem oben zitierten Brief an den Bruder: „Im Übrigen werde ich froh sein, wieder an methodologische und dann agrarpolitische Studien zu kommen. Die Ausgestaltung des ,Protestantismus‘ zu einem Buch muß nebenher in langsamem Tempo gehen. Dazu muß ich später noch einmal nach England und den V[ereinigten] Staaten und bis das möglich wird, hat es gute Weile.“ Dazu die Bände I/6, I/7, I/10 und I/11 der Max Weber-Gesamtausgabe.
73
[68]Brief Max Webers an Alfred Weber vom 8. März 1905, GStA PK, VI. HA, Nl. Max Weber, Nr. 30, Bd. 4, Bl. 59–60 (MWG II/4).
6. ,Kirchen‘ und ,Sekten‘: Ein Vergleich zwischen den USA und Deutschland
Nun ist dieses Bild unvollständig insofern, als Weber im Jahre 1906 eine kirchen- und sozialpolitische Skizze über die Kirchen und Sekten in Nordamerika veröffentlichte. Man sah darin eine Fortsetzung der Artikelfolge über die „Protestantische Ethik und den ,Geist‘ des Kapitalismus“. Das ist diese Skizze nun allerdings nicht. Hätte Weber sie tatsächlich so verstanden, so hätte er sie wohl kaum in der Frankfurter Zeitung und noch einmal, ein wenig verändert, in der Christlichen Welt veröffentlicht. Zudem ist die darin enthaltene begriffliche Unterscheidung zwischen „Kirche“ und „Sekte“ keineswegs neu. Weber hatte sie bereits in seinem zweiten Aufsatz, im Zusammenhang mit dem zweiten selbständigen Träger der protestantischen Askese, dem Täufertum und seinen sekundären Erscheinungen, verwendet.
74
Neu ist der deutsch-amerikanische Vergleich. Strenggenommen müßte man zwischen Kirchen- und Sektengeist sowie Kirchen- und Sektenform unterscheiden. Jener wirkt innerlich, dieser äußerlich. Der Sektengeist betont den Gnadenpartikularismus und steigert ihn so sehr, daß auch äußerlich die Erwählten von den Nichterwählten sichtbar getrennt werden müssen. In der Artikelfolge steht eher der innere, beim Sektenaufsatz der äußere Gesichtspunkt im Vordergrund. – Die Unterscheidung zwischen Kirche und Sekte und Andeutungen zur Kulturbedeutung des Sektengeistes finden sich übrigens bereits im Objektivitätsaufsatz. Dazu Weber, Objektivität, S. 68.
Dennoch wollte Weber die Grundgedanken des Artikels für eine Fortsetzung verwenden. Als sein Verleger wieder einmal einen Separatdruck vorschlug, unverändert und als erste Lieferung bezeichnet, der dann später eine zweite Lieferung mit einer Einleitung nebst Titel und Inhaltsverzeichnis folgen könnte, antwortete Weber: „Ich würde dagegen sein, den Aufsatz formell als ,1. Lieferung‘ zu bezeichnen. Vielmehr würde ich lieber in einem kurzen (4 Seiten betragenden) Vorwort klarlegen, daß die Arbeit fortgesetzt werden soll. Ev. würde ich auch am Schluß den Anfang einer Fortsetzung beifügen, welche in einem s. Z. in der ,Christl[ichen] Welt‘ publizierten Artikel enthalten [69]ist.“
75
Und wenig später heißt es: „Bezüglich der Beifügung des Artikels aus der ,Chr[istlichen] W[elt]‘ geben Sie mir wohl Freiheit? Ich muß sehen, ob ich ihn passend umarbeiten kann, so daß er den eventl. weiteren Gang des Buches nicht stört.“ [69]Brief Max Webers an Paul Siebeck vom 2. April 1907, MWG II/5, S. 276.
76
Brief Max Webers an Paul Siebeck vom 13. April 1907, MWG II/5, S. 280.
Der Artikel in der Christlichen Welt ist also nicht die versprochene Fortsetzung, wohl aber ein Anfang davon. Was könnte dieser Anfang sein? Wir betonten oben, Weber habe in der Aufsatzfolge die ,Kirchenverfassungen‘, wie es dort heißt, zunächst bewußt ausgeklammert. Aber diese institutionelle Seite ist für die Erziehung und die äußere Kontrolle der Lebensführung der Gläubigen natürlich zentral. Nun hatte er während seiner USA-Reise, deren Ertrag für seine kulturgeschichtliche Arbeit er im übrigen nicht hoch veranschlagte,
77
eine strikte Trennung von Kirche und Staat kennengelernt sowie die Gliederung eines Landes in eine Vielzahl von lokal verankerten Denominationen, aus denen sich im Laufe der Zeit auch eine Vielzahl säkularer voluntaristischer Organisationen entwickelt hatte. Das war geradezu das Gegenbild zu Preußen-Deutschland mit seinem autoritären Staats- und Landeskirchentum. Die USA sei kein „Sandhaufen“ von Individuen, wie manche meinten, so Weber, Dazu den Brief Max Webers an Helene Weber vom 19. November 1905, Bestand Max Weber-Schäfer, Deponat BSB München, Ana 446: „Daß das ,wissenschaftliche‘ Resultat der Reise für mich zu den Kosten im Verhältnis stände, lässt sich natürlich nicht behaupten. Ich habe für meine Zeitschrift eine erhebliche Zahl interessanter Mitarbeiter gewonnen, bin ganz anders als früher im Stande, die Zahlen der Statistik und die Berichte der Regierungen in den V[ereinigten] Staaten zu verstehen, werde selbst einige Kritiken über Negerliteratur und dgl. schreiben, auch sonst einige kleine Sachen vielleicht, aber für meine kulturgeschichtliche Arbeit habe ich nicht viel mehr gesehen als: wo die Dinge sind, die ich sehen müsste, insbesondere die Bibliotheken, die ich zu benutzen hätte, und die weit über das Land verstreut in kleinen Sekten und Colleges stecken.“ Er spricht dann noch von der Erweiterung des wissenschaftlichen Horizonts und den Langzeitwirkungen, die mit solchen Reisen gewöhnlich verbunden seien. Mit etwas anderer Betonung der Brief an Georg Jellinek, allerdings noch während der Reise geschrieben: „Sehr vieles ist sehr anders hier, als es die Reiseschriftsteller, auch Münsterberg, schildern; ich habe für meine Zwecke viel gesehen.“ Brief Max Webers an Georg Jellinek vom 24. September 1904 (aus St. Louis), BA Koblenz, Nl. Georg Jellinek, Nr. 31 (MWG II/4).
78
sondern ein organisatorisch reich gegliedertes Gemeinwesen, in dem die soziale Kontrolle des Einzelnen durch seine religiöse Gemeinschaft eine große Rolle spiele. Er müsse etwas leisten, um in sie aufgenommen zu werden, und mit der Aufnahme in die Gemeinschaft werde seine Lebensführung unter die scharfe Kontrolle der Genossen gestellt. Diese Beobachtung bringt Weber dazu, im religiösen Bereich begrifflich sauber zwischen Kirche und Sekte zu unterscheiden. In die Kirche werde man hineingeboren, und die [70]Mitgliedschaft sei nicht an Leistungen gebunden. In eine Sekte dagegen trete man freiwillig ein, falls man, abhängig von der Erfüllung bestimmter Leistungskriterien, aufgenommen werde. Dann müsse man sich aber im Kreis der Genossen weiterhin bewähren. Die verschiedenen Strömungen des asketischen Protestantismus seien nach dieser Definition alle als Sekten verfaßt. Selbst der Calvinismus, obgleich äußerlich eine Kirche, sei innerlich eine Sekte. Das Sektenprinzip stützte also nach Weber den ,fundamentalen Bewährungsgedanken‘ auch äußerlich. Weber, „Kirchen“ und „Sekten“, unten, S. 453 f.
Weber, der ,Would-be Englishman‘,
79
von seiner Familiengeschichte her eng mit dem anglo-amerikanischen Kapitalismus vertraut, [70]So die Formulierung von Guenther Roth. Dazu Roth, Guenther, Weber the Would-Be Englishman: Anglophilia and Family History, in: Lehmann, Hartmut and Roth, Guenther (eds.), Weber’s ,Protestant Ethic‘: Origins, Evidence, Contexts. – New York: Cambridge University Press 1993, S. 83–121.
80
sieht in der Sekte eine kulturhistorische Erfindung von größter Tragweite. Auch sie ist, wie schon die Askese, von dem mittelalterlichen Mönchtum vorgeprägt. Aber erst im Zusammenhang mit dem asketischen Protestantismus entfaltete sie ihre volle ökonomische und vor allem auch politische Wirkung. Weber stritt sich mit Adolf Harnack nicht nur über die Rolle des Luthertums in Preußen-Deutschland, sondern auch über die ,amerikanische Freiheit‘, die ihm offensichtlich etwas anderes als Luthers Freiheit eines Christenmenschen war. Noch mitten in der Arbeit an dem zweiten Aufsatz zur „Protestantischen Ethik“, aber auf dem Hintergrund der frischen USA-Erfahrung, schreibt er an Harnack: „Wir dürfen doch nicht vergessen, daß wir den Sekten Dinge verdanken, die Niemand von uns heute missen könnte: Gewissensfreiheit u. die elementarsten ,Menschenrechte‘, die uns heut selbstverständlicher Besitz sind. Nur radikaler Idealismus konnte das schaffen“, Roth, Familiengeschichte, bes. Kap. II und XIV.
81
ein radikaler Idealismus in Sektenform. Brief Max Webers an Adolf Harnack vom 12. Januar 1905, Staatsbibliothek zu Berlin PK, Nl. Adolf von Harnack, K. 44, Bl. 1–2 (MWG II/4). Ferner Troeltsch, Bedeutung des Protestantismus, S. 201–316. Siehe auch den Editorischen Bericht zu Weber, „Kirchen“ und „Sekten“, unten, S. 426–434, und die Einleitung, oben, S. 25 f.
Weber veröffentlichte also zum ersten Mal eher beiläufig eine für ihn grundlegend wichtige begriffliche Unterscheidung, die er dann bis ins Spätwerk hinein ausbaute.
82
Ernst Troeltsch übernimmt sie und ergänzt sie um eine dritte Form, die er Mystizismus oder Enthusiasmus nennt. Was darüber hinaus im Sektenaufsatz steht, sagt zwar viel über Webers USA-Verständnis, doch wenig über die Fortführung der Aufsatzfolge. Gewiß, er wollte die publizierte Aufsatzfolge als Buch veröffentlichen und sie dafür revidieren und erweitern, [71]daran besteht kein Zweifel. Aber er schob diese Aufgabe, das jedenfalls sagen die zitierten Dokumente, vor sich her und damit auf die lange Bank. In den „Soziologischen Grundbegriffen“ sind dann „Kirche" und „Sekte" je eine Unterform von Anstalt bzw. Verein. Weber, Soziologische Grundbegriffe, MWG I/23, S. 210.
Man kann natürlich darüber nur spekulieren, warum er die begonnene Arbeit nicht zügig weiterführte. Fühlte er sich vielleicht doch auf dem theologischen und religionsgeschichtlichen Gebiet nur als Dilettant? Dafür spräche auch seine Entscheidung, die Einladung von Georg von Below, auf dem Historikertag des Jahres 1906 über sein Thema zu sprechen, abzulehnen und statt seiner Ernst Troeltsch als Redner vorzuschlagen.
83
Wäre dies nicht eine günstige Gelegenheit gewesen, seine Gedanken zur Entstehung des kapitalistischen Geistes unter Historikern zu verbreiten? Hatte nicht Werner Sombart diese Gelegenheit drei Jahre zuvor für seinen Modernen Kapitalismus äußerst wirkungsvoll genutzt? Oder hielt er Ernst Troeltsch auf diesem Gebiet einfach für den kompetenteren Forscher? Wenig später, 1908, und erst recht im Rückblick 1920, klingt es so, als sei dies der entscheidende Grund. [71]Brief Max Webers an Georg von Below vom 23. August 1905, GStA PK, VI. HA, Nl. Max Weber, Nr. 30, Bd. 4, Bl. 130 (MWG II/4). Ferner der Editorische Bericht zu: Troeltsch, Bedeutung des Protestantismus, S. 183 ff.
84
In der zweiten Antikritik zu Fischer aus dem Jahre 1908 heißt es über die geplante Separatausgabe: „Daß ich sie noch nicht vorlegen kann, hat seinen Grund nicht etwa in sachlichen Schwierigkeiten, sondern teils in hier nicht interessierenden persönlichen Umständen, teils in einigen – wie jeder, der das ,Archiv‘ eines Blickes gewürdigt hat, weiß – weit abliegenden anderen Arbeiten, teils endlich darin, daß mein Kollege und Freund E[rnst] Tröltsch inzwischen eine ganze Reihe von Problemen, die auf meiner Route lagen, in glücklichster Weise von seinem Gedankenkreis aus aufgegriffen hatte, und ich ein unnützes Parallelarbeiten (bei dem ihm die weitaus größere Sachkunde zu Gebote stände) zu vermeiden wünschte.“ Weber, Bemerkungen, unten, S. 505 f., Fn. 3. – In die zweite Fassung der „Protestantischen Ethik“ von 1919/20 fügte Weber eine Fußnote ein, die folgendermaßen lautet: „Statt der ursprünglich beabsichtigten unmittelbaren Fortsetzung im Sinn des weiter oben stehenden Programms habe ich mich, teils aus zufälligen Gründen, insbesondere wegen des Erscheinens von E[rnst] Troeltschs ,Soziallehren der christlichen Kirchen‘ (der manches von mir zu Erörternde in einer Art erledigte, wie ich als Nicht-Theologe es nicht gekonnt hätte), teils aber auch, um diese Ausführungen ihrer Isoliertheit zu entkleiden und in die Gesamtheit der Kulturentwicklung hineinzustellen, seinerzeit entschlossen, zunächst die Resultate vergleichender Studien über die universalgeschichtlichen Zusammenhänge von Religion und Gesellschaft niederzuschreiben.“ Weber, GARS I, S. 206, Fn. 1 (MWG I/18). Das „seinerzeit“ und die Resultate universalgeschichtlicher Zusammenhänge können sich allerdings nicht auf den hier diskutierten Zeitraum beziehen. Dazu ausführlich die Einleitung zu MWG I/18.
7. Kritiken und Antikritiken
Angesichts der Selbstzweifel Webers, ob es denn tunlich sei, die beiden Aufsätze zur „Protestantischen Ethik“ unverändert außerhalb des Archivs für [72]Sozialwissenschaft und Sozialpolitik zu veröffentlichen, überrascht es dann doch, mit welcher Verve er sie wenig später gegen Kritiker verteidigte. Vielleicht ist hier tatsächlich ein existentielles Moment mit im Spiel. Diese Kritiker zwangen ihn trotz seiner Interessen an anderen Themenfeldern zurück zu seinen Protestantismusstudien. Die erste Runde von Kritik und Antikritik absolviert er mit H. Karl Fischer, die zweite mit Felix Rachfahl. Der Kampf der Kontrahenten geht jeweils über zwei Runden. Dann bricht er ab.
Fischer war auf dem Feld ein Neuling, Rachfahl dagegen ein anerkannter Historiker. Die Einwände von Fischer wogen leicht, die von Rachfahl dagegen schwer. Den Kampf mit Fischer bestimmten methodische, den mit Rachfahl mehr inhaltliche als methodische Fragen. Beiden Kämpfen ist jedoch gemeinsam, daß sich Weber mit seinem Ansatz von seinen Kritikern mißverstanden sieht.
Weber konzidiert dabei von Beginn an, daß „philologische Funde meine Ergebnisse jederzeit berichtigen“ können.
1
Er erkennt also das Vetorecht der Quellen an. [72]Weber, Kritische Bemerkungen, unten, S. 479.
2
Die Tatsachen hätten sich nicht nach der Theorie, sondern „die Theorie nach den Tatsachen zu richten“. So, im Anschluß an Reinhart Koselleck, Wolfgang Lienemann, Historia vitae magistra, oder: Was ist kritische Rezeption, in: Hofheinz, Marco et al. (Hg.), Calvins Erbe. Beiträge zur Wirkungsgeschichte Johannes Calvins. – Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2011, S. 375 ff.
3
Was die Tatsachen anbelangt, so hält er Fischer für inkompetent. Bei Rachfahl dagegen sieht die Sache anders aus. Weber, Kritische Bemerkungen, unten, S. 490.
Resümieren wir zunächst kurz die Antikritiken zu Fischer. Die entscheidenden Punkte sind schnell genannt. Fischer interpretierte Webers Aufsatzfolge als den Versuch, die „Wahrheit der idealistischen Geschichtsdeutung“ darzutun, und er verband dies sogar mit einer Anspielung auf Hegel.
4
Dieser angeblichen idealistischen Geschichtsauffassung stellte er die wirtschaftsgeschichtliche Darstellung Sombarts als Alternative gegenüber, und zog aus der behaupteten Einseitigkeit beider Sichtweisen den Schluß, man brauche eine dritte Position, die in der Psychologie zu finden sei. Wer psychische Zustände wie den Geist des Kapitalismus oder den Geist der Berufspflicht historisch erklären wolle, müsse dies psychogenetisch tun, brauche also eine psychologisch-historische Betrachtungsweise, eine Art Psychohistorie. Außerdem sei die Feststellung eines Zusammenhangs zwischen zwei Erscheinungen, wie er zwischen Konfession und wirtschaftlichem Erfolg zweifellos bestehe, noch keine gültige kausale Erklärung. Um zu einer solchen zu gelangen, hätte [73]Weber alle anderen möglichen Deutungen des Zusammenhangs von Konfession und wirtschaftlichem Erfolg ausschließen müssen. Fischer, H. Karl, Kritische Beiträge zu Prof. Μ. Webers Abhandlung: „Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus“, in: AfSSp, 25. Band, 1. Heft, 1907, S. 232–242; abgedruckt unten, S. 469–477 (hinfort: Fischer, Kritische Beiträge), hier unten, S. 470 und 472.
5
Das aber habe er versäumt. [73]Fischer, K. H., Protestantische Ethik und „Geist des Kapitalismus“: Replik auf Herrn Prof. Max Webers Gegenkritik, in: AfSSp, 26. Band, 1. Heft, 1908, S. 270–274; abgedruckt unten, S. 494–497 (hinfort: Fischer, Replik), hier unten, S. 495 f.
Weber reagiert darauf äußerst ungehalten. Vermutlich stört ihn nicht so sehr die undifferenzierte Wiedergabe seines Ansatzes,
6
als vielmehr die Aufforderung, eine psychologische Erklärung für das von ihm formulierte Problem zu wählen, also das Heil der Sozial- und Geschichtswissenschaft in der Psychologie zu suchen. Dies weckte bei ihm wohl Reminiszenzen an den Methodenstreit in der Nationalökonomie und an den Lamprechtstreit in der Geschichtswissenschaft. In beiden Fällen ging es um die Frage, ob für die Sozial- und Geschichtswissenschaft eine Psychologie als fundierende Disziplin benötigt werde. Weber hatte dies vehement verneint. Dies natürlich auch. So beklagt Weber, Kritische Bemerkungen, unten, S. 478–485, die Tatsache, daß Fischer ständig zusammenwerfe, was er sorgfältig unterschieden habe: Franklin von Fugger, Luthers Berufsbegriff von dem des asketischen Protestantismus, den Geist von der Form, die Gegenwart vom 17. Jahrhundert, schließlich den materialistischen oder ökonomischen vom idealistischen oder spiritualistischen Gesichtspunkt, unter denen man die historische Wirklichkeit betrachten könne. Auch sei Calvin nicht identisch mit Calvinismus, Calvinismus wiederum nicht mit asketischem Protestantismus, Responsenliteratur, auf die es ankomme, eben keine Erbauungsliteratur. Aber darüber könne man nur mit jemandem diskutierten, der, anders als Fischer, die Quellen kenne.
7
Die Psychologie sei eine Einzeldisziplin wie jede andere, in ihrem Begriffsapparat noch nicht allzu weit gediehen. Wo sie nützliche Erkenntnisse biete, seien diese zu verwerten, wie die anderer Disziplinen auch. Sie habe aber keine Sonderstellung im Konzert der Disziplinen. Nützliche Erkenntnisse für sein Problem erwartet Weber zudem nur von einer exakten, experimentell arbeitenden psychologischen Forschung, etwa auf dem Gebiet religionspathologischer Phänomene. Er dachte dabei an die Arbeiten von Willy Hellpach und Hans Gruhle, nachrangig auch an die von Sigmund Freud. Dazu auch die Fortsetzung des Roscher-Aufsatzes: Weber, Roscher und Knies II, S. 128: Die „zuweilen gehörte Behauptung, daß die ,Psychologie‘ im allgemeinen oder eine erst zu schaffende besondere Art von Psychologie um deswillen für die Geschichte oder die Nationalökonomie ganz allgemein unentbehrliche ,Grundwissenschaft‘ sein müsse, weil alle geschichtlichen und ökonomischen Vorgänge ein ,psychisches‘ Stadium durchlaufen, durch ein solches ,hindurchgehen‘ müßten, ist natürlich unhaltbar.“
8
Weber schätzte Hellpach wegen seiner Arbeiten über Hysterie und Nervosität (dazu die Einträge im Verzeichnis der von Max Weber zitierten Literatur, unten, S. 851). Gruhle konsultierte er im Zusammenhang mit seinen Arbeiten zur Psychophysik. 1907 hatte Weber die wichtigsten Schriften von Freud gelesen und in einem Brief an Else Jaffé vom 13. September 1907, in dem er begründet, weshalb er einen Artikel von Otto Gross, einem Schüler Freuds, für das Archiv ablehne, folgendes Urteil gefällt: [74]„Gleichwohl unterliegt es keinem Zweifel, daß Freud’s Gedankenreihen für ganze Serien von kultur-, speziell religions-historischen und sittengeschichtlichen Erscheinungen zu einer Interpretationsquelle von sehr großer Bedeutung werden können, – wenn auch freilich, von der Warte des Kulturhistorikers aus abgeschätzt, ganz entfernt nicht von so universeller, wie der sehr begreifliche Eifer und die Entdeckerfreude von Freud und seinen Jüngern dies annimmt.“ MWG II/5, S. 395 f. – Webers Stellung zur wissenschaftlichen Psychologie ist sicherlich zum Teil zeitgebunden. Fischers Einwand, Weber benötige bei dem von ihm aufgeworfenen Problem eine psychologisch-historische Betrachtung, war keineswegs unberechtigt (Fischer, Kritische Beiträge, unten, S. 474–476). Faktisch präsentiert Weber denn auch eine solche Betrachtung, wenngleich er sie nicht so nennt. Aber die Sozialisationstheorie, mit deren Hilfe er die Erziehungswirkungen der verschiedenen Konfessionen abschätzt, schließt eine Motivationstheorie ein, die er pragmatisch begründet. Pragmatisch heißt dabei, kausale Zurechnungen mit Hilfe unserer Alltagserfahrung vorzunehmen, was in der Mehrzahl der Fälle völlig ausreichend sei. Es gibt aber keinen Grund, bei der Frage nach der Bildung von Motiven nicht auf die Erkenntnisse der Fachpsychologie zurückzugreifen, und zwar nicht nur bei pathologischen Phänomenen, an die Weber hier in erster Linie denkt. Dies zuzugeben heißt nicht, der Psychologie eine Sonderstellung im Konzert der Wissenschaften einzuräumen. In der Ablehnung „einer ,Hierarchie‘ der Wissenschaften nach Comteʼschem Muster“ war Weber zweifellos im Recht. Zum Zitat Weber, Max, Die Grenznutzlehre und das ,psychophysische Grundgesetz‘, in: AfSSp, 27. Band, Heft 2, 1908, S. 546–558, hier S. 553 (MWG I/12).
[74]Darüber hinaus hatte sich Fischer erlaubt, Weber methodische Naivität vorzuwerfen.
9
Dieser sehe die methodischen Schwierigkeiten einfach nicht, die sich mit dem Anspruch auf zwingende kausale Zurechnungen verbänden. Dies mußte Weber besonders empören, hatte er doch sein Vorgehen aus seiner Sicht penibel beschrieben und zudem kurz davor im Anschluß an den „ausgezeichneten Physiologen v. Kries“ und an die Strafrechtstheorie unter dem Titel „Objektive Möglichkeit und adäquate Verursachung in der historischen Kausalbetrachtung“ seine Lösung des Zurechnungsproblems in der Geschichtswissenschaft entwickelt. Besonders Fischer, Replik, unten, S. 496.
10
Es gehe nicht darum, alle anderen Deutungsmöglichkeiten, wie von Fischer gefordert, auszuschließen, sondern für eine plausibilisierte Deutungsmöglichkeit aus den unendlich vielen Ursachen, die ein zu erklärendes Objekt bewirkt haben, diejenigen zu identifizieren, ohne die diese Wirkung nicht eingetreten wäre. Dies geschehe, auf dem Hintergrund unseres nomologischen und ontologischen Wissens, mittels einer kontrafaktischen Konstruktion („was wäre gewesen, wenn …“). Habe man auf diesem Wege eine adäquaten Verursachung für ein ,historisches Individuum‘ gefunden, so suche man nach weiteren Verursachungen, um den kausalen Regreß zu vertiefen und den Zurechnungshorizont Schritt für Schritt zu erwei[75]tern. So sei er in seiner Untersuchung vorgegangen, und weitere solche Schritte habe er ausdrücklich vorgesehen. Weber, Max, Kritische Studien auf dem Gebiet der kulturwissenschaftlichen Logik, in: AfSSp, 22. Band, Heft 1, 1906, S. 143–207 (MWG I/7), bes. II. Teil: „Objektive Möglichkeit und adäquate Verursachung in der historischen Kausalbetrachtung“, S. 185 ff., Zitat: S. 188.
11
[75]Weber, Bemerkungen, unten, S. 504–507.
Weber stellt noch einmal klar, was er als seine Hauptthese bezeichnet: daß die verschiedenen Richtungen des asketischen Protestantismus mit ihrer Lehre und Praxis die Lebensführung ihrer Anhänger beeinflußt haben, und, daß dieser Einfluß unabhängig von variierenden politischen, ökonomischen, geographischen und ethnischen Bedingungen, vor allem aber unabhängig „von dem Maß der Entwicklung des Kapitalismus als Wirtschaftssystem“, in die gleiche Richtung ging.
12
All dies habe mit ,idealistischer Geschichtsschreibung‘ nichts zu schaffen. Weber prognostiziert, „daß, wenn meine Untersuchungen einmal zu Ende kommen sollten, ich zur Abwechslung ganz ebenso entrüstet der Kapitulation vor dem historischen Materialismus geziehen werde wie jetzt der Ideologie.“ Ebd., unten, S. 503. Weber nennt als Gebiete, auf denen sich diese gleiche Wirkungsrichtung im 17. Jahrhundert nachweisen lasse, Neu-England, die deutsche Diaspora, Südfrankreich, Holland, England, Irland, Friesland und „zahlreiche andere deutsche Gebiete“.
13
Ebd., unten, S. 509 f., Fn. 5.
Weber hatte den kleinen Strauß mit Fischer auf heimischem Territorium ausgefochten: Kritiken und Antikritiken erschienen im Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik. Bei der Auseinandersetzung mit Felix Rachfahl war es anders. Dieser wählte die von Paul Hinneberg herausgegebene Internationale Wochenschrift für Wissenschaft, Kunst und Technik für seinen Angriff. Rachfahl beschränkte sich auch nicht auf eine Rezension, sondern schrieb einen Gegenentwurf von nahezu derselben Länge, wie Webers zweiter Aufsatz war. Schon dies schafft eine ungewöhnliche Ausgangslage.
Rachfahl benutzt das Calvin-Jahr für seinen Angriff und beschränkt sich nicht auf die Auseinandersetzung mit Weber, sondern bezieht auch Forscher mit ein, die aus seiner Sicht ähnliche Auffassungen vertraten, insbesondere Ernst Troeltsch.
14
Vom Troeltsch-Weberschen Schema, Neben Ernst Troeltsch rechnet Rachfahl auch Eberhard Gothein und Hans von Schubert zu dieser (Heidelberger) Richtung. Dazu Rachfahl, Felix, Kalvinismus und Kapitalismus, in: Internationale Wochenschrift für Wissenschaft, Kunst und Technik, hg. von Paul Hinneberg, 3. Jg., Nr. 39 vom 25. Sept. 1909, Sp. 1217–1238, dass. (Fortsetzung), Nr. 40 vom 2. Okt. 1909, Sp. 1249–1268; dass. (Fortsetzung), Nr. 41 vom 9. Okt. 1909, Sp. 1287–1300; dass. (Fortsetzung), Nr. 42 vom 16. Okt. 1909, Sp. 1319– 1334; dass. (Schluß), Nr. 43 vom 23. Okt. 1909, Sp. 1347–1367; abgedruckt, unten, S. 521–572 (hinfort: Rachfahl, Kalvinismus), hier unten, S. 522 f. Siehe auch unten, S. 80 f., Fn. 40.
15
dann von der Troeltsch-Weberschen These ist die Rede, die es zu überwinden gelte. Rachfahl, Kalvinismus, unten, S. 556.
16
Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, ob die religiösen Faktoren, insbesondere [76]die religiösen Lehren, tatsächlich den Einfluß auf die reale Entwicklung hatten, der ihnen von Troeltsch und Weber angeblich zugeschrieben wird. Die Kritik lautet, daß diese Wirkung von beiden maßlos überschätzt werde, weil sie nicht in Rechnung stellten, „wie wenig sich die politische, wirtschaftliche und weltliche Entwicklung überhaupt durch religiöse Lehren binden läßt, wenn diese das rein religiöse Gebiet überschreiten.“ Ebd., unten, S. 557.
17
Es ist also auch das methodische Problem der Gewichtung von Kausalfaktoren mit im Spiel. [76]Ebd., unten, S. 557.
Rachfahl bestreitet dabei nicht, daß historisch zwischen Calvinismus und Kapitalismus innere Beziehungen bestanden haben. Es gelte aber, „quellenmäßig den Nachweis ihrer Existenz zu führen, sowie ihre besondere Art und ihren Umfang zu ermitteln“.
18
Dies sei aber weder bei Troeltsch noch bei Weber zureichend geschehen. Rachfahl macht dabei den einen für den anderen haftbar. Ingesamt seien die Nachweise, die beide für den Einfluß des Calvinismus auf die kapitalistische Entwicklung beibrächten, nicht nur „spärlich und unzulänglich“, sondern auch oft „zweideutig, unbestimmt und widerspruchsvoll.“ Ebd., unten, S. 543.
19
Rachfahl sucht dies an den Beispielen Frankreich, Holland, England und den USA zu zeigen. Letztlich führe das genaue Studium der jeweiligen historischen Situation zumindest für Holland und England zu dem Schluß, „daß das Auftreten des Kapitalismus älter ist als die ,asketischen Richtungen‘ der Reformation“. Ebd., unten, S. 544.
20
Außerdem sei auch der kapitalistische Geist, richtig verstanden, älter als die asketischen Richtungen des Protestantismus. Ebd., unten, S. 551.
21
Alles laufe, insbesondere bei Weber, auf eine ungeheuerliche „Einseitigkeit und Übertreibung“ hinaus. Ebd., unten, S. 553.
22
Ebd., unten, S. 555.
Rachfahl macht dafür auch methodische Gründe namhaft. Es sei die idealtypische Begriffsbildung, die eine solch verzerrte Wahrnehmung der historischen Wirklichkeit begünstige. Denn durch diese Art der Begriffsbildung würden „alle anderen wirklich vorhandenen Momente zugunsten eines einzigen eliminiert“, das man dann zum konstitutiven Faktor erkläre. Weber habe auf diese Weise ein einziges Motiv „künstlich und sinnwidrig isoliert“ und es für die ganze historische Wirklichkeit genommen. Sehe man aber auf den Unternehmer neuen Stils – eine Anspielung auf Sombart – „wie er wirklich ist, nicht durch die Brille des ,idealtypischen Begriffs‘ Webers, so wird man, was seine Stellung zu den Kulturgütern anbelangt, mehr Ähnlichkeit zwischen ihm und dem ,Frühkapitalisten‘ im Zeitalter und unter dem Einflusse der Renais[77]sance entdecken, als mit dem Kapitalisten, der unter der Herrschaft ,reformierter Askese‘ steht.“
23
[77]Ebd., unten, S. 554.
Rachfahls Gegenentwurf besteht denn auch hauptsächlich darin, die idealtypische Begriffsbildung zu verwerfen und den nichtreligiösen Faktoren ein größeres Gewicht für die Erklärung der Entstehung des Kapitalismus zuzumessen. Die religiösen Faktoren hätten allenfalls eine fördernde, eine bloß verstärkende Wirkung auf eine bereits stattfindende Entwicklung ausgeübt. Strenggenommen ist dies das Argument von Sombart. Er hatte behauptet, die religiösen Faktoren seien nicht ursächlich, sondern sie verstärkten nur eine schon vorhandene Entwicklung – eine Auffassung, die Weber mit seinen Studien gerade korrigieren will.
Freilich geht Rachfahl noch einen Schritt weiter. So wichtig die Berufsethik der Reformierten auch sei, noch wichtiger sei das Prinzip religiöse Toleranz. Es spiele hauptsächlich in Holland eine Rolle, schon abgeschwächter in England. Der Beachtung dieses Prinzips sei es letztlich zuzurechnen, daß diese beiden Länder vom 16. bis zum 18. Jahrhundert zu den Hauptträgern des Kapitalismus unter den protestantischen Völkern geworden seien.
24
Besonders an Holland könne man dies studieren. Aber selbst die Republik der Vereinigten Niederlande sei von einem rein calvinistischen Gemeinwesen immer noch weit entfernt gewesen. Denn hier habe Calvin mit Erasmus im Streit gelegen, und selbst die Dordrechter Synode habe „keinen wirklichen, geschweige denn einen dauernden Sieg“ des Calvinismus gebracht. Ebd., unten, S. 560.
25
Ebd.
Weber reagierte auf diese fundamentale Kritik an seinem Ansatz nicht in der Internationalen Wochenschrift, sondern im Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik. Denn die Redaktion der Wochenschrift hatte eine Antwort auf Rachfahls Kritik nicht von ihm, sondern nur von Ernst Troeltsch erfragt. Weber ärgerte sich natürlich darüber, auch, daß er als Teil eines Kollektivs Troeltsch-Weber behandelt wurde. Bei seinem starken Autonomiebedürfnis und gesteigerten Ehrgefühl mußte ihn beides verletzen. Er läßt denn auch alle kollegialen Rücksichten fallen und setzt zu einer scharfen Gegenpolemik an.
Weber konstatiert: Schon die Überschrift von Rachfahls Polemik zeige die Schiefheiten, mit denen er arbeite. Mit der Formulierung ,Kalvinismus und Kapitalismus‘ nehme er einerseits eine „willkürliche Beschränkung des Themas“ vor.
26
Er, Weber, habe nicht nur über Calvinismus, sondern über den asketischen Protestantismus mit seinen vielen Verzweigungen gesprochen. Andererseits liegt für ihn aber auch eine willkürliche Erweiterung des Themas vor. Denn Rachfahl tue so, als habe er neben der seelischen Seite der modernen Wirtschaftsentwicklung auch die institutionelle aus religiösen Zusammen[78]hängen erklären wollen, nicht nur einen konstitutiven Bestandteil des kapitalistischen Geistes, die Idee der Berufspflicht, sondern auch das kapitalistische Wirtschaftssystem. Dabei habe er doch ausdrücklich betont, „daß es sowohl ,kapitalistischen Geist‘ ohne kapitalistische Wirtschaft (Franklin) wie auch das Umgekehrte gegeben“ habe. Weber, Antikritisches zum „Geist“ des Kapitalismus, unten, S. 584.
27
Im Übrigen habe er anhand der verschiedenen Strömungen des asketischen Protestantismus nur versucht, die „spezifischen Wirkungen eines bestimmten Motivs“ darzustellen, durch welches Beruf, Leben und Ethik zu einem eigentümlichen Ausgleich gebracht worden seien, einem Ausgleich, der in dieser Art weder in der Antike noch im Mittelalter bestanden habe und auch heute fehle, wo wir erneut in Spannungen lebten, „die – weit über den Kreis der von mir herausgegriffenen Sphäre hinaus – sich zu Kulturproblemen ersten Ranges auswachsen, wie sie, in dieser Art, nur unsere ,bürgerliche‘ Welt kennt.“ [78]Ebd., unten, S. 602.
28
Weber wiederholt dabei nur bereits Gesagtes, will sich mit Rachfahl auch nicht weiter auseinandersetzen, weil dieser keinen eigenen Standpunkt habe, und er schließt mit der Feststellung: „Die Entwicklung des ,Berufsmenschentums‘ in seiner Bedeutung als Komponente des kapitalistischen ,Geistes‘, – auf dies Thema haben sich meine Auseinandersetzungen zunächst ausdrücklich und absichtsvoll beschränkt. Ich kann absolut nichts dafür, wenn liederliche Leser dies zu ignorieren für gut befinden.“ Ebd., unten, S. 605 f.
29
Liederliche Leser, das trifft freilich nicht nur auf Rachfahl zu. Ebd., unten, S. 617 f.
Es war nicht zu erwarten, daß es bei diesem Schlagabtausch bliebe. Denn auch Troeltsch hatte geantwortet,
30
und Rachfahl schwang sich zu einer Kritik der Antikritik von abermals beachtlicher Länge auf. Er suchte zwar seine Behauptung von der Troeltsch-Weber-These, jetzt Weber-Troeltsch-Hypothese genannt, Troeltsch, Ernst, Die Kulturbedeutung des Calvinismus, in: Internationale Wochenschrift für Wissenschaft, Kunst und Technik, hg. von Paul Hinneberg, 4. Jg. – Berlin: August Scherl, Nr. 15 vom 9. April 1910, Sp. 449–468; Nr. 16 vom 16. April 1910, Sp. 501–508 (hinfort: Troeltsch, Kulturbedeutung des Calvinismus); dass. auch in: Troeltsch-KGA 8, S. 143–181, dazu auch die Einleitung von Trutz Rendtorff, ebd., S. 31 ff.
31
zu verteidigen, indem er die wechselseitige Abhängigkeit der beiden Autoren erneut darzulegen suchte. Aber er trennte dann die Auseinandersetzung mit Troeltsch von der mit Weber. Letztere nimmt wiederum den größten Raum der in drei Teile gegliederten Abhandlung ein. Rachfahl, Felix, Nochmals Kalvinismus und Kapitalismus, in: Internationale Wochenschrift für Wissenschaft, Kunst und Technik, hg. von Paul Hinneberg, 4. Jg., 1910, Nr. 22 vom 28. Mai, Sp. 689–702; dass. (Fortsetzung), Nr. 23 vom 4. Juni, Sp. 717–734; dass. (Fortsetzung), Nr. 24 vom 11. Juni, Sp. 755–768; dass. (Schluß), Nr. 25 vom 18. Juni, Sp. 775–796; abgedruckt unten, S. 625–664 (hinfort: Rachfahl, Nochmals Kalvinismus), hier unten, S. 627.
32
Ebd., unten, S. 637–664.
[79]Nachdem er die ,Kollektivarbeit‘ qualifiziert
33
und die „Abrechnung“ mit Troeltsch für vollzogen erklärt hat, [79]Rachfahl bestreitet, überhaupt von Kollektivarbeit gesprochen zu haben: „Ich habe diesen Ausdruck nie gebraucht, und noch viel weniger ist es mir eingefallen, eine ,Kollektivarbeit‘ der beiden Autoren in irgendeinem anderen Punkt als eben in der sogenannten ,Weber-Troeltschschen Hypothese‘ zu behaupten.“ Ebd., unten, S. 627.
34
behandelt Rachfahl noch einmal drei Punkte zu Weber. Schließlich sagt er noch, wie dieser hätte vorgehen müssen, um zu einem brauchbaren wissenschaftlichen Ergebnis zu kommen. Ebd., unten, S. 637.
Die drei Punkte sind schnell abgehandelt. 1. Nach Rachfahl ist die protestantische Askese historisch eine Fehldeutung, denn der Protestantismus habe die mittelalterliche Askese nicht fortgebildet, sondern als Sondermoral verworfen. 2. Toleranz sei für die kapitalistische Entwicklung wichtiger als Berufsethik, wenngleich auch sie nur als fördernder, verstärkender Faktor infrage komme. 3. Webers Definition des kapitalistischen Geistes sei so eng, daß es bei ihm „unendlich viel Kapitalismus gibt, der ohne kapitalistischen Geist entstanden sein müßte, und daß sein ,kapitalistischer Geist‘ eben nicht imstande ist, die Kapitalsbildung und das kapitalistische Wirtschaftssystem der Neuzeit auch nur annähernd zu erklären, daß er ihm weiterhin einen viel zu großen Einfluß auf diesem Gebiete zugeschrieben hat.“
35
Und noch einmal zusammengefaßt zur Weber-Troeltsch- oder Troeltsch-Weber-These: Beide hätten „die Bedeutung des Kalvinismus, sowohl des genuinen als auch des puritanischen, für die Entwicklung des ,Geschäftslebens‘“ einfach übertrieben, und man müsse einsehen, „daß vielmehr als Träger des kapitalistischen Geistes und der Kapitalbildung libertinistische, rationalistische, indifferente und aufklärerische Elemente in viel größerem Umfange in Betracht kommen, als man nach diesen beiden Autoren annehmen sollte.“ Ebd., unten, S. 651.
36
Ebd., unten, S. 644.
Überhaupt hätte Weber aus Rachfahls Sicht anders vorgehen müssen. Zunächst hätte dies eine klare Formulierung seiner These (Aufgabe) verlangt. Diese hätte folgendermaßen aussehen können (müssen): „es hat sich unter dem Einfluß reformierter Berufsethik eine bestimmte Abart kapitalistischen Geistes im Lauf der Neuzeit entwickelt; ich will ihren Ursprung, die Grenzen ihrer Expansion feststellen, sowie der Frage der qualitativen Prägung nachgehen, d. h. zu ermitteln trachten, ob der kapitalistische Geist, der das kapitalistische Wirtschaftssystem der Gegenwart geschaffen hat (sic), aus dieser Quelle bestimmte Züge empfangen hat, die für sein Wesen von ,konstitutiver‘ Bedeutung geworden sind.“
37
Weber, Antikritisches Schlußwort, unten, S. 654.
Man sieht an dieser Formulierung, wie wenig Rachfahl tatsächlich Webers Ansatz begriffen hatte. Auch wies Weber ja bereits am Ende des zweiten [80]Aufsatzes zur „Protestantischen Ethik“ ausdrücklich darauf hin, man müsse auch die Herkunft der „anderen plastischen Elemente der modernen Kultur“ untersuchen, wolle man das Maß der Kulturbedeutung abschätzen, das dem asketischen Protestantismus zukomme.
38
Kandidaten für eine solche Erweiterung des Zurechnungshorizonts unter einem ,spiritualistischen‘ Gesichtspunkt sah er im humanistischen Rationalismus, im philosophischen und wissenschaftlichen Empirismus und im Utilitarismus, der die religiös fundierte innerweltliche Askese auflöse und durch eine säkulare Begründung ersetze. Rachfahl rennt also offene Türen ein, wenn er die Berücksichtigung nichtreligiöser Momente für die Erklärung eines Teils der modernen Kultur reklamiert. Weber erwähnt darüber hinaus die Rolle der variierenden sozialen Gemeinschaften und die andere Seite der Kausalbeziehung. Denn es sei für ein einigermaßen vollständiges Bild wichtig, die Art zu untersuchen, „wie die protestantische Askese ihrerseits durch die Gesamtheit der gesellschaftlichen Kulturbedingungen, insbesondere der ökonomischen, in ihrem Werden und ihrer Eigenart beeinflußt“ wurde. [80]Weber, Protestantische Ethik II, unten, S. 424 f.
39
Angesichts dieses eindeutigen Sachverhalts nimmt es nicht Wunder, wenn Weber sich verärgert darüber zeigt, daß sein Kontrahent einfach nicht sehen wolle, wie er seine Aufgabe absichtsvoll begrenzt habe. Und dies nicht ex post, sondern vom Beginn an. Ebd., unten, S. 424.
40
Auch dies ist ihm freilich [81]nicht nur im Falle Rachfahl widerfahren. Ein Großteil der sogenannten Kontroversliteratur zur sogenannten Weber-These basiert darauf. Rachfahl betont am Ende seiner zweiten Kritik noch einmal, es sei eben kein Zufall, daß das, was Weber (er unterstellt: erst jetzt) als eine Teilerscheinung bezeichne, von den meisten seiner Leser für das Ganze genommen werde, selbst von seinen Freunden und Anhängern. Als ,Beweis‘ nennt er Eberhard Gothein, Ernst Troeltsch und Hans von Schubert. Dabei kümmert es ihn wenig, daß Gotheins Arbeit vor der von Weber erschienen war und daß von Schubert in seinem Festvortrag aus Anlaß der Calvin-Gedächtnisfeier der Theologischen Fakultät der Universität Heidelberg am 11. Juli 1909 Weber nur in einem Satz am Ende seiner Rede erwähnte. Aus Webers Insistieren darauf, daß er seinen Erkenntnisanspruch von Beginn an eingeschränkt habe, konstruiert Rachfahl gar eine Desavouierung seiner Freunde und Anhänger. Siehe Rachfahl, Nochmals Kalvinismus, unten, S. 660 f. Mit den drei Namen hatte er bereits in seiner ersten Kritik operiert. Siehe Rachfahl, Kalvinismus, unten, S. 522 f., sowie dazu oben, S. 75, Anm. 14. – Ähnlich verfährt Rachfahl auch mit der Arbeit von Gerhart von Schulze-Gaevernitz, um seine Behauptung, Weber habe nicht nur eine Teilerscheinung untersucht, sondern das Ganze behandelt, zu belegen. Schulze-Gaevernitz veröffentlichte 1906 eine große Studie über Englands Aufstieg zur Weltmacht. Darin sucht er auch die vom Puritanismus geprägte mentale Seite der englischen Entwicklung seit dem 17. Jahrhundert nachzuzeichnen. In diesem Zusammenhang bezeichnet er die Webersche Aufsatzfolge als vorbildlich. Weber habe die Bedeutung des „Evangeliums der Berufsarbeit“ entschlüsselt. Es genüge, „auf diese ausgezeichnete Arbeit hier zu verweisen, aus der auf das deutlichste hervorgeht, wie die ,innerweltliche Askese‘ des Puritanismus es war, welche Arbeitgeber und Arbeiter für das Industriezeitalter heranbildete.“ Schulze-Gaevernitz gilt Webers Aufsatzfolge als ein „bewunderungswürdiges Zeugnis deutscher Gelehrsamkeit“. Siehe Schulze-Gaevernitz, Gerhart von, Britischer Imperialismus und englischer Freihandel zu Be[81]ginn des zwanzigsten Jahrhunderts. – Leipzig: Duncker & Humblot 1906, S. 46 bzw. S. 412 (hinfort: Schulze-Gaevernitz, Britischer Imperialismus). Rachfahl, Kalvinismus, behauptet nun, die Darstellung von Schulze-Gaevernitz sei „ganz beherrscht von der Weberschen These“ (unten, S. 549, Fn. 25), woran man abermals erkennen könne, wie umfassend diese These gemeint sei, wenn man sie so, wie im Fall von Schulze-Gaevernitz geschehen, rezipieren könne, eine Argumentation, die Weber schon allein deshalb erbost haben muß, weil er seinen eigenen Ansatz mit dem von Schulze-Gaevernitz keineswegs identifiziert sehen wollte. So heißt es in einem Brief an seinen Bruder Alfred vom 30. Januar 1907: „Was den Schulze-Gävernitz’schen ,Imperialismus‘ anlangt, so bin ich insoweit natürlich Deiner Ansicht, als diese Übertreibungen von Ansichten, die ich auch vertrete, in der That notwendig diesen Ansichten selbst schaden müssen, so glänzend das Buch ist.“ MWG II/5, S. 236. Rachfahl betreibt also, im Sinne von Arthur Schopenhauer, eine rabulistische Strategie der Erweiterung: „Die Behauptung des Gegners wird über die natürliche Grenze hinausgeführt, also in einem weiteren Sinne genommen, als er beabsichtigt oder sogar auch ausgedrückt hat, um sie sodann in solchem Sinne bequem zu widerlegen.“ Dazu Schopenhauer, Arthur, Parerga und Paralipomena. Kleine philosophische Schriften II. – Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1976, S. 39.
Webers „Antikritisches Schlußwort“, mit dem er die Debatte mit Rachfahl beendet, bringt denn auch nichts entscheidend Neues.
41
Rachfahls Toleranzthese, den einzigen inhaltlichen Gedanken, wie Weber sagt, den dieser zu der Debatte beizusteuern hatte, weist er zurück. Anders urteilt Wilhelm Hennis. Weber habe erst hier seine mit den beiden Aufsätzen verbundene wahre Absicht preisgegeben. Deshalb sei Rachfahl dafür zu danken, „daß er durch sein unverdrossenes Insistieren Weber zur präziseren Offenlegung seiner wissenschaftlichen Absichten zwang“. Siehe Hennis, Wilhelm, Max Webers Fragestellung. Studien zur Biographie des Werks. – Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) 1987, S. 17. Zuvor habe Weber ein Versteckspiel getrieben, indem er seine „,zentralen‘ Absichten“ verwischte. Erst im Herbst 1910 habe er sie „in voller Unschuld“ dargetan. Dies aber hätte er, so Hennis, doch – „,gefälligst‘ möchte man in seinem Tone sagen – schon im November 1904 eingangs seines ersten Aufsatzes sagen können, statt sich über die badische Berufs-, Konfessions- und Steuerstatistik an das Thema heranzuschlängeln. Es grenzt an Unverfrorenheit, wenn er jetzt, sechs Jahre später, zum ersten Mal damit herausrückt, ,das‘, nämlich, daß ihn ,zentral‘ ,die Entwicklung des Menschentums‘ interessiert habe“ (S. 22) – und nicht der kapitalistische Geist. Daß es die Entwicklung des Menschentums war, wird man freilich auch im Antikritischen Schlußwort schwerlich finden. Denn Weber spricht nicht vom Menschentum allgemein, sondern vom Berufsmenschentum. Hennis hält übrigens die beiden Aufsätze unter didaktischen Gesichtspunkten für gründlich mißlungen. Sie seien „für einen Durchschnittsansprüche stellenden Leser, der sich eine einführende Problemskizze, umrißartige Kennzeichnung des Untersuchungsgegenstandes, Hinweise auf die Art des Vorgehen wünscht, eine Katastrophe“. Ebd., S. 16.
42
Denn ob toleriert, selbst tolerant oder intolerant, ob herrschend oder unterdrückt, in all diesen Konstellationen habe der asketische Protestantismus seine spezifischen Wirkungen [82]entfaltet. Insofern sei die Existenz von Toleranz oder Intoleranz für die Erklärung des ,historischen Individuum‘, das Weber interessierte, um in seiner Terminologie zu sprechen, keine ,adäquate Verursachung‘. Weber, Antikritisches zum „Geist“ des Kapitalismus, unten, S. 585; ders., Antikritisches Schlußwort, unten, S. 684–692.
43
[82]Weber hatte sich übrigens zur Rolle des Toleranzprinzips bereits im zweiten Aufsatz geäußert. Siehe Weber, Protestantische Ethik II, unten, S. 311–314, Fn. 78.
Man kann den zweiten Teil des „Antikritischen Schlußworts“ als eine griffige Zusammenfassung der Aufsatzfolge lesen, obgleich Weber es insgesamt als Dokument einer „Keilerei“ bezeichnet.
44
Durch Rachfahl herausgefordert, erläutert Weber noch einmal sein Vorgehen Brief Max Webers an Karl Vossler vom 11. und 14. Dezember 1910, MWG II/6, S. 740: „Ich bin sehr beschämt, Ihnen nichts Werthvolles als Äquivalent schicken zu können. Die gleichzeitig geschickte Rachfahl-Keilerei ist sehr unerfreulich.“ Vossler hatte Weber unter anderem sein Buch über Dante geschickt, das dieser im Detail bespricht und mit dem Urteil versieht, er, Weber, habe „noch nie etwas über Dante gelesen, was auch nur von ferne an den Reichtum, die Präzision und Sauberkeit des Auffassens und der sprachlich-stilistischen und gedanklichen Gestaltung, die congeniale Erfassung des Kerns der dichterischen Schöpfung und ihre Vermittlung an den Leser heranreichte, wie ich sie bei Ihnen finde.“ (ebd.).
45
und fügt den alten Überlegungen zwei neue ergänzend hinzu. Die eine hängt mit den Erfahrungen der USA-Reise zusammen und betrifft die begriffliche Unterscheidung zwischen Kirche und Sekte für die Abschätzung der Wirkung religiöser Institutionen. Weber, Antikritisches Schlußwort, unten, S. 710 f., wobei die Punkte 1–5 die Problemstellung, die darauf folgenden Punkte 1–2 die Problemlösung betreffen.
46
Die andere betrifft die Tatsache, daß Weber inzwischen auch von antikem Kapitalismus spricht. Diese Einsicht hatte er bei seiner Arbeit über die Agrarverhältnisse im Altertum gewonnen. Ebd., unten, S. 715 ff.
47
Kapitalismus ist also nicht mehr nur ein vorwiegend neuzeitliches, er ist ein universalgeschichtliches Phänomen. Dazu Weber, Agrarverhältnisse3, MWG I/6, bes. S. 713 ff. Weber trug diese These von der Existenz eines antiken Kapitalismus zuerst im Eranos-Kreis vor. Es war dort sein zweiter Vortrag. Zu Weber, Kapitalismus im Altertum, auch oben, S. 40 mit Anm. 58.
48
Umso wichtiger ist es, das Spezifische des modernen Kapitalismus nach ,Geist‘ und ,Form‘ herauszuarbeiten, um ihn von anderen Kapitalismen zu unterscheiden. Deshalb rückt neben der alten Frage nach den Modifikationen in der Wirkung des asketischen Protestantismus in seinen verschiedenen Verbreitungsgebieten die nach den Arten des Kapitalismus (Altertum, Mittelalter, Neuzeit) jetzt stärker als zuvor in den Blick. Schluchter, Entzauberung, Kap. IV, und ders., Einleitung zu MWG III/6, Abschnitt 2.
49
Dazu etwa Weber, Antikritisches Schlußwort, unten, S. 737–739.
Weber modifiziert denn auch das Programm für die Fortführung der Aufsatzfolge, die ja, wie von ihm immer wieder betont, schließlich in ein Buch münden sollte. Er spricht von den „wirklich dringendsten Fragen“, die er beantworten müsse. Es seien drei: 1. die „sehr viel tiefer ins einzelne zu verfolgende Differenzierung der Wirkungen calvinistischer, täuferischer, pietis[83]tischer Ethik auf den Lebensstil“; 2. eine eingehende Untersuchung „der Ansätze ähnlicher Entwicklungen im Mittelalter und im antiken Christentum, soweit die Arbeiten von Troeltsch hier noch Raum lassen“; 3. die Betrachtung der anderen Seite der Kausalbeziehung, der ökonomischen, insbesondere unter dem Gesichtspunkt, wie das Bürgertum oder Teile desselben eine Affinität zu dem asketischen Lebensstil entwickelten.
50
[83]Ebd., unten, S. 735.
8. Ausblick: Über den asketischen Protestantismus hinaus?
Weber verwirklichte weder das erste noch das zweite Fortsetzungsprogramm in den folgenden Jahren. Auch der separaten Veröffentlichung des bereits Geschriebenen verweigerte er sich. Wie weit er mit der Arbeit am ersten Fortsetzungsprogramm vor 1910 vorangekommen war, das ja mit dem Punkt 1 des zweiten Fortsetzungsprogramms weitgehend übereinstimmt, läßt sich nicht mit Bestimmtheit sagen. Am 27. Juli 1908 schreibt er an Paul Siebeck, die Arbeit am „Capitalismus“ sei „schon ziemlich gefördert“.
51
Aber da steckt er noch mitten in der Arbeit an seiner „Psychophysik“. Zudem scheint sich sein Forschungsinteresse auf dem Gebiet der Religion vom asketischen Protestantismus auf andere Erscheinungen des Christentums zu verlagern. Wann genau dies geschieht, ist ebenfalls ungewiß. Brief Max Webers an Paul Siebeck vom 27. Juli 1908, MWG II/5, S. 609.
Bereits im zweiten Fortsetzungsprogramm ist eine historische Erweiterung in dieser Hinsicht zu erkennen. Für das Problem der Lebensführung ist vom Rückgang auf das Urchristentum und auf die Zeit bis zur Reformation die Rede. Dabei kommt neben dem lateinischen auch das orthodoxe Christentum in den Blick. Dies ist sicherlich Folge von Webers Beschäftigung mit der bürgerlichen Revolution in Rußland. Wichtige institutionelle Erfindungen, die den Kapitalismus förderten, hatte Weber schon immer auch in der vorreformatorischen Zeit gesehen. Das Erkenntnisinteresse richtet sich also inzwischen auf einen weiteren Zeithorizont. Dies wird auch aus einem Diskussionsbeitrag Webers auf dem Deutschen Soziologentag 1910 deutlich. Hier hält Ernst Troeltsch einen Vortrag über das stoisch-christliche und das moderne, profane Naturrecht.
52
Ferdinand Tönnies kommentiert diesen Vortrag mit einer langen Einlassung, und Max Weber erwiderte darauf. Er verteidigte dabei indirekt den Heidelberger Kollegen. Hier wird noch einmal die alte Fachmenschenfreundschaft lebendig, die wenige Jahre später zerbricht. Troeltsch, Ernst, Das stoisch-christliche und das moderne profane Naturrecht, in: Verhandlungen des Ersten Deutschen Soziologentages vom 19.–22. Oktober in Frankfurt a.Μ. – Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) 1911, S. 166–192. (hinfort: Troeltsch, Stoisch-christliches Naturrecht).
53
Bezeichnend Webers Urteil über Troeltschs Vortrag gegenüber Franz Eulenburg, [84]der an der Tagung nicht teilnahm: „Troeltsch: Vortrag ausgezeichnet, vor allem: gänzlich wertfrei – Debatte die beste des Tages.“ Brief Max Webers an Franz Eulenburg vom 27. Oktober 1910, MWG II/6, S. 655.
[84]Troeltsch unterstreicht im Kreis der Soziologen die Eigenlogik religiöser Ideen. Er spricht vom christlichen Idealgesetz, das in einem spannungsreichen Verhältnis zu nichtchristlichen Idealen und zu den Natur- und Sozialgesetzen stehe. Dieses christliche Idealgesetz werde von den sich wandelnden Weltzuständen beeinflußt, gestalte sich aber selber. Troeltsch nennt dies die „soziologische Selbstgestaltung der christlichen Idee.“
54
Das Idealgesetz des Urchristentums verbinde Individualismus mit Sozialismus, den Wert jeder Einzelseele mit dem Wert der in Liebe verbundenen Gemeinschaft aller. Dieses Idealgesetz treibe im Laufe der Entwicklung drei Sozialtypen hervor. Es sind die Typen Kirche, Sekte und Mystik (oder Enthusiasmus). Sie seien im Urchristentum noch nicht ausdifferenziert und gegeneinander profiliert. Diese drei Typen gestalteten das Gott-Mensch-Verhältnis und die „Auseinandersetzung mit den natürlichen Notwendigkeiten und den außerchristlichen Idealen des sozialen Lebens verschieden.“ Troeltsch, Stoisch-christliches Naturrecht, S. 170.
55
Die erste und wichtigste Gestaltung sei die der Kirche, die das absolute christliche Naturrecht mit dem relativen Naturrecht der Stoa zum stoisch-christlichen Naturrecht verbinde, um ihr Verhältnis zur Welt zu regulieren. Auch der Altprotestantismus mit den beiden Konfessionen Luthertum und Calvinismus und selbst die Sekten folgten zunächst dem dadurch vorgezeichneten Weg. Allerdings hätten sie das mittelalterliche Erbe in unterschiedlicher Weise weiterentwickelt. Nur der dritte Typus, die Mystik, habe mit dem stoisch-christlichen Naturrecht so gut wie nichts tun. Im 18. Jahrhundert löse sich das Naturrecht allmählich aus religiöser Bindung. Aber auch im modernen, profanen Naturrecht wirkten religiöse Einschläge fort. Ebd., S. 174.
Im Anschluß an den Vortrag von Troeltsch eröffnete Ferdinand Tönnies die Debatte mit einem langen Beitrag. Als Hobbes-Experte fühlte er sich insbesondere von Troeltschs Behandlung des profanen Naturrechts herausgefordert. Aber er berührte auch methodische und soziologische Fragen. Tönnies bestritt die von Troeltsch behauptete Eigenlogik von Ideen. Sie seien doch viel eher Reflexe ökonomischer Verhältnisse. Insofern sei er Anhänger der materialistischen Geschichtsauffassung.
56
Außerdem seien Sekten überhaupt erst auf städtischem Boden entstanden. Beide Behauptungen riefen nun wiederum Max Weber auf den Plan. Ebd., S. 192.
Weber wiederholt seine bekannten methodischen Vorbehalte gegen eine rein ökonomische Geschichtsbetrachtung. Sie führe zu einer „allzu gradlinigen Konstruktion“ der Beziehung zwischen ökonomischen und religiösen [85]Sachverhalten, was auch an der Einlassung von Tönnies erkennbar sei.
57
Denn die Bemerkung zu den Sekten sei nicht richtig. Die erste Gemeinschaft, die das Sektenprinzip in Reinform verwirklicht habe, sei die der Donatisten. Und diese hätten keinen städtischen, sondern einen agrarischen Hintergrund. [85]Weber, Diskussionsbeiträge auf dem Ersten Deutschen Soziologentag am 21. Oktober 1910, unten, S. 747 f.
58
Religiöse Entwicklungen dürften also nicht als bloße Exponenten oder Reflexe ökonomischer Konstellationen behandelt werden. Dies könne man gerade am Verhältnis von Stadt, Land und religiöser Gemeinschaftsbildung, aber auch an der Art und Weise studieren, wie diese Gemeinschaften unter Umständen die jeweilige soziale Schichtung durchbrechen, indem sie Anhänger aus allen sozialen Schichten rekrutierten, wenngleich es im Laufe der Entwicklung dann auch häufig wieder zu schichtspezifischen Schließungen komme. Ebd., unten, S. 748.
Weber betont außerdem, die Typen Kirche, Sekte und Mystik, die Troeltsch in seinem Vortrag in den Mittelpunkt gestellt hatte, seien Konstruktionen. Er nimmt dies zum Anlaß, auf einen wichtigen Aspekt seiner eigenen Begriffsverwendung einzugehen. Was idealtypisch sauber getrennt werde, erscheine empirisch in der Regel in Mischungsverhältnissen. So sei der Calvinismus zwar Kirche, aber innerlich Sekte, die Orthodoxie zwar ebenfalls Kirche, aber innerlich Mystik. Nur im Katholizismus mit dem Papst als letzter Instanz und im Luthertum mit dem Wort der Bibel als letzter Instanz sei das Kirchenprinzip relativ rein verwirklicht. Die verschiedenen Strömungen des asketischen Protestantismus aber, so läßt sich folgern, realisieren in relativ reiner Form das Prinzip der Sekte. Es ist die Art religiöser Gemeinschaft, die dem Bewährungsgedanken institutionell am besten entspricht.
Weber wiederholt auch hier seine These, der Calvinismus und der „sektiererische Protestantismus“ hätten aufgrund des institutionalisierten und internalisierten Bewährungsgedankens das Berufsmenschentum gezüchtet, auf dem der moderne Kapitalismus aufruhe.
59
Aber nicht dies ist beachtlich, sondern die Tatsache, daß er, zweifellos angeregt von Ernst Troeltsch, nun das Urchristentum in seine Betrachtung mit einbezieht und aus dem Streben nach der certitudo salutis zunächst eine doppelte, eine psychische und eine soziale Folgerung zieht. Entweder gehe man den Weg der Mystik, fundiert in dem Liebesgedanken, mit der letzten Konsequenz der „amorphe[n] Formlosigkeit des Liebes-Akosmismus“, oder den Weg der Askese, fundiert in dem Bewährungsgedanken, mit der letzten Konsequenz des „ad majorem Dei gloriam“, der bedingungslosen Verwirklichung von Gottes Willen in dieser Welt und [86]ausschließlich zu dessen Ruhm. Ebd., unten, S. 759 f.
60
Die Folge sei bei dem einen letztlich persönliche Verbrüderung, im Sinne von Tönnies Gemeinschaft, bei dem anderen aber „,Zivilisation‘, Tausch, Markt, sachlicher Zweckverband“, im Sinne von Tönnies Gesellschaft, er sagt hier: Vergesellschaftung. [86]Dies präludiert die später ausgearbeitete Unterscheidung zwischen Mystik und Askese in ihrer jeweiligen außerweltlichen und innerweltlichen Ausprägung.
61
Weber hat diesen Gedanken später in die Unterscheidung zwischen ,Vergemeinschaftung‘ und ,Vergesellschaftung‘ überführt. Ebd., unten, S. 762 f.
Wir sehen also tatsächlich eine Ausweitung des Erkenntnisinteresses auf das Christentum als Ganzes.
62
Eine Ausweitung über das Christentum hinaus sehen wir allerdings noch nicht. Drei Jahre später wird Weber in einem Brief an Paul Siebeck schreiben, er habe „eine geschlossene soziologische Theorie und Darstellung ausgearbeitet, welche alle großen Gemeinschafsformen zur Wirtschaft in Beziehung setzt: von der Familie und Hausgemeinschaft zum ,Betrieb‘, zur Sippe, zur ethnischen Gemeinschaft, zur Religion (alle großen Religionen der Erde umfassend: Soziologie der Erlösungslehren und der religiösen Ethiken, – was Tröltsch gemacht hat, jetzt für alle Religionen, nur wesentlich knapper)“. In dieses Bild paßt auch die Bitte Max Webers an Paul Siebeck, er möge ihm ein Exemplar der Kirchengeschichte von Karl Müller zuschicken. Diese behandelt in 231 Paragraphen die Geschichte vom Urchristentum bis zur Reformation. Müller, Karl, Kirchengeschichte. Erster Band. – Freiburg i. B.: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) 1892, und ders., Kirchengeschichte. Zweiter Band. Erster Halbband. – Tübingen und Leipzig: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) 1902.
63
Zu diesem Zeitpunkt hatte Troeltsch seine seit 1908 im Archiv erschienenen Aufsätze über die Soziallehren der christlichen Kirchen in einem großen Buch zusammengeführt und veröffentlicht. Brief Max Webers an Paul Siebeck vom 30. Dezember 1913, MWG II/8, S. 449 f.
64
Webers umfassende Soziologie der Erlösungslehren und religiösen Ethiken, offensichtlich auch eine Reaktion darauf, entstand vermutlich 1912/13, jedenfalls einige Zeit nach dem „Antikritischen Schlußwort“. Damit veränderte er zwar den Kontext der Aufsatzfolge, nicht aber diese selbst. Sie blieb weiterhin unverändert liegen. Eine Überarbeitung erfolgte vermutlich erst 1919, und die geplante Fortsetzung verhinderte der Tod. Troeltsch, Ernst, Die Soziallehren der christlichen Kirchen und Gruppen. – Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) 1911.
65
Dazu ausführlich die Einleitung in Band I/18.
Mit dem „Antikritischen Schlußwort“ ist also der erste Akt des Stückes über die „Protestantische Ethik“ beendet. In den folgenden Jahren steht nicht diese, sondern die „Wirtschaftsethik der Weltreligionen“ im Mittelpunkt. Die Jahre 1911 bis 1913 bedeuten für die Entwicklung von Webers Werk zweifellos einen Einschnitt. Er ist genauso gravierend wie der nach seiner Erkrankung, der schließlich zum Rücktritt von der Professur führte. In die Zeit nach dem [87]„Antikritischen Schlußwort“ fällt eine Erkenntnis, ja geradezu eine Entdeckung, wie Marianne Weber berichtet.
66
Sie betrifft das Rationalitätspotential der Weltreligionen, insbesondere das der jüdisch-christlichen Tradition. Webers skeptische Beurteilung der aufschließenden Kraft des Rationalitätsbegriffs, den Sombart ja mit seiner These vom ökonomischen Rationalismus in die Debatte eingeführt hatte, weicht zwar nicht gänzlich, doch die Rationalismusdebatte gewinnt im Werk an Bedeutung. Im ersten Protestantismus-Aufsatz heißt es noch, teilweise gegen Sombart gerichtet, man dürfe den Protestantismus insgesamt nicht einfach als eine „,Vorfrucht‘ rein rationalistischer Lebensanschauungen“ betrachten. Zudem zeige die Geschichte des Rationalismus „keineswegs eine auf den einzelnen Lebensgebieten parallel fortschreitende Entwicklung“. [87]Weber, Marianne, Lebensbild, S. 349.
67
Und überhaupt sei der Rationalismus ein historischer Begriff, „der eine Welt von Gegensätzen in sich schließt“. Weber, Protestantische Ethik I, unten, S. 176.
68
Nun möchte Weber in diese Welt von Gegensätzen tiefer eindringen, und zwar auf allen Lebensgebieten oder Handlungsfeldern. Damit geht er aber zugleich über den Zusammenhang von Religion und Wirtschaft hinaus. Ebd., unten, S. 177.
Webers Entwicklung von 1903 bis 1910, in welche Zeit die erste Fassung der Protestantismusstudien fällt, zeigt nicht dieselbe Kohärenz, wie wir sie etwa von Ernst Troeltsch kennen. Sie verläuft eher mehrgleisig, weitgehend ohne inneren Zusammenhang. Zum einen werden Themen aus der Zeit vor der Erkrankung weiter vertieft, so etwa im Aufsatz über den Fideikommiß und in der großen Abhandlung über die antiken Agrarverhältnisse, wenn auch bereichert um neue Gedanken, wie den des antiken Kapitalismus; zum anderen werden neue Themen entwickelt, so etwa in den Protestantismusstudien und in den methodologischen Schriften, deren Höhepunkt die Auseinandersetzung mit Stammler ist. Dabei kann man die ersten Umrisse einer verstehenden Soziologie erkennen, die als Handlungs- und Strukturtheorie konzipiert ist. Daneben stehen, relativ isoliert, die als Chroniken bezeichneten Rußlandschriften, bei denen das politische Interesse im Vordergrund steht. Mit der „Psychophysik der industriellen Arbeit“ setzt Weber einen weiteren thematischen Schwerpunkt, die sich mit dem Übrigen kaum überschneidet. Diese Texte stehen zwar der Methodologie sowie der Handlungs- und Strukturtheorie nahe, setzen diese aber nicht einfach fort. Diese ,Zersplitterung‘ scheint erst nach 1910 zu weichen. Und dies führt zunächst nicht zur Protestantischen Ethik zurück, sondern von ihr weg.
Es folgt aber noch ein zweiter Akt in diesem Stück, und die Frage ist: Was ändert sich dabei? Dies wird uns beschäftigen, wenn es um die Überarbeitung der Abhandlungen von 1904, 1905 und 1906 für den Band I der Gesammelten Aufsätze zur Religionssoziologie aus dem Jahre 1920 geht. Der [88]Ort dafür ist der Band I/18 der Max Weber-Gesamtausgabe. Dann erst ergibt sich in Bezug auf die Protestantismusstudien das vollständige Bild.
9. Zur Anordnung der Texte
In dem hier vorgelegten Band weichen wir von einem Grundprinzip der Max Weber-Gesamtausgabe ab: Dem Leser wird von den beiden Aufsätzen „Die protestantische Ethik und der ,Geist‘ des Kapitalismus“
69
zunächst nicht der Text letzter, sondern der Text erster Hand präsentiert. Der Text letzter Hand erschien im Jahre 1920 als Teil von Band I der Gesammelten Aufsätze zur Religionssoziologie. [88]Ediert unten, S. 97–215 und 222–425.
70
Er wird im Band I/18 der Max Weber-Gesamtausgabe zusammen mit der „Vorbemerkung“ und dem Text „Die protestantischen Sekten und der Geist des Kapitalismus“ ediert. Weber, Max, Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus, in: ders., Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie I. – Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) 1920, S. 17–206 (MWG I/18).
71
Dieser Text über die „Sekten“ stellt allerdings eine nahezu komplette Neufassung dar, so daß er mit dem in diesem Band edierten Text „,Kirchen‘ und ,Sekten‘ in Nordamerika“ Die Texte in GARS I, S. 1–16 und 207–236 (MWG I/18).
72
nur noch wenig gemein hat. Hier von erster und letzter Hand zu sprechen, wäre nicht sachgerecht. Bei den Aufsätzen „Die protestantische Ethik und der ,Geist‘ des Kapitalismus“ ist das anders. Hier ist Text letzter Hand gegenüber dem Text erster Hand zwar erweitert, aber nicht fundamental verschieden. In Band I/18 wird der Text letzter Hand zusammen mit dem frühen Text als einer Variante ediert, so daß der Leser verfolgen kann, welche textlichen Veränderungen Weber nach 1905 vornahm. Sie bestehen hauptsächlich in Erweiterungen und in Auseinandersetzungen mit Kritikern, insbesondere mit Werner Sombart und Lujo Brentano. Doch fehlt auch hier die ursprünglich geplante Fortsetzung. Ediert unten, S. 426–462.
73
Siehe dazu oben, S. 66 f.
Warum wurde dennoch nicht bereits hier der Text letzter Hand geboten? Dies begründet sich mit der Wirkung, welche die frühe Fassung zeitigte. Weber wurde nach Erscheinen der beiden Protestantismus-Aufsätze, wie gezeigt, in eine Kontroverse verstrickt, die ihn zu insgesamt vier Antikritiken herausforderte. Die Kritiken
74
sowohl wie Webers Antikritiken Es handelt sich um: Fischer, Kritische Beiträge, und Fischer, Replik, sowie um: Rachfahl, Kalvinismus, und Rachfahl, Nochmals Kalvinismus.
75
beziehen sich [89]auf die frühe Fassung und lassen sich nur im Zusammenhang damit angemessen verstehen. Webers Erwiderungen gegenüber Fischer: Weber, Kritische Bemerkungen, und Weber, Bemerkungen, seine Erwiderungen gegenüber Rachfahl: Weber, Antikritisches zum „Geist“ des Kapitalismus, und Weber, Antikritisches Schlußwort.
Um dem Leser ein möglichst genaues Bild über den Ablauf dieser Kontroverse zu ermöglichen, sind auch die teilweise sehr umfangreichen Kritiken, obgleich keine Weber-Texte, in die Edition aufgenommen. Sie erscheinen als Anhang zu den Editorischen Berichten und sind ohne editorische Bearbeitung nachgedruckt.
76
Da die Kontrahenten sich wechselseitig auf ihre Texte beziehen, kann auf diese Weise die Auseinandersetzung Schritt für Schritt verfolgt werden. Keiner der aufgenommenen Texte ist gekürzt. [89]Fischers Kritiken sind abgedruckt unten, S. 469–477 und 494–497, Rachfahls Kritiken unten, S. 521–572 und 625–664. Im Anschluß folgt die Edition der Antikritiken, unten, S. 478–490 und 498-514, S. 573–619 und 665–740.
An den übrigen Grundsätzen der Max Weber-Gesamtausgabe wird freilich auch in diesem Band festgehalten: am Chronologie- und am Pertinenzprinzip. Seit Talcott Parsons die Aufsatzfolge „Die protestantische Ethik und der ,Geist‘ des Kapitalismus“ ins Englische übersetzte,
77
wird sie im Ausland zwar häufig als ein „Buch“ behandelt, doch ist sie eben kein Buch, sondern eine Aufsatzfolge, die fortgesetzt werden sollte. Zwischen der Publikation des ersten und der des zweiten Aufsatzes liegt zudem nahezu ein Jahr. In dieser Zeit hielt Weber einen Vortrag im „Eranoskreis“, in dem er erste Ergebnisse seines zweiten Aufsatzes seinen Zuhörern mitteilte. Die Edition gibt diese Entwicklung wieder, indem sie diesen Vortrag Webers, „Die protestantische Askese und das moderne Erwerbsleben“, dem Chronologieprinzip folgend, zwischen die beiden Aufsätze stellt. Weber, Max, The protestant ethic and the spirit of capitalism. Translated by Talcott Parsons, with a foreword by R. H. Tawney. – London: Allen & Unwin 1930.
78
Ediert unten, S. 216–221.
Aus dem Pertinenzprinzip folgt, daß außer Antikritiken auch zwei Diskussionsbeiträge Webers auf dem Ersten Deutschen Soziologentag von Oktober 1910 aufzunehmen waren.
79
Denn diese stehen in einem sachlichen Zusammenhang mit den übrigen Texten in diesem Band. Webers „Antikritisches Schlußwort zum Geist des Kapitalismus“ und seine Diskussionsbeiträge auf dem Ersten Deutschen Soziologentag zeichnen ein eindrückliches Bild vom Stand seiner religionssoziologischen Überlegungen im Jahre 1910. Das Jahr 1910 markiert zugleich einen Einschnitt in Webers religionssoziologischer Arbeit, wie sich im Band I/18 der Max Weber-Gesamtausgabe zeigen wird. Weber, Diskussionsbeiträge auf dem Ersten Deutschen Soziologentag am 21. Oktober 1910, ediert unten, S. 741–761 und 761–764 (nach dem vorangehenden Vortrag Ernst Troeltschs stehen sie unter dem Titel „Das stoisch-christliche Naturrecht und das moderne profane Naturrecht“).
Im Übrigen gelten für die Bearbeitung der Texte die sonstigen Editionsregeln der Max Weber-Gesamtausgabe (im Band unten, S. 984–994).
[90]Anhang zur Einleitung
Hinweise auf die geplante Fortführung der „Protestantischen Ethik“
| Texthinweise in: Weber, Protestantische Ethik II | Belegstellen | |
| MWG-Seite | Hg.–Anm. | |
| Was die Ablehnung der „Kreaturvergötterung“ und das Prinzip, daß, zunächst in der Kirche, letztlich aber im Leben überhaupt, nur Gott „herrschen“ solle, politisch bedeutete, davon später. | S. 267 f., Fn. 21 | 29 |
| Die „Menschlichkeit“ der Beziehungen zum „Nächsten“ ist sozusagen abgestorben. […] – Natürlich bezeichnet das alles nur eine „Tendenz“, und wir werden später selbst bestimmte Einschränkungen zu machen haben. | S. 269 f., Fn. 21b | 37 |
| […] sondern wir werden später, wenn wir die politisch und sozial so weittragende Bedeutung der reformierten Abendmahlslehre und Abendmahlspraxis betrachten, noch davon zu reden haben, welche Rolle auch außerhalb des Pietismus die Feststellbarkeit des Gnadenstandes des einzelnen z. B. für die Frage seiner Zulassung zum Abendmahl […] während des ganzen 17. Jahrhunderts gespielt hat. | S. 273 | 53 |
| Inwieweit die hier möglichst scharf gezeichneten Gegensätze nur relative sind, ist später zu erörtern. | S. 287, Fn. 50 | 22 |
| Und auch wo die Konsequenz der Sektenbildung nicht gezogen wurde, gingen die mannigfachsten Ausgestaltungen der Kirchenverfassung, wie wir später sehen werden, aus dem Versuch hervor, wiedergeborene und unwiedergeborene, zum Sakrament nicht reife, Christen zu scheiden und nur wiedergeborene Prediger zuzulassen. | S. 298 | 64 |
| […] die Abstinenz vom Abendmahl bei Teilnahme unwiedergeborener Personen daran (von der in anderem Zusammenhang noch zu reden sein wird) […] | S. 309, Fn. 76 | 9 |
| Die vorstehenden Bemerkungen [zur Toleranz und Trennung von Kirche und Staat], auf die ja weiterhin eingehender zurückzukommen sein wird […] | S. 313, Fn. 78 | 34 |
| Texthinweise in: Weber, Protestantische Ethik II | Belegstellen | |
| MWG-Seite | Hg.–Anm. | |
| Die religiöse Aristokratie der Heiligen […] ist alsdann […] innerhalb der Kirche voluntaristisch in der Form der Konventikelbildung organisiert, während sie im englischen Puritanismus, wie später zu erörtern sein wird, teils zur förmlichen Unterscheidung von Aktiv- und Passivchristen in der Verfassung der Kirche, teils […] zur Sektenbildung drängte. | S. 318 | 50 |
| Sie [die Gefühlsseite] ist in ihrem Gegensatz gegen den westeuropäischen Rationalismus, wenn überhaupt „sozialpsychisch“, dann am ehesten durch die Rückständigkeit und patriarchale Gebundenheit des deutschen Ostens verständlich zu machen, wie wir später sehen werden. | S. 330, Fn. 101a | 18 |
| Es ist aber nicht irgend eine ihm immanente „Entwicklungstendenz“, welche sich darin äußert, sondern jene Unterschiede folgen aus Gegensätzlichkeiten des religiösen und sozialen Milieus, dem ihre führenden Vertreter entstammten. Davon in anderem Zusammenhang. | S. 336 | 41 |
| Erst später wird auch davon zu reden sein, wie die Eigenart des deutschen Pietismus in seiner sozialen und geographischen Verbreitung zum Ausdruck kommt. | S. 336 f. | 42 |
| Indessen ist dabei der Patriarchalismus auf dem Boden der reformierten und erst recht der täuferischen Ethik anders geartet als auf dem Boden des Pietismus. Dies Problem wird uns erst in anderem Zusammenhang beschäftigen. | S. 337, Fn. 113 | 46 |
| Der reine Gefühlspietismus endlich ist […] eine religiöse Spielerei für „leisure classes“. So wenig erschöpfend diese Charakterisierung ist – wie sich noch zeigen wird – […] | S. 337 f. | 49 |
| Wichtig für unsere Probleme wird er [der Methodismus] erst wieder, wo wir zur Betrachtung der Sozialethik und damit der Reglementierung des Berufslebens durch die kirchlichen Organisationen gelangen. | S. 345 | 82 |
| Sie [die „Particular Baptists“] interessieren uns daher erst in anderem Zusammenhang. | S. 346, Fn. 122 | 89 |
| Daß freilich auch bei diesen ganz bestimmte religiöse Motive zur „believers’ church“ drängten, wurde schon angedeutet und wird uns in seinen Folgen später noch beschäftigen. | S. 350, Fn. 126 | 18 |
| Texthinweise in: Weber, Protestantische Ethik II | Belegstellen | |
| MWG-Seite | Hg.–Anm. | |
| Er [der Grundsatz der Weltmeidung] drückt sich namentlich in der ursprünglich strengen Meidung der Exkommunizierten auch im bürgerlichen Verkehr aus, – ein Punkt, in welchem selbst die Calvinisten der Auffassung, daß die bürgerlichen Verhältnisse grundsätzlich von den geistlichen Censuren nicht berührt werden, Konzessionen machten. Darüber später. | S. 352, Fn. 129 | 28 |
| Die sozial-ethische Bedeutung des […] Satzes: „Tut anderen nur, was ihr wollt, daß sie euch tun“ – wird uns später beschäftigen. | S. 356, Fn. 134 | 49 |
| Wir werden bei Besprechung der Klassenbeziehungen der protestantischen Askese darauf zurückkommen. | S. 359, Fn. 136 | 58 |
| Dabei prägte nun die ungeheure Bedeutung, welche die täuferische Heilslehre auf die Kontrolle durch das Gewissen, als die individuelle Offenbarung Gottes, legte, ihrer Gebahrung im Berufsleben einen Charakter auf, dessen große Bedeutung für die Entfaltung wichtiger Seiten des kapitalistischen Geistes wir erst bei Betrachtung der Sozialethik der protestantischen Askese näher kennen lernen werden. | S. 361 | 66 |
| Auf Kautskys Darstellung der wiedertäuferischen Bewegung und seiner Theorie des „ketzerischen Kommunismus“ überhaupt (im ersten Bande des gleichen Werkes) wird erst später einzugehen sein. | S. 362, Fn. 138 | 72 |
| Ein weiteres wichtiges Element, welches der Intensität der innerweltlichen Askese der täuferischen Denominationen zugute kam, kann in seiner vollen Bedeutung ebenfalls erst in anderem Zusammenhang zur Erörterung gelangen. | S. 363 | 77 |
| Wir werden auch auf diesen Punkt bei Betrachtung der Sozialpolitik des asketischen Protestantismus zu sprechen kommen und dann den großen Unterschied zu beachten haben, welcher zwischen der Wirkung der autoritären Sittenpolizei der Staatskirchen und der auf freiwilliger Unterwerfung ruhenden Sittenpolizei der Sekten bestand. | S. 364 | 80 |
| Auf die Bedeutung dieser und ähnlicher Äußerungen für die Frage der Klassenbedingtheit der Askese gehen wir hier noch nicht ein. | S. 374, Fn. 14 | 53 |
| Texthinweise in: Weber, Protestantische Ethik II | Belegstellen | |
| MWG-Seite | Hg.–Anm. | |
| Der Utilitarismus ist eben […] Konsequenz der unpersönlichen Gestaltung der „Nächstenliebe“ und der Ablehnung aller Weltverherrlichung durch die Exklusivität des puritanischen „in majorem Dei gloriam“. […] Die politische Seite der Sache gehört in einen späteren Zusammenhang. | S. 382, Fn. 27 | 94 |
| […] über die Frage der Erlaubtheit des Zinses, auf welche wir in einem späteren Kapitel eingehen […] | S. 386 f. Fn. 35 | 20 |
| Eingehender kommen wir auf diesen Punkt [die Theorie, daß das mosaische Gesetz durch den neuen Bund nur soweit seiner Geltung entkleidet sei, als es zeremonielle oder geschichtlich bedingte Vorschriften für das jüdische Volk enthalte, im übrigen aber als Ausdruck der „lex naturae“ seine Geltung von jeher besessen und daher auch behalten habe,] erst in anderem Zusammenhang zu sprechen. | S. 393, Fn. 47a | 52 |
| Die Satire der Gegner […] setzt ebenfalls gerade bei der Stubengelehrsamkeit und geschulten Dialektik der Puritaner ein: dies hängt, wie wir später sehen werden, teilweise mit der religiösen Schätzung des Wissens zusammen, welche aus der Stellung zur katholischen „fides implicita“ folgte. | S. 400 | 79 |
| Die Klassenabstufung der Kirchenplätze in den holländischen Kirchen zeigt den aristokratischen Charakter dieses Kirchentums noch heute. – Davon später. | S. 403, Fn. 54b | 94 |
| Auf die Bedeutung für die Entwicklung der Technik und der empirischen Wissenschaften kommen wir später zu sprechen. | S. 405, Fn. 59 | 13 |
| Es ist schon früher gesagt, daß wir auf die Frage der Klassenbedingtheit der religiösen Bewegungen später gesondert eingehen. | S. 411, Fn. 69 | 33 |
| Für diejenigen, deren „kausales Gewissen“ ohne ökonomische […] „Deutung“ nicht beruhigt ist, sei hiermit bemerkt, daß ich den Einfluß der wirtschaftlichen Entwicklung auf das Schicksal der religiösen Gedankenbildungen für sehr bedeutend halte und später darzulegen suchen werde, wie in unserem Falle die gegenseitigen Anpassungsvorgänge und Beziehungen beider sich gestaltet haben. | S. 411, Fn. 69 | 37 |
| Die Rolle, welche der Kirchenzucht dabei zukam, werden wir später erörtern. | S. 413, Fn. 71 | 45 |
| Texthinweise in: Weber, Protestantische Ethik II | Belegstellen | |
| MWG-Seite | Hg.–Anm. | |
| Sehr regelmäßig – wir werden das später noch verfolgen – finden wir die genuinsten Anhänger puritanischen Geistes in den Reihen der erst im Aufsteigen begriffenen Schichten der Kleinbürger und Farmer und die „beati possidentes“, selbst bei den Quäkern, recht oft zur Verleugnung der alten Ideale bereit. | S. 415 | 50 |
| Bemerkt sei nur noch, daß natürlich die vor der von uns betrachteten Entwicklung liegende Periode der kapitalistischen Entwicklung überall mitbedingt war durch christliche Einflüsse, hemmende ebenso wie fördernde. Welcher Art diese waren, gehört in ein späteres Kapitel. | S. 424 f. Fn. 86 | 88 |
| Texthinweise in: Weber, Kritische Bemerkungen | Belegstellen | |
| MWG-Seite | Hg.–Anm. | |
| […] über die (im weiteren Verlauf der Untersuchung noch näher zu besprechenden) Determinanten der Entwicklung Hollands habe ich XX S. 26, XXI S. 95, 96 einige (allerdings nur gänzlich provisorische) Bemerkungen gemacht […] | S. 482 f. | 31 |
| Über die Bedeutung bestimmter religiöser Gruppen für die Entwicklung des niederrheinischen Gebiets in der frühkapitalistischen Zeit wird wohl noch bei Fortsetzung meiner Darstellung zu sprechen sein. | S. 483 | 35 |
| Texthinweise in: Weber, Bemerkungen | Belegstellen | |
| MWG-Seite | Hg.–Anm. | |
| Alle diese hatten ja ihre eigenartige spezifische „Methodik“, und von ihnen allen sind eben deshalb Bestandteile in den Lebensstil führender moderner Nationen eingegangen (von manchen derselben werde ich s. Z. zu reden haben). | S. 505, Fn. 2 | 47 |
| Texthinweise in: Weber, Bemerkungen | Belegstellen | |
| MWG-Seite | Hg.–Anm. | |
| Mein Herr Kritiker hatte das volle Recht, zu sagen: die Gegenprobe und nähere Interpretation, die versprochen ist, fehlt bisher. | S. 506, Fn. 3 | 54 |
| Es ist sehr gut möglich, daß, wenn meine Untersuchungen einmal zu Ende kommen sollten, ich zur Abwechslung ganz ebenso entrüstet der Kapitulation vor dem historischen Materialismus geziehen werde, wie jetzt der Ideologie. | S. 509 f. Fn. 5 | 83 |
| Texthinweise in: Weber, Antikritisches zum „Geist“ des Kapitalismus | Belegstellen | |
| MWG-Seite | Hg.–Anm. | |
| Hätte ich meinen Aufsatz fortgesetzt, so würde ich die Aufgabe gehabt haben, große Teile des jetzt von Tröltsch bearbeiteten Gebiets mitzubehandeln. | S. 576 | 16 |
| Nun befinde ich mich […] in dieser Hinsicht keineswegs im Gegensatz zu ihm [Rachfahl], habe vielmehr selbst diese – in meine Darstellung, soweit sie bisher reicht, im Einzelnen noch nicht hineingehörigen – Zusammenhänge erwähnt […]. | S. 585 | 64 |
| […] gegen die (im 17. Jahrhund[ert] höfischen) Monopolisten und Groß-Finanziers […] war er [der Kampf] – das würde ich bei Fortsetzung meiner Artikel zu zeigen gehabt haben – von einer sehr bestimmten Theorie des „justum pretium“ getragen […] | S. 604, Fn. 23 | 69 |
| Ich hatte sehr nachdrücklich betont, daß ich im Fall einer Vollendung meiner Aufsätze, wo dann die umgekehrte Kausalbeziehung […] zur Geltung gelangen müßte, wahrscheinlich der „Kapitulation vor dem Geschichtsmaterialismus“ ganz ebenso geziehen werden würde […] | S. 608, Fn. 28 | 88 |
| […] und ausdrücklich die Erörterung der umgekehrten Kausalrelation der Fortsetzung der ausdrücklich als unabgeschlossen bezeichneten Aufsätze überwiesen. Zu einem „Abschluß“ sind nun – und das ist, wie schon gesagt, mein dauernder Nachteil, – jene Aufsätze aus Gründen, die ich deutlich (auch oben) gesagt habe und die an Gewicht seither nur gewonnen haben, nicht gelangt […]. | S. 616 | 29 |
| Texthinweise in: Weber, Antikritisches Schlußwort | Belegstellen | |
| MWG-Seite | Hg.–Anm. | |
| Ich meinerseits gebe die Hoffnung, gerade diese Partien meiner Arbeit fortführen (und dabei sehr viel weiter vertiefen) zu können, nicht auf […] | S. 689, Fn. 10 | 55 |
| […] und dann hätte ich 3. das, was ich in diesem Aufsatz ausgesprochenermaßen und nach seiner ganzen Anlage teils gar nicht, teils noch nicht (nämlich in den bisher allein erschienenen Partien nicht) verfolgen konnte: die Grenzen ihrer Expansion, ermitteln sollen […] | S. 708 | 72 |
| Damit ergab sich dann das Problem, nicht für die ganze ursprünglich beabsichtigte Aufsatzreihe (wie ausdrücklich an deren Schluß gesagt ist), wohl aber für die zunächst folgenden Ausführungen in den seinerzeit in diesem Archiv veröffentlichten Studien […] | S. 710 | 80 |
| Diese, in vielem sehr fühlbaren, Unterschiede traten nur in diesem Teil meiner Ausführungen (der bis jetzt allein vorliegt) notwendig vor dem Gemeinsamen zurück. | S. 728 | 67 |
| Noch so viele Einzelansätze zu einer praktischen Berufsethik dieser Art, die sich im Mittelalter finden – ich habe ausdrücklich mir vorbehalten, darauf zu sprechen zu kommen –, ändern nichts daran, daß solch ein „geistiges Band“ eben damals fehlte. | S. 731 | 76 |