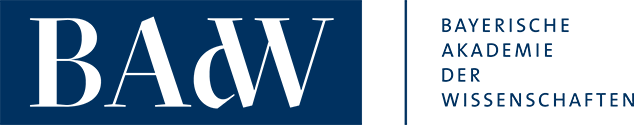[Wirtschaft und Gesellschaft, 1. Lieferung, 1921]N1 Die Überschrift findet sich nicht in der MWG-Druckfassung; hier in MWG digital eingefügt.
Die Überschrift findet sich nicht in der MWG-Druckfassung; hier in MWG digital eingefügt.
[147][A 1]Kapitel I. Soziologische Grundbegriffe.
Vorbemerkung. Die Methode dieser einleitenden, nicht gut zu entbehrenden, aber unvermeidlich abstrakt und wirklichkeitsfremd wirkenden Begriffsdefinition beansprucht in keiner Art: neu zu sein. Im Gegenteil wünscht sie nur in – wie gehofft wird – zweckmäßigerer und etwas korrekterer (eben deshalb freilich vielleicht pedantisch wirkender) Ausdrucksweise zu formulieren, was jede empirische Soziologie tatsächlich meint, wenn sie von den gleichen Dingen spricht. Dies auch da, wo scheinbar ungewohnte oder neue Ausdrücke verwendet werden. Gegenüber dem Aufsatz im Logos IV (1913, S. 253 ff.
a
)[147]A: 253 f.
1
ist die Terminologie tunlichst vereinfacht und daher auch mehrfach verändert, um möglichst leicht verständlich zu sein. Das Bedürfnis nach unbedingter Popularisierung freilich wäre mit dem Bedürfnis nach größtmöglichster Begriffsschärfe nicht immer vereinbar und muß diesem gegebenenfalls weichen. [147]Weber, Kategorien, S. 253–295.
Über „Verstehen“ vgl. die „Allgemeine Psychopathologie“ von K[arl] Jaspers
2
(auch einige Bemerkungen von Rickert in der 2. Aufl. der „Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung“ Jaspers, Psychopathologie. Zum Begriff des Verstehens bei Karl Jaspers, den er im Dialog mit Max Weber ausarbeitete, insbes. ebd., S. 12–23 und S. 145–153.
3
und namentlich von Simmel in den „Problemen der Geschichtsphilosophie“ Rickert, Grenzen2, insbes. S. 521 ff.
4
gehören dahin). [148]Methodisch weise ich auch hier, wie schon öfter, auf den Vorgang von F[riedrich] Gottl in der freilich etwas schwer verständlich geschriebenen und wohl nicht überall ganz zu Ende gedanklich durchgeformten Schrift: „Die Herrschaft des Worts“ hin. Simmel, Probleme2, entwickelt im ersten Kapitel eine Theorie des historischen Verstehens im Rahmen der Frage nach der Möglichkeit der historischen Erkenntnis überhaupt, nach dem „Apriori des geschichtlichen Erkennens“ (ebd., S. V). Dieses Kapitel war nach Weber für eine Theorie des Verstehens besonders relevant. Das konstatiert er bereits 1905: „Die logisch weitaus entwickeltsten Ansätze einer Theorie des ‚Verstehensʼ finden sich in der zweiten Auflage von Simmels ,Probleme der Geschichtsphilosophieʼ (S. 27–62).“ (Weber, Roscher und Knies II, S.137). Weber würdigt vor allem Simmels Verdienst, „das objektive ,Verstehenʼ des Sinnes einer Äußerung von der subjektiven ,Deutungʼ der Motive eines (sprechenden oder handelnden) Menschen klar geschieden zu haben“. Er stellt aber gegenüber Simmel korrigierend fest, das Verstehen des Sinns einer Äußerung sei nicht, wie bei diesem, auf die theoretische Erkenntnis beschränkt, sondern betreffe auch Befehle, Appelle an das Gewissen, Werturteile und Wertgefühle, kurz: alles „Geäußerte“ (ebd., S. 139). Die Unterscheidung der beiden Arten des Verstehens findet sich bei Simmel, Probleme2, S. 28. Weber bezieht sich an zwei weiteren Stellen in Kapitel I auf Simmels Theorie des historischen Verstehens, so in § 1, Nr. 2 und Nr. 4, unten, S. 150 und S. 153. Für Weber ist die 2. Auflage von Simmels Arbeit auch deshalb attraktiv, weil sie „durch und durch unter dem Einfluß Rickertʼscher Gedanken“ stehe. Vgl. dazu den Brief Max Webers an Franz Eulen[148]burg vom 10. April 1905, GStA PK, VI. HA, Nl. Max Weber, Nr. 30, Bd. 4, Bl. 113–114 (MWG II/4).
5
Sachlich vor allem auf das schöne Werk von F[erdinand] Tönnies, Gemeinschaft und Gesellschaft. Gottl, Herrschaft. Weber würdigt dieses Werk in seinem Aufsatz über Roscher und Knies wegen der selbständigen Behandlung der Probleme der Begriffsbildung in der Nationalökonomie, kritisiert aber neben der „fast bis zur Unverständlichkeit sublimierten Sprache“ den dabei eingenommenen „psychologistischen erkenntnistheoretischen Standpunkt“. Nach der Veröffentlichung von Heinrich Rickerts Kapitel 4 und 5 seiner „Grenzen“ im Jahre 1902 sei denn auch Gottls Ansatz „in manchen […] Punkten“ überholt (Weber, Roscher und Knies I, S. 4, Fn. 1). Gottls Buch bleibt für Weber aber unabhängig davon wegen der darin enthaltenen Theorie der Deutung wichtig, eines Themas, das Rickert 1902 noch ausgespart hatte. Gottl habe „die umfassendste methodologische Verwertung der Kategorie [der Deutung]“ durchgeführt (ebd. II, S. 137 f.). Im übrigen unterstreicht Weber bei aller Kritik immer wieder seine Wertschätzung der methodologischen Arbeit dieses Autors. Er gebe eine „in ihrer Eigenart feine und geistvolle Beleuchtung des Problems“ (ebd. I, S. 4, Fn. 1), seine Arbeit enthalte „viele vortreffliche Bemerkungen“ (ebd. II, S. 141, Fn. 2). Zu Webers ausführlicher Kritik an Gottls Verstehenstheorie ebd. II, S. 141–143, Fn. 2. Es kostete Weber allerdings große Mühe, Gottls Beitrag gerecht zu werden. In einem Brief an ihn gesteht er, er habe die Arbeit „4 Mal lesen müssen“, um das Gemeinte zu erfassen. Dazu Brief Max Webers an Friedrich Gottl vom 8. April 1906, MWG II/5, S. 69–72, Zitat: S. 70.
6
Ferner auf das stark irreführende Buch von R[udolf] Stammler, Wirtschaft und Recht nach der materialistischen Geschichtsauffassung und meine Kritik dazu im Archiv f[ür] Sozialwissensch[aft] XXIV (1907), Tönnies, Gemeinschaft. Die zweite Auflage von 1912 versah Tönnies mit dem neuen Untertitel „Grundbegriffe der reinen Soziologie“ (vgl. Tönnies, Gemeinschaft2). Weber grenzt sich allerdings von Tönniesʼ Terminologie ab, vgl. Kap. I, § 9, Nr. 1, unten, S. 195; ferner den Brief Max Webers an Ferdinand Tönnies vom 29. August 1909, MWG II/6, S. 237 f.
7
welche die Grundlagen des Nachfolgenden vielfach schon enthielt. Von Simmels Methode (in der „Soziologie“ und in „Philos[ophie] des Geldes“) Stammler, Wirtschaft und Recht2; Weber, Stammlers Überwindung, S. 94–151. Webers Handexemplar von Stammlers Buch (Max Weber-Arbeitsstelle, BAdW München) weist Anstreichungen und Randnotizen auf nahezu jeder Seite auf.
b
weiche ich durch tunlichste Scheidung des gemeinten von dem objektiv gültigen „Sinn“ ab, die beide Simmel nicht nur nicht immer scheidet, sondern oft absichtsvoll ineinander fließen läßt.[148]In A folgt ein Komma.
8
Simmel, Soziologie; Simmel, Philosophie des Geldes2. Webers Aussage scheint sich nicht auf eine einzelne Textstelle zu beziehen. Sie gilt vielmehr dem Ansatz von Simmels Soziologie allgemein. Von Simmels soziologischer Methode im engeren Sinn distanziert Weber sich. Generell wirft er ihm eine Neigung zu einer „psychologisti[149]schen Formulierungsweise“ vor (Weber, Roscher und Knies II, S. 140). Dazu ausführlich die Einleitung, oben, S. 34 ff.
[149]§ 1. Soziologie (im hier verstandenen Sinn dieses sehr vieldeutig gebrauchten Wortes) soll heißen: eine Wissenschaft, welche soziales Handeln deutend verstehen und dadurch in seinem Ablauf und seinen Wirkungen ursächlich erklären will. „Handeln“ soll dabei ein menschliches Verhalten (einerlei ob äußeres oder innerliches Tun, Unterlassen oder Dulden) heißen, wenn und insofern als der oder die Handelnden mit ihm einen subjektiven Sinn verbinden. „Soziales“ Handeln aber soll ein solches Handeln heißen, welches seinem von dem oder den Handelnden gemeinten Sinn nach auf das Verhalten anderer bezogen wird und daran in seinem Ablauf orientiert ist.
I. Methodische Grundlagen.
1. „Sinn“ ist hier entweder a) der tatsächlich α. in einem historisch gegebenen Fall von einem Handelnden oder β. durchschnittlich und annähernd in einer gegebenen Masse von Fällen von den Handelnden oder b) der
c
in einem begrifflich konstruierten reinen Typus von dem oder den als Typus gedachten Handelnden subjektiv gemeinte Sinn. Nicht etwa irgendein objektiv „richtiger“ oder ein metaphysisch ergründeter „wahrer“ Sinn. Darin liegt der Unterschied der empirischen Wissen[A 2]schaften vom Handeln: der Soziologie und der Geschichte, gegenüber allen dogmatischen: Jurisprudenz, Logik, Ethik, Ästhetik, welche an ihren Objekten den „richtigen“, „gültigen“, Sinn erforschen wollen.[149]Fehlt in A; der sinngemäß ergänzt; vgl. dazu auch die Einteilung unten, S. 155 f., Nr. 6.
2. Die Grenze sinnhaften Handelns gegen ein bloß (wie wir hier sagen wollen:) reaktives, mit einem subjektiv gemeinten Sinn nicht verbundenes, Sichverhalten ist durchaus flüssig. Ein sehr bedeutender Teil alles soziologisch relevanten Sichverhaltens, insbesondere das rein traditionale Handeln (s. u.)
9
steht auf der Grenze beider. Sinnhaftes, d. h. verstehbares, Handeln liegt in manchen Fällen psychophysischer Vorgänge gar nicht, in andren nur für den Fachexperten vor; Kap. I, § 2, Nr. 4, unten, S. 176.
10
mystische und daher in Worten [150]nicht adäquat kommunikable Vorgänge sind für den solchen Erlebnissen nicht Zugänglichen nicht voll verstehbar. Dagegen ist die Fähigkeit, aus Eignem ein gleichartiges Handeln zu produzieren, nicht Voraussetzung der Verstehbarkeit: „man braucht nicht Cäsar zu sein, um Cäsar zu verstehen.“ Weber stützt sich hier auf die psychologische und psychopathologische Literatur der Zeit, insbesondere auf die Arbeiten von Emil Kraepelin und seiner Schule. Im Zusammenhang mit den „Erhebungen über Auslese und Anpassung (Berufswahl und Berufsschicksal) der Arbeiterschaft der geschlossenen Großindustrie“ im Verein für Sozialpolitik schrieb Weber eine kritische Literaturübersicht unter dem Titel „Zur Psy[150]chophysik der industriellen Arbeit“, in die er die Ergebnisse einer kleinen eigenen empirischen Untersuchung in der Weberei seiner Verwandten in Örlinghausen einschaltete (vgl. dazu MWG I/11, S. 162–380 und die Einleitung des Herausgebers, ebd., bes. S. 20 ff.). Bereits in der Studie über den asketischen Protestantismus hatte er sich mit Literatur dieser Art beschäftigt, was ihn zu dem Urteil führte: „Der einigermaßen gesicherte Begriffsvorrat der Psychologie reicht vorerst entfernt nicht aus, um für die Zwecke der historischen Forschung auf dem Gebiet unserer Probleme nutzbar gemacht zu werden.“ Weber, Max, Die protestantische Ethik und der ,Geistʼ des Kapitalismus. II. Die Berufsidee des asketischen Protestantismus, in: AfSSp, Band 21, 1905, S. 1–110 (MWG I/9), Zitat: S. 45, Fn. 79a.
11
Die volle „Nacherlebbarkeit“ ist für die Evidenz des Verstehens wichtig, nicht aber absolute Bedingung der Sinndeutung. Weber gibt eine Formulierung von Simmel verkürzt wieder. Bei diesem heißt es: „Und dennoch sind wir überzeugt, daß man kein Cäsar zu sein braucht, um Cäsar wirklich zu verstehen, und kein zweiter Luther, um Luther zu begreifen.“ Simmel, Probleme2, S. 57. Das Zitat verwendet Weber bereits in Roscher und Knies II, S. 146, Fn. 1.
12
Verstehbare und nicht verstehbare Bestandteile eines Vorgangs sind oft untermischt und verbunden. Weber bezieht sich hier vermutlich auf Gottl. Dieser hatte behauptet, alles Handlungsgeschehen sei Erlebnis. Wir nähmen es „geradeaus als Miterleben entgegen, auf dem Umwege der Sprache als Nacherlebtes“ . Es treffe „mit diesem Erleben zusammen, daß uns alles Geschehen des Handelns gleich mit einem Gehalte zufällt.“ (Gottl, Herrschaft, S. 78). Weber bestreitet zwar nicht die erkenntnispsychologische Rolle der nacherlebenden Deutung, wohl aber die von Gottl behauptete Einheit von evidenter Deutung und empirischer Geltung. Der Grundirrtum der von Gottl und von anderen akzeptierten Erkenntnistheorie bestehe darin, „daß sie das Maximum ,anschaulicherʼ Evidenz mit dem Maximum von (empirischer) Gewißheit verwechselt.“ (Weber, Roscher und Knies III, S. 92). Zum logischen Charakter des Nacherlebens ebd., S. 96 f.
3. Alle Deutung strebt, wie alle Wissenschaft überhaupt, nach „Evidenz“. Evidenz des Verstehens kann entweder: rationalen (und als dann entweder: logischen oder mathematischen) oder: einfühlend nacherlebenden: emotionalen, künstlerisch-rezeptiven Charakters sein. Rational evident ist auf dem Gebiet des Handelns vor allem das in seinem gemeinten Sinnzusammenhang restlos und durchsichtig intellektuell Verstandene. Einfühlend evident ist am Handeln das in seinem erlebten Gefühlszusammenhang
d
voll Nacherlebte. Rational verständlich, d. h. also hier: unmittelbar und eindeutig intellektuell sinnhaft erfaßbar[,] sind im Höchstmaß vor allem die im Verhältnis mathematischer oder logischer Aussagen zueinander stehen[151]den[150]A: Gefühlzusammenhang
e
Sinnzusammenhänge. Wir verstehen ganz eindeutig, was es sinnhaft bedeutet, wenn jemand den Satz 2 × 2 = 4 oder den pythagoreischen Lehrsatz denkend oder argumentierend verwertet, oder wenn er eine logische Schlußkette – nach unseren Denkgepflogenheiten: – „richtig“ vollzieht. Ebenso, wenn er aus uns als „bekannt“ geltenden „Erfahrungstatsachen“ und aus gegebenen Zwecken die für die Art der anzuwendenden „Mittel“ sich (nach unsern Erfahrungen) eindeutig ergebenden Konsequenzen in seinem Handeln zieht. Jede Deutung eines derart rational orientierten Zweckhandelns besitzt – für das Verständnis der angewendeten Mittel – das Höchstmaß von Evidenz. Mit nicht der gleichen, aber mit einer für unser Bedürfnis nach Erklärung hinlänglichen Evidenz verstehen wir aber auch solche „Irrtümer“ (einschließlich der „Problemverschlingungen“),[151]A: stehende
13
denen wir selbst zugänglich sind oder deren Entstehung einfühlend erlebbar gemacht werden kann. Hingegen manche letzten „Zwecke“ und „Werte“, an denen das Handeln eines Menschen erfahrungsgemäß orientiert sein kann, vermögen wir sehr oft nicht voll evident zu verstehen, sondern unter Umständen zwar intellektuell zu erfassen, dabei aber andrerseits, je radikaler sie von unsren eigenen letzten Werten abweichen, desto schwieriger uns durch die einfühlende Phantasie nacherlebend verständlich zu machen. Je nach Lage des Falles müssen wir dann uns begnügen, sie nur intellektuell zu deuten, oder unter Umständen, wenn auch das mißlingt, geradezu: sie als Gegebenheiten einfach hinnehmen, und aus ihren soweit als möglich intellektuell gedeuteten oder soweit möglich einfühlend annäherungsweise nacherlebten Richtpunkten den Ablauf des durch sie motivierten Handelns uns verständlich machen. Dahin gehören z. B. viele religiöse und karitative Virtuosenleistungen für den dafür Unempfänglichen. Ebenso auch extrem rationalistische Fanatismen („Menschenrechte“) für den, der diese Richtpunkte seinerseits radikal perhorresziert.[151] Zur Rolle der Evidenz im Erkenntnisprozeß vgl. oben, S. 150, Hg.-Anm. 12. Der Ausdruck „Problemverschlingung“ stammt von Windelband (vgl. Windelband, Wilhelm, Lehrbuch der Geschichte der Philosophie, 4., durchgesehene Aufl. – Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) 1907, S. 11–13 (§ 2, Abschn. 4 und 5)). Er bezeichnet damit ein Problem der Philosophiegeschichtsschreibung. Eine systematische Geschichte der Philosophie sei damit konfrontiert, daß „Fragen, die an sich nichts miteinander zu tun haben, vermischt und in ihrer Lösung voneinander abhängig gemacht werden.“ Ein „äußerst wichtiges und häufig wiederkehrendes Hauptbeispiel“ hierfür sei „die Einmischung ethischer und ästhetischer Interessen in die Behandlung theoretischer Probleme“ (ebd., S. 12). Weber verwendet den Ausdruck auch unten, S. 159 mit Hg.-Anm. 26.
14
– Aktuelle [152]Affekte (Angst, Zorn, Ehrgeiz, Neid, Eifersucht, Liebe, Begeisterung, Stolz, Rachedurst, Pietät, Hingabe, Begierden aller Art) und die (vom rationalen Zweckhandeln aus angesehen:) irrationalen aus ihnen folgenden Reaktionen vermögen wir, je mehr wir ihnen selbst zugänglich sind, desto evidenter emotional nachzuerleben, in jedem Fall aber, auch wenn sie ihrem Grade nach unsre eignen Möglichkeiten absolut übersteigen, sinnhaft einfühlend zu verstehen und in ihrer Einwirkung auf die Richtung und Mittel des Handelns intellektuell in Rechnung zu stellen. In seinen Studien zum Recht während der Vorkriegszeit behandelt Weber die Menschenrechte im Kontext des Code civil. Diesen hält er für ein Produkt rationaler Gesetzgebung mit „formellen Qualitäten“, „welche eine außerordentliche Durchsichtigkeit und präzise Verständlichkeit der Bestimmungen teils wirklich enthalten, teils vortäu[152]schen.“ Diese „spezifische Art von Rationalismus“, der mitunter die „juristische Sublimierung“ der plastischen Gestaltung opfere, führe zu einer „epigrammatische[n] Theatralik“, die auch die „Menschen- und Bürgerrechte in den amerikanischen und französischen Verfassungen“ kennzeichne (Weber, Die Entwicklungsbedingungen des Rechts, MWG I/22-3, S. 593 f.). Dies steht in Zusammenhang mit Webers Auffassung, daß die Rechnung des Rationalismus nirgends voll aufgehe.
Für die typenbildende wissenschaftliche Betrachtung werden nun alle irrationalen, affektuell bedingten, Sinnzusammenhänge des Sichverhaltens, die das Handeln beeinflussen, am übersehbarsten als „Ablenkungen“ von einem konstruierten rein zweckrationalen Verlauf desselben erforscht und dargestellt. Z. B. wird bei einer Erklärung einer „Börsenpanik“ zweckmäßigerweise zunächst festgestellt: wie ohne Beeinflussung durch irrationale Affekte das Handeln abgelaufen wäre, und dann werden jene irrationalen Komponenten als „Störungen“ eingetragen. Ebenso wird bei einer politischen oder militärischen Aktion zunächst zweckmäßigerweise festgestellt: wie das Handeln bei Kenntnis aller Umstände und aller Absichten der Mitbeteiligten und bei streng zweckrationaler, an der uns gültig scheinenden Erfahrung [A 3]orientierter, Wahl der Mittel verlaufen wäre. Nur dadurch wird alsdann die kausale Zurechnung von Abweichungen davon zu den sie bedingenden Irrationalitäten möglich. Die Konstruktion eines streng zweckrationalen Handelns also dient in diesen Fällen der Soziologie, seiner evidenten Verständlichkeit und seiner – an der Rationalität haftenden – Eindeutigkeit wegen, als Typus („Idealtypus“), um das reale, durch Irrationalitäten aller Art (Affekte, Irrtümer)
f
beeinflußte Handeln als „Abweichung“ von dem bei rein rationalem Verhalten zu gewärtigenden Verlaufe zu verstehen.[152]In A folgt ein Komma.
Insofern und nur aus diesem methodischen Zweckmäßigkeitsgrunde ist die Methode der „verstehenden“ Soziologie „rationalistisch“. Dies Verfahren darf aber natürlich nicht als ein rationalistisches Vorurteil der Soziologie, sondern nur als methodisches Mittel verstanden und also nicht etwa zu dem Glauben an die tatsächliche Vorherrschaft des Rationalen über das Leben umgedeutet werden. Denn darüber, inwieweit in der Realität rationale Zweckerwägungen das tatsächliche Handeln bestimmen und inwie[153]weit nicht, soll es ja nicht das Mindeste aussagen. (Daß die Gefahr rationalistischer Deutungen am unrechten Ort naheliegt, soll damit nicht etwa geleugnet werden. Alle Erfahrung bestätigt leider deren Existenz.)
4. Sinnfremde Vorgänge und Gegenstände kommen für alle Wissenschaften vom Handeln als: Anlaß, Ergebnis, Förderung oder Hemmung menschlichen Handelns in Betracht. „Sinnfremd“ ist nicht identisch mit „unbelebt“ oder „nichtmenschlich“. Jedes Artefakt, z. B. eine „Maschine“, ist lediglich aus dem Sinn deutbar und verständlich, den menschliches Handeln (von möglicherweise sehr verschiedener Zielrichtung) der Herstellung und Verwendung dieses Artefakts verlieh (oder verleihen wollte); ohne Zurückgreifen auf ihn bleibt sie gänzlich unverständlich. Das Verständliche daran ist also die Bezogenheit menschlichen Handelns darauf, entweder als „Mittel“ oder als „Zweck“, der dem oder den Handelnden vorschwebte und woran ihr Handeln orientiert wurde. Nur in diesen Kategorien findet ein Verstehen solcher Objekte statt. Sinnfremd bleiben dagegen alle – belebten, unbelebten, außermenschlichen, menschlichen – Vorgänge oder Zuständlichkeiten ohne gemeinten Sinngehalt, soweit sie nicht in die Beziehung von
g
„Mittel“ und „Zweck“ zum Handeln treten, sondern nur seinen Anlaß, seine Förderung oder Hemmung darstellen. Der Einbruch des Dollart Anfang des 12. Jahrhunderts hat (vielleicht!) „historische“ Bedeutung als Auslösung gewisser Umsiedelungsvorgänge von beträchtlicher geschichtlicher Tragweite.[153]A: vom
15
Die Absterbeordnung und der organische Kreislauf des Lebens überhaupt: von der Hilflosigkeit des Kindes bis zu der des Greises, hat natürlich erstklassige soziologische Tragweite durch die verschiedenen Arten, in welchen menschliches Handeln sich an diesem Sachverhalt orientiert hat und orientiert. Eine wiederum andere Kategorie bilden die nicht verstehbaren Erfahrungssätze über den Ablauf psychischer oder psycho-physiologischer Erscheinungen (Ermüdung, Übung, Gedächtnis usw., ebenso aber z. B. typische Euphorien bei bestimmten Formen der Kasteiung, typische Unterschiede der Reaktionsweisen nach Tempo, Art, Eindeutigkeit usw.).[153] Der Dollart, eine annähernd 100 km2 große Meeresbucht westlich der Emsmündung gegenüber der Seehafenstadt Emden, entstand, als sich das Land plötzlich senkte und durch das Meer überflutet wurde. Wann dies geschah, ist umstritten. Das von Weber genannte Datum läßt sich nicht nachweisen. Meist werden die Jahre 1277 oder 1287 genannt. Weber erwähnt den Vorgang bereits in Roscher und Knies II, S. 144.
16
Letztlich ist der Sachverhalt aber der gleiche wie bei andern unverstehbaren Gegebenheiten: wie der praktisch Handelnde, so nimmt die verstehende Betrachtung sie als „Daten“ hin, mit denen zu rechnen ist. Vgl. dazu die Erläuterung oben, S. 149 f., Hg.-Anm. 10.
[154]Die Möglichkeit ist nun gegeben, daß künftige Forschung auch unverstehbare Regelmäßigkeiten für sinnhaft besondertes Verhalten auffindet, so wenig dies bisher der Fall ist. Unterschiede des biologischen Erbguts (der „Rassen“)
17
z. B. würden – wenn und soweit der statistisch schlüssige Nachweis des Einflusses auf die Art des soziologisch relevanten Sichverhaltens, also: insbesondere des sozialen Handelns in der Art seiner Sinnbezogenheit, erbracht würde, – für die Soziologie als Gegebenheiten ganz ebenso hinzunehmen sein, wie die physiologischen Tatsachen etwa der Art des Nahrungsbedarfs oder der Wirkung der Seneszenz[154] Mit den Ansprüchen der Rassentheorien setzt sich Weber bereits vor der Jahrhundertwende kritisch auseinander. Sein Urteil dort: die Bedeutung der üblichen Rassenmerkmale für ökonomische und kulturelle Fragen werde überschätzt (vgl. Weber, Theoretische Nationalökonomie, MWG III/1 , S. 356). Im Objektivitätsaufsatz dient ihm die Anthropologie als ein Beispiel dafür, wie man anstelle von Fachwissen Weltanschauung produzieren könne. Wie alle Theorien der letzten Instanz, eigne auch der Anthropologie ein monistischer und gegen sich gänzlich unkritischer Grundzug. Gesellschaftstheorien auf anthropologischer und damit naturwissenschaftlicher Grundlage – gemeint sind insbesondere die Arbeiten von Otto Ammon – seien eher Ausdruck von Nichtwissen (Weber, Objektivität, S. 42f.). Weber hielt an der skeptischen Einschätzung der Erklärungskraft rassentheoretischer Ansätze für soziale und kulturelle Fragen auch noch 1919/20 fest. In der „Vorbemerkung“ zu den „Gesammelten Aufsätzen zur Religionssoziologie“ heißt es: „Der Verfasser bekennt: daß er persönlich und subjektiv die Bedeutung des biologischen Erbgutes hoch einzuschätzen geneigt ist. Nur sehe ich, trotz der bedeutenden Leistungen der anthropologischen Arbeit, z. Z. noch keinerlei Weg, seinen Anteil an der hier untersuchten Entwicklung nach Maß und – vor allem – nach Art und Einsatzpunkten irgendwie exakt zu erfassen oder auch nur vermutungsweise anzudeuten.“ Weber, Vorbemerkung, GARS I, S. 15 (MWG I/18).
18
auf das Handeln. Und das Anerkenntnis ihrer kausalen Bedeutung würde natürlich die Aufgaben der Soziologie (und der Wissenschaften vom Handeln überhaupt): die sinnhaft orientierten Handlungen deutend zu verstehen, nicht im mindesten ändern. Sie würde in ihre verständlich deutbaren Motivationszusammenhänge an gewissen Punkten nur unverstehbare Tatsachen (etwa: typische Zusammenhänge der Häufigkeit bestimmter Zielrichtungen des Handelns, oder des Grades seiner typischen Rationalität, mit Schädelindex Seneszenz (von lat. senescere, alt werden, altern), in Medizin und Biologie ein Fachbegriff für das Altern und die damit verbundenen organischen Prozesse.
19
oder Hautfarbe oder welchen andren physiologischen Erbqualitäten immer) einschalten, wie sie sich schon heute (s. o.) Mit dem Schädel-Index hatten vor allem Otto Ammon und George Vacher de Lapouge bei gesellschaftstheoretischen Fragen operiert. Ammon etwa behauptete, der Unterschied zwischen Katholiken und Protestanten lasse sich auf die Schädelform zurückführen (Rundköpfe versus Langköpfe). Dazu Ammon, Otto, Die natürliche Auslese beim Menschen. Aufgrund der anthropologischen Untersuchungen der Wehrpflichtigen in Baden und anderer Materialien dargestellt. – Jena: Gustav Fischer 1893; Weber kritisiert Ammon bereits in seinen nationalökonomischen Vorlesungen (MWG III/1 , S. 355–357).
20
darin vorfinden.[155] Siehe oben, S. 149 mit Hg.-Anm. 10.
[155]5. Verstehen kann heißen: 1) das aktuelle Verstehen des gemeinten Sinnes einer Handlung (einschließlich: einer Äußerung). Wir „verstehen“ z. B. aktuell den Sinn des Satzes 2 × 2 = 4, den wir hören oder lesen (rationales aktuelles Verstehen von Gedanken)[,] oder einen Zornausbruch, der sich in Gesichtsausdruck, Interjektionen, irrationalen Bewegungen manifestiert (irrationales aktuelles Ver[A 4]stehen von Affekten)[,] oder das Verhalten eines Holzhackers oder jemandes, der nach der Klinke greift[,] um die Tür zu schließen[,] oder der auf ein Tier mit dem Gewehr anlegt (rationales aktuelles Verstehen von Handlungen). – Verstehen kann aber auch heißen: 2) erklärendes Verstehen. Wir „verstehen“ motivationsmäßig, welchen Sinn derjenige, der den Satz 2 × 2 = 4 ausspricht
h
oder niedergeschrieben hat, damit verband, daß er dies gerade jetzt und in diesem Zusammenhang tat, wenn wir ihn mit einer kaufmännischen Kalkulation, einer wissenschaftlichen Demonstration, einer technischen Berechnung oder einer anderen Handlung befaßt sehen, in deren Zusammenhang nach ihrem uns verständlichen Sinn dieser Satz „hineingehört“, das heißt: einen uns verständlichen Sinnzusammenhang gewinnt (rationales Motivationsverstehen). Wir verstehen das Holzhacken oder Gewehranlegen nicht nur aktuell, sondern auch motivationsmäßig, wenn wir wissen, daß der Holzhacker entweder gegen Lohn oder aber für seinen Eigenbedarf oder zu seiner Erholung (rational), oder etwa „weil er sich eine Erregung abreagierte“ (irrational), oder wenn der Schießende auf Befehl zum Zweck der Hinrichtung oder der Bekämpfung von Feinden (rational) oder aus Rache (affektuell, also in diesem Sinn: irrational) diese Handlung vollzieht. Wir verstehen endlich motivationsmäßig den Zorn, wenn wir wissen, daß ihm Eifersucht, gekränkte Eitelkeit, verletzte Ehre zugrunde liegt (affektuell bedingt, also: irrational motivationsmäßig). All dies sind verständliche Sinnzusammenhänge, deren Verstehen wir als ein Erklären des tatsächlichen Ablaufs des Handelns ansehen. „Erklären“ bedeutet also für eine mit dem Sinn des Handelns befaßte Wissenschaft soviel wie: Erfassung des Sinnzusammenhangs, in den, seinem subjektiv gemeinten Sinn nach, ein aktuell verständliches Handeln hineingehört. (Über die kausale Bedeutung dieses „Erklärens“ s. Nr. 6.) In all diesen Fällen, auch bei affektuellen Vorgängen, wollen wir den subjektiven Sinn des Geschehens, auch des Sinnzusammenhanges als „gemeinten“ Sinn bezeichnen (darin also über den üblichen Sprachgebrauch hinausgehend, der von „Meinen“ in diesem Verstand nur bei rationalem und zweckhaft beabsichtigtem[155]A: ausspricht,
i
Handeln zu sprechen pflegt).A: beabsichtigten
6. „Verstehen“ heißt in all diesen Fällen: deutende Erfassung: a) des im Einzelfall real gemeinten (bei historischer Betrachtung) oder b) des durch[156]schnittlich und annäherungsweise gemeinten (bei soziologischer Massenbetrachtung) oder c) des für den reinen Typus (Idealtypus) einer häufigen Erscheinung wissenschaftlich zu konstruierenden („idealtypischen“) Sinnes oder Sinnzusammenhangs. Solche idealtypische Konstruktionen sind z. B. die von der reinen Theorie der Volkswirtschaftslehre aufgestellten Begriffe und „Gesetze“. Sie stellen dar, wie ein bestimmt geartetes, menschliches Handeln ablaufen würde, wenn es streng zweckrational, durch Irrtum und Affekte ungestört, und wenn es ferner ganz eindeutig nur an einem Zweck (Wirtschaft) orientiert wäre. Das reale Handeln verläuft nur in seltenen Fällen (Börse) und auch dann nur annäherungsweise so,
j
wie im Idealtypus konstruiert. (Über den Zweck solcher Konstruktionen s. Archiv f[ür] Sozialwiss[enschaft] XIX S. 64 ff. und unten Nr. 8).[156]A: annäherungsweise, so
21
[156] Weber, Objektivität, S. 64 ff., sowie unten, S. 160.
Jede Deutung strebt zwar nach Evidenz. Aber eine sinnhaft noch so evidente Deutung kann als solche und um dieses Evidenzcharakters willen noch nicht beanspruchen: auch die kausal gültige Deutung zu sein. Sie ist stets an sich nur eine besonders evidente kausale Hypothese. a) Es verhüllen vorgeschobene „Motive“ und „Verdrängungen“ (d. h. zunächst: nicht eingestandene Motive) oft genug gerade dem Handelnden selbst den wirklichen Zusammenhang der Ausrichtung seines Handelns derart, daß auch subjektiv aufrichtige Selbstzeugnisse nur relativen Wert haben. In diesem Fall steht die Soziologie vor der Aufgabe, diesen Zusammenhang zu ermitteln und deutend festzustellen, obwohl er nicht oder, meist: nicht voll als in concreto „gemeint“ ins Bewußtsein gehoben wurde: ein Grenzfall der Sinndeutung. b) Äußeren Vorgängen des Handelns, die uns als „gleich“ oder „ähnlich“ gelten, können höchst verschiedene Sinnzusammenhänge bei dem oder den Handelnden zugrunde liegen, und wir „verstehen“ auch ein sehr stark abweichendes, oft sinnhaft geradezu gegensätzliches Handeln gegenüber Situationen, die wir als unter sich „gleichartig“ ansehen (Beispiele bei Simmel, Probl[eme] der Geschichtsphil[osophie]).
22
c) Die handelnden Menschen sind gegebenen Situationen gegenüber sehr oft gegensätzlichen, miteinander kämpfenden Antrieben ausgesetzt, die wir sämtlich „verstehen“. In welcher relativen Stärke aber die verschiedenen im „Moti[157]venkampf“ Die Beispiele finden sich in Simmel, Probleme2, S. 9–14. Simmel unterscheidet zwischen „äußerlichen“ oder „äußeren“ historischen Handlungen und Situationen und den „untergelegten psychologischen Voraussetzungen“ sowie den verschiedenen möglichen Deutungen des Handelns. Er illustriert dies am Verhältnis von Robespierre und den Hebertisten, an den Adelsfehden in Ravenna im Trecento, am Handeln von Regierungen in demokratisch verfaßten Staaten mit zwei politischen Hauptparteien und an den Folgen der Aufhebung der Leibeigenschaft in Rußland und Preußen.
23
liegenden uns untereinander gleich verständlichen Sinnbezogenheiten im Handeln sich auszudrücken pflegen, läßt sich, nach aller Erfahrung, in äußerst vielen Fällen nicht einmal annähernd, durchaus regelmäßig aber nicht sicher, abschätzen. Der tatsächliche Ausschlag des Motivenkampfes allein gibt darüber Aufschluß. Kontrolle der verständlichen Sinndeutung durch den Erfolg: den Ausschlag im tatsächlichen Verlauf, ist also, wie bei jeder Hypothese, unentbehrlich. Sie kann mit relativer Genauigkeit nur in den leider wenigen und sehr besondersartigen dafür ge[A 5]eigneten Fällen im psychologischen Experiment erreicht werden. Nur in höchst verschiedener Annäherung in den (ebenfalls begrenzten) Fällen zählbarer und in ihrer Zurechnung eindeutiger Massenerscheinungen durch die Statistik. Im übrigen gibt es nur die Möglichkeit der Vergleichung möglichst vieler Vorgänge des historischen oder Alltagslebens, welche sonst gleichartig, aber in dem entscheidenden einen Punkt: dem jeweils auf seine praktische Bedeutsamkeit hin untersuchten „Motiv“ oder „Anlaß“, verschieden geartet sind: eine wichtige Aufgabe der vergleichenden Soziologie. Oft freilich bleibt leider nur das unsichere Mittel des „gedanklichen Experiments“, d. h. des Fortdenkens einzelner Bestandteile der Motivationskette und der Konstruktion des dann wahrscheinlichen Verlaufs, um eine kausale Zurechnung zu erreichen.[157] Vermutlich Anspielung auf Arthur Schopenhauer. Dieser spricht in seiner Ethik vom „Konflikt der Motive“, der sich im menschlichen Bewußtsein mit seiner Deliberationsfähigkeit abspiele, und dieser Konflikt währe so lange, „bis zuletzt das entschieden stärkste Motiv die andern aus dem Felde schlägt und den Willen bestimmt“ (vgl. Schopenhauer, Arthur, Preisschrift über die Freiheit des Willens, in: ders., Die beiden Grundprobleme der Ethik, behandelt in zwei akademischen Preisschriften. – Frankfurt a. M.: Joh. Christ. Hermannsche Buchhandlung (F. E. Suchsland) 1841, S. 1–100, Zitat: S. 38). Schopenhauer geht dabei auch auf die nicht eingestandenen und vorgeschobenen Motive ein: „Hiezu kommt noch, daß der Mensch die Motive seines Thuns oft vor allen Andern verbirgt, bisweilen sogar vor sich selbst, nämlich da, wo er sich scheut zu erkennen, was eigentlich es ist, das ihn bewegt, Dieses oder Jenes zu thun“ (ebd., S. 42f.). Von „Motivenkampf“ spricht auch Willy Hellpach im Zusammenhang mit der Unterscheidung von Triebhandlung, Willkürhandlung und Wahlhandlung. Hellpach, Willy, Die Grenzwissenschaften der Psychologie. – Leipzig: Verlag der Dürrʼschen Buchhandlung 1902, S. 10 (das Exemplar in der Universitätsbibliothek Heidelberg enthält Anstreichungen von Webers Hand).
Das sog. „Greshamsche Gesetz“
24
z. B. ist eine rational evidente Deutung menschlichen Handelns bei gegebenen Bedingungen und unter der [158]idealtypischen Voraussetzung rein zweckrationalen Handelns. Inwieweit tatsächlich ihm entsprechend gehandelt wird, kann nur die (letztlich im Prinzip irgendwie „statistisch“ auszudrückende) Erfahrung über das tatsächliche Verschwinden der jeweils in der Geldverfassung zu niedrig bewerteten Münzsorten aus dem Verkehr lehren: sie lehrt tatsächlich seine sehr weitgehende Gültigkeit. In Wahrheit ist der Gang der Erkenntnis der gewesen: daß zuerst die Erfahrungsbeobachtungen vorlagen und dann die Deutung formuliert wurde. Ohne diese gelungene Deutung wäre unser kausales Bedürfnis offenkundig unbefriedigt. Ohne den Nachweis andrerseits, daß der – wie wir einmal annehmen wollen – gedanklich erschlossene Ablauf des Sichverhaltens auch wirklich in irgendeinem Umfang eintritt, wäre ein solches an sich noch so evidentes „Gesetz“ für die Erkenntnis des wirklichen Handelns eine wertlose Konstruktion. In diesem Beispiel ist die Konkordanz von Sinnadäquanz und Erfahrungsprobe durchaus schlüssig und sind die Fälle zahlreich genug, um die Probe auch als genügend gesichert anzusehen. Die sinnhaft erschließbare, durch symptomatische Vorgänge (Verhalten der hellenischen Orakel und Propheten zu den Persern) gestützte geistvolle Hypothese Ed[uard] Meyers über die kausale Bedeutung der Schlachten von Marathon, Salamis, Plataiai für die Eigenart der Entwicklung der hellenischen (und damit der okzidentalen) Kultur Das Greshamsche Gesetz wird gemeinhin wie folgt wiedergegeben: „Das ‚schlechteʼ Geld verdrängt das ,guteʼ aus dem Umlauf.“ Das Gesetz gilt bei einer Doppelwährung (also bei Bimetallismus, aber auch bei Plurimetallismus), zum Beispiel bei einer Währung mit Münzen aus Gold und mit Münzen aus Silber. Das festgesetzte, tarifierte Wertverhältnis zwischen den Münzen aus Gold und aus Silber und das durch den Markt bestimmte Preisverhältnis von Gold und Silber als Waren müssen nicht übereinstimmen. In einem solchen Fall verdrängen die, gemessen am Marktwert ihres Metalls, [158]zu hoch tarifierten Münzen („schlechtes“ Geld) die zu niedrig tarifierten („gutes“ Geld), weil der zweckrational orientierte Geldbesitzer die letzteren zurückbehält und nur die ersteren im Umlauf verwendet. Deshalb spricht Weber davon, bei einer Geldverfassung dieser Art würden die zu niedrig bewerteten Münzsorten aus dem Verkehr verschwinden. Dazu auch seine Ausführungen in Kap. II, § 32, unten, S. 386 und 395 mit den Hg.-Anmerkungen. Zu Thomas Gresham (1519–1579) und dem ihm zugeschriebenen Gesetz Lotz, Walther, Greshamsches Gesetz, in: WbVW3, Band 1, 1911, S. 1191 f.
25
ist nur durch diejenige Probe zu erhärten, welche an den Beispielen des Verhaltens der Perser im Falle des Sieges (Jerusalem, Ägypten, Kleinasien) gemacht werden kann und in vieler Hinsicht notwendig unvollkommen bleiben muß. Die bedeutende rationale Evidenz der Hypothese muß hier notgedrungen als Stütze nachhelfen. In sehr vielen Fällen sehr evident scheinender historischer Zurechnung fehlt aber jede Möglichkeit auch nur einer solchen Probe, wie sie in diesem Fall noch möglich war. Alsdann bleibt die Zurechnung eben endgültig „Hypothese“. Zu Eduard Meyers Deutung der Perserkriege siehe Meyer, Eduard, Geschichte des Altertums, 2. Aufl., Band 2. – Stuttgart: Cotta 1928, S. 444–448. Von der welthistorischen Bedeutung der Perserkriege und speziell der Schlachten bei Marathon und Salamis handelt Weber bereits in dem Aufsatz „Kritische Studien auf dem Gebiet der kulturwissenschaftlichen Logik“, in: AfSSp, Band 22, Heft 1, 1906, S. 143–207 (MWG I/7), hier S. 192. Dabei kritisiert er Eduard Meyers Auffassung von der historischen Methode.
[159]7. „Motiv“ heißt ein Sinnzusammenhang, welcher dem Handelnden selbst oder dem Beobachtenden als sinnhafter „Grund“ eines Verhaltens erscheint. „Sinnhaft adäquat“ soll ein zusammenhängend ablaufendes Verhalten in dem Grade heißen, als die Beziehung seiner Bestandteile von uns nach den durchschnittlichen Denk- und Gefühlsgewohnheiten als typischer (wir pflegen zu sagen: „richtiger“) Sinnzusammenhang bejaht wird. „Kausal adäquat“ soll dagegen ein Aufeinanderfolgen von Vorgängen in dem Grade heißen, als nach Regeln der Erfahrung eine Chance besteht: daß es
k
stets in gleicher Art tatsächlich abläuft. (Sinnhaft adäquat in diesem Wortverstand ist z. B. die nach den uns geläufigen Normen des Rechnens oder Denkens richtige Lösung eines Rechenexempels. Kausal adäquat ist – im Umfang des statistischen Vorkommens – die nach erprobten Regeln der Erfahrung stattfindende Wahrscheinlichkeit einer – von jenen uns heute geläufigen Normen aus gesehen – „richtigen“ oder „falschen“ Lösung, also auch eines typischen „Rechenfehlers“ oder einer typischen „Problemverschlingung“).[159]A: sie
26
Kausale Erklärung bedeutet also die Feststellung: daß nach einer irgendwie abschätzbaren, im – seltenen – Idealfall: zahlenmäßig angebbaren, Wahrscheinlichkeitsregel auf einen bestimmten beobachteten (inneren oder äußeren) Vorgang ein bestimmter anderer Vorgang folgt (oder: mit ihm gemeinsam auftritt).[159] Zur „Problemverschlingung“ vgl. oben, S. 151, Hg.-Anm. 13.
Eine richtige kausale Deutung eines konkreten Handelns bedeutet: daß der äußere Ablauf und das Motiv zutreffend und zugleich in ihrem Zusammenhang sinnhaft verständlich erkannt sind. Eine richtige kausale Deutung typischen Handelns (verständlicher Handlungstypus) bedeutet: daß der als typisch behauptete Hergang sowohl (in irgendeinem Grade) sinnadäquat erscheint wie (in irgendeinem Grade) als kausal adäquat festgestellt werden kann. Fehlt die Sinnadäquanz, dann liegt selbst bei größter und zahlenmäßig in ihrer Wahrscheinlichkeit präzis angebbarer Regelmäßigkeit des Ablaufs (des äußeren sowohl wie des psychischen) nur eine unverstehbare (oder nur unvollkommen verstehbare) statistische Wahrscheinlichkeit vor. Andererseits bedeutet für die Tragweite soziologischer Erkenntnisse selbst die evidenteste Sinnadäquanz nur in dem Maß eine richtige kausale Aussage, als der Beweis für das Bestehen einer (irgendwie [A 6]angebbaren) Chance erbracht wird, daß das Handeln den sinnadäquat erscheinenden Verlauf tatsächlich mit angebbarer Häufigkeit oder Annäherung (durchschnittlich oder im „reinen“ Fall) zu nehmen pflegt. Nur solche statistische Regelmäßigkeiten, welche einem verständlichen gemeinten Sinn eines sozialen Handelns entsprechen, sind (im hier gebrauchten Wortsinn) verständliche Handlungstypen, also: „soziologische Regeln“. Nur solche rationalen [160]Konstruktionen eines sinnhaft verständlichen Handelns sind soziologische Typen realen Geschehens, welche in der Realität wenigstens in irgendeiner Annäherung beobachtet werden können. Es ist bei weitem nicht an dem: daß parallel der erschließbaren Sinnadäquanz immer auch die tatsächliche Chance der Häufigkeit des ihr entsprechenden Ablaufs wächst. Sondern ob dies der Fall ist, kann in jedem Fall nur die äußere Erfahrung zeigen. – Statistik gibt es (Absterbestatistik, Ermüdungsstatistik, Maschinenleistungsstatistik, Regenfallstatistik) von sinnfremden Vorgängen genau im gleichen Sinn wie von sinnhaften. Soziologische Statistik aber (Kriminalstatistik, Berufsstatistik, Preisstatistik, Anbaustatistik) nur von den letzteren (Fälle, welche beides enthalten: etwa Erntestatistik, sind selbstredend häufig).
8. Vorgänge und Regelmäßigkeiten, welche, weil unverstehbar, im hier gebrauchten Sinn des Wortes nicht als „soziologische Tatbestände“ oder Regeln bezeichnet werden, sind natürlich um deswillen nicht etwa weniger wichtig. Auch nicht etwa für die Soziologie im hier betriebenen Sinne des Wortes (der ja eine Begrenzung auf „verstehende Soziologie“ enthält, welche niemandem aufgenötigt werden soll und kann). Sie rücken nur, und dies allerdings methodisch ganz unvermeidlich, in eine andere Stelle als das verstehbare Handeln: in die von „Bedingungen“, „Anlässen“, „Hemmungen“, „Förderungen“ desselben.
9. Handeln im Sinn sinnhaft verständlicher Orientierung des eignen Verhaltens gibt es für uns stets nur als Verhalten von einer oder mehreren einzelnen Personen.
Für andre Erkenntniszwecke mag es nützlich oder nötig sein, das Einzelindividuum z. B. als eine Vergesellschaftung von „Zellen“ oder einen Komplex biochemischer Reaktionen, oder sein „psychisches“ Leben als durch (gleichviel wie qualifizierte) Einzelelemente konstituiert aufzufassen. Dadurch werden zweifellos wertvolle Erkenntnisse (Kausalregeln) gewonnen. Allein wir verstehen dies in Regeln ausgedrückte Verhalten dieser Elemente nicht. Auch nicht bei psychischen Elementen, und zwar: je naturwissenschaftlich exakter sie gefaßt werden, desto weniger: zu einer Deutung aus einem gemeinten Sinn ist gerade dies niemals der Weg. Für die Soziologie (im hier gebrauchten Wortsinn, ebenso wie für die Geschichte) ist aber gerade der Sinnzusammenhang des Handelns Objekt der Erfassung. Das Verhalten der physiologischen Einheiten, etwa: der Zellen[,] oder irgendwelcher psychischer Elemente können wir (dem Prinzip nach wenigstens) zu beobachten oder aus Beobachtungen zu erschließen suchen, Regeln („Gesetze“) dafür gewinnen und Einzelvorgänge mit deren Hilfe kausal „erklären“, d. h.: unter Regeln bringen. Die Deutung des Handelns nimmt jedoch von diesen Tatsachen und Regeln nur soweit und nur in dem Sinn Notiz, wie von irgendwelchen anderen (z. B. von physikalischen, astronomischen, geologischen, meteorologischen, geographi[161]schen, botanischen, zoologischen, physiologischen, anatomischen, von sinnfremden psychopathologischen oder von den naturwissenschaftlichen Bedingungen von technischen) Tatbeständen.
Für wiederum andere (z. B. juristische) Erkenntniszwecke oder für praktische Ziele kann es andererseits zweckmäßig und geradezu unvermeidlich sein: soziale Gebilde („Staat“, „Genossenschaft“, „Aktiengesellschaft“, „Stiftung“) genau so zu behandeln, wie Einzelindividuen (z. B. als Träger von Rechten und Pflichten oder als Täter rechtlich relevanter Handlungen). Für die verstehende Deutung des Handelns durch die Soziologie sind dagegen diese Gebilde lediglich Abläufe und Zusammenhänge spezifischen Handelns einzelner Menschen, da diese allein für uns verständliche Träger von sinnhaft orientiertem Handeln sind. Trotzdem kann die Soziologie auch für ihre Zwecke jene kollektiven Gedankengebilde anderer Betrachtungsweisen nicht etwa ignorieren. Denn die Deutung des Handelns hat zu jenen Kollektivbegriffen folgende beiden
l
Beziehungen: a) Sie selbst ist oft genötigt, mit ganz ähnlichen (oft mit ganz gleichartig bezeichneten) Kollektivbegriffen zu arbeiten, um überhaupt eine verständliche Terminologie zu gewinnen. Die Juristen- sowohl wie die Alltagssprache bezeichnet z. B. als „Staat“ sowohl den Rechtsbegriff wie jenen Tatbestand sozialen Handelns, für welchen die Rechtsregeln gelten wollen. Für die Soziologie besteht der Tatbestand „Staat“ nicht notwendig nur oder gerade aus den rechtlich relevanten Bestandteilen. Und jedenfalls gibt es für sie keine „handelnde“ Kollektivpersönlichkeit. Wenn sie von „Staat“ oder von „Nation“ oder von „Aktiengesellschaft“ oder von „Familie“ oder von „Armeekorps“ oder von ähnlichen „Gebilden“ spricht, so meint sie damit vielmehr lediglich einen bestimmt gearteten Ablauf tatsächlichen, oder als möglich [A 7]konstruierten sozialen Handelns einzelner, schiebt also dem juristischen Begriff, den sie um seiner Präzision und Eingelebtheit willen verwendet, einen gänzlich anderen Sinn unter. – b) Die Deutung des Handelns muß von der grundlegend wichtigen Tatsache Notiz nehmen: daß jene dem Alltagsdenken oder dem juristischen (oder anderem Fach-)Denken angehörigen Kollektivgebilde Vorstellungen von etwas teils Seiendem, teils Geltensollendem in den Köpfen realer Menschen (der Richter und Beamten nicht nur, sondern auch des „Publikums“) sind, an denen sich deren Handeln orientiert[,] und daß sie als solche eine ganz gewaltige, oft geradezu beherrschende, kausale Bedeutung für die Art des Ablaufs des Handelns der realen Menschen haben. Vor allem als Vorstellungen von etwas Gelten- (oder auch: Nicht-Gelten-)Sollendem. (Ein moderner „Staat“ besteht zum nicht unerheblichen Teil deshalb in dieser Art: – als Komplex eines spezifischen Zusammenhandelns von Menschen, – weil bestimmte [162]Menschen ihr Handeln an der Vorstellung orientieren, daß er bestehe oder so bestehen solle: daß also Ordnungen von jener juristisch-orientierten Art gelten. Darüber später.)[161]Lies: drei
27
Während für die eigene Terminologie der Soziologie (litt. a) es möglich, wennschon äußerst pedantisch und weitläufig, wäre: diese von der üblichen Sprache nun einmal nicht nur für das juristische Geltensollen, sondern auch für das reale Geschehen gebrauchten Begriffe ganz zu eliminieren und durch ganz neu gebildete Worte zu ersetzen, wäre wenigstens für diesen wichtigen Sachverhalt natürlich selbst dies ausgeschlossen. – c) Die Methode der sogenannten „organischen“ Soziologie (klassischer Typus: Schäffles geistvolles Buch: Bau und Leben des sozialen Körpers) [162]Kap. I, § 6, unten, S. 185–189. Ferner die geplante Neufassung der Rechtssoziologie. Vgl. dazu den Editorischen Bericht, oben, S. 110 f.
28
sucht das gesellschaftliche Zusammenhandeln durch Ausgehen vom „Ganzen“ (z. B. einer „Volkswirtschaft“) zu erklären, innerhalb dessen dann der einzelne und sein Verhalten ähnlich gedeutet werden Schäffle, Bau I, II2. In seinen Vorlesungen „Allgemeine (,theoretischeʼ) Nationalökonomie“ hielt Weber Schäffles Buch freilich keineswegs für geistvoll, sondern für eine „Misgeburt“ und fragte: „Was hilft die Analogie v[on] Telegraphen u. Nerven“? (vgl. MWG III/1, S. 369). Zur „organischen Soziologie“ der Zeit vgl. auch Barth, Paul, Philosophie der Geschichte als Soziologie, Erster Teil: Grundlegung und kritische Übersicht, 2., durchges. und sehr erw. Aufl. – Leipzig: Reisland 1915, „Dritte Abteilung. Die biologische Soziologie“, S. 243–403; zu Schäffle bes. ebd., S. 352–362.
m
, wie etwa die Physiologie die Stellung eines körperlichen „Organs“ im „Haushalt“ des Organismus (d. h. vom Standpunkt von dessen „Erhaltung“ aus) behandelt. (Vgl. das berühmte Kolleg-Diktum eines Physiologen: „§ x: Die Milz. Von der Milz wissen wir nichts, meine Herren. Soweit die Milz!“[162]A: wird
29
Tatsächlich „wußte“ natürlich der Betreffende von der Milz ziemlich viel: Lage, Größe, Form usw. – nur die „Funktion“ konnte er nicht angeben, und dies Unvermögen nannte er „Nichtswissen“). Inwieweit bei andren Disziplinen diese Art der funktionalen Betrachtung der „Teile“ eines „Ganzen“ (notgedrungen) definitiv sein muß, bleibe hier unerörtert: es ist bekannt, daß die biochemische und biomechanische Betrachtung sich grundsätzlich nicht damit begnügen möchte. Für eine deutende Soziologie kann eine solche Ausdrucksweise 1) praktischen Veranschaulichungs- und provisorischen Orientierungszwecken dienen (und in dieser Funktion höchst nützlich und nötig – aber freilich auch, bei Überschätzung ihres Erkenntniswerts und falschem Begriffsrealismus: höchst nachteilig – sein). Und 2): Sie allein kann uns unter Umständen dasjenige soziale Handeln herausfinden helfen, dessen deutendes Verstehen für die Erklärung eines Zusammenhangs wichtig ist. Aber an diesem Punkt beginnt erst die Arbeit der Soziologie (im hier verstandenen Wortsinn). Wir sind ja bei „sozialen [163]Gebilden“ (im Gegensatz zu „Organismen“) in der Lage: über die bloße Feststellung von funktionellen Zusammenhängen und Regeln („Gesetzen“) hinaus etwas aller „Naturwissenschaft“ (im Sinn der Aufstellung von Kausalregeln für Geschehnisse und Gebilde und der „Erklärung“ der Einzelgeschehnisse daraus) ewig Unzugängliches zu leisten: eben das „Verstehen“ des Verhaltens der beteiligten Einzelnen, während wir das Verhalten z. B. von Zellen nicht „verstehen“, sondern nur funktionell erfassen und dann nach Regeln seines Ablaufs feststellen können. Diese Mehrleistung der deutenden gegenüber der beobachtenden Erklärung ist freilich durch den wesentlich hypothetischeren und fragmentarischeren Charakter der durch Deutung zu gewinnenden Ergebnisse erkauft. Aber dennoch: sie ist gerade das dem soziologischen Erkennen Spezifische. Das Zitat konnte nicht nachgewiesen werden.
Inwieweit auch das Verhalten von Tieren uns sinnhaft „verständlich“ ist und umgekehrt: – beides in höchst unsicherm Sinn und problematischem Umfang, – und inwieweit also theoretisch es auch eine Soziologie der Beziehungen des Menschen zu Tieren (Haustieren, Jagdtieren) geben könne (viele Tiere „verstehen“ Befehl, Zorn, Liebe, Angriffsabsicht und reagieren darauf offenbar vielfach nicht ausschließlich mechanisch-instinktiv, sondern irgendwie auch bewußt sinnhaft und erfahrungsorientiert), bleibt hier völlig unerörtert. An sich ist das Maß unsrer Einfühlbarkeit bei dem Verhalten von „Naturmenschen“ nicht wesentlich größer. Wir haben aber sichere Mittel, den subjektiven Sachverhalt beim Tier festzustellen, teils garnicht, teils in nur sehr unzulänglicher Art: die Probleme der Tierpsychologie sind bekanntlich ebenso interessant wie dornenvoll.
30
Es bestehen insbesondere bekanntlich Tiervergesellschaftungen der verschiedensten Art: monogame und polygame „Familien“, Herden, Rudel, endlich funktionsteilige „Staaten“. (Das Maß der Funktionsdifferenzierung dieser Tiervergesellschaftungen geht keineswegs parallel mit dem Maß der Organ- [A 8]oder der morphologischen Entwicklungs-Differenzierung der betreffenden Tiergattung. So ist die Funktionsdifferenzierung bei den Termiten und sind infolgedessen deren Artefakte weit differenzierter als bei [164]den Ameisen und Bienen). Hier ist selbstverständlich die rein funktionale Betrachtung: die Ermittlung der für die Erhaltung[,] d. h. die Ernährung, Verteidigung, Fortpflanzung, Neubildung[,] der betreffenden Tiergesellschaften entscheidenden Funktionen der einzelnen Typen von Individuen („Könige“, „Königinnen“, „Arbeiter“, „Soldaten“, „Drohnen“, „Geschlechtstiere“, „Ersatz-Königinnen“ usw.)[,][163] Bei den folgenden Ausführungen über Tiergesellschaften hält sich Max Weber vor allem an das unten (S. 164 mit Hg.-Anm. 33) zitierte Buch von Escherich, Termiten. Ein Exemplar fand sich in Webers Handbibliothek (Max Weber-Arbeitsstelle, BAdW München), mit Anstreichungen vor allem in der „Einleitung“ sowie im „Ersten“ und im „Zweiten Kapitel“. Zur Frage der Funktionsdifferenzierung in Tiergesellschaften heißt es dort: „Daraus erklärt sich auch, daß zwischen der Höhe der staatlichen Organisation und der systematischen Stellung der betreffenden Tiere keine direkten Relationen bestehen, so daß also im System tiefstehende Tiere höhere soziale Äußerungen erkennen lassen können, als hochstehende.“ (ebd., S. 5). Zur Tierpsychologie: „Vor allem fehlt uns noch fast jeglicher Einblick in die Termitenpsyche.“ Und weiter: „Die Termitenpsychologie ist noch völlig eine terra incognita, die der gründlichen Bearbeitung in erster Linie bedarf.“ (ebd., S. 5).
31
sehr oft mindestens für jetzt das Definitive, mit dessen Feststellung sich die Forschung begnügen muß. Was darüber hinausging, waren lange Zeit lediglich Spekulationen oder Untersuchungen über das Maß, in welchem Erbgut einerseits, Umwelt andererseits an der Entfaltung dieser „sozialen“ Anlagen beteiligt sein könnten. (So namentlich die Kontroversen zwischen Weismann – dessen „Allmacht der Naturzüchtung“ in ihrem Unterbau stark mit ganz außerempirischen Deduktionen arbeitete – und Götte). [164]Zitate aus Escherich, Termiten, S. 42 ff.
32
Darüber aber, daß es sich bei jener Beschränkung auf die funktionale Erkenntnis eben um ein notgedrungenes und, wie gehofft wird, nur provisorisches Sichbegnügen handelt, ist sich die ernste Forschung natürlich völlig einig. (S[iehe] z. B. für den Stand der Termiten-Forschung die Schrift von Escherich 1909). Weismann, Naturzüchtung, vertrat in der Auseinandersetzung mit Herbert Spencer, der ihm gegenüber die natürliche Selektion bezweifelt hatte, die These, es sei tatsächlich schwierig, „sich diesen Selectionsprocess wirklich im Einzelnen vorzustellen“ (ebd., S. 31). Man könne nur „im Allgemeinen mit Darwin sagen, daß Selection durch Häufung ,kleinster Variationenʼ arbeitet, und daraus schließen, daß diese ,kleinsten Variationenʼ Selectionswerth besitzen müssen“ (ebd., S. 35). Ein stringenter Beweis aber fehle noch, und es sei eine offene Frage, ob er sich jemals führen lasse. Dies berechtige allerdings nicht dazu, an die Stelle der natürlichen Selektion die Vererbung erworbener Eigenschaften zu setzen. Weismann behauptet, daß uns die Naturzüchtung als Erklärungsprinzip durch die „Macht der Logik“ aufgezwungen sei (ebd., S. 42). Auch Alexander Goette folgte in dieser Frage eher Darwin als Lamarck, obgleich er starke Zweifel an Darwins Erklärung der Entstehung neuer Arten hegte. Er suchte die Ursachen dafür nicht in zufälligen äußeren Einflüssen und im Nützlichkeitsprinzip, sondern „im variierenden Organismus selbst“. Dazu Goette, Alexander, Lehrbuch der Zoologie. – Leipzig: Wilhelm Engelmann 1902, S. 21. Eine Kontroverse zwischen beiden, die Weber behauptet, ließ sich nicht nachweisen. Weber diskutiert Weismanns Position bereits in seinen Vorlesungen „Allgemeine (,theoretischeʼ) Nationalökonomie“, MWG III/1 , S. 351 f.
33
Man möchte eben nicht nur die ziemlich leicht erfaßbare „Erhaltungswichtigkeit“ der Funktionen jener einzelnen differenzierten Typen einsehen und die Art, wie, ohne Annahme der Vererbung erworbener Eigenschaften [165]oder umgekehrt im Falle dieser Annahme (und dann: bei welcher Art von Deutung dieser Annahme), jene Differenzierung erklärlich ist, dargelegt erhalten, sondern auch wissen: 1. was denn den Ausschlag der Differenzierung aus dem noch neutralen, undifferenzierten, Anfangsindividuum entscheidet, – 2. was das differenzierte Individuum veranlaßt, sich (im Durchschnitt) so zu verhalten[,] wie dies tatsächlich dem Erhaltungsinteresse der differenzierten Gruppe dient. Wo immer die Arbeit in dieser Hinsicht fortschritt, geschah dies durch Nachweis (oder Vermutung) von chemischen Reizen oder physiologischen Tatbeständen (Ernährungsvorgänge, parasitäre Kastration usw.) Escherich, Termiten. Wenn Weber davon spricht, daß sich die zeitgenössische zoologische Erforschung von Tiergesellschaften auf „funktionale“ Fragestellungen beschränke, meint er wohl dieses Buch. Ein Desiderat der zoologischen Forschung sah Escherich darin, „eine brauchbare Methode für die experimentelle Forschung“ zu finden (ebd., S. 5). Zur „funktionalen“ Analyse von Termitengesellschaften siehe ebd., S. 8–30, insbes. S. 24–30 (Kap. „Funktionen der einzelnen Kasten“).
34
bei den Einzelindividuen auf experimentellem Wege. Inwieweit die problematische Hoffnung besteht, experimentell auch die Existenz „psychologischer“ und „sinnhafter“ Orientierung wahrscheinlich zu machen, könnte heute wohl selbst der Fachmann kaum sagen. Ein kontrollierbares Bild der Psyche dieser sozialen Tierindividuen auf der Basis sinnhaften „Verstehens“ erscheint selbst als ideales Ziel wohl nur in engen Grenzen[165] Dazu Escherich, Termiten, S. 23, der geneigt war, „der Nahrung den vornehmsten Einfluß auf die Entwicklungsrichtung zuzuschreiben“. Zur „parasitären Kastration“ – Parasiten im Darm verhindern bei Arbeiterlarven die Ausbildung der Genitalanlagen – ebd.
n
erreichbar. Jedenfalls ist nicht von da aus das „Verständnis“ menschlichen sozialen Handelns zu erwarten, sondern grade umgekehrt: mit menschlichen Analogien wird dort gearbeitet und muß gearbeitet werden.[165]A: Grenze
35
Erwartet darf vielleicht werden: daß diese Analogien uns einmal für die Fragestellung nützlich werden: wie in den Frühstadien der menschlichen sozialen Differenzierung der Bereich rein mechanisch-instinktiver Differenzierung im Verhältnis zum individuell sinnhaft Verständlichen und weiter zum bewußt rational Geschaffenen einzuschätzen ist. Die verstehende Soziologie wird sich selbstverständlich klar sein müssen: daß für die Frühzeit auch der Menschen die erstere Komponente schlechthin überragend ist[,] und auch für die weiteren Entwicklungsstadien sich ihrer steten Mitwirkung (und zwar: entscheidend wichtigen Mitwirkung) bewußt bleiben. Alles „traditionale“ Handeln (§ 2) Escherich warnt zwar davor, Tiergesellschaften zu vermenschlichen, weil Tiergesellschaften ausschließlich instinktgesteuert seien, was für Menschengesellschaften nicht zutreffe (Escherich, Termiten, S. 42 ff. und S. 119). Dennoch benutzte er für die Beschreibung dieser Tiergesellschaften menschliche Analogien. Dazu oben, S. 164 mit Hg.-Anm. 31.
36
und breite Schichten des „Charisma“ (K. III) Kap. I, § 2, unten, S. 175.
37
als des Keims psychischer „Ansteckung“ Kap. III, § 10 ff., unten, S. 490 ff.
38
und dadurch Trägers soziologischer „Entwicklungsreize“ stehen [166]solchen nur biologisch begreifbaren, nicht oder nur in Bruchstücken verständlich deutbaren und motivationsmäßig erklärbaren, Hergängen mit unmerklichen Übergängen sehr nahe. Das alles entbindet aber die verstehende Soziologie nicht von der Aufgabe: im Bewußtsein der engen Schranken, in die sie gebannt ist, zu leisten, was eben wieder nur sie leisten kann. Von „psychischer Ansteckung“ spricht Gustave Le Bon in seinen Ausführungen [166]über die Masse, Le Bon, Psychologie, bes. S. 11–22 und S. 27–37. In der Masse veränderten sich die Reaktionen des Individuums: „Dans une foule, tout sentiment, tout acte est contagieux, et contagieux à ce point que lʼindividu sacrifie très facilement son intérêt personnel à lʼintérêt collectif“ (ebd., S. 18). Für Le Bon hängt die Ansteckung auf das engste mit der „suggestibilité“ zusammen: „Je veux parler de la suggestibilité, dont la contagion mentionnée plus haut nʼest dʼailleurs quʼun effet“ (ebd.). Weber benutzte möglicherweise nicht das französische Original, sondern die deutsche Übersetzung (Le Bon, Psychologie der Massen), die 1908 in der Reihe Philosophisch-soziologische Bücherei bei Klinkhardt in Leipzig erschienen war, übrigens zusammen mit der Übersetzung von Gabriel Tardes Schrift „Die sozialen Gesetze. Skizze zu einer Soziologie“ und Emile Durkheims Schrift „Die Methode der Soziologie“. Zweck der Reihe war es u. a., Autoren aus dem Ausland in Deutschland bekannt zu machen.
Die verschiedenen Arbeiten von Othmar Spann, oft reich an guten Gedanken neben freilich gelegentlichen Mißverständnissen und, vor allem, Argumentationen auf Grund nicht zur empirischen Untersuchung gehöriger reiner Werturteile, haben also unzweifelhaft recht mit der freilich von niemand ernstlich bestrittenen Betonung der Bedeutung der funktionalen Vorfragestellung (er nennt dies: „universalistische Methode“) für jede Soziologie.
39
Wir müssen gewiß erst wissen: welches Handeln funktional, vom Standpunkt der „Erhaltung“ (aber weiter und vor allem eben doch auch: der Kultureigenart!) und: einer bestimmt gerichteten Fortbildung eines sozialen Handelnstyps wichtig ist, um dann die Frage stellen zu können: wie kommt dies Handeln zustande? welche Motive bestimmen es? Man muß erst wissen: was ein „König“, „Beamter“, „Unternehmer“, „Zuhälter“, „Magier“ leistet: – welches typische „Handeln“ (das allein ja ihn zu einer dieser Kategorien stempelt) also für die Analyse wichtig ist [167]und in Betracht kommt, ehe man an diese Analyse gehen kann („Wertbezogenheit“ im Sinn H[einrich] Rickerts). Spann legt seine „universalistische Methode“ beispielsweise in dem Buch „Kurzgefaßtes System der Gesellschaftslehre“ dar, dort bes. „Erstes Buch. Einleitung. Methodische Vorfragen der Gesellschaftslehre“ (Spann, System, S. 1–20) und „Drittes Buch, II. Kapitel. Der Universalismus“ (ebd., S. 244–284). Spanns Methode ist bereits entwickelt in Spann, Wirtschaft und Gesellschaft. Dieses Buch benutzt Weber in seiner begonnenen, aber nach wenigen Seiten abgebrochenen Kritik an dem soziologischen Ansatz von Georg Simmel. Vgl. Weber, Max, Georg Simmel als Soziologe und Theoretiker der Gesellschaft, Deponat Max Weber, BSB München, Ana 446, OM 4 (MWG I/12). Im Manuskript heißt es: „Es kann dabei in manchen wesentlichen Punkten an die scharfsinnige Kritik angeknüpft werden, welche Dr O[thmar] Spann, allerdings vor Erscheinen des letzten Werkes [gemeint ist die „Soziologie“ von Simmel] an Simmelʼs Begriffen von ,Gesellschaft‘ und ,Soziologie‘ geübt hat. Ich verweise auf dessen Ausführungen in seinem Buch: Wirtschaft und Gesellschaft, Dresden 1907[,] speziell S. 192 ff.[,] und bemerke, daß ich dieselbe[n] im Folgenden nicht zu jedem einzelnen Satz erneut zitiere.“ (ebd., S. III). Dazu auch die Einleitung, oben, S. 30 ff.
40
Aber erst diese Analyse leistet ihrerseits das, was das soziologische Verstehen des Handelns von typisch [A 9]differenzierten einzelnen Menschen (und: nur bei den Menschen) leisten kann und also: soll. Das ungeheure Mißverständnis jedenfalls, als ob eine „individualistische“ Methode eine (in irgendeinem möglichen Sinn) individualistische Wertung bedeute, ist ebenso auszuschalten, wie die Meinung: der unvermeidlich (relativ) rationalistische Charakter der Begriffsbildung bedeute den Glauben an das Vorwalten rationaler Motive oder gar: eine positive Wertung des „Rationalismus“. Auch eine sozialistische Wirtschaft müßte soziologisch genau so „individualistisch“, d. h.: aus dem Handeln der Einzelnen: – der Typen von „Funktionären“, die in ihr auftreten, – heraus[,] deutend verstanden werden, wie etwa die Tauschvorgänge durch die Grenznutzlehre[167] Zum Begriff der theoretischen Wertbeziehung, die sich sowohl auf die Auswahl wie auf die Konstitution des historischen Objekts („historisches Individuum“) bezieht, vgl. Rickert, Grenzen2, Viertes Kapitel, III, S. 333 ff.; zuvor schon S. 316 ff., bes. S. 325.
41
(oder eine zu findende „bessere“, aber in diesem Punkt ähnliche Methode). Denn stets beginnt auch dort die entscheidende empirisch-soziologische Arbeit erst mit der Frage: welche Motive bestimmten und bestimmen die einzelnen Funktionäre und Glieder dieser „Gemeinschaft“, sich so zu verhalten, daß sie entstand und fortbesteht? Alle funktionale (vom „Ganzen“ ausgehende) Begriffsbildung leistet nur Vorarbeit dafür, deren Nutzen und Unentbehrlichkeit – wenn sie richtig geleistet wird – natürlich unbestreitbar ist. Für Weber gehört die „Grenznutzlehre“ zum Kernbestand der abstrakten Theorie in der Nationalökonomie. Er identifiziert diese hauptsächlich mit den Werken der Österreichischen Schule, insbesondere mit den Arbeiten von Carl Menger und Friedrich von Wieser. Methodisch teilt er deren individualistischen und subjektivistischen Ansatz: Der Wert einer Nutzleistung für den Wirtschaftenden hänge von dessen subjektiver Bedürfnis- und Sättigungsskala ab: Je stärker das Bedürfnis nach einer Nutzleistung, desto höher die Wertschätzung, je gesättigter das Bedürfnis, desto geringer. In den Vorlesungen über „Allgemeine (,theoretische‘) Nationalökonomie“ formuliert Weber das sich daraus ergebende subjektive Wertgesetz wie folgt: „Werthschätzung bei begrenzten Gütern nach Grenznutzen, bei vermehrbaren Gütern nach Grenznutzen u. Grenzkosten.“ Und er fügt hinzu: „nicht weil etwas kostet, werthvoll, sondern weil werthvoll, nimmt man die Kosten in Kauf.“ (MWG III/1, S. 253). Bei Wieser findet sich unter anderem folgende Formulierung: „Bei jedem teilbaren Bedürfnis wird innerhalb jedes Bedürfnisabschnittes der mit der ersten Verwendungseinheit vorzunehmende Befriedigungsakt mit der höchsten Intensität begehrt, jede Verwendung weiterer Einheiten derselben Art wird mit abnehmender Intensität begehrt, bis der Sättigungspunkt erreicht ist, darüber hinaus schlägt das Bedürfnis in Widerwillen um.“ (Wieser, Theorie, S. 148). Das Wertgesetz bildet bei Wieser die Grundlage für das Preisgesetz; vgl. dazu Schluchter, Entstehungsgeschichte, in: MWG I/24, S. 22–24.
10. Die „Gesetze“, als welche man manche Lehrsätze der verstehenden Soziologie zu bezeichnen gewohnt ist, – etwa das Greshamsche „Gesetz“ [168]– sind durch Beobachtung erhärtete typische Chancen eines bei Vorliegen gewisser Tatbestände zu gewärtigenden Ablaufes von sozialem Handeln, welche aus typischen Motiven und typisch gemeintem Sinn der Handelnden verständlich sind.
42
Verständlich und eindeutig sind sie im Höchstmaß soweit, als rein zweckrationale Motive dem typisch beobachteten Ablauf zugrunde liegen (bzw. dem methodisch konstruierten Typus aus Zweckmäßigkeitsgründen zugrunde gelegt werden), und als dabei die Beziehung zwischen Mittel und Zweck nach Erfahrungssätzen eindeutig ist (beim „unvermeidlichen“ Mittel). In diesem Fall ist die Aussage zulässig: daß, wenn streng zweckrational gehandelt würde, so und nicht anders gehandelt werden müßte (weil den Beteiligten im Dienste ihrer – eindeutig angebbaren – Zwecke aus „technischen“ Gründen nur diese und keine anderen Mittel zur Verfügung stehen). Gerade dieser Fall zeigt zugleich: wie irrig es ist, als die letzte „Grundlage“ der verstehenden Soziologie irgendeine „Psychologie“ anzusehen.[168] Zum Greshamschen Gesetz vgl. oben, S. 157 mit Hg.-Anm. 24. Ein soziologisches Gesetz stellt nach Max Weber nicht nur den (statistischen) Zusammenhang zwischen zwei Größen fest, sondern auch die diesem zugrundeliegenden Motive der Handelnden. Vgl. dazu die Bemerkungen zum Verhältnis von Sinnadäquanz und Kausaladäquanz in Kap. I, § 1, Nr. 7, oben, S. 159 f. An anderer Stelle beschreibt Weber den Charakter ökonomischer Gesetze wie folgt: Sie seien „Schemata rationalen Handelns […], die nicht durch psychologische Analyse der Individuen, sondern durch idealtypische Wiedergabe des Preiskampfs-Mechanismus aus der so in der Theorie hergestellten objektiven Situation deduziert werden, welche da, wo sie ,rein‘ zum Ausdruck kommt, dem in den Markt verflochtenen Individuum nur die Wahl läßt zwischen der Alternative: ,teleologische‘ Anpassung an den ,Markt‘ oder ökonomischer Untergang.“ Weber, Roscher und Knies III, S. 115 f.
43
Unter „Psychologie“ versteht heute jeder etwas anderes. Ganz bestimmte methodische Zwecke rechtfertigen für eine naturwissenschaftliche Behandlung gewisser Vorgänge die Trennung [169]von „Physischem“ Weber wendet sich sowohl gegen eine psychologistische Erkenntnistheorie als auch gegen eine psychologische Fundierung von Einzelwissenschaften wie Soziologie und Ökonomik. Erkenntnispsychologie und Erkenntnislogik seien scharf zu trennen, und unter den empirischen Wissenschaften gebe es keine Hierarchie. Der Neigung etwa in der Ökonomik, eine psychologische Begründung der (subjektiven) Werttheorie zu suchen, „,psychologische‘ Abstraktionen“ an die Stelle der Analyse einer „generell gegebenen (,objektiven‘) Situation“ zu setzen (vgl. Weber, Roscher und Knies III, S. 93, Fn. 5), könnten selbst Vertreter der Österreichischen Schule nicht widerstehen. Im Aufsatz über Roscher und Knies heißt es kategorisch: „Mit irgend welcher ,Psychologie‘, sei sie ,Individual‘- oder ,Sozial‘-Psychologie, hat die ,Grenznutzlehre‘ auch nicht das allergeringste zu schaffen“ (Weber, Roscher und Knies III, S. 93 f., Fn. 5). Diese Ablehnung einer Sonderrolle der Psychologie bedeutet freilich nicht, wie Weber dort bereits betont, daß man die wissenschaftlichen Erkenntnisse der empirischen Psychologie, wie auch die jeder anderen Einzelwissenschaft, für die Lösung ökonomischer und soziologischer Erklärungsprobleme nicht verwenden solle. Sie bedeutet auch keine Ablehnung des psychologischen Verstehens in Ökonomik und Soziologie.
o
und „Psychischem“, welche in diesem Sinn den Disziplinen vom Handeln fremd ist.[169]A: vom „Physischen“
44
Die Ergebnisse einer wirklich nur das im Sinn naturwissenschaftlicher Methodik „Psychische“ mit Mitteln der Naturwissenschaft erforschenden und also ihrerseits nicht – was etwas ganz andres ist – menschliches Verhalten auf seinen gemeinten Sinn hin deutenden psychologischen Wissenschaft, gleichviel wie sie methodisch geartet sein möge, können natürlich[,] genau ebenso wie diejenigen irgendeiner anderen Wissenschaft, im Einzelfall Bedeutung für eine soziologische Feststellung gewinnen und haben sie oft in hohem Maße. Aber irgendwelche generell näheren Beziehungen als zu allen anderen Disziplinen hat die Soziologie zu ihr nicht. Der Irrtum liegt im Begriff des „Psychischen“: Was nicht „physisch“ sei, sei „psychisch“. Aber der Sinn eines Rechenexempels, den jemand meint, ist doch nicht „psychisch“. Die rationale Überlegung eines Menschen: ob ein bestimmtes Handeln bestimmt gegebenen Interessen nach den zu erwartenden Folgen förderlich sei oder nicht[,] und der entsprechend dem Resultat gefaßte Entschluß werden uns nicht um ein Haar verständlicher durch „psychologische“ Erwägungen. Gerade auf solchen rationalen Voraussetzungen aber baut die Soziologie (einschließlich der Nationalökonomie) die meisten ihrer „Gesetze“ auf. Bei der soziologischen Erklärung von Irrationalitäten des Handelns dagegen kann die verstehende Psychologie in der Tat unzweifelhaft entscheidend wichtige Dienste leisten. Aber das ändert an dem methodologischen Grundsachverhalt nichts.[169] Weber folgt hier dem Vorschlag Heinrich Rickerts, bei der Einteilung der Wissenschaften logischen Kriterien Vorrang vor ontischen zu geben und bei den ontischen nicht nach physisch-psychisch, sondern nach sinnfrei-sinnhaft zu fragen. Entscheidend ist also nicht, ob Objekte und Vorgänge physischer oder psychischer Natur sind, sondern ob sie als Träger von Sinn betrachtet werden. Dazu insbesondere Webers Auseinandersetzung mit Rudolf Stammler, wo er vier Begriffe von ,Natur‘ unterscheidet: Natur als Komplex von Objekten, Natur als Betrachtungsweise, Natur als die Gesamtheit des Empirischen und Natur als das Sinnlose, „richtiger: ,Natur‘ wird ein Vorgang, wenn wir bei ihm nach einem ,Sinn‘ nicht fragen.“ Weber, Stammlers Überwindung, S. 119 f. und S. 127 f., Zitat: S. 128.
11. Die Soziologie bildet – wie schon mehrfach als selbstverständlich vorausgesetzt – Typen-Begriffe und sucht generelle Regeln des Geschehens. Im Gegensatz zur Geschichte, welche die kausale Analyse und Zurechnung individueller, kulturwichtiger, Handlungen, Gebilde, Persönlichkeiten erstrebt. Die Begriffsbildung der Soziologie entnimmt ihr Material, als Paradigmata, sehr wesentlich, wenn auch keineswegs ausschließlich, den auch unter den Gesichtspunkten der Geschichte relevanten Realitäten des Handelns. Sie bildet ihre Begriffe und sucht nach ihren Regeln vor allem auch unter dem Gesichtspunkt: ob sie damit der histori[170]schen kausalen Zurechnung der kulturwichtigen Erscheinungen einen Dienst leisten kann. Wie bei jeder generalisierenden Wissenschaft bedingt die Eigenart ihrer Abstraktionen es, daß ihre Begriffe gegenüber der konkreten Realität des Historischen relativ inhaltsleer sein müssen. Was sie dafür zu [A 10]bieten hat, ist gesteigerte Eindeutigkeit der Begriffe. Diese gesteigerte Eindeutigkeit ist durch ein möglichstes Optimum von Sinnadäquanz erreicht, wie es die soziologische Begriffsbildung erstrebt. Diese kann – und das ist bisher vorwiegend berücksichtigt – bei rationalen (wert- oder zweckrationalen) Begriffen und Regeln besonders vollständig erreicht werden. Aber die Soziologie sucht auch irrationale (mystische, prophetische, pneumatische, affektuelle) Erscheinungen in theoretischen und zwar sinnadäquaten Begriffen zu erfassen. In allen Fällen, rationalen wie irrationalen, entfernt sie sich von der Wirklichkeit und dient der Erkenntnis dieser in der Form: daß durch Angabe des Maßes der Annäherung einer historischen Erscheinung an einen oder mehrere dieser Begriffe diese eingeordnet werden kann. Die gleiche historische Erscheinung kann z. B. in einem Teil ihrer Bestandteile „feudal“, im anderen „patrimonial“, in noch anderen „bureaukratisch“, in wieder anderen „charismatisch“ geartet sein.
45
Damit mit diesen Worten etwas Eindeutiges gemeint sei, muß die Soziologie ihrerseits „reine“ („Ideal“-)Typen von Gebilden jener Arten entwerfen, welche je in sich die konsequente Einheit möglichst vollständiger Sinnadäquanz zeigen, eben deshalb aber in dieser absolut idealen reinen Form vielleicht ebensowenig je in der Realität auftreten, wie eine physikalische Reaktion, die unter Voraussetzung eines absolut leeren Raums errechnet ist.[170] Vgl. dazu Kap. III, bes. § 13, unten, S. 527 ff.
46
Nur vom reinen („Ideal“-)Typus her ist soziologische Kasuistik möglich. Daß die Soziologie außerdem nach Gelegenheit auch den Durchschnitts-Typus von der Art der empirisch-statistischen Typen verwendet: – ein Gebilde, welches der methodischen Erläuterung nicht besonders bedarf, versteht sich von selbst. Aber wenn sie von „typischen“ Fällen spricht, meint sie im Zweifel stets den Idealtypus, der seinerseits rational oder irrational sein kann, zumeist (in der nationalökonomischen Theorie z. B. immer) rational ist, stets aber sinnadäquat konstruiert wird. Weber entwickelt diesen Zusammenhang bereits in Roscher und Knies III, S. 106 f.
Man muß sich klar sein, daß auf soziologischem Gebiete „Durchschnitte“ und also „Durchschnittstypen“ sich nur da einigermaßen eindeutig bilden lassen, wo es sich nur um Gradunterschiede qualitativ gleichartigen sinnhaft bestimmten Verhaltens handelt. Das kommt vor. In der Mehrzahl der Fälle ist aber das historisch oder soziologisch relevante Handeln von qualitativ heterogenen Motiven beeinflußt, zwischen denen ein „Durchschnitt“ im eigentlichen Sinn gar nicht zu ziehen ist. Jene idealtypi[171]schen Konstruktionen sozialen Handelns, welche z. B. die Wirtschaftstheorie vornimmt, sind also in dem Sinn „wirklichkeitsfremd“,
47
als sie – in diesem Fall – durchweg fragen: wie würde im Fall idealer und dabei rein wirtschaftlich orientierter Zweckrationalität gehandelt werden, um so das reale[171] Nach Weber operiert die abstrakte Wirtschaftstheorie mit einem konstruierten Wirtschaftssubjekt. Es handle sich um „einen unrealistischen Menschen, analog einer mathematischen Idealfigur.“ (Weber, Erstes Buch. Die begrifflichen Grundlagen der Volkswirtschaftslehre, MWG III/1 , S. 122 f.). Solche Idealtypen haben für ihn rein heuristischen Charakter und sind mehr oder weniger nützlich. In der Methode der Idealtypenbildung sind sich Nationalökonomie und Soziologie gleich. In dem Aufsatz „Kritische Studien auf dem Gebiet der kulturwissenschaftlichen Logik“ heißt es lapidar: „Um die wirklichen Kausalzusammenhänge zu durchschauen, konstruieren wir unwirkliche.“ (Weber, Kritische Studien, in: AfSSp, Band 22, Heft 1, 1906, S. 143–207, Zitat: S. 204; MWG I/7).
p
, durch Traditionshemmungen, Affekte, Irrtümer, Hineinspielen nicht wirtschaftlicher Zwecke oder Rücksichtnahmen mindestens mitbestimmte Handeln 1. insoweit verstehen zu können, als es tatsächlich ökonomisch zweckrational im konkreten Falle mitbestimmt war, oder – bei Durchschnittsbetrachtung – zu sein pflegt, 2. aber auch: gerade durch den Abstand seines realen Verlaufes vom idealtypischen die Erkenntnis seiner wirklichen Motive zu erleichtern. Ganz entsprechend würde eine idealtypische Konstruktion einer konsequenten mystisch bedingten akosmistischen Haltung zum Leben (z. B. zur Politik und Wirtschaft) zu verfahren haben. Je schärfer und eindeutiger konstruiert die Idealtypen sind: je weltfremder sie also, in diesem Sinne, sind, desto besser leisten sie ihren Dienst, terminologisch und klassifikatorisch sowohl wie heuristisch. Die konkrete kausale Zurechnung von Einzelgeschehnissen durch die Arbeit der Geschichte verfährt der Sache nach nicht anders, wenn sie, um z. B. den Verlauf des Feldzuges von 1866 zu erklären, sowohl für Moltke wie für Benedek zunächst (gedanklich) ermittelt (wie sie es schlechthin tun muß):[171]A: reine
48
wie jeder von ihnen, bei voller Erkenntnis der eigenen und der Lage des Gegners, im Fall idealer Zweckrationalität disponiert haben würde, um damit zu vergleichen: wie tatsächlich disponiert worden ist[,] und dann gerade [172]den beobachteten (sei es durch falsche Information, tatsächlichen Irrtum, Denkfehler, persönliches Temperament oder außerstrategische Rücksichten bedingten) Abstand kausal zu erklären. Auch hier ist (latent) eine idealtypische zweckrationale Konstruktion verwendet. – Im Jahre 1866 standen sich in der Schlacht bei Königgrätz Helmuth von Moltke als Oberbefehlshaber auf preußischer Seite und Ludwig von Benedek als Oberbefehlshaber auf österreichischer Seite gegenüber. Benedek wurde am 3. Juli vernichtend geschlagen. Während Moltkes Strategie hoch gelobt wurde, galt die Strategie Benedeks als wenig planvoll und entschlossen. Schon in dem Aufsatz „Roscher und Knies“ wählt Weber Moltkes Strategie als Beispiel für erfolgreiches Handeln. Dabei dient ihm die idealtypisch gefaßte Kriegskunstlehre nicht nur als heuristisches Mittel für die kausale Zurechnung, sondern auch als Maßstab für die Beurteilung der Entscheidungen der Heerführer. Dies ist zugleich ein Beispiel für technische Kritik (Weber, Roscher und Knies III, S. 100 f., Fn. 1).
Idealtypisch sind aber die konstruktiven Begriffe der Soziologie nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich. Das reale Handeln verläuft in der großen Masse seiner Fälle in dumpfer Halbbewußtheit oder Unbewußtheit seines „gemeinten Sinns“. Der Handelnde „fühlt“ ihn mehr unbestimmt[,] als daß er ihn wüßte oder „sich klar machte“, handelt in der Mehrzahl der Fälle triebhaft oder gewohnheitsmäßig. Nur gelegentlich, und bei massenhaft gleichartigem Handeln oft nur von Einzelnen, wird ein (sei es rationaler[,] sei es irrationaler) Sinn des Handelns in das Bewußtsein gehoben. Wirklich effektiv, d. h. voll bewußt und klar, sinnhaftes Handeln ist in der Realität stets nur ein Grenzfall. Auf diesen Tatbestand wird jede historische und soziologische Betrachtung bei Analyse der Realität stets Rück[A 11]sicht zu nehmen haben. Aber das darf nicht hindern, daß die Soziologie ihre Begriffe durch Klassifikation des möglichen „gemeinten Sinns“ bildet, also so, als ob das Handeln tatsächlich bewußt sinnorientiert verliefe. Den Abstand gegen die Realität hat sie jederzeit, wenn es sich um die Betrachtung dieser in ihrer Konkretheit handelt, in Betracht zu ziehen und nach Maß und Art festzustellen.
Man hat eben methodisch sehr oft nur die Wahl zwischen unklaren oder klaren, aber dann irrealen und „idealtypischen“ Termini. In diesem Fall aber sind die letzteren wissenschaftlich vorzuziehen. (S[iehe] über all dies Arch[iv] f[ür] Sozialwiss[enschaft] XIX a. a. O.)
49
[172] Gemeint ist: Weber, Objektivität, S. 22–88; bereits oben, S. 156 mit Hg.-Anm. 21, zitiert.
II. Begriff des sozialen Handelns.
1. Soziales Handeln (einschließlich des Unterlassens oder Duldens) kann orientiert werden am vergangenen, gegenwärtigen oder für künftig erwarteten Verhalten anderer (Rache für frühere Angriffe, Abwehr gegenwärtigen Angriffs, Verteidigungsmaßregeln gegen künftige Angriffe). Die „anderen“ können Einzelne und Bekannte oder unbestimmt Viele und ganz Unbekannte sein („Geld“ z. B. bedeutet ein Tauschgut, welches der Handelnde beim Tausch deshalb annimmt, weil er sein Handeln an der Erwartung orientiert, daß sehr zahlreiche, aber unbekannte und unbestimmt viele Andre es ihrerseits künftig in Tausch zu nehmen bereit sein werden).
[173]2. Nicht jede Art von Handeln – auch von äußerlichem Handeln – ist „soziales“ Handeln im hier festgehaltenen Wortsinn. Äußeres Handeln dann nicht, wenn es sich lediglich an den Erwartungen des Verhaltens sachlicher Objekte orientiert. Das innere Sichverhalten ist soziales Handeln nur dann, wenn es sich am Verhalten anderer orientiert. Religiöses Verhalten z. B. dann nicht, wenn es Kontemplation, einsames Gebet usw. bleibt. Das Wirtschaften (eines einzelnen) erst dann und nur insofern, als es das Verhalten Dritter mit in Betracht zieht. Ganz allgemein und formal also schon: indem es auf die Respektierung der eignen faktischen Verfügungsgewalt über wirtschaftliche Güter durch Dritte reflektiert. In materialer Hinsicht: indem es z. B. beim Konsum den künftigen Begehr Dritter mitberücksichtigt und die Art des eignen „Sparens“ daran mitorientiert. Oder indem es bei der Produktion einen künftigen Begehr Dritter zur Grundlage seiner Orientierung macht usw.
3. Nicht jede Art von Berührung von Menschen ist sozialen Charakters, sondern nur ein sinnhaft am Verhalten des andern orientiertes eignes Verhalten. Ein Zusammenprall zweier Radfahrer z. B. ist ein bloßes Ereignis wie ein Naturgeschehen. Wohl aber wären
q
ihr Versuch, dem andern auszuweichen[,] und die auf den Zusammenprall folgende Schimpferei, Prügelei oder friedliche Erörterung „soziales Handeln“.[173]A: wäre
4. Soziales Handeln ist weder identisch a) mit einem gleichmäßigen Handeln mehrerer noch b) mit jedem durch das Verhalten anderer beeinflußten Handeln. a) Wenn auf der Straße eine Menge Menschen beim Beginn eines Regens gleichzeitig den Regenschirm aufspannen, so ist (normalerweise) das Handeln des einen nicht an dem des andern orientiert, sondern das Handeln aller gleichartig an dem Bedürfnis nach Schutz gegen die Nässe. – b) Es ist bekannt, daß das Handeln des einzelnen durch die bloße Tatsache, daß er sich innerhalb einer örtlich zusammengedrängten „Masse“ befindet, stark beeinflußt wird (Gegenstand der „massenpsychologischen“ Forschung, z. B. von der Art der Arbeiten Le Bonʼs): massenbedingtes Handeln.
50
Und auch zerstreute Massen können durch ein simultan oder sukzessiv auf den einzelnen (z. B. durch Vermittlung der Presse) wirkendes und als solches empfundenes Verhalten Vieler das Verhalten der einzelnen massenbedingt werden lassen. Bestimmte Arten des Reagierens werden durch die bloße Tatsache, daß der Einzelne sich als Teil einer „Masse“ fühlt, erst ermöglicht, andre erschwert. Infolgedessen kann dann ein bestimmtes Ereignis oder menschliches Verhalten Empfindungen der verschiedensten Art: Heiterkeit, Wut, Begeisterung, Verzweiflung und Leidenschaften aller Art hervorrufen, welche bei Vereinzelung nicht (oder [174]nicht so leicht) als Folge eintreten würden, – ohne daß doch dabei (in vielen Fällen wenigstens) zwischen dem Verhalten des einzelnen und der Tatsache seiner Massenlage eine sinnhafte Beziehung bestände. Ein derart durch das Wirken der bloßen Tatsache der „Masse“ rein als solcher in seinem Ablauf nur reaktiv verursachtes oder mitverursachtes, nicht auch darauf sinnhaft bezogenes Handeln würde begrifflich nicht „soziales Handeln“ im hier festgehaltenen Wortsinn sein. Indessen ist der Unterschied natürlich höchst flüssig. Denn nicht nur z. B. beim Demagogen, sondern oft auch beim Massenpublikum selbst kann dabei ein verschieden großes und verschieden deutbares Maß von Sinnbeziehung zum Tatbestand der „Masse“ bestehen. – Ferner würde bloße „Nachahmung“ fremden Handelns (auf deren Bedeutung G[abriel] Tarde berechtigtes Gewicht legt)[173] Le Bon, Psychologie. Vgl. dazu auch oben, S. 165 f., Hg.-Anm. 38.
51
begrifflich dann nicht spezifisch „soziales Handeln“ sein, wenn sie lediglich reaktiv, ohne sinnhafte Orientierung des eigenen an dem fremden Handeln, erfolgt. Die Grenze ist derart flüssig, daß eine Unterscheidung oft kaum möglich erscheint. Die bloße Tatsache aber, daß jemand [A 12]eine ihm zweckmäßig scheinende Einrichtung, die er bei andren kennen lernte, nun auch bei sich trifft, ist nicht in unserem Sinn: soziales Handeln. Nicht am Verhalten des andern orientiert sich dies Handeln, sondern durch Beobachtung dieses Verhaltens hat der Handelnde bestimmte objektive Chancen kennen gelernt, und an diesen orientiert er sich. Sein Handeln ist kausal, nicht aber sinnhaft, durch fremdes Handeln bestimmt. Wird dagegen z. B. fremdes Handeln nachgeahmt, weil es „Mode“ ist, als traditional, mustergültig oder als ständisch „vornehm“ gilt oder aus ähnlichen Gründen, so liegt die Sinnbezogenheit – entweder: auf das Verhalten der Nachgeahmten, oder: Dritter, oder: beider – vor. Dazwischen liegen naturgemäß Übergänge. Beide Fälle: Massenbedingtheit und Nachahmung sind flüssig und Grenzfälle sozialen Handelns, wie sie noch oft, z. B. beim traditionalen Handeln (§ 2) begegnen werden. Der Grund der Flüssigkeit liegt in diesen wie andren Fällen darin, daß die Orientierung an fremdem Verhalten und der Sinn des eigenen Handelns ja keineswegs immer eindeutig feststellbar oder auch nur bewußt und noch seltener: vollständig bewußt sind[174] Tarde, Lʼimitation. Eine deutsche Ausgabe dieses Werks lag zu Webers Lebzeiten nicht vor.
r
. Bloße „Beeinflussung“ und sinnhafte „Orientierung“ sind schon um deswillen nicht immer sicher zu scheiden. Aber begrifflich sind sie zu trennen, obwohl, selbstredend, die nur „reaktive“ Nachahmung mindestens die gleiche soziologische Tragweite hat wie diejenige, welche „soziales Handeln“ im eigentlichen Sinn darstellt. Die Soziologie hat es eben keineswegs nur mit „sozialem Handeln“ zu tun, sondern dieses bildet nur (für die hier betriebene Art von [175]Soziologie) ihren zentralen Tatbestand, denjenigen, der für sie als Wissenschaft sozusagen konstitutiv ist. Keineswegs aber ist damit über die Wichtigkeit dieses im Verhältnis zu anderen Tatbeständen etwas ausgesagt.[174]A: ist
§ 2. Wie jedes Handeln kann auch das soziale Handeln bestimmt sein 1. zweckrational: durch Erwartungen des Verhaltens von Gegenständen der Außenwelt und von andren Menschen und unter Benutzung dieser Erwartungen als „Bedingungen“ oder als „Mittel“ für rational, als Erfolg, erstrebte und abgewogene eigne Zwecke, – 2. wertrational: durch bewußten Glauben an den – ethischen, ästhetischen, religiösen oder wie immer sonst zu deutenden – unbedingten Eigenwert eines bestimmten Sichverhaltens rein als solchen und unabhängig vom Erfolg, – 3. affektuell, insbesondere emotional: durch aktuelle Affekte und Gefühlslagen, – 4. traditional: durch eingelebte Gewohnheit.
1. Das streng traditionale Verhalten steht – ganz ebenso wie die rein reaktive Nachahmung (s. vorigen §)
52
– ganz und gar an der Grenze und oft jenseits dessen, was man ein „sinnhaft“ orientiertes Handeln überhaupt nennen kann. Denn es ist sehr oft nur ein dumpfes in der Richtung der einmal eingelebten Einstellung ablaufendes Reagieren auf gewohnte Reize. Die Masse alles eingelebten Alltagshandelns nähert sich diesem Typus, der nicht nur als Grenzfall in die Systematik gehört, sondern auch deshalb, weil (wovon später) [175]Oben, S. 172.
53
die Bindung an das Gewohnte in verschiedenem Grade und Sinne bewußt aufrecht erhalten werden kann: in diesem Fall nähert sich dieser Typus dem von Nr. 2. Kap. III, § 6, unten, S. 468 ff.
2. Das streng affektuale Sichverhalten steht ebenso an der Grenze und oft jenseits dessen, was bewußt „sinnhaft“ orientiert ist; es kann hemmungsloses Reagieren auf einen außeralltäglichen Reiz sein. Eine Sublimierung ist es, wenn das affektual bedingte Handeln als bewußte Entladung der Gefühlslage auftritt: es befindet sich dann meist (nicht immer) schon auf dem Wege zur „Wertrationalisierung“ oder zum Zweckhandeln oder zu beiden.
3. Affektuelle und wertrationale Orientierung des Handelns unterscheiden sich durch die bewußte Herausarbeitung der letzten Richtpunkte des Handelns und konsequente planvolle Orientierung daran bei dem letzteren. Sonst haben sie gemeinsam: daß für sie der Sinn des Handelns nicht in dem jenseits seiner liegenden Erfolg, sondern in dem bestimmt gearte[176]ten Handeln als solchem
s
liegt. Affektuell handelt, wer sein Bedürfnis nach aktueller Rache, aktuellem Genuß, aktueller Hingabe, aktueller kontemplativer Seligkeit oder nach Abreaktion aktueller Affekte (gleichviel wie massiver oder wie sublimer Art) befriedigt.[176]A: solchen
Rein wertrational handelt, wer ohne Rücksicht auf die vorauszusehenden Folgen handelt im Dienst seiner Überzeugung von dem, was Pflicht, Würde, Schönheit, religiöse Weisung, Pietät, oder die Wichtigkeit einer „Sache“ gleichviel welcher Art ihm zu gebieten scheinen. Stets ist (im Sinn unserer Terminologie) wertrationales Handeln ein Handeln nach „Geboten“ oder gemäß „Forderungen“, die der Handelnde an sich gestellt glaubt. Nur soweit menschliches Handeln sich an solchen [A 13]Forderungen orientiert – was stets nur in einem sehr verschieden großen, meist ziemlich bescheidenen, Bruchteil der Fall ist –[,] wollen wir von Wertrationalität reden. Wie sich zeigen wird, kommt ihr Bedeutung genug zu, um sie als Sondertyp herauszuheben, obwohl hier im übrigen nicht eine irgendwie erschöpfende Klassifikation der Typen des Handelns zu geben versucht wird.
4. Zweckrational handelt, wer sein Handeln nach Zweck, Mitteln
t
und Nebenfolgen orientiert und dabei sowohl die Mittel gegen die Zwecke, wie die Zwecke gegen die Nebenfolgen, wie endlich auch die verschiedenen möglichen Zwecke gegeneinander rational abwägt: also jedenfalls weder affektuell (und insbesondere nicht emotional) noch traditional handelt. Die Entscheidung zwischen konkurrierenden und kollidierenden Zwecken und Folgen kann dabei ihrerseits wertrational orientiert sein: dann ist das Handeln nur in seinen Mitteln zweckrational. Oder es kann der Handelnde die konkurrierenden und kollidierenden Zwecke ohne wertrationale Orientierung an „Geboten“ und „Forderungen“ einfach als gegebene subjektive Bedürfnisregungen in eine Skala ihrer von ihm bewußt abgewogenen Dringlichkeit bringen und darnach sein Handeln so orientieren, daß sie in dieser Reihenfolge nach Möglichkeit befriedigt werden (Prinzip des „Grenznutzens“).A: Mittel
54
Die wertrationale Orientierung des Handelns kann also zur zweckrationalen in verschiedenartigen Beziehungen stehen. Vom Standpunkt der Zweckrationalität aus aber ist Wertrationalität immer, und zwar je mehr sie den Wert, an dem das Handeln orientiert wird, zum absoluten Wert steigert, desto mehr: irrational, weil sie ja um so weniger auf die Folgen des Handelns reflektiert, je unbedingter allein dessen Eigenwert (reine Gesinnung, Schönheit, absolute Güte, absolute Pflichtmäßigkeit) für sie in Betracht kommt. Absolute Zweckrationalität des Handelns ist aber auch nur ein im wesentlichen konstruktiver Grenzfall.[176] Zum „Prinzip des Grenznutzens“ vgl. unten, S. 227 mit Hg.-Anm. 30. Friedrich von Wieser spricht vom „Gesetz des Grenznutzens“ (vgl. Wieser, Theorie, S. 194).
[177]5. Sehr selten ist Handeln, insbesondere soziales Handeln, nur in der einen oder der andren Art orientiert. Ebenso sind diese Arten der Orientierung natürlich in gar keiner Weise erschöpfende Klassifikationen der Arten der Orientierung des Handelns, sondern für soziologische Zwecke geschaffene begrifflich reine Typen, denen sich das reale Handeln mehr oder minder annähert oder aus denen es – noch häufiger – gemischt ist. Ihre Zweckmäßigkeit für uns kann nur der Erfolg ergeben.
§ 3. Soziale „Beziehung“ soll ein seinem Sinngehalt nach aufeinander gegenseitig eingestelltes und dadurch orientiertes Sichverhalten mehrerer heißen. Die soziale Beziehung besteht also durchaus und ganz ausschließlich: in der Chance, daß in einer (sinnhaft) angebbaren Art sozial gehandelt wird, einerlei zunächst: worauf diese Chance beruht.
1. Ein Mindestmaß von Beziehung des beiderseitigen Handelns aufeinander soll also Begriffsmerkmal sein. Der Inhalt kann der allerverschiedenste sein: Kampf, Feindschaft, Geschlechtsliebe, Freundschaft, Pietät, Marktaustausch, „Erfüllung“ oder „Umgehung“ oder „Bruch“ einer Vereinbarung, ökonomische oder erotische oder andre „Konkurrenz“, ständische oder nationale oder Klassengemeinschaft (falls diese letzteren Tatbestände über bloße Gemeinsamkeiten hinaus „soziales Handeln“ erzeugen, – wovon später).
55
Der Begriff besagt also nichts darüber: ob „Solidarität“ der Handelnden besteht oder das gerade Gegenteil.[177] Kap. IV, unten, S. 592 ff., das allerdings von Weber nicht mehr abgeschlossen werden konnte.
2. Stets handelt es sich um den im Einzelfall wirklich oder durchschnittlich oder im konstruierten „reinen“ Typus von den Beteiligten gemeinten, empirischen, Sinngehalt, niemals um einen normativ „richtigen“ oder metaphysisch „wahren“ Sinn. Die soziale Beziehung besteht, auch wenn es sich um sogenannte „soziale Gebilde“, wie „Staat“, „Kirche“, „Genossenschaft“, „Ehe“ usw. handelt, ausschließlich und lediglich in der Chance, daß ein seinem Sinngehalt nach in angebbarer Art aufeinander eingestelltes Handeln stattfand, stattfindet oder stattfinden wird. Dies ist immer festzuhalten, um eine „substanzielle“ Auffassung dieser Begriffe zu vermeiden. Ein „Staat“ hört z. B. soziologisch zu „existieren“ dann auf, sobald die Chance, daß bestimmte Arten von sinnhaft orientiertem sozialem Handeln ablaufen, geschwunden ist. Diese Chance kann eine sehr große oder eine verschwindend geringe sein. In dem Sinn und Maße, als sie tatsächlich (schätzungsweise) bestand oder besteht, bestand oder besteht auch die [178]betreffende soziale Beziehung. Ein anderer klarer Sinn ist mit der Aussage: daß z. B. ein bestimmter „Staat“ noch oder nicht mehr „existiere“, schlechthin nicht zu verbinden.
3. Es ist in keiner Art gesagt: daß die an dem aufeinander eingestellten Handeln Beteiligten im Einzelfall den gleichen Sinngehalt in die soziale Beziehung legen oder sich sinnhaft entsprechend der Einstellung des Gegenpartners innerlich zu ihm einstellen, daß also in diesem Sinn „Gegenseitigkeit“ besteht. „Freundschaft“, „Liebe“, „Pietät“, „Vertragstreue“, „nationales Gemeinschaftsgefühl“ [A 14]von der einen Seite kann auf durchaus andersartige Einstellungen der anderen Seite stoßen. Dann verbinden eben die Beteiligten mit ihrem Handeln einen verschiedenen Sinn: die soziale Beziehung ist insoweit von beiden Seiten objektiv „einseitig“. Aufeinander bezogen ist sie aber auch dann insofern, als der Handelnde vom Partner (vielleicht ganz oder teilweise irrigerweise) eine bestimmte Einstellung dieses letzteren ihm (dem Handelnden) gegenüber voraussetzt und an diesen Erwartungen sein eignes Handeln orientiert, was für den Ablauf des Handelns und die Gestaltung der Beziehung Konsequenzen haben kann und meist
u
wird. Objektiv „beiderseitig“ ist sie natürlich nur insoweit, als der Sinngehalt einander – nach den durchschnittlichen Erwartungen jedes der Beteiligten – „entspricht“, also z. B. der Vatereinstellung die Kindeseinstellung wenigstens annähernd so gegenübersteht, wie der Vater dies (im Einzelfall oder durchschnittlich oder typisch) erwartet. Eine völlig und restlos auf gegenseitiger sinnentsprechender Einstellung ruhende soziale Beziehung ist in der Realität nur ein Grenzfall. Fehlen der Beiderseitigkeit aber soll, nach unserer Terminologie, die Existenz einer „sozialen Beziehung“ nur dann ausschließen, wenn sie die Folge hat: daß ein Aufeinanderbezogensein des beiderseitigen Handelns tatsächlich fehlt. Alle Arten von Übergängen sind hier wie sonst in der Realität die Regel.[178]Zu ergänzen wäre: haben
4. Eine soziale Beziehung kann ganz vorübergehenden Charakters sein oder aber auf Dauer, d. h. derart eingestellt sein: daß die Chance einer kontinuierlichen Wiederkehr eines sinnentsprechenden (d. h. dafür geltenden und demgemäß erwarteten) Verhaltens besteht. Nur das Vorliegen dieser Chance: – der mehr oder minder großen Wahrscheinlichkeit also, daß ein sinnentsprechendes Handeln stattfindet[,] und nichts darüber hinaus – bedeutet der „Bestand“ der sozialen Beziehung, was zur Vermeidung falscher Vorstellungen stets gegenwärtig zu halten ist. Daß eine „Freundschaft“ oder daß ein „Staat“ besteht oder bestand, bedeutet also ausschließlich und allein: wir (die Betrachtenden) urteilen, daß eine Chance vorliegt oder vorlag: daß auf Grund einer bestimmt gearteten Einstellung bestimmter Menschen in einer einem durchschnittlich gemeinten Sinn nach
v
angeb[179]baren Art gehandelt wird, und sonst gar nichts (vgl. Nr. 2 a[m] E[nde]).A: noch
56
Die für die juristische Betrachtung unvermeidliche Alternative: daß ein Rechtssatz bestimmten Sinnes entweder (im Rechtssinn) gelte oder nicht, ein Rechtsverhältnis entweder bestehe oder nicht, gilt für die soziologische Betrachtung also nicht. [179]Oben, S. 177 f.
5. Der Sinngehalt einer sozialen Beziehung kann wechseln: – z. B. eine politische Beziehung aus Solidarität in Interessenkollision umschlagen. Es ist dann nur eine Frage der terminologischen Zweckmäßigkeit und des Maßes von Kontinuität der Wandlung, ob man in solchen Fällen sagt: daß eine „neue“ Beziehung gestiftet sei oder: daß die fortbestehende alte einen neuen „Sinngehalt“ erhalten habe. Auch kann der Sinngehalt zum Teil perennierend, zum Teil wandelbar sein.
6. Der Sinngehalt, welcher eine soziale Beziehung perennierend konstituiert, kann in „Maximen“ formulierbar sein, deren durchschnittliche oder sinnhaft annähernde Innehaltung die Beteiligten von dem oder den Partnern erwarten und an denen sie ihrerseits (durchschnittlich und annähernd) ihr Handeln orientieren. Je rationaler – zweckrationaler oder wertrationaler – orientiert das betreffende Handeln seinem allgemeinen Charakter nach ist, desto mehr ist dies der Fall. Bei einer erotischen oder überhaupt affektuellen (z. B. einer „Pietäts“-)Beziehung ist die Möglichkeit einer rationalen Formulierung des gemeinten Sinngehalts z. B. naturgemäß weit geringer als etwa bei einem geschäftlichen Kontraktverhältnis.
7. Der Sinngehalt einer sozialen Beziehung kann durch gegenseitige Zusage vereinbart sein. Dies bedeutet: daß die daran Beteiligten für ihr künftiges Verhalten (sei es zu einander[,] sei es sonst) Versprechungen machen. Jeder daran Beteiligte zählt dann – soweit er rational erwägt – zunächst (mit verschiedener Sicherheit) normalerweise darauf, daß der andre sein Handeln an einem von ihm (dem Handelnden) selbst verstandenen Sinn der Vereinbarung orientieren werde. Er orientiert sein eignes Handeln teils zweckrational (je nachdem mehr oder minder sinnhaft „loyal“) an dieser Erwartung, teils wertrational an der „Pflicht“[,] auch seinerseits die eingegangene Vereinbarung dem von ihm gemeinten Sinn gemäß zu „halten“. Soviel hier vorweg. Im übrigen vgl. § 9 und § 13.
57
Kap. I, § 9, unten, S. 194 ff., und § 13, unten, S. 207 f.
§ 4. Es lassen sich innerhalb des sozialen Handelns tatsächliche Regelmäßigkeiten beobachten, d. h. in einem typisch gleichartig gemeinten Sinn beim gleichen Handelnden sich wiederholende oder (eventuell auch: zugleich) bei zahlreichen Handelnden ver[180]breitete Abläufe von Handeln. Mit diesen Typen des Ablaufs von Handeln befaßt sich die Soziologie, im Gegensatz zur Geschichte als der kausalen Zurechnung wichtiger, d. h. schicksalhafter, Einzelzusammenhänge.
[A 15]Eine tatsächlich bestehende Chance einer Regelmäßigkeit der Einstellung sozialen Handelns soll heißen Brauch, wenn und soweit die Chance ihres Bestehens innerhalb eines Kreises von Menschen lediglich durch tatsächliche Übung gegeben ist. Brauch soll heißen Sitte, wenn die tatsächliche Übung auf langer Eingelebtheit beruht. Sie soll dagegen bezeichnet werden als „bedingt durch Interessenlage“ („interessenbedingt“), wenn und soweit die Chance ihres empirischen Bestandes lediglich durch rein zweckrationale Orientierung des Handelns der einzelnen an gleichartigen Erwartungen bedingt ist.
1. Zum Brauch gehört auch die „Mode“. „Mode“ im Gegensatz zu „Sitte“ soll Brauch dann heißen, wenn (gerade umgekehrt wie bei Sitte) die Tatsache der Neuheit des betreffenden Verhaltens Quelle der Orientierung des Handelns daran wird. Sie hat ihre Stätte in der Nachbarschaft der „Konvention“, da sie wie (meist) diese ständischen Prestigeinteressen entspringt. Hier wird sie nicht näher behandelt.
2. „Sitte“ soll uns eine im Gegensatz zu „Konvention“ und „Recht“ nicht äußerlich garantierte Regel heißen, an welche sich der Handelnde freiwillig, sei es einfach „gedankenlos“ oder aus „Bequemlichkeit“ oder aus welchen Gründen immer, tatsächlich hält und deren wahrscheinliche Innehaltung er von andren diesem Menschenkreis Angehörigen aus diesen Gründen gewärtigen kann. Sitte in diesem Sinn wäre also nichts „Geltendes“: es wird von niemandem „verlangt“, daß er sie mitmache. Der Übergang von da zur geltenden Konvention und zum Recht ist natürlich absolut flüssig. Überall ist das tatsächlich Hergebrachte der Vater des Geltenden gewesen. Es ist heute „Sitte“, daß wir am Morgen ein Frühstück ungefähr angebbarer Art zu uns nehmen; aber irgendeine „Verbindlichkeit“ dazu besteht (außer für Hotelbesucher) nicht; und es war nicht immer Sitte. Dagegen ist die Art der Bekleidung, auch wo sie aus „Sitte“ entstanden ist, heut in weitem Umfang nicht mehr nur Sitte, sondern Konvention. Über Brauch und Sitte sind die betreffenden Abschnitte aus Iherings „Zweck im Recht“ (Band II) noch heut lesenswert.
58
Vgl. auch P[aul][180] Ihering, Zweck II, untersucht die Entstehung der Sitten und unterscheidet dabei zwischen Brauch, Sitte, Mode, Moral und Recht. Die Sitte grenzt er einerseits gegen [181]den Brauch, andererseits gegen die Moral ab. Als Abgrenzungskriterium dient ihm der Grad der sozialen Verpflichtung (ebd., S. 230 f.).
a
Oertmann, [181]Rechtsregelung und Verkehrssitte (1914) und neustens: E[rnst] Weigelin, Sitte, Recht und Moral, 1919 (übereinstimmend mit mir gegen Stammler).[180]A: K.
59
Oertmann, Verkehrssitte, und Weigelin, Sitte. Oertmann und Weigelin zitieren allerdings in ihren Arbeiten Weber nicht, wie es die Formulierung nahelegen könnte. Sie kritisieren aber Stammler in ähnlicher Weise wie dieser (vgl. auch oben, S. 148, Hg.-Anm. 7, und unten, S. 184, Hg.-Anm. 64, sowie die Einleitung, oben, S. 30 ff.). Weigelin etwa diskutiert Brauch, Mode, Sitte, Recht und Moral im Gegenzug zu Stammler als zwar voneinander abgrenzbare, aber dennoch zusammengehörende Phänomene imperativen und zwingenden Charakters, die als Aspekte einer einheitlichen Lebensordnung begriffen werden müßten. Oertmann bestreitet Stammlers Behauptung, die Sittenregel lasse sich von der Rechtsregel dadurch unterscheiden, daß jene eine bloße Einladung an den Handelnden sei, die er auch ausschlagen könne, ohne Sanktionen zu erleiden. Dagegen Oertmann: die Verletzung einer Sittenregel werde häufig härter bestraft als die einer Rechtsregel. Weigelin bezieht sich übrigens auch explizit auf die von Weber weiter unten (S. 188, Hg.-Anm. 69 bzw. 71) herangezogenen rechtlichen Bestimmungen: RCPO § 888 sowie BGB §§ 157 und 242.
3. Zahlreiche höchst auffallende Regelmäßigkeiten des Ablaufs sozialen Handelns, insbesondere (aber nicht nur) des wirtschaftlichen Handelns, beruhen keineswegs auf Orientierung an irgendeiner als „geltend“ vorgestellten Norm, aber auch nicht auf Sitte, sondern lediglich darauf: daß die Art des sozialen Handelns der Beteiligten, der Natur der Sache nach, ihren normalen, subjektiv eingeschätzten, Interessen so am durchschnittlich besten entspricht und daß sie an dieser subjektiven Ansicht und Kenntnis ihr Handeln orientieren: so etwa Regelmäßigkeiten der Preisbildung bei „freiem“ Markt.
60
Die Marktinteressenten orientieren eben ihr Verhalten, als „Mittel“, an eignen typischen subjektiven wirtschaftlichen Interessen als „Zweck“ und an den ebenfalls typischen Erwartungen, die sie vom voraussichtlichen Verhalten der anderen hegen, als „Bedingungen“, jenen Zweck zu erreichen. Indem sie derart, je strenger zweckrational sie handeln, desto ähnlicher auf gegebene Situationen reagieren, entstehen Gleichartigkeiten, Regelmäßigkeiten und Kontinuitäten der Einstellung und des Handelns, welche sehr oft weit stabiler sind, als wenn Handeln sich an Normen und Pflichten orientiert, die einem Kreise von Menschen tatsächlich für „verbindlich“ gelten. Diese Erscheinung: daß Orientierung an der nackten eignen und fremden Interessenlage Wirkungen hervorbringt, welche jenen gleichstehen, die durch Normierung – und zwar sehr oft vergeblich – zu erzwingen gesucht werden, hat insbesondere auf wirtschaftlichem Gebiet große Aufmerksamkeit erregt: – sie war geradezu eine der Quellen des Entstehens der Nationalökonomie als Wissenschaft. Zum „freien“ Markt vgl. unten, S. 248 und 264.
61
Sie gilt [182]aber von allen Gebieten des Handelns in ähnlicher Art. Sie bildet in ihrer Bewußtheit und inneren Ungebundenheit den polaren Gegensatz gegen jede Art von innerer Bindung durch Einfügung in bloße eingelebte „Sitte“, wie andererseits gegen Hingabe an wertrational geglaubte Normen. Eine wesentliche Komponente der „Rationalisierung“ des Handelns ist der Ersatz der inneren Einfügung in eingelebte Sitte durch die planmäßige Anpassung an Interessenlagen. Freilich erschöpft dieser Vorgang den Begriff der „Rationalisierung“ des Handelns nicht. Denn außerdem kann diese positiv in der Richtung der bewußten Wertrationalisierung, negativ aber außer auf Kosten der Sitte auch auf Kosten affektuellen Handelns, und endlich auch zugunsten eines wertungläubigen[,] rein zweckrationalen In seiner Vorlesung „Geschichte der Nationalökonomie“ aus dem Sommersemester 1896 in Freiburg sieht Weber eine der Quellen der Nationalökonomie in der Ablösung des Merkantilismus durch den ökonomischen Individualismus (MWG III/1, [182]S. 689 ff., §§ 2 und 3). Als Triebkräfte gelten ihm dort der Physiokratismus in Frankreich und der Smithianismus in England. Über Adam Smith heißt es: „Dag[e]g[en] Interessenharmonie u. Concurrenzmaxime v[on] Physiokraten übernommen / Grund: Verkehr der Bevormundung entwachsen / Form der Theorie: der Eigennutz steht im Dienst der Gesamtheit“ (ebd., S. 697). Das habe verschiedene Interpretationen des Individualismus in Gestalt des Liberalismus ausgelöst und schließlich zur Kritik des ökonomischen Individualismus durch den wissenschaftlichen Sozialismus geführt. Eine anders akzentuierte Betrachtung der Entstehungsbedingungen der Nationalökonomie findet sich im Objektivitätsaufsatz (Weber, Objektivität, S. 60 f.).
b
auf Kosten von wertrational gebundenem [A 16]Handeln verlaufen. Diese Vieldeutigkeit des Begriffs der „Rationalisierung“ des Handelns wird uns noch öfter beschäftigen. (Begriffliches dazu am Schluß!)[182]Zu ergänzen wäre: Handelns
62
Worauf sich der interne Verweis bezieht, ist unklar. Am Schluß von Kapitel I findet sich Begriffliches dazu nicht. In den folgenden Kapiteln II und III verwendet Weber allerdings die Unterscheidung zwischen formaler und materialer Rationalität, so zum Beispiel in Kap. II in den §§ 9 (S. 251 f.), 13 (S. 285 ff.), 30 (S. 375 f.), 35 (S. 404 ff.) und in Kap. III in § 5 (S. 448).
4. Die Stabilität der (bloßen) Sitte beruht wesentlich darauf, daß derjenige, welcher sein Handeln nicht an ihr orientiert, „unangepaßt“ handelt, d. h. kleine und große Unbequemlichkeiten und Unzuträglichkeiten mit in den Kauf nehmen muß, so lange das Handeln der Mehrzahl seiner Umwelt nun einmal mit dem Bestehen der Sitte rechnet und darauf eingestellt ist.
Die Stabilität der Interessenlage beruht, ähnlich, darauf, daß, wer sein Handeln nicht an dem Interesse der andern orientiert, – mit diesen nicht „rechnet“ – deren Widerstand herausfordert oder einen von ihm nicht gewollten und nicht vorausgesehenen Erfolg hat und also Gefahr läuft, an eignem Interesse Schaden zu nehmen.
§ 5. Handeln, insbesondre soziales Handeln und wiederum insbesondre eine soziale Beziehung, können
c
von seiten der Betei[183]ligten an der Vorstellung vom Bestehen einer legitimen Ordnung orientiert werden. Die Chance, daß dies tatsächlich geschieht, soll „Geltung“ der betreffenden Ordnung heißen.Zu erwarten wäre: kann
1. „Gelten“ einer Ordnung soll uns also mehr bedeuten als eine bloße, durch Sitte oder Interessenlage bedingte Regelmäßigkeit eines Ablaufs sozialen Handelns. Wenn Möbeltransportgesellschaften regelmäßig um die Zeit der Umzugstermine inserieren, so ist diese Regelmäßigkeit durch „Interessenlage“ bedingt. Wenn ein Höker
63
zu bestimmten Monats- oder Wochentagen eine bestimmte Kundschaft aufsucht, so ist das entweder eingelebte Sitte oder ebenfalls Produkt seiner Interessenlage (Turnus in seinem Erwerbssprengel). Wenn ein Beamter aber täglich zur festen Stunde auf dem Büro erscheint, so ist das (auch, aber:) nicht nur durch eingelebte Gewöhnung (Sitte) und (auch, aber:) nicht nur durch eigne Interessenlage bedingt, der er nach Belieben nachleben könnte oder nicht. Sondern (in der Regel: auch) durch das „Gelten“ der Ordnung (Dienstreglement) als Gebot, dessen Verletzung nicht nur Nachteile brächte, sondern – normalerweise – auch von seinem „Pflichtgefühl“ wertrational (wenn auch in höchst verschiedenem Maße wirksam) perhorresziert wird. [183]Aus dem Plattdeutschen übernommene, veraltete Bezeichnung für Kleinhändler, die auf lokalen Märkten, auf der Straße oder im Haus des Kunden ihre (in der Hucke) mit sich geführten Waren anbieten.
2. Einen Sinngehalt einer sozialen Beziehung wollen wir a) nur dann eine „Ordnung“ nennen, wenn das Handeln an angebbaren „Maximen“ (durchschnittlich und annähernd) orientiert wird. Wir wollen b) nur dann von einem „Gelten“ dieser Ordnung sprechen, wenn diese tatsächliche Orientierung an jenen Maximen mindestens auch (also in einem praktisch ins Gewicht fallenden Maß) deshalb erfolgt, weil sie als irgendwie für das Handeln geltend: verbindlich oder vorbildlich, angesehen werden. Tatsächlich findet die Orientierung des Handelns an einer Ordnung naturgemäß bei den Beteiligten aus sehr verschiedenen Motiven statt. Aber der Umstand, daß neben den andern Motiven die Ordnung mindestens einem Teil der Handelnden auch als vorbildlich oder verbindlich und also geltensollend vorschwebt, steigert naturgemäß die Chance, daß das Handeln an ihr orientiert wird, und zwar oft in sehr bedeutendem Maße. Eine nur aus zweckrationalen Motiven innegehaltene Ordnung ist im allgemeinen weit labiler, als die lediglich kraft Sitte, infolge der Eingelebtheit eines Verhaltens, erfolgende Orientierung an dieser: die von allen häufigste Art der inneren Haltung. Aber sie ist noch ungleich labiler als eine mit dem Prestige der Vorbildlichkeit oder Verbindlichkeit, wir wollen sagen: der „Legitimität“, auftretende. Die Übergänge von der bloß traditional oder bloß [184]zweckrational motivierten Orientierung an einer Ordnung zum Legitimitäts-Glauben sind natürlich in der Realität durchaus flüssig.
3. An der Geltung einer Ordnung „orientieren“ kann man sein Handeln nicht nur durch „Befolgung“ ihres (durchschnittlich verstandenen) Sinnes. Auch im Fall der „Umgehung“ oder „Verletzung“ ihres (durchschnittlich verstandenen) Sinnes kann die Chance ihrer in irgendeinem Umfang bestehenden Geltung (als verbindliche Norm) wirken. Zunächst rein zweckrational. Der Dieb orientiert an der „Geltung“ des Strafgesetzes sein Handeln: indem er es verhehlt. Daß die Ordnung innerhalb eines Menschenkreises „gilt“, äußert sich eben darin, daß er den Verstoß verhehlen muß. Aber von diesem Grenzfall abgesehen: sehr häufig beschränkt sich die Verletzung der Ordnung auf mehr oder minder zahlreiche Partialverstöße, oder sie sucht sich, mit verschiedenem Maß von Gutgläubigkeit, als legitim hinzustellen. Oder es bestehen tatsächlich verschiedene Auffassungen des Sinnes der Ordnung nebeneinander, die dann – für die Soziologie – jede in dem Umfang „gelten“, als sie das tatsächliche Verhalten bestimmen. Es macht der Soziologie keine Schwierigkeiten, das Nebeneinandergelten verschiedener einander widersprechender Ordnungen innerhalb des gleichen Menschenkreises anzuerkennen. Denn sogar der einzelne kann sein Handeln an einander widersprechenden Ordnungen orientieren. [A 17]Nicht nur sukzessiv, wie es alltäglich geschieht, sondern auch durch die gleiche Handlung. Wer einen Zweikampf vollzieht, orientiert sein Handeln am Ehrenkodex, indem er aber dies Handeln verhehlt oder umgekehrt: sich dem Gericht stellt, am Strafgesetzbuch. Wenn freilich Umgehung oder Verletzung des (durchschnittlich geglaubten) Sinns einer Ordnung zur Regel geworden sind, so „gilt“ die Ordnung eben nur noch begrenzt oder schließlich gar nicht mehr. Zwischen Geltung und Nichtgeltung einer bestimmten Ordnung besteht also für die Soziologie nicht, wie für die Jurisprudenz (nach deren unvermeidlichem Zweck) absolute Alternative. Sondern es bestehen flüssige Übergänge zwischen beiden Fällen, und es können, wie bemerkt, einander widersprechende Ordnungen nebeneinander „gelten“, jede – heißt dies dann – in dem Umfang, als die Chance besteht, daß das Handeln tatsächlich an ihr orientiert wird.
Kenner der Literatur werden sich an die Rolle erinnern, welche der Begriff der „Ordnung“ in R[udolf] Stammlers zweifellos – wie alle seine Arbeiten – glänzend geschriebenem, aber gründlich verfehltem und die Probleme verhängnisvoll verwirrendem, in der Vorbemerkung zitiertem Buch spielt. (Vgl. dazu meine ebendort zitierte – im Verdruß über die angerichtete Verwirrung leider in der Form etwas scharf geratene – Kritik).
64
Bei Stammler ist nicht nur das empirische und das normative [185]Gelten nicht geschieden, sondern überdies verkannt, daß das soziale Handeln sich nicht nur an „Ordnungen“ orientiert; vor allem aber ist in logisch völlig verfehlter Weise die Ordnung zur „Form“ des sozialen Handelns gemacht und dann in eine ähnliche Rolle zum „Inhalt“ gerückt, wie sie die „Form“ im erkenntnistheoretischen Sinn spielt (von andern Irrtümern ganz abgesehen). Tatsächlich orientiert sich z. B. das (primär) wirtschaftliche Handeln (K. II)[184] Gemeint sind: Stammler, Wirtschaft und Recht2, und Weber, Stammlers Überwindung, bereits oben, S. 148 mit Hg.-Anm. 7 und S. 169 mit Hg.-Anm. 44, zitiert. Vgl. ferner unten, S. 186, Hg.-Anm. 67.
65
an der Vorstellung von der Knappheit bestimmter verfügbarer Mittel der Bedarfsbefriedigung im Verhältnis zum (vorgestellten) Bedarf und an dem gegenwärtigen und für künftig vorausgesehenen Handeln Dritter, die auf die gleichen Mittel reflektieren; dabei aber orientiert es sich natürlich außerdem in der Wahl seiner „wirtschaftlichen“ Maßregeln an jenen „Ordnungen“, welche der Handelnde als Gesetze und Konventionen „geltend“ weiß, d. h. von denen er weiß, daß ein bestimmtes Reagieren Dritter im Fall ihrer Verletzung eintreten wird. Diesen höchst einfachen empirischen Sachverhalt hat Stammler in der hoffnungslosesten Weise verwirrt und insbesondere ein Kausalverhältnis zwischen „Ordnung“ und realem Handeln für begrifflich unmöglich erklärt. Zwischen dem juristisch-dogmatischen, normativen Gelten der Ordnung und einem empirischen Vorgang gibt es ja in der Tat kein Kausalverhältnis, sondern nur die Frage: wird der empirische Vorgang von der (richtig interpretierten) Ordnung juristisch „betroffen“? soll sie also (normativ) für ihn gelten? und, wenn ja, was sagt sie als für ihn normativ geltensollend aus? Zwischen der Chance aber, daß an der Vorstellung vom Gelten einer durchschnittlich so und so verstandenen Ordnung das Handeln orientiert wird, und dem wirtschaftlichen Handeln besteht selbstverständlich (gegebenenfalls) ein Kausalverhältnis im ganz gewöhnlichen Sinn des Worts. Für die Soziologie aber „ist“ eben lediglich jene Chance der Orientierung an dieser Vorstellung „die“ geltende Ordnung.[185] Kap. II, §§ 1, 3, 4, unten, S. 216–223, 225–232, bes. aber S. 218 f.
§ 6. Die Legitimität einer Ordnung kann garantiert sein:
I. rein innerlich und zwar
- rein affektuell: durch gefühlsmäßige Hingabe;
- wertrational:ddurch Glauben an ihre absolute Geltung als Ausdruck letzter verpflichtender Werte (sittlicher, ästhetischer oder irgendwelcher andrer);[185]Doppelpunkt fehlt in A.
- religiös: durch den Glauben an die Abhängigkeit eines Heilsgüterbesitzes von ihrer Innehaltung;
[186]II. auch (oder: nur) durch Erwartungen spezifischer äußerer Folgen, also: durch Interessenlage; aber: durch Erwartungen von besonderer Art.
Eine Ordnung soll heißen:
- Konvention, wenn ihre Geltung äußerlich garantiert ist durch die Chance, bei Abweichung innerhalb eines angebbaren Menschenkreises auf eine (relativ) allgemeine und praktisch fühlbare Mißbilligung zu stoßen, –
- Recht, wenn sie äußerlich garantiert ist durch die Chance einese(physischen oder psychischen) Zwanges durch ein auf Erzwingung der Innehaltung oder Ahndung der Verletzung gerichtetes Handeln eines eigens darauf eingestellten Stabes von Menschen.[186]Fehlt in A; eines sinngemäß ergänzt.
Über Konvention s. neben Ihering a. a. O. Weigelin a. a. O. und F[erdinand] Tönnies, Die Sitte (1909).
66
[186] Zu Ihering, Zweck, und Weigelin, Sitte, siehe oben, S. 180 mit Hg.-Anm. 58; ferner Tönnies, Sitte; ein Handexemplar mit einigen Anstreichungen befindet sich in der Max Weber-Arbeitsstelle, BAdW München. Vgl. dazu auch den Brief Max Webers an Ferdinand Tönnies vom 29. August 1909, MWG II/6, S. 237.
[A 18]1. Konvention soll die innerhalb eines Menschenkreises als „geltend“ gebilligte und durch Mißbilligung gegen Abweichungen garantierte „Sitte“ heißen. Im Gegensatz zum Recht (im hier gebrauchten Sinn des Worts) fehlt der speziell auf die Erzwingung eingestellte Menschenstab. Wenn Stammler die Konvention vom Recht durch die absolute „Freiwilligkeit“ der Unterwerfung scheiden will, so ist das nicht im Einklang mit dem üblichen Sprachgebrauch und auch für seine eigenen Beispiele nicht zutreffend.
67
Die Befolgung der „Konvention“ (im üblichen Wortsinn) – etwa: des üblichen Grüßens, der als anständig geltenden Bekleidung, der Schranken des Verkehrs nach Form und Inhalt – wird dem einzelnen als verbind[187]lich oder vorbildlich durchaus ernstlich „zugemutet“ und durchaus nicht, – wie etwa die bloße „Sitte“, seine Speisen in bestimmter Art zu bereiten, – freigestellt. Ein Verstoß gegen die Konvention („Standessitte“) wird oft durch die höchst wirksame und empfindliche Folge des sozialen Boykotts der Standesgenossen stärker geahndet[,] als irgendein Rechtszwang dies vermöchte. Was fehlt, ist lediglich der besondre, auf ein spezifisches, die Innehaltung garantierendes Handeln eingestellte Stab von Menschen Stammler unterscheidet „zwei Klassen sozialer Regeln“, die „rechtlichen Satzungen“ oder Rechtsregeln und die „Konventionalregeln“. Die Konventionalregeln bilden ihm die „Masse jener Normen, die in den Weisungen von Anstand und Sitte, in den Forderungen der Etikette und den Formen des geselligen Verkehres im engeren Sinne, in der Mode und den vielfachen äußeren Gebräuchen, wie in dem Kodex der ritterlichen Ehre uns entgegentreten.“ (Stammler, Wirtschaft und Recht2, S. 121). Mit den beiden Regelarten seien unterschiedliche Geltungsansprüche verbunden. Während das Recht den Anspruch erhebe, „zu gebieten, ganz unabhängig von der Zustimmung des Rechtsunterworfenen“, enthalte die Konventionalregel eine „bedingungsweise Einladung“ . Sie beanspruche lediglich, „zu gelten zufolge der Einwilligung des Unterstellten“ (ebd., S. 124 f.).
f
(bei uns: Richter, Staatsanwälte, Verwaltungsbeamte, Exekutoren usw.). Aber der Übergang ist flüssig. Der Grenzfall der konventionellen Garantie einer Ordnung im Übergang zur Rechtsgarantie ist die Anwendung des förmlichen, angedrohten und organisierten, Boykotts. Dieser wäre für unsre Terminologie bereits ein Rechtszwangsmittel. Daß die Konvention außer durch die bloße Mißbilligung auch durch andre Mittel (etwa: Gebrauch des Hausrechts bei konventionswidrigem Verhalten) geschützt wird, interessiert hier nicht. Denn entscheidend ist: daß eben dann der einzelne, und zwar infolge der konventionellen Mißbilligung, diese (oft drastischen) Zwangsmittel anwendet, nicht: ein Stab von Menschen eigens dafür bereit steht.[187]A: Menschen,
2. Uns soll für den Begriff „Recht“ (der für andre Zwecke ganz anders abgegrenzt werden mag) die Existenz eines Erzwingungs-Stabes entscheidend sein. Dieser braucht natürlich in keiner Art dem zu gleichen, was wir heute gewohnt sind. Insbesondere ist es nicht nötig, daß eine „richterliche“ Instanz vorhanden sei. Auch die Sippe (bei der Blutrache und Fehde) ist ein solcher Stab, wenn für die Art ihres Reagierens Ordnungen irgendwelcher Art tatsächlich gelten. Allerdings steht dieser Fall auf der äußersten Grenze dessen, was gerade noch als „Rechtszwang“ anzusprechen ist. Dem „Völkerrecht“ ist bekanntlich die Qualität als „Recht“ immer wieder bestritten worden, weil es an einer überstaatlichen Zwangsgewalt fehle. Für die hier (als zweckmäßig) gewählte Terminologie würde in der Tat eine Ordnung, die äußerlich lediglich durch Erwartungen der Mißbilligung und der Repressalien des Geschädigten, also konventionell und durch Interessenlage, garantiert ist, ohne daß ein Stab von Menschen existiert, dessen Handeln eigens auf ihre Innehaltung eingestellt ist, nicht als „Recht“ zu bezeichnen sein. Für die juristische Terminologie kann dennoch sehr wohl das Gegenteil gelten. Die Mittel des Zwangs sind irrelevant. Auch die „brüderliche Vermahnung“, welche in manchen Sekten als erstes Mittel sanften Zwangs gegen Sünder üblich war, gehört – wenn durch eine Regel geordnet und durch einen Menschenstab durchgeführt – dahin. Ebenso z. B. die zensorische Rüge
68
als Mittel, „sittliche“ Normen des Verhaltens zu garan[188]tieren. Erst recht also der psychische Zwang durch die eigentlichen kirchlichen Zuchtmittel. Es gibt also natürlich ganz ebenso ein hierokratisch wie ein politisch oder ein durch Vereinsstatuten oder durch Hausautorität oder durch Genossenschaften und Einungen garantiertes „Recht“. Auch die Regeln eines „Komments“ gelten dieser Begriffsbestimmung als „Recht“. Der Fall des § 888 Abs. 2 RZPO. (unvollstreckbare Rechte) [187]Mißbilligung des Verhaltens bestimmter Personen durch einen Zensor. Das Amt [188]des Zensors gab es z. B. im alten Rom (u. a. zur Sittenaufsicht) und im kaiserlichen China (zur Beurteilung des Kaisers und der Beamten). Dazu Weber, Recht, MWG I/22-3, S. 377 bzw. Weber, Konfuzianismus, MWG I/19, S. 177 f., mit Fn. 77 und 78.
69
gehört selbstverständlich dahin. Die „leges imperfectae“ und die „Naturalobligationen“ sind Formen der Rechtssprache, in welchen indirekt Schranken oder Bedingungen der Zwangsanwendung ausgedrückt werden. § 888 der Reichscivilprozeßordnung (RCPO) vom 30. Januar 1877 in der Fassung von 1900 lautet: „Kann eine Handlung durch einen Dritten nicht vorgenommen werden, so ist, wenn sie ausschließlich vom Willen des Schuldners abhängt, auf Antrag von dem Prozeßgericht erster Instanz zu erkennen, daß der Schuldner zur Vornahme der Handlung durch Geldstrafen bis zum Gesammtbetrage von fünfzehnhundert Mark oder durch Haft anzuhalten sei. – Diese Bestimmung kommt im Falle der Verurtheilung zur Eingehung einer Ehe, im Fall der Verurtheilung zur Herstellung des ehelichen Lebens und im Fall der Verurtheilung zur Leistung von Diensten aus einem Dienstvertrage nicht zur Anwendung.“
70
Eine zwangsmäßig oktroyierte „Verkehrssitte“ ist insoweit Recht (§§ 157, 242 BGB.). Mit dem aus dem römischen Recht stammenden Begriff „leges imperfectae“ (lat., Pl. von lex imperfecta, unvollkommenes Gesetz) werden Rechtsvorschriften bezeichnet, an die der Gesetzgeber keine Rechtsfolgen, z. B. Strafen, geknüpft hat. Unter „Naturalobligationen“ werden Verbindlichkeiten verstanden, die nicht im Prozeßwege durchgesetzt werden können, z. B. verjährte Forderungen oder Spiel- und Wettschulden. Vgl. dazu Klingmüller, Fritz, Die Lehre von den natürlichen Verbindlichkeiten. Eine historisch-dogmatische Untersuchung. – Berlin: Guttentag 1905.
71
Vgl. über den Begriff der „guten Sitte“ (= billigenswerte und daher vom Recht sanktionierte Sitte) Max Rümelin in der „Schwäb[ischen] Heimatsgabe für Th[eodor] Häring“ (1918). Der juristische Begriff der „Verkehrssitte“ bezeichnet die ständige Übung eines bestimmten Verhaltens im Rechtsverkehr. Die Verkehrssitte ist im Gegensatz zum Gewohnheitsrecht keine Rechtsnorm, wird jedoch bei der nach „Treu und Glauben“ vorzunehmenden Auslegung von Verträgen herangezogen. Die von Weber zitierten §§ 157 und 242 des BGB vom 18. August 1896, 1900 in Kraft getreten, lauten: „§ 157. Verträge sind so auszulegen, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern.“ „§ 242. Der Schuldner ist verpflichtet, die Leistung so zu bewirken, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern.“
72
Rümelin, Sittengesetz, S. 133–148.
3. Nicht jede geltende Ordnung hat notwendig generellen und abstrakten Charakter. Geltender „Rechtssatz“ und „Rechtsentscheidung“ eines konkreten Falles z. B. waren keineswegs unter allen Umständen so voneinander geschieden, wie wir dies heute als normal ansehen. Eine „Ordnung“ kann also auch als Ordnung lediglich eines konkreten Sachverhalts auftre[189]ten. Alles Nähere gehört in die Rechtssoziologie.
73
Wir werden vorerst, wo nichts andres gesagt ist, zweckmäßigerweise mit der modernen Vorstellungsweise über die Beziehung von Rechtssatz und Rechtsentscheidung arbeiten.[189] Die Neufassung des Kapitels über Recht ist nicht überliefert. Vgl. dazu die Einleitung, oben, S. 69, und die Übersicht zum Editorischen Bericht, oben, S. 109–111.
4. „Äußerlich“ garantierte Ordnungen können außerdem auch noch „innerlich“ garantiert sein. Die Beziehung zwischen Recht, Konvention und „Ethik“ ist für die Soziologie kein Problem. Ein „ethischer“ Maßstab ist für sie ein solcher, der eine [A 19]spezifische Art von wertrationalem Glauben von Menschen als Norm an menschliches Handeln legt, welches das Prädikat des „sittlich Guten“ in Anspruch nimmt, ebenso wie Handeln, welches das Prädikat „schön“ in Anspruch nimmt, dadurch an ästhetischen Maßstäben sich mißt. Ethische Normvorstellungen in diesem Sinn können das Handeln sehr tiefgehend beeinflussen und doch jeder äußeren Garantie entbehren. Letzteres pflegt dann der Fall zu sein, wenn durch ihre Verletzung fremde Interessen wenig berührt werden. Sie sind andrerseits sehr oft religiös garantiert. Sie können aber auch (im Sinn der hier gebrauchten Terminologie) konventionell: durch Mißbilligung der Verletzung und Boykott[,] oder auch noch rechtlich, durch strafrechtliche oder polizeiliche Reaktion oder zivilrechtliche Konsequenzen, garantiert sein. Jede tatsächlich – im Sinne der Soziologie – „geltende“ Ethik pflegt weitgehend durch die Chance der Mißbilligung ihrer Verletzung, also: konventionell, garantiert zu sein. Andrerseits beanspruchen aber nicht (mindestens: nicht notwendig) alle konventionell oder rechtlich garantierten Ordnungen den Charakter ethischer Normen, die rechtlichen – oft rein zweckrational gesatzten – im Ganzen noch weit weniger als die konventionellen. Ob eine unter Menschen verbreitete Geltungsvorstellung als dem Bereich der „Ethik“ angehörig anzusehen ist oder nicht (also „bloße“ Konvention oder „bloße“ Rechtsnorm ist), kann für die empirische Soziologie nicht anders als nach demjenigen Begriff des „Ethischen“ entschieden werden, der in dem in Frage stehenden Menschenkreise tatsächlich galt oder gilt. Allgemeines läßt sich darüber deshalb für sie nicht aussagen.
§ 7. Legitime Geltung kann einer Ordnung von den Handelnden zugeschrieben werden:
- kraft Tradition: Geltung des immer Gewesenen;
- kraft affektuellen (insbesondre: emotionalen) Glaubens: Geltung des neu Offenbarten oder des Vorbildlichen; [190]
- kraft wertrationalen Glaubens; Geltung des als absolut gültig Erschlossenen;
- kraft positiver Satzung, an deren Legalität geglaubt wird.
Diese Legalität kann als legitim gelten
- kraft Vereinbarung der Interessenten für diese;
- kraft Oktroyierung auf Grund einer als legitim geltenden Herrschaft von Menschen über Menschen und Fügsamkeit.
Alles Nähere gehört (vorbehaltlich einiger noch weiter zu definierender Begriffe) in die Herrschafts- und Rechtssoziologie.
74
Hier sei nur bemerkt:[190] Zur Herrschaftssoziologie siehe Kap. III, bes. §§ 1–2, unten, S. 449–455; zur Rechtssoziologie vgl. die vorangehende Anm. 73, oben, S. 189.
1. Die Geltung von Ordnungen kraft Heilighaltung der Tradition ist die universellste und ursprünglichste. Angst vor magischen Nachteilen verstärkte die psychische Hemmung gegenüber jeder Änderung eingelebter Gepflogenheiten des Handelns, und die mannigfachen Interessen, welche sich an Erhaltung der Fügsamkeit in die einmal geltende Ordnung zu knüpfen pflegen, wirkten im Sinn ihrer Erhaltung. Darüber später in Kap. III.
75
Kap. III, §§ 6–9, unten, S. 468–485.
2. Bewußte Neuschöpfungen von Ordnungen waren ursprünglich fast stets prophetische Orakel oder mindestens prophetisch sanktionierte und als solche heilig geglaubte Verkündigungen, bis herab zu den Statuten der hellenischen Aisymneten.
76
Die Fügsamkeit hing dann am Glauben an die Legitimation des Propheten. Ohne Neuoffenbarung von Ordnungen war in Epochen der Geltung des strengen Traditionalismus die Entstehung neuer Ordnungen, d. h. solcher, die als „neu“ angesehen wurden, nur so [191]möglich, daß diese als in Wahrheit von jeher geltend und nur noch nicht richtig erkannt oder als zeitweise verdunkelt und nunmehr wiederentdeckt behandelt wurden. Aisymnet war in der griechischen Antike die Bezeichnung für einen Schiedsrichter, der zunächst bei Sportwettkämpfen und bei Rechtsstreitigkeiten, dann zunehmend auch bei sozialen und politischen Konflikten innerhalb der Stadtstaaten (Poleis) eingesetzt wurde. Die Aisymnetie galt als eine besondere Form der politischen Herrschaft, bei der, außerhalb der üblichen Verfahren, häufig ,von außen‘, aus einer befreundeten Stadt, ein Schlichter mit weitgehenden Vollmachten bestimmt wurde, um den Stadtfrieden wiederherzustellen. Weber nennt in seiner Religionssoziologie den Aisymneten einen Gesetzgeber und grenzt ihn typologisch vom Propheten und vom Tyrannen ab. Diese usurpieren die Herrschaft, während der Aisymnet von den Betroffenen auf Zeit eingesetzt wird. Weber spricht deshalb auch von dem „legalen Aisymneten“. Dazu Weber, Religiöse Gemeinschaften, MWG I/22-2, S. 185. Der Aisymnet soll aber nicht einfach die alte Ordnung wiederherstellen, sondern eine neue schaffen: Er „soll den Ständeausgleich vollziehen und ein für immer gültiges neues ,heiliges‘ Recht schaffen und göttlich beglaubigen lassen.“ Ebd., S. 182. Schon Aristoteles behandelte die Aisymnetie als eine besondere Herrschaftsform, nennt sie allerdings „eine auf Wahl beruhende Tyrannis“. Dazu Aristoteles, Politik. – Hamburg: Felix Meiner 1958, Zitat: S. 110 (1285a).
3. Der reinste Typus der wertrationalen Geltung wird durch das „Naturrecht“ dargestellt. Wie begrenzt auch immer gegenüber seinen idealen Ansprüchen, so ist doch ein nicht ganz geringes Maß von realem Einfluß seiner logisch erschlossenen Sätze auf das Handeln nicht zu bestreiten und sind diese sowohl von dem offenbarten wie vom gesatzten wie vom traditionalen Recht zu scheiden.
4. Die heute geläufigste Legitimitätsform ist der Legalitätsglaube: die Fügsamkeit gegenüber formal korrekt und in der üblichen Form zustandegekommenen Satzungen. Der Gegensatz paktierter und oktroyierter Ordnungen ist dabei nur relativ. Denn sobald die Geltung einer paktierten Ordnung nicht auf einmütiger Vereinbarung beruht, – wie dies in der Vergangenheit oft für erforderlich zur wirklichen Legitimität gehalten wurde, – sondern innerhalb eines Kreises von Menschen auf tatsächlicher Fügsamkeit abweichend Wollender gegenüber [A 20]Majoritäten – wie es sehr oft der Fall ist, – dann liegt tatsächlich eine Oktroyierung gegenüber der Minderheit vor. Der Fall andrerseits, daß gewaltsame oder doch rücksichtslosere und zielbewußtere Minderheiten Ordnungen oktroyieren, die dann auch den ursprünglich Widerstrebenden als legitim gelten, ist überaus häufig. Soweit „Abstimmungen“ als Mittel der Schaffung oder Änderung von Ordnungen legal sind, ist es sehr häufig, daß der Minderheitswille die formale Mehrheit erlangt und die Mehrheit sich fügt, also: die Majorisierung nur Schein ist. Der Glaube an die Legalität paktierter Ordnungen reicht ziemlich weit zurück und findet sich zuweilen auch bei sog. Naturvölkern: fast stets aber ergänzt durch die Autorität von Orakeln.
5. Die Fügsamkeit gegenüber der Oktroyierung von Ordnungen durch einzelne oder mehrere setzt, soweit nicht bloße Furcht oder zweckrationale Motive dafür entscheidend sind, sondern Legalitätsvorstellungen bestehen, den Glauben an eine in irgendeinem Sinn legitime Herrschaftsgewalt des oder der Oktroyierenden voraus, wovon daher gesondert zu handeln ist (§§ 13, 16 und K. III).
77
[191] Kap. I, § 13, unten, S. 207 f., Kap. I, § 16, unten, S. 210 f., Kap. III, dort bes. §§ 1–2, unten, S. 449–455.
6. In aller Regel ist Fügsamkeit in Ordnungen außer durch Interessenlagen der allerverschiedensten Art durch eine Mischung von Traditionsgebundenheit und Legalitätsvorstellung bedingt, soweit es sich nicht um ganz neue Satzungen handelt. In sehr vielen Fällen ist den fügsam Handelnden dabei natürlich nicht einmal bewußt, ob es sich um Sitte, Konvention oder Recht handelt. Die Soziologie hat dann die typische Art der Geltung zu ermitteln.
[192]§ 8. Kampf soll eine soziale Beziehung insoweit heißen, als das Handeln an der Absicht der Durchsetzung des eignen Willens gegen Widerstand des oder der Partner orientiert ist. „Friedliche“ Kampfmittel sollen solche heißen, welche nicht in aktueller physischer Gewaltsamkeit bestehen. Der „friedliche“ Kampf soll „Konkurrenz“ heißen, wenn er als formal friedliche Bewerbung um eigne Verfügungsgewalt über Chancen geführt wird, die auch andre begehren. „Geregelte Konkurrenz“ soll eine Konkurrenz insoweit heißen, als sie in Zielen und Mitteln sich an einer Ordnung orientiert. Der ohne sinnhafte Kampfabsicht gegeneinander stattfindende (latente) Existenzkampf menschlicher Individuen oder Typen um Lebens- oder Überlebenschancen soll „Auslese“ heißen: „soziale Auslese“, sofern es sich um Chancen Lebender im Leben, „biologische Auslese“, sofern es sich um Überlebenschancen von Erbgut handelt.
1. Vom blutigen, auf Vernichtung des Lebens des Gegners abzielenden, jede Bindung an Kampfregeln ablehnenden Kampf bis zum konventional geregelten Ritterkampf (Heroldsruf vor der Schlacht von Fontenoy: „Messieurs les Anglais, tirez les premiers“)
78
und zum geregelten Kampfspiel (Sport), von der regellosen „Konkurrenz“ etwa erotischer Bewerber um die Gunst einer Frau, dem an die Ordnung des Markts gebundenen Konkurrenzkampf um Tauschchancen, bis zu geregelten künstlerischen „Konkurrenzen“ oder zum „Wahlkampf“ gibt es die allerverschiedensten lückenlosen Übergänge. Die begriffliche Absonderung des gewaltsamen Kampfes rechtfertigt sich durch die Eigenart der ihm normalen Mittel und die daraus folgenden Besonderheiten der soziologischen Konsequenzen seines Eintretens (s. K. II und später).[192] Der Bericht der Episode geht auf Voltaire zurück. In der Schlacht von Fontenoy im Jahre 1745, die im Rahmen des österreichischen Erbfolgekriegs ausgetragen wurde, standen sich ein französisches und ein englisch-hannoveranisches Heer gegenüber. Während eines Frontalangriffes soll Lord Charles Hay den Franzosen Comte dʼAnterroche und seine Truppen aufgefordert haben: „Messieurs des gardes-françaises, tirez“, worauf dieser geantwortet haben soll: „Messieurs, nous ne tirons jamais les premiers; tirez vous-mêmes“. Voltaire, Précis du siècle de Louis XV. – Paris: Lʼimprimerie des Frères Mame 1808, Kap. 15, S. 107–124, Zitat: S. 114.
79
Kap. II, § 1, unten, S. 218 f., Abschnitt 2 und 3. „Später“ bezieht sich möglicherweise auf das geplante, aber nicht überlieferte Kapitel über den Staat (Staatssoziologie).
2. Jedes typisch und massenhaft stattfindende Kämpfen und Konkurrieren führt trotz noch so vieler ausschlaggebender Zufälle und Schicksale [193]doch auf die Dauer im Resultat zu einer „Auslese“ derjenigen, welche die für den Sieg im Kampf durchschnittlich wichtigen persönlichen Qualitäten in stärkerem Maße besitzen. Welches diese Qualitäten sind: ob mehr physische Kraft oder skrupelfreie Verschlagenheit, mehr Intensität geistiger Leistungs- oder Lungenkraft und Demagogentechnik, mehr Devotion gegen Vorgesetzte oder gegen umschmeichelte Massen, mehr originale Leistungsfähigkeit oder mehr soziale Anpassungsfähigkeit, mehr Qualitäten, die als außergewöhnlich oder solche, die als nicht über dem Massendurchschnitt stehend gelten: – darüber entscheiden die Kampf- und Konkurrenzbedingungen, zu denen, neben allen denkbaren individuellen und Massenqualitäten auch jene Ordnungen gehören, an denen sich, sei es traditional[,] sei es wertrational oder zweckrational, das Verhalten im Kampf orientiert. Jede von ihnen beeinflußt die Chancen der sozialen Auslese. Nicht jede soziale Auslese ist in unsrem Sinn „Kampf“. „Soziale Auslese“ bedeutet vielmehr zunächst nur: daß bestimmte Typen des Sichverhaltens und also, eventuell, der persönlichen Qualitäten, bevorzugt sind in der Möglichkeit der Gewinnung einer bestimmten sozialen Beziehung (als „Geliebter“, „Ehemann“, „Abgeordneter“, „Beamter“, „Bauleiter“, „Generaldirektor“, „erfolgreicher Unternehmer“ usw.). Ob diese soziale Vorzugschance durch „Kampf“ [A 21]realisiert wird, ferner aber: ob sie auch die biologische Überlebenschance des Typus verbessert oder das Gegenteil, darüber sagt sie an sich nichts aus.
Nur wo wirklich Konkurrenz stattfindet, wollen wir von „Kampf“ sprechen. Nur im Sinn von „Auslese“ ist der Kampf tatsächlich, nach aller bisherigen Erfahrung, und nur im Sinn von biologischer Auslese ist er prinzipiell unausschaltbar. „Ewig“ ist die Auslese deshalb, weil sich kein Mittel ersinnen läßt, sie völlig auszuschalten. Eine pazifistische Ordnung strengster Observanz kann immer nur Kampfmittel, Kampfobjekte und Kampfrichtung im Sinn der Ausschaltung bestimmter von ihnen regeln. Das bedeutet: daß andre Kampfmittel zum Siege in der (offenen) Konkurrenz oder – wenn man sich (was nur utopistisch-theoretisch möglich wäre) auch diese beseitigt denkt – dann immer noch in der (latenten) Auslese um Lebens- und Überlebenschancen führen und diejenigen begünstigen, denen sie, gleichviel ob als Erbgut oder Erziehungsprodukt, zur Verfügung stehen. Die soziale Auslese bildet empirisch, die biologische prinzipiell, die Schranke der Ausschaltung des Kampfes.
3. Zu scheiden von dem Kampf der einzelnen um Lebens- und Überlebenschancen ist natürlich „Kampf“ und „Auslese“ sozialer Beziehungen. Nur in einem übertragenen Sinn kann man hier diese Begriffe anwenden. Denn „Beziehungen“ existieren ja nur als menschliches Handeln bestimmten Sinngehalts. Und eine „Auslese“ oder ein „Kampf“ zwischen ihnen bedeutet also: daß eine bestimmte Art von Handeln durch eine andere, sei [194]es der gleichen oder anderer Menschen, im Lauf der Zeit verdrängt wird. Dies ist in verschiedener Art möglich. Menschliches Handeln kann sich a) bewußt darauf richten: bestimmte konkrete, oder: generell bestimmt geordnete, soziale Beziehungen[,] d. h. das ihrem Sinngehalt entsprechend ablaufende Handeln[,] zu stören oder im Entstehen oder Fortbestehen zu verhindern (einen „Staat“ durch Krieg oder Revolution oder eine „Verschwörung“ durch blutige Unterdrückung, „Konkubinate“ durch polizeiliche Maßnahmen, „wucherische“ Geschäftsbeziehungen durch Versagung des Rechtsschutzes und Bestrafung)
g
oder durch Prämierung des Bestehens der einen Kategorie zuungunsten der andern bewußt zu beeinflussen: Einzelne sowohl wie viele verbundene Einzelne können sich derartige Ziele setzen. Es kann aber auch b) der ungewollte Nebenerfolg des Ablaufs sozialen Handelns und der dafür maßgebenden Bedingungen aller Art sein: daß bestimmte konkrete, oder bestimmt geartete, Beziehungen (d. h. stets: das betreffende Handeln) eine abnehmende Chance haben, fortzubestehen oder neu zu entstehen. Alle natürlichen und Kultur-Bedingungen jeglicher Art wirken im Fall der Veränderung in irgendeiner Weise dahin, solche Chancen für die allerverschiedensten Arten sozialer Beziehungen zu verschieben. Es ist jedermann unbenommen, auch in solchen Fällen von einer „Auslese“ der sozialen Beziehungen – z. B. der staatlichen Verbände – zu reden, indem[194]In A folgt ein Komma.
h
der „Stärkere“ (im Sinn des „Angepaßteren“) siege. Nur ist festzuhalten, daß diese sog. „Auslese“ mit der Auslese der Menschentypen weder im sozialen noch im biologischen Sinn etwas zu tun hat, daß in jedem einzelnen Fall nach dem Grunde zu fragen ist, der die Verschiebung der Chancen für die eine oder die andere Form des sozialen Handelns und der sozialen Beziehungen bewirkt, oder eine soziale Beziehung gesprengt, oder ihr die Fortexistenz gegenüber andern gestattet hat, und daß diese Gründe so mannigfaltig sind, daß ein einheitlicher Ausdruck dafür unpassend erscheint. Es besteht dabei stets die Gefahr: unkontrollierte Wertungen in die empirische Forschung zu tragen und vor allem: Apologie des im Einzelfall oft rein individuell bedingten, also in diesem Sinn des Wortes: „zufälligen“, Erfolges zu treiben. Die letzten Jahre brachten und bringen davon mehr als zuviel. Denn das oft durch rein konkrete Gründe bedingte Ausgeschaltetwerden einer (konkreten oder qualitativ spezifizierten) sozialen Beziehung beweist ja an sich noch nicht einmal etwas gegen ihre generelle „Angepaßtheit“.A: in dem mögliche Lesart auch: in der
§ 9. „Vergemeinschaftung“ soll eine soziale Beziehung heißen, wenn und soweit die Einstellung des sozialen Handelns – im [195]Einzelfall oder im Durchschnitt oder im reinen Typus – auf subjektiv gefühlter (affektueller oder traditionaler) Zusammengehörigkeit der Beteiligten beruht.
„Vergesellschaftung“ soll eine soziale Beziehung heißen, wenn und soweit die Einstellung des sozialen Handelns auf rational (wert- oder zweckrational) motiviertem Interessenausgleich oder auf ebenso motivierter Interessenverbindung beruht. Vergesellschaftung kann typisch insbesondre (aber nicht: nur) auf rationaler Vereinbarung durch gegenseitige Zusage beruhen. Dann wird das vergesellschaftete Handeln im Rationalitätsfall orientiert a) wertrational[,] [A 22]an dem Glauben an die eigne Verbindlichkeit, – b) zweckrational[,] an der Erwartung der Loyalität des Partners.
1. Die Terminologie erinnert an die von F[erdinand] Tönnies in seinem grundlegenden Werk: Gemeinschaft und Gesellschaft, vorgenommene Unterscheidung.
80
Doch hat T[önnies] für seine Zwecke dieser Unterscheidung alsbald einen wesentlich spezifischeren Inhalt gegeben, als hier für unsre Zwecke nützlich wäre. Die reinsten Typen der Vergesellschaftung sind a) der streng zweckrationale frei paktierte Tausch auf dem Markt: – ein aktuelles Kompromiß entgegengesetzt, aber komplementär, Interessierter; – b) der reine, frei paktierte, Zweckverein, eine nach Absicht und Mitteln rein auf Verfolgung sachlicher (ökonomischer oder anderer) Interessen der Mitglieder abgestellte Vereinbarung kontinuierlichen Handelns;[195] Vgl. dazu oben, S. 148, Hg.-Anm. 6.
i
– c) der wertrational motivierte Gesinnungsverein: die rationale Sekte, insoweit, als sie von der Pflege emotionaler und affektueller Interessen absieht und nur der „Sache“ dienen will (was freilich nur in besondern Fällen in ganz reinem Typus vorkommt).[195]A: Handelns,
2. Vergemeinschaftung kann auf jeder Art von affektueller oder emotionaler oder aber traditionaler Grundlage ruhen: eine pneumatische Brüdergemeinde,
81
eine erotische Beziehung, ein Pietätsverhältnis, eine „nationale“ Gemeinschaft, eine kameradschaftlich zusammenhaltende Truppe. Den Typus gibt am bequemsten die Familiengemeinschaft ab. Die große Mehrzahl sozialer Beziehungen aber hat teils den Charakter der Ver[196]gemeinschaftung, teils den der Vergesellschaftung. Jede noch so zweckrationale und nüchtern geschaffene und abgezweckte soziale Beziehung (Kundschaft z. B.) kann Gefühlswerte stiften, welche über den gewillkürten Zweck hinausgreifen. Jede über ein aktuelles Zweckvereinshandeln hinausgehende, also auf längere Dauer eingestellte, soziale Beziehungen zwischen den gleichen Personen herstellende und nicht von vornherein auf sachliche Einzelleistungen begrenzte Vergesellschaftung – wie etwa die Vergesellschaftung im gleichen Heeresverband, in der gleichen Schulklasse, im gleichen Kontor, der gleichen Werkstatt – neigt, in freilich höchst verschiedenem Grade, irgendwie dazu. Ebenso kann umgekehrt eine soziale Beziehung, deren normaler Sinn Vergemeinschaftung ist, von allen oder einigen Beteiligten ganz oder teilweise zweckrational orientiert werden. Wie weit z. B. ein Familienverband von den Beteiligten als „Gemeinschaft“ gefühlt oder als „Vergesellschaftung“ ausgenutzt wird, ist sehr verschieden. Der Begriff der „Vergemeinschaftung“ ist hier absichtlich noch ganz allgemein und also: sehr heterogene Tatbestände umfassend, definiert. Von pneumatischen Gemeinschaften handelt Weber am Beispiel des Täufertums und der daraus hervorgegangenen Sekten der Baptisten, Mennoniten und Quäker und sieht darin eine „Renaissance urchristlicher pneumatisch-religiöser Gedanken“. Vgl. Weber, Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus, in: GARS I, S. 150 ff., Zitat: S. 154 (MWG I/18).
3. Vergemeinschaftung ist dem gemeinten Sinn nach normalerweise der radikalste Gegensatz gegen „Kampf“. Dies darf nicht darüber täuschen, daß tatsächlich Vergewaltigung jeder Art innerhalb auch der intimsten Vergemeinschaftungen gegenüber dem seelisch Nachgiebigeren durchaus normal ist, und daß die „Auslese“ der Typen innerhalb der Gemeinschaften ganz ebenso stattfindet und zur Verschiedenheit der durch sie gestifteten Lebens- und Überlebenschancen führt wie irgendwo sonst. Vergesellschaftungen andrerseits sind sehr oft lediglich Kompromisse widerstreitender Interessen, welche nur einen Teil des Kampfgegenstandes oder der Kampfmittel ausschalten (oder: dies doch versuchen), den Interessengegensatz selbst und die Konkurrenz um die Chancen im übrigen aber bestehen lassen. „Kampf“ und Gemeinschaft sind relative Begriffe; der Kampf gestaltet sich eben sehr verschieden, je nach den Mitteln (gewaltsame oder „friedliche“) und der Rücksichtslosigkeit ihrer Anwendung. Und jede wie immer geartete Ordnung sozialen Handelns läßt, wie gesagt, die reine tatsächliche Auslese im Wettbewerb der verschiedenen Menschentypen um die Lebenschancen irgendwie bestehen.
4. Keineswegs jede Gemeinsamkeit der Qualitäten, der Situation oder des Verhaltens ist eine Vergemeinschaftung. Z. B. bedeutet die Gemeinsamkeit von solchem biologischen Erbgut, welches als „Rassen“-Merkmal angesehen wird, an sich natürlich noch keinerlei Vergemeinschaftung der dadurch Ausgezeichneten. Durch Beschränkung des commercium und connubium seitens der Umwelt können sie in eine gleichartige – dieser Umwelt gegenüber isolierte – Situation geraten. Aber auch wenn sie auf diese Situation gleichartig reagieren, so ist dies noch keine Vergemeinschaftung, und auch das bloße „Gefühl“ für die gemeinsame Lage und [197]deren Folgen erzeugt sie noch nicht. Erst wenn sie auf Grund dieses Gefühls ihr Verhalten irgendwie aneinander orientieren, entsteht eine soziale Beziehung zwischen ihnen – nicht nur: jedes von ihnen zur Umwelt – und erst soweit diese eine gefühlte Zusammengehörigkeit dokumentiert, „Gemeinschaft“. Bei den Juden z. B. ist dies – außerhalb der zionistisch orientierten Kreise und des Handelns einiger andrer Vergesellschaftungen für jüdische Interessen – nur in relativ sehr geringem Maße der Fall, wird von ihnen vielfach geradezu abgelehnt.
82
Gemeinsamkeit der Sprache, geschaffen durch gleichartige Tradition von seiten der Familie und [A 23]Nachbarumwelt, erleichtert das gegenseitige Verstehen, also die Stiftung aller sozialer Beziehungen, im höchsten Grade. Aber an sich bedeutet sie noch keine Vergemeinschaftung, sondern nur die Erleichterung des Verkehrs innerhalb der betreffenden Gruppen, also: der Entstehung von Vergesellschaftungen. Zunächst: zwischen den einzelnen und nicht in deren Eigenschaft als Sprachgenossen, sondern als Interessenten sonstiger Art: die Orientierung an den Regeln der gemeinsamen Sprache ist primär also nur Mittel der Verständigung, nicht Sinngehalt von sozialen Beziehungen. Erst die Entstehung bewußter Gegensätze gegen Dritte kann für die an der Sprachgemeinsamkeit Beteiligten eine gleichartige Situation, Gemeinschaftsgefühl und Vergesellschaftungen, deren bewußter Existenzgrund die gemeinsame Sprache ist, stiften. – Die Beteiligung an einem „Markt“ (Begriff s. K. II) [197]Die Emanzipation der Juden war im 19. Jahrhundert in den verschiedenen europäischen Ländern, wenn auch unterschiedlich weit, vorangekommen, erlitt aber insbesondere ab den 1870er Jahren Rückschläge. In Deutschland organisierte sich der Antisemitismus in Parteien, in Rußland gab es Pogrome, in Frankreich erschütterte die Dreyfus-Affäre die Öffentlichkeit. Nicht zuletzt Ereignisse dieser Art stärkten die zionistische Bewegung, das Streben nach einem eigenen jüdischen Staat. Diese Bewegung erfaßte aber nur eine Minderheit der Juden, war in sich nicht einheitlich und wurde von assimilationsbereiten Juden, die sich in die deutsche Gesellschaft integrieren wollten, abgelehnt. Erst durch Theodor Herzls Schrift „Der Judenstaat“ und die ab 1897 stattfindenden Zionistenkongresse in Basel gewann der Zionismus eine gewisse Einheitlichkeit. Herzl hatte postuliert, die Judenfrage sei keine soziale oder religiöse, sondern eine nationale Frage. Schließlich einigte man sich auf Palästina als Territorium für diesen Staat. Vgl. hierzu Battenberg, Friedrich, Das europäische Zeitalter der Juden. Zur Entwicklung einer Minderheit in der nichtjüdischen Umwelt Europas. – Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1990, S. 208 ff. Weber beurteilte die Erfolgsaussichten einer säkularen zionistischen Bewegung skeptisch. Dazu sein Brief an Ernst J. Lesser vom 18. August 1913, MWG II/8, S. 312–315.
83
ist wiederum anders geartet. Sie stiftet Vergesellschaftung zwischen den einzelnen Tauschpartnern und eine soziale Beziehung (vor allem: „Konkurrenz“) zwischen den Tauschreflektanten, die gegenseitig ihr Verhalten aneinander orientieren müssen. Aber darüber hinaus entsteht Vergesellschaftung nur, soweit etwa einige Beteiligte zum Zweck [198]erfolgreicheren Preiskampfs, oder: sie alle zu Zwecken der Regelung und Sicherung des Verkehrs, Vereinbarungen treffen. (Der Markt und die auf ihm ruhende Verkehrswirtschaft ist im übrigen der wichtigste Typus der gegenseitigen Beeinflussung des Handelns durch nackte Interessenlage, wie sie der modernen Wirtschaft charakteristisch ist.) Kap. II, § 8, unten, S. 248 ff.
§ 10. Eine soziale Beziehung (gleichviel ob Vergemeinschaftung oder Vergesellschaftung) soll nach außen „offen“ heißen, wenn und insoweit die Teilnahme an dem an ihrem Sinngehalt orientierten gegenseitigen sozialen Handeln, welches sie konstituiert, nach ihren geltenden Ordnungen niemand verwehrt wird, der dazu tatsächlich in der Lage und geneigt ist. Dagegen nach außen „geschlossen“[,] dann, insoweit und in dem Grade, als
k
ihr Sinngehalt oder ihre geltenden Ordnungen die Teilnahme ausschließen oder beschränken oder an Bedingungen knüpfen. Offenheit und Geschlossenheit können traditionell oder affektuell oder wert- oder zweckrational bedingt sein. Die rationale Schließung[198]Lies: wenn, insoweit und in dem Grade als,
l
insbesondere durch folgenden Sachverhalt: Eine soziale Beziehung kann den Beteiligten Chancen der Befriedigung innerer oder äußerer Interessen eröffnen, sei es dem Zweck oder dem Erfolg nach, sei es durch solidarisches Handeln oder durch Interessenausgleich. Wenn die Beteiligten von ihrer Propagierung eine Verbesserung ihrer eignen Chancen nach Maß, Art, Sicherung oder Wert erwarten, so sind sie an Offenheit, wenn umgekehrt von deren Monopolisierung, so sind sie an Schließung nach außen interessiert.Zu ergänzen wäre: oder Öffnung
Eine geschlossene soziale Beziehung kann monopolisierte Chancen den Beteiligten a) frei oder b) nach Maß und Art reguliert oder rationiert oder c) den einzelnen oder Gruppen von ihnen dauernd und relativ oder völlig unentziehbar appropriiert garantieren (Schließung nach innen). Appropriierte Chancen sollen „Rechte“ heißen. Die Appropriation kann gemäß der Ordnung 1) an die an bestimmten Gemeinschaften und Gesellschaften – z. B. Hausgemeinschaften – Beteiligten oder 2) an Einzelne und in diesem Fall a: rein persönlich oder b: so erfolgen, daß im Todesfall ein oder mehrere durch eine soziale Bezie[199]hung oder durch Gebürtigkeit (Verwandtschaft) mit dem bisherigen Genießer der Chance Verbundene
m
oder der oder die von ihm zu bezeichnenden Anderen in die appropriierten Chancen einrücken (erbliche Appropriation). Sie kann endlich 3) so erfolgen, daß der Genießer die Chance a): bestimmten oder endlich b): daß er sie beliebigen anderen durch Vereinbarung mehr oder minder frei abtreten kann (veräußerliche Appropriation). Der an einer geschlossenen Beziehung Beteiligte soll Genosse, im Fall der Regulierung der Beteiligung aber, sofern diese ihm Chancen appropriiert, Rechtsgenosse genannt werden. Erblich an Einzelne oder an erbliche Gemeinschaften oder Gesellschaften appropriierte Chancen sollen: Eigentum (der einzelnen oder der betreffenden Gemeinschaften oder Gesellschaften), veräußerlich appropriierte: freies Eigentum heißen.[199]A: Verbundenen
Die scheinbar nutzlos „mühselige“ Definition dieser Tatbestände ist ein Beispiel dafür: daß gerade das „Selbstverständliche“ (weil anschaulich Eingelebte) am wenigsten „gedacht“ zu werden pflegt.
[A 24]1. a) Traditional geschlossen pflegen z. B. Gemeinschaften zu sein, deren Zugehörigkeit sich auf Familienbeziehungen gründet.
b) Affektuell geschlossen zu sein pflegen persönliche Gefühlsbeziehungen (z. B. erotische oder – oft – pietätsmäßige).
c) Wertrational (relativ) geschlossen pflegen strikte Glaubensgemeinschaften zu sein.
d) Zweckrational typisch geschlossen sind ökonomische Verbände mit monopolistischem oder plutokratischem Charakter.
Einige Beispiele beliebig herausgegriffen:
Offenheit oder Geschlossenheit einer aktuellen Sprachvergesellschaftung hängt von dem Sinngehalt ab (Konversation im Gegensatz zu intimer oder geschäftlicher Mitteilung). – Die Marktbeziehung pflegt primär wenigstens oft offen zu sein. – Bei zahlreichen Vergemeinschaftungen und Vergesellschaftungen beobachten wir einen Wechsel zwischen Propagierung und Schließung. So z. B. bei den Zünften, den demokratischen Städten der Antike und des Mittelalters, deren Mitglieder zeitweise, im Interesse der Sicherung ihrer Chancen durch Macht, die möglichste Vermehrung, zu anderen Zeiten, im Interesse des Wertes ihres Monopols, Begrenzung der Mitgliedschaft erstrebten. Ebenso nicht selten bei Mönchsgemeinschaften und Sekten, die von religiöser Propaganda zur Abschließung im Interesse der Hochhaltung des ethischen Standards oder auch aus materiellen Grün[200]den übergingen. Verbreiterung des Marktes im Interesse vermehrten Umsatzes und monopolistische Begrenzung des Marktes stehen ähnlich nebeneinander. Sprachpropaganda findet sich heute als normale Folge der Verleger- und Schriftsteller-Interessen gegenüber den früher nicht seltenen ständisch geschlossenen und Geheimsprachen.
2. Das Maß und die Mittel der Regulierung und Schließung nach außen können sehr verschieden sein, so daß der Übergang von Offenheit zu Reguliertheit und Geschlossenheit flüssig ist: Zulassungsleistungen und Noviziate oder Erwerb eines bedingt käuflichen Mitgliedsanteils, Ballotage
84
für jede Zulassung, Zugehörigkeit oder Zulassung kraft Gebürtigkeit (Erblichkeit) oder kraft jedermann freistehender Teilnahme an bestimmten Leistungen oder – im Fall der Schließung und Appropriation nach innen – kraft Erwerbs eines appropriierten Rechts und die verschiedensten Abstufungen der Teilnahmebedingungen finden sich. „Reguliertheit“ und „Geschlossenheit“ nach außen sind also relative Begriffe. Zwischen einem vornehmen Klub, einer gegen Billet zugänglichen Theatervorstellung und einer auf Werbung ausgehenden Parteiversammlung, einem frei zugänglichen Gottesdienst, demjenigen einer Sekte und den Mysterien eines Geheimbundes bestehen alle denkbaren [200]Aus dem Französischen stammender Begriff für ein Abstimmungsverfahren, bei dem in der Regel weiße und schwarze Kugeln verwendet werden, wobei die weiße Kugel für Zustimmung, die schwarze für Ablehnung steht. Das Verfahren wurde hauptsächlich für die Aufnahme neuer Mitglieder in exklusive Gemeinschaften verwendet. Angeblich haben dieses auch „Kugelung“ genannte Verfahren zuerst die Benediktiner im Mittelalter bei der Bestimmung ihrer Äbte praktiziert.
n
Übergänge.[200]A: denkbare
3. Die Schließung nach innen – unter den Beteiligten selbst und im Verhältnis dieser zueinander – kann ebenfalls die verschiedenste Form annehmen. Z. B. kann eine nach außen geschlossene Kaste, Zunft oder etwa: Börsengemeinschaft ihren Mitgliedern die freie Konkurrenz miteinander um alle monopolisierten Chancen überlassen oder ein jedes Mitglied streng auf bestimmte, ihm lebenslang oder auch (so namentlich in Indien) erblich und veräußerlich appropriierte Chancen, so z. B. Kundschaften oder Geschäftsobjekte, beschränken, eine nach außen geschlossene Markgenossenschaft
85
dem Markgenossen entweder freie Nutzung oder ein [201]streng an den Einzelhaushalt gebundenes Kontingent, ein nach außen geschlossener Siedlungsverband freie Nutzung des Bodens oder dauernd appropriierte feste Hufenanteile zubilligen und garantieren, alles dies mit allen denkbaren Übergängen und Zwischenstufen. Historisch z. B. haben die Schließung der Anwartschaften auf Lehen, Pfründen und Ämter nach Innen und die Appropriation an die Inhaber höchst verschiedene Formen angenommen, und ebenso können Markgenossenschaft, auch Markgemeinschaft oder Markverband, ist im Rahmen von Webers Verbandstheorie eine jener historischen Erscheinungsformen, die er zusammen mit Hausgemeinschaft, Nachbarschaftsverband, Dorfgemeinschaft, Sippenverband und Stamm behandelt. Sie tritt insbesondere in der Frühzeit der Besiedelung eines Gebietes auf, wenn die Siedelnden noch von ‚freiem‘ Wald und Ödland umgeben sind. Mit enger werdendem Nahrungsspielraum tendiert die Markgenossenschaft zu einer Schließung nach außen, der dann auch eine Schließung nach innen folgen kann. Die Stadien der Schließung nach außen und nach innen behandelt Weber als Stadien der Appropriation. Vgl. unten, S. 202, Z. 3 ff.; und u. a. die Vorkriegstexte [201]„Wirtschaftliche Beziehungen der Gemeinschaften im allgemeinen“, MWG I/22-1, S. 77–107, bes. S. 79 ff., und das Stichwortmanuskript „Hausverband, Sippe und Nachbarschaft“, ebd., S. 291–327. Weber stellt in den Vorkriegsmanuskripten allerdings noch Verband und Verein typologisch einander gegenüber. Diese Gegenüberstellung gibt er hier auf. Dazu auch unten, S. 213, Hg.-Anm. 18.
o
– wozu die Entwicklung der „Betriebsräte“ der erste Schritt sein könnte (aber nicht: sein muß) – die Anwartschaft auf und die Innehabung von Arbeitsstellen sich vom closed shop bis zum Recht an der einzelnen Stelle (Vorstufe: Verbot der Entlassung ohne Zustimmung der Vertreter der Arbeiterschaft) steigern.[201]A: kann
86
Alle Einzelheiten gehören in die sachliche Einzelanalyse. Das Höchstmaß dauernder Appropriation besteht bei solchen Chancen, welche dem einzelnen (oder bestimmten Verbänden einzelner, z. B. Hausgemeinschaften, Sippen, Familien) derart garantiert sind, daß 1. im Todesfall der Übergang in bestimmte andere Hände durch die Ordnungen geregelt und garantiert ist, – 2. die Inhaber der Chance dieselbe frei an beliebige Dritte übertragen können, welche dadurch Teilhaber der sozialen Beziehung werden: diese ist also, im Fall solcher vollen Appropriation nach innen, zugleich eine nach außen (relativ) offene Beziehung (sofern sie den Mitgliedschafts-Erwerb nicht an die Zustimmung der andern Rechtsgenossen bindet). Nach heftigen Auseinandersetzungen um die Stellung der Belegschaft im Betrieb wurde am 4. Februar 1920 das „Betriebsrätegesetz“ erlassen. Es schrieb für jeden Betrieb ab einer Größe von zwanzig Beschäftigten vor, eine Betriebsvertretung in Gestalt eines Betriebsrats (Arbeiterrat und Angestelltenrat) zu bilden, der unter anderem bei Entlassungen mitwirkte (vgl. Reichs-Gesetzblatt Jg. 1920, hg. im Reichsministerium des Innern, Berlin 1920, S. 147–174 (hinfort: Betriebsrätegesetz); sowie Max Webers kritischen Kommentar zu dem Gesetz in seinem Brief an Carl Petersen vom 14. April 1920, MWG II/10, S. 985 f.). Unter „closed shop“ versteht man eine Schließung sozialer Beziehungen, die dadurch zustande kommt, daß sich Arbeitgeber und Gewerkschaft darauf einigen, nur Mitglieder der vereinbarenden Gewerkschaft in einem Betrieb zuzulassen. Diese Praxis war bereits Mitte des 19. Jahrhunderts in England in einigen Gewerben verbreitet, in Deutschland wurde sie erstmals 1906 von der Tarifgemeinschaft der Buchdrucker eingeführt. Das oben genannte Betriebsrätegesetz verbot solche Vereinbarungen (§ 81).
4. Motiv der Schließung kann sein a) Hochhaltung der Qualität und (eventuell) dadurch des Prestiges und der daran haftenden Chancen der Ehre und (eventuell) des Gewinnes. Beispiele: Asketen-, Mönchs- (ins[202]besondere auch z. B. in Indien: Bettelmönchs-), Sekten- (Puritaner!), Krieger-, Ministerialen- und andere Beamten- [A 25]und politische
p
Bürgerverbände (z. B. in der Antike), Handwerkereinungen; b) Knappwerden der Chancen im Verhältnis zum (Konsum-)Bedarf („Nahrungsspielraum“): Konsumtionsmonopol (Archetypos: die Markgemeinschaft); c) Knappwerden der Erwerbschancen („Erwerbsspielraum“): Erwerbsmonopol (Archetypos: die Zunft- oder die alten Fischereiverbände usw.). Meist ist das Motiv a mit b oder c kombiniert.[202]A: politischen
§ 11. Eine soziale Beziehung kann für die Beteiligten nach traditionaler oder gesatzter Ordnung die Folge haben: daß bestimmte Arten des Handelns a) jedes an der Beziehung Beteiligten allen Beteiligten („Solidaritätsgenossen“) oder b) das Handeln bestimmter Beteiligter
q
(„Vertreter“) den andern Beteiligten („Vertretenen“) zugerechnet wird, daß also sowohl die Chancen wie die Konsequenzen ihnen zugute kommen bzw. ihnen zur Last fallen. Die Vertretungsgewalt (Vollmacht) kann nach den geltenden Ordnungen – 1. in allen Arten und Graden appropriiert (Eigenvollmacht) oder aber – 2. nach Merkmalen dauernd oder zeitweise zugewiesen sein – oder 3. durch bestimmte Akte der Beteiligten oder Dritter, zeitweilig oder dauernd, übertragen werden (gesatzte Vollmacht). Über die Bedingungen, unter denen soziale Beziehungen (Gemeinschaften oder Gesellschaften) als Solidaritäts- oder als Vertretungsbeziehungen behandelt werden, läßt sich generell nur sagen, daß der Grad, in welchem ihr Handeln entweder a) auf gewaltsamen Kampf oder b) auf friedlichen Tausch als Zweck ausgerichtet ist, dafür in erster Linie entscheidend ist, daß aber im übrigen zahlreiche erst in der Einzelanalyse festzustellende Sonderumstände dafür maßgebend waren und sind. Am wenigsten pflegt naturgemäß diese Folge bei den rein ideelle Güter mit friedlichen Mitteln verfolgendenLies: b) bestimmter Beteiligter
r
einzutreten. Mit dem Maß der Geschlossenheit nach außen geht die Erscheinung der Solidarität oder Vertretungsmacht zwar oft, aber nicht immer, parallel.Zu ergänzen wäre: sozialen Beziehungen
[203]1. Die „Zurechnung“ kann praktisch bedeuten: a) passive und aktive Solidarität: Für das Handeln des einen Beteiligten gelten alle ganz wie er selbst als verantwortlich, durch sein Handeln andrerseits alle ebenso wie er als legitimiert zur Nutzung der dadurch gesicherten Chancen. Die Verantwortlichkeit kann Geistern oder Göttern gegenüber bestehen, also religiös orientiert sein. Oder: Menschen gegenüber, und in diesem Fall konventional für und gegen Rechtsgenossen (Blutrache gegen und durch Sippengenossen, Repressalien gegen Stadtbürger und Konnationale)
1
oder rechtlich (Strafe gegen Verwandte, Hausgenossen, Gemeindegenossen, persönliche Schuldhaftung von Hausgenossen und Handelsgesellschaftern füreinander und zugunsten solcher). Auch die Solidarität den Göttern gegenüber hat historisch (für die altisraelitische, altchristliche, altpuritanische Gemeinde) sehr bedeutende Folgen gehabt. b) Sie kann andrerseits (Mindestmaß!) auch nur bedeuten: daß nach traditionaler oder gesatzter Ordnung die an einer geschlossenen Beziehung Beteiligten eine Verfügung über Chancen gleichviel welcher Art (insbesondere: ökonomische Chancen), welche ein Vertreter vornimmt, für ihr eignes Verhalten als legal gelten lassen. („Gültigkeit“ der Verfügungen des „Vorstandes“ eines „Vereins“ oder des Vertreters eines politischen oder ökonomischen Verbandes über Sachgüter, die nach der Ordnung „Verbandszwecken“ dienen sollen.)[203] „Konnationale“ sind Angehörige einer Nation, die auf einem anderen Staatsgebiet leben. Zusammengehörigkeit und rechtliche Behandlung gleichnationaler Gruppen über Staatsgrenzen hinweg war zu Webers Zeit eine wichtige Frage der Politik gegenüber Minderheiten (Volksgruppen).
2. Der Tatbestand der „Solidarität“ besteht typisch a) bei traditionalen Gebürtigkeits- oder Lebens-Gemeinschaften (Typus: Haus und Sippe), – b) bei geschlossenen Beziehungen, welche die monopolisierten Chancen durch eigne Gewaltsamkeit behaupten (Typus: politische Verbände, insbesondere in der Vergangenheit, aber in weitestem Umfang, namentlich im Kriege, auch noch der Gegenwart), – c) bei Erwerbs-Vergesellschaftungen mit persönlich durch die Beteiligten geführtem Betrieb (Typus: offene Handelsgesellschaft), – d) unter Umständen bei Arbeitsgesellschaften (Typus: Artjel).
2
– Der Tatbestand der „Vertretung“ besteht typisch bei Zweckvereinen und gesatzten Verbänden, insbesondere dann, wenn ein [204]„Zweckvermögen“ (darüber später in der Rechtssoziologie) „Artjel“ (russ.) „Genossenschaft“: Assoziation von gleichberechtigten Personen, die Arbeit und Dienste übernahmen, die von Einzelnen nicht zu verrichten waren. Sie schlossen sich entweder allein mit ihrer Arbeitskraft oder auch mit Kapitaleinlagen zusammen, hafteten solidarisch und teilten den Ertrag. Dazu Apostol, Paul, Das Artjél. Eine wirtschaftsgeschichtliche Studie (Münchener Volkswirtschaftliche Studien, hg. von Lujo Brentano und Walther Lotz, Stück 25). – Stuttgart: J. G. Cotta 1898. Diese Schrift nennt Max Weber bereits im „Grundriß zu den Vorlesungen über Allgemeine (,theoretischeʼ) Nationalökonomie“, MWG III/1 , S. 98.
3
gesammelt und verwaltet wird.[204] Zur Rechtssoziologie vgl. die Einleitung, oben, S. 69.
3. Nach „Merkmalen“ zugewiesen ist eine Vertretungsgewalt z. B., wenn sie nach der Reihenfolge des Alters oder nach ähnlichen Tatbeständen zuständig wird.
4. Alles Einzelne dieses Sachverhalts läßt sich nicht generell, sondern erst bei der soziologischen Einzelanalyse darlegen. Der älteste und allgemeinste hierher gehörige Tatbestand ist die Repressalie, als Rache sowohl wie als Pfandzugriff.
[A 26]§ 12. Verband soll eine nach außen regulierend beschränkte oder geschlossene soziale Beziehung dann heißen, wenn die Innehaltung ihrer Ordnung garantiert wird durch das eigens auf deren Durchführung eingestellte Verhalten bestimmter Menschen: eines Leiters und, eventuell, eines Verwaltungsstabes, der gegebenenfalls normalerweise zugleich Vertretungsgewalt hat. Die Innehabung der Leitung oder einer Teilnahme am Handeln des Verwaltungsstabes – die „Regierungsgewalten“ – können a) appropriiert oder b) durch geltende Verbandsordnungen bestimmten oder nach bestimmten Merkmalen oder in bestimmten Formen auszulesenden Personen dauernd oder zeitweise oder für bestimmte Fälle zugewiesen sein. „Verbandshandeln“ soll a) das auf die Durchführung der Ordnung bezogene[,] kraft Regierungsgewalt oder Vertretungsmacht legitime Handeln des Verwaltungsstabs selbst, b) das von ihm durch Anordnungen geleitete Handeln der Verbandsbeteiligten heißen.
1. Ob es sich um Vergemeinschaftung oder Vergesellschaftung handelt, soll für den Begriff zunächst keinen Unterschied machen. Das Vorhandensein eines „Leiters“: Familienhaupt, Vereinsvorstand, Geschäftsführer, Fürst, Staatspräsident, Kirchenhaupt, dessen Handeln auf Durchführung der Verbandsordnung eingestellt ist, soll genügen, weil diese spezifische Art von Handeln: ein nicht bloß an der Ordnung orientiertes, sondern auf deren Erzwingung abgestelltes Handeln, soziologisch dem Tatbestand der geschlossenen „sozialen Beziehung“ ein praktisch wichtiges neues Merkmal hinzufügt. Denn nicht jede geschlossene Vergemeinschaftung oder Vergesellschaftung ist ein „Verband“: z. B. nicht eine erotische Beziehung oder eine Sippengemeinschaft ohne Leiter.
[205]2. Die „Existenz“ des Verbandes haftet ganz und gar an dem „Vorhandensein“ eines Leiters und eventuell eines Verwaltungsstabes. D. h. genauer ausgedrückt: an dem Bestehen der Chance, daß ein Handeln angebbarer Personen stattfindet, welches seinem Sinn nach die Ordnungen des Verbandes durchzuführen trachtet: daß also Personen vorhanden sind, die darauf „eingestellt“ sind, gegebenenfalls in jenem Sinn zu handeln. Worauf diese Einstellung beruht: ob auf traditonaler oder affektueller oder wertrationaler Hingabe (Lehens-, Amts-, Dienst-Pflicht) oder auf zweckrationalen Interessen (Gehaltsinteresse usw.), ist begrifflich vorerst gleichgültig. In etwas anderem als der Chance des Ablaufes jenes, in jener Weise orientierten, Handelns „besteht“, soziologisch angesehen, der Verband also für unsere Terminologie nicht. Fehlt die Chance dieses Handelns eines angebbaren Personenstabes (oder: einer angebbaren Einzelperson), so besteht für unsere Terminologie eben nur eine „soziale Beziehung“, aber kein „Verband“. So lange aber die Chance jenes Handelns besteht, so lange „besteht“, soziologisch angesehen, der Verband trotz des Wechsels der Personen, die ihr Handeln an der betreffenden Ordnung orientieren. (Die Art der Definition hat den Zweck: eben diesen Tatbestand sofort einzubeziehen).
3. a) Außer dem Handeln des Verwaltungsstabes selbst oder unter dessen Leitung kann auch ein spezifisches an der Verbandsordnung orientiertes Handeln der sonst Beteiligten typisch ablaufen, dessen Sinn die Garantie der Durchführung der Ordnung ist (z. B. Abgaben oder leiturgische persönliche Leistungen aller Art: Geschworenendienst, Militärdienst usw.). – b) Die geltende Ordnung kann auch Normen enthalten, an denen sich in andern Dingen das Handeln der Verbandsbeteiligten orientieren soll (z. B. im Staatsverband das „privatwirtschaftliche“, nicht der Erzwingung der Geltung der Verbandsordnung, sondern Einzelinteressen dienende Handeln: am „bürgerlichen“ Recht). Die Fälle a kann man „verbandsbezogenes Handeln“, diejenigen der Fälle
s
b verbandsgeregeltes Handeln nennen. Nur das Handeln des Verwaltungsstabes selbst und außerdem alles planvoll von ihm geleitete verbandsbezogene Handeln soll „Verbandshandeln“ heißen. „Verbandshandeln“ wäre z. B. für alle Beteiligten ein Krieg, den ein Staat „führt“[,] oder eine „Eingabe“, die ein Vereinsvorstand beschließen läßt, ein „Vertrag“, den der Leiter schließt und dessen „Geltung“ den Verbandsgenossen oktroyiert und zugerechnet wird (§ 11),[205]Lies: die Fälle
4
ferner der Ablauf aller „Rechtsprechung“ und „Verwaltung“. (S[iehe] auch § 14.)[205] Oben, S. 202 f.
5
Unten, S. 209.
[206]Ein Verband kann sein: a) autonom oder heteronom, b) autokephal oder heterokephal. Autonomie bedeutet, daß nicht, wie bei Heteronomie, die Ordnung des Verbands durch Außenstehende gesatzt wird, sondern durch Verbandsgenossen kraft dieser ihrer Qualität (gleichviel wie sie im übrigen erfolgt). Autokephalie be[A 27]deutet: daß der Leiter und der Verbandsstab nach eignen Ordnungen des Verbandes, nicht, wie bei Heterokephalie, durch Außenstehende bestellt wird (gleichviel wie sonst die Bestellung erfolgt).
Heterokephalie besteht z. B. für die Ernennung der governors der kanadischen Provinzen (durch die Zentralregierung von Kanada).
6
Auch ein heterokephaler Verband kann autonom und ein autokephaler heteronom sein. Ein Verband kann auch, in beiden Hinsichten, teilweise das eine und teilweise das andre sein. Die autokephalen deutschen Bundesstaaten waren trotz der Autokephalie innerhalb der Reichskompetenz heteronom, innerhalb ihrer eignen (in Kirchen- und Schulsachen z. B.) autonom. [206]Die Provinzen von „British North America“ wurden durch den „Constitution Act“ des britischen Parlaments im Jahre 1867 zu einer Union zusammengeschlossen („An Act for the Union of Canada, Nova Scotia, and New Brunswick, and the Government thereof“). Es folgten weitere Akte, mit denen das britische Parlament die Verfassung Kanadas schuf. In Nr. 58 der so entstandenen Verfassung ist die Ernennung der Governors wie folgt geregelt: „For each Province there shall be an Officer, styled the Lieutenant Governor, appointed by the Governor General in Council by Instrument under the Great Seal of Canada“. Der „Governor General“ wiederum handelte im Namen der Königin, welche die Exekutive verkörperte. Nr. 9 lautet: „The Executive Government and Authority of and over Canada is hereby declared to continue and be vested in the Queen.“ Handschug, Stephan, Einführung in das kanadische Recht. – München: C. H. Beck 2003, Anhang A: Verfassungsdokumente im Auszug, S. 112 ff.
7
Elsaß-Lothringen war in Deutschland in beschränktem Umfang autonom, aber heterokephal (den Statthalter setzte der Kaiser ein Die Verfassung des Deutschen Reiches vom 16. April 1871 besiegelte den „ewigen Bund“ der Staaten, die sich „zum Schutze des Bundesgebietes“ und „zur Pflege der Wohlfahrt des Deutschen Volkes“ zusammengeschlossen hatten. Sie unterwarfen sich in bestimmten Angelegenheiten der Reichsgesetzgebung. Diese sind in Art. 4 aufgeführt. Dazu gehörten jedoch nicht Kirchen- und Schulangelegenheiten. Sie blieben der Landesgesetzgebung vorbehalten.
a
).[206]Fehlt in A; ein sinngemäß ergänzt.
8
Alle diese [207]Sachverhalte können auch teilweise vorliegen. Ein sowohl völlig heteronomer wie heterokephaler Verband wird (wie etwa ein „Regiment“ innerhalb eines Heeresverbandes) in aller Regel als „Teil“ eines umfassenderen Verbandes zu bezeichnen sein. Ob dies der Fall ist, kommt aber auf das tatsächliche Maß von Selbständigkeit der Orientierung des Handelns im Einzelfall an und ist terminologisch reine Zweckmäßigkeitsfrage. Elsaß-Lothringen wurde nach dem deutsch-französischen Krieg von Frankreich abgetreten und als „Reichsland“ dem Deutschen Reich eingegliedert. Als solches war es anders gestellt als die Bundesstaaten. Die Staatsgewalt übte der Kaiser aus, der sie ab 1879 einem von ihm eingesetzten Statthalter übertrug. Auch die landesgesetzliche Autonomie, der sich die Bundesstaaten erfreuten, war eingeschränkt, allerdings nicht völlig versagt. Zum Status von Elsaß-Lothringen als „Reichsland“ vgl. Bruck, Ernst, [207]Das Verfassungs- und Verwaltungsrecht von Elsaß-Lothringen, 3 Bände. – Straßburg: Trübner 1908–1910.
§ 13. Die gesatzten Ordnungen einer Vergesellschaftung können entstehen a) durch freie Vereinbarung oder b) durch Oktroyierung und Fügsamkeit. Eine Regierungsgewalt in einem Verbande kann die legitime Macht zur Oktroyierung neuer Ordnungen in Anspruch nehmen. Verfassung eines Verbandes soll die tatsächliche Chance der Fügsamkeit gegenüber der Oktroyierungsmacht der bestehenden Regierungsgewalten nach Maß, Art und Voraussetzungen heißen. Zu diesen Voraussetzungen können
b
nach geltender Ordnung insbesondere die Anhörung oder Zustimmung bestimmter Gruppen oder Bruchteile der Verbandsbeteiligten, außerdem natürlich die verschiedensten sonstigen Bedingungen, gehören.[207]A: kann
Ordnungen eines Verbandes können außer den Genossen auch Ungenossen oktroyiert werden, bei denen bestimmte Tatbestände vorliegen. Insbesondere kann ein solcher Tatbestand in einer Gebietsbeziehung (Anwesenheit, Gebürtigkeit, Vornahme gewisser Handlungen innerhalb eines Gebiets) bestehen: „Gebietsgeltung“. Ein Verband, dessen Ordnungen grundsätzlich Gebietsgeltung oktroyieren, soll Gebietsverband heißen, einerlei inwieweit seine Ordnung auch nach innen: den Verbandsgenossen gegenüber, nur Gebietsgeltung in Anspruch nimmt (was möglich ist und wenigstens in begrenztem Umfang vorkommt).
1. Oktroyiert im Sinn dieser Terminologie ist jede nicht durch persönliche freie Vereinbarung aller Beteiligten zustandegekommene Ordnung. Also auch der „Mehrheitsbeschluß“, dem sich die Minderheit fügt. Die Legitimität des Mehrheitsentscheids ist daher (s. später bei der Soziologie [208]der Herrschaft und des Rechts)
9
in langen Epochen (noch im Mittelalter bei den Ständen, und bis in die Gegenwart in der russischen Obschtschina)[208] Kap. III, unten, S. 500 und 582; zur Soziologie des Rechts vgl. die Einleitung, oben, S. 69 und den Editorischen Bericht, oben, S. 109–111.
10
oft nicht anerkannt oder problematisch gewesen. Als Obschtschina oder Obščina bezeichnet man die russische Bauerngemeinde, die ihre Angelegenheiten selbst verwaltete (Landumteilung, Ordnung innerhalb des Dorfes) und bis 1903 kollektiv für die Steuerzahlung verantwortlich war.
2. Auch die formal „freien“ Vereinbarungen sind, wie allgemein bekannt, sehr häufig tatsächlich oktroyiert (so in der Obschtschina). Dann ist für die Soziologie nur der tatsächliche Sachverhalt maßgebend.
3. Der hier gebrauchte „Verfassungs“-Begriff ist der auch von Lassalle verwendete.
11
Mit der „geschriebenen“ Verfassung, überhaupt mit der Verfassung im juristischen Sinn, ist er nicht identisch. Die soziologische Frage ist lediglich die: wann, für welche Gegenstände und innerhalb welcher Grenzen und – eventuell – unter welchen besonderen Voraussetzungen (z. B. Billigung von Göttern oder Priestern oder Zustimmung von Wahlkörperschaften usw.) fügen sich dem Leiter die Verbandsbeteiligten und steht ihm der Verwaltungsstab und das Verbandshandeln zu Gebote, wenn er „Anordnungen trifft“, insbesondere Ordnungen oktroyiert. Lassalle grenzt sich von juristischen Verfassungsbegriffen ab und sieht die Verfassung eines Landes als den Ausdruck von Machtverhältnissen: „Wir haben jetzt also gesehen […], was die Verfassung eines Landes ist, nämlich: die in einem Lande bestehenden thatsächlichen Machtverhältnisse“ (Lassalle, Über Verfassungswesen, S. 481). In seinen Vorlesungen „Arbeiterfrage und Arbeiterbewegung“ von 1895 und 1898 hatte sich Weber ausführlich mit Lassalle beschäftigt, und zwar in „§ 11. Ferdinand Lassalle und die Entstehung der deutschen Sozialdemokratie“, MWG III/4, S. 203–216. Zur Rede „Über Verfassungswesen“ heißt es (ebd., S. 210): „Betonung der Bedeutung der realen Machthaltenden“.
4. Den Haupttypus der oktroyierten „Gebietsgeltung“ stellen dar: Strafrechtsnormen und manche andere „Rechtssätze“, bei denen Anwesenheit, Gebürtigkeit, Tatort, Erfüllungsort usw. innerhalb des Gebietes des Verbandes Voraussetzungen der Anwendung der Ordnung sind, in politischen Verbänden. (Vgl. den Gierke-Preußschen Begriff der „Gebietskörperschaft“.)
12
Gierke, Otto, Das deutsche Genossenschaftsrecht, 4 Bände. – Berlin: Weidmann 1868–1913, insbes. Band 2: Geschichte des deutschen Körperschaftsbegriffs, 1873; sowie Preuß, Hugo, Gemeinde, Staat, Reich als Gebietskörperschaften. Versuch einer deutschen Staatskonstruktion auf Grundlage der Genossenschaftstheorie. – Berlin: Springer 1889. Hugo Preuß übertrug die Genossenschaftstheorie Otto Gierkes auf das Staatsrecht, korrigierte dessen Ansatz dabei insofern, als er die Vereinbarkeit von Genossenschafts- und Souveränitätstheorie bestritt, die Gierke behauptet hatte (Preuß, Gebietskörperschaften, Kap. V). Preuß entwickelt ein Staatsrecht ohne den Souveränitätsbegriff. Im Mittelpunkt steht die Körperschaft, in der sich nach seiner Auffassung die gegensätzlichen Prinzipien von Genossenschaft und Anstalt verbinden (ebd., [209]S. 253). Gemeinde, (Bundes-)Staat und Reich seien Körperschaften (S. 257), genauer: Gebietskörperschaften (S. 261), die „eine aufsteigende Reihe von der Ortsgemeinde bis zum Reich“ bildeten (S. 418 f.). Diese Gebietskörperschaften müsse man als Glieder eines Organismus, einer rechtlich organisierten Gesamtperson, verstehen.
[209]§ 14. Eine Ordnung, welche Verbandshandeln regelt, soll Verwaltungsordnung heißen. Eine Ordnung, welche andres soziales Handeln regelt und die durch diese Regelung eröffneten Chancen den Handelnden garantiert, soll [A 28]Regulierungsordnung heißen. Insoweit ein Verband lediglich an Ordnungen der ersten Art orientiert ist, soll er Verwaltungsverband, insoweit lediglich an solchen der letzteren, regulierender Verband heißen.
1. Selbstverständlich ist die Mehrzahl aller Verbände sowohl das eine wie das andere; ein lediglich regulierender Verband wäre etwa ein theoretisch denkbarer reiner „Rechtsstaat“ des absoluten laissez faire (was freilich auch die Überlassung der Regulierung des Geldwesens an die reine Privatwirtschaft voraussetzen würde).
2. Über den Begriff des „Verbandshandelns“ s. § 12, Nr. 3.
13
Unter den Begriff der „Verwaltungsordnung“ fallen alle Regeln, die gelten wollen für das Verhalten sowohl des Verwaltungsstabs, wie der Mitglieder „gegenüber dem Verband“, wie man zu sagen pflegt, d. h. für jene Ziele, deren Erreichung die Ordnungen des Verbandes durch ein von ihnen positiv vorgeschriebenes planvoll eingestelltes Handeln seines Verwaltungsstabes und seiner Mitglieder zu sichern trachten Kap. I, § 12, oben, S. 205.
c
. Bei einer absolut kommunistischen Wirtschaftsorganisation würde annähernd alles soziale Handeln darunter fallen, bei einem absoluten Rechtsstaat andrerseits nur die Leistung der Richter, Polizeibehörden, Geschworenen, Soldaten und die Betätigung als Gesetzgeber und Wähler. Im allgemeinen – aber nicht immer im einzelnen – fällt die Grenze der Verwaltungs- und der Regulierungsordnung mit dem zusammen, was man im politischen Verband als „öffentliches“ und „Privatrecht“ scheidet. (Das Nähere darüber in der Rechtssoziologie.)[209]A: trachtet
14
Zur Behandlung von öffentlichem und privatem Recht vgl. Weber, Recht, MWG I/22-3, S. 274 ff.; eine Neufassung der Rechtssoziologie ist jedoch nicht überliefert, vgl. dazu die Einleitung, oben, S. 69.
§ 15. Betrieb soll ein kontinuierliches Zweckhandeln bestimmter Art, Betriebsverband eine Vergesellschaftung mit kontinuierlich zweckhandelndem Verwaltungsstab heißen.
[210]Verein soll ein vereinbarter Verband heißen, dessen gesatzte Ordnungen nur für die kraft persönlichen Eintritts Beteiligten Geltung beanspruchen.
Anstalt soll ein Verband heißen, dessen gesatzte Ordnungen innerhalb eines angebbaren Wirkungsbereiches jedem nach bestimmten Merkmalen angebbaren Handeln (relativ) erfolgreich oktroyiert werden.
1. Unter den Begriff des „Betriebs“ fällt natürlich auch der Vollzug von politischen und hierurgischen Geschäften, Vereinsgeschäften usw., soweit das Merkmal der zweckhaften Kontinuierlichkeit zutrifft.
2. „Verein“ und „Anstalt“ sind beide Verbände mit rational (planvoll) gesatzten Ordnungen. Oder richtiger: soweit ein Verband rational gesatzte Ordnungen hat, soll er Verein oder Anstalt heißen. Eine „Anstalt“ ist vor allem der Staat nebst allen seinen heterokephalen Verbänden und – soweit ihre Ordnungen rational gesatzt sind – die Kirche. Die Ordnungen einer „Anstalt“ erheben den Anspruch zu gelten für jeden, auf den bestimmte Merkmale (Gebürtigkeit, Aufenthalt, Inanspruchnahme bestimmter Einrichtungen) zutreffen, einerlei ob der Betreffende persönlich – wie beim Verein – beigetreten ist und vollends: ob er bei den Satzungen mitgewirkt hat. Sie sind also in ganz spezifischem Sinn oktroyierte Ordnungen. Die Anstalt kann insbesondere Gebietsverband sein.
3. Der Gegensatz von Verein und Anstalt ist relativ. Vereinsordnungen können die Interessen Dritter berühren, und es kann diesen dann die Anerkennung der Gültigkeit dieser Ordnungen oktroyiert werden, durch Usurpation und Eigenmacht des Vereins sowohl wie durch legal gesatzte Ordnungen (z. B. Aktienrecht).
4. Es bedarf kaum der Betonung: daß „Verein“ und „Anstalt“ nicht etwa die Gesamtheit aller denkbaren Verbände restlos unter sich aufteilen. Sie sind, ferner, nur „polare“ Gegensätze (so auf religiösem Gebiet: „Sekte“ und „Kirche“).
15
[210] Zur Definition von „Kirche“ und „Sekte“ vgl. unten, S. 214 f., Abschnitt 4.
§ 16. Macht bedeutet jede Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den eignen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen, gleichviel worauf diese Chance beruht.
Herrschaft soll heißen die Chance, für einen Befehl bestimmten Inhalts bei angebbaren Personen Gehorsam zu finden; Disziplin soll heißen die Chance, kraft eingeübter Einstellung für [211]einen Befehl prompten, automatischen und schematischen Gehorsam bei einer angebbaren Vielheit von Menschen zu finden.
1. Der Begriff „Macht“ ist soziologisch amorph. Alle denkbaren Qualitäten eines Menschen und alle denkbaren Konstellationen können jemand in die Lage versetzen, [A 29]seinen Willen in einer gegebenen Situation durchzusetzen. Der soziologische Begriff der „Herrschaft“ muß daher ein präziserer sein und kann nur die Chance bedeuten: für einen Befehl Fügsamkeit zu finden.
2. Der Begriff der „Disziplin“ schließt die „Eingeübtheit“ des kritik- und widerstandslosen Massengehorsams ein.
Der Tatbestand einer Herrschaft ist nur an das aktuelle Vorhandensein eines erfolgreich andern Befehlenden, aber weder unbedingt an die Existenz eines Verwaltungsstabes noch eines Verbandes geknüpft; dagegen allerdings – wenigstens in allen normalen Fällen – an die eines von beiden. Ein Verband soll insoweit, als seine Mitglieder als solche kraft geltender Ordnung Herrschaftsbeziehungen unterworfen sind, Herrschaftsverband heißen.
1. Der Hausvater herrscht ohne Verwaltungsstab. Der Beduinenhäuptling, welcher Kontributionen von Karawanen, Personen und Gütern erhebt, die seine Felsenburg passieren, herrscht über alle jene wechselnden und unbestimmten, nicht in einem Verband miteinander stehenden Personen, welche, sobald und solange sie[,] in eine bestimmte Situation geraten sind, kraft seiner Gefolgschaft, die ihm gegebenenfalls als Verwaltungsstab zur Erzwingung dient. (Theoretisch denkbar wäre eine solche Herrschaft auch seitens eines einzelnen ohne allen Verwaltungsstab.)
2. Ein Verband ist vermöge der Existenz seines Verwaltungsstabes stets in irgendeinem Grade Herrschaftsverband. Nur ist der Begriff relativ. Der normale Herrschaftsverband ist als solcher auch Verwaltungsverband. Die Art wie, der Charakter des Personenkreises, durch welchen
d
, und die Objekte, welche verwaltet werden, und die Tragweite der Herrschaftsgeltung bestimmen die Eigenart des Verbandes. Die ersten beiden Tatbestände aber sind im stärksten Maß durch die Art der Legitimitätsgrundlagen der Herrschaft begründet (über diese s. u. Kap. III.).[211]Zu ergänzen wäre: verwaltet wird
16
[211] Kap. III, § 1, unten, S. 449–455
[212]§ 17. Politischer Verband soll ein Herrschaftsverband dann und insoweit heißen, als sein Bestand und die Geltung seiner Ordnungen innerhalb eines angebbaren geographischen Gebiets kontinuierlich durch Anwendung und Androhung physischen Zwangs seitens des Verwaltungsstabes garantiert werden. Staat soll ein politischer Anstaltsbetrieb heißen, wenn und insoweit sein Verwaltungsstab erfolgreich das Monopol legitimen physischen Zwanges für die Durchführung der Ordnungen in Anspruch nimmt. – „Politisch orientiert“ soll ein soziales Handeln, insbesondere auch ein Verbandshandeln, dann und insoweit heißen, als es die Beeinflussung der Leitung eines politischen Verbandes, insbesondere die Appropriation oder Expropriation oder Neuverteilung oder Zuweisung von Regierungsgewalten, bezweckt.
Hierokratischer Verband soll ein Herrschaftsverband dann und insoweit heißen, als zur Garantie seiner Ordnungen psychischer Zwang durch Spendung oder Versagung von Heilsgütern (hierokratischer Zwang) verwendet wird. Kirche soll ein hierokratischer Anstaltsbetrieb heißen, wenn und soweit sein Verwaltungsstab das Monopol legitimen hierokratischen Zwanges in Anspruch nimmt.
1. Für politische Verbände ist selbstverständlich die Gewaltsamkeit weder das einzige, noch auch nur das normale Verwaltungsmittel. Ihre Leiter haben sich vielmehr aller überhaupt möglichen Mittel für die Durchsetzung ihrer Zwecke bedient. Aber ihre Androhung und, eventuell, Anwendung ist allerdings ihr spezifisches Mittel und überall die ultima ratio, wenn andre Mittel versagen. Nicht nur politische Verbände haben Gewaltsamkeit als legitimes Mittel verwendet und verwenden sie, sondern ebenso: Sippe, Haus, Einungen, im Mittelalter unter Umständen: alle Waffenberechtigten. Den politischen Verband kennzeichnet neben dem Umstand: daß die Gewaltsamkeit (mindestens auch) zur Garantie von „Ordnungen“ angewendet wird, das Merkmal: daß er die Herrschaft seines Verwaltungsstabes und seiner Ordnungen für ein Gebiet in Anspruch nimmt und gewaltsam garantiert. Wo immer für Verbände, welche Gewaltsamkeit anwenden, jenes Merkmal zutrifft – seien es Dorfgemeinden oder selbst einzelne Hausgemeinschaften oder Verbände von Zünften oder von Arbeiterverbänden („Räten“)
17
– müssen sie insoweit politische Verbände heißen. [212] Vermutlich Anspielung auf das in der Zeit viel diskutierte Rätesystem als ökono[213]misch-politische Ordnung: Die Arbeiter eines Betriebs wählen ihre Repräsentanten direkt. Diese haben ein imperatives Mandat, sind also der Basis rechenschaftspflichtig und jederzeit abrufbar. Das System setzt sich fort auf der Bezirks-, Landes- und nationalen Ebene, und zwar durch Delegation von unten nach oben, so daß sich die Repräsentanten gegenüber den Repräsentierten nicht verselbständigen können. Die Gewaltenteilung ist aufgehoben. Dieses Rätesystem ließ sich nirgends dauerhaft verwirklichen. Eine Schrumpfversion überlebte in Art. 165 der Weimarer Reichsverfassung, nun aber auf das Gebiet der Wirtschaft beschränkt.
[213][A 30]2. Es ist nicht möglich, einen politischen Verband – auch nicht: den „Staat“ – durch Angeben des Zweckes seines Verbandshandelns zu definieren.
18
Von der Nahrungsfürsorge bis zur Kunstprotektion hat es keinen Zweck gegeben, den politische Verbände nicht gelegentlich, von der persönlichen Sicherheitsgarantie bis zur Rechtsprechung keinen, den alle politischen Verbände verfolgt hätten. Man kann daher den „politischen“ Charakter eines Verbandes nur durch das – unter Umständen zum Selbstzweck gesteigerte – Mittel definieren, welches nicht ihm allein eigen, aber allerdings spezifisch und für sein Wesen unentbehrlich ist: die Gewaltsamkeit. Dem Sprachgebrauch entspricht dies nicht ganz; aber er ist ohne Präzisierung unbrauchbar. Man spricht von „Devisenpolitik“ der Reichsbank, von der „Finanzpolitik“ einer Vereinsleitung, von der „Schulpolitik“ einer Gemeinde und meint damit die planvolle Behandlung und Führung einer bestimmten sachlichen Angelegenheit. In wesentlich charakteristischerer Art scheidet man die „politische“ Seite oder Tragweite einer Angelegenheit Eine Zwecklehre des Staates war Bestandteil der überkommenen Staatslehren. So auch noch bei Georg Jellinek, dessen Allgemeine Staatslehre für Webers Herrschaftssoziologie von grundlegender Bedeutung ist. Dazu Jellinek, Georg, Allgemeine Staatslehre, 2. Aufl. – Berlin: O. Häring 1905, Achtes Kapitel (Die Lehre vom Zweck des Staates), S. 223–258 (hinfort: Jellinek, Staatslehre2). Möglicherweise folgt Weber hier Hugo Preuß, der mit seinem staatsrechtlichen Ansatz nicht nur den Souveränitätsbegriff, sondern auch den Zweckbegriff überwinden wollte (vgl. oben, S. 208 f., Hg.-Anm. 12). Anders als Preuß, stellt Weber allerdings nicht Genossenschaft und Anstalt, sondern Verein und Anstalt einander gegenüber. Beide fallen bei ihm unter die allgemeine Kategorie des Herrschaftsverbands.
e
oder den „politischen“ Beamten, die „politische“ Zeitung, die „politische“ Revolution, den „politischen“ Verein, die „politische“ Partei, die „politische“ Folge von andren: wirtschaftlichen, kulturlichen, religiösen usw. Seiten oder Arten der betreffenden Personen, Sachen, Vorgänge, – und meint damit alles das, was mit den Herrschaftsverhältnissen innerhalb des (nach unsrem Sprachgebrauch:) „politischen“ Verbandes: des Staats, zu tun hat, deren Aufrechterhaltung, Verschiebung, Umsturz herbeiführen oder hindern oder fördern kann, im Gegensatz zu Personen, Sachen, Vorgängen, die damit nichts zu schaffen haben. Es wird also auch in diesem Sprachgebrauch das Gemeinsame in dem Mittel: „Herrschaft“: in der Art [214]nämlich, wie eben staatliche Gewalten sie ausüben, unter Ausschaltung des Zwecks, dem die Herrschaft dient, gesucht. Daher läßt sich behaupten, daß die hier zugrunde gelegte Definition nur eine Präzision des Sprachgebrauchs enthält, indem sie das tatsächlich Spezifische: die Gewaltsamkeit (aktuelle oder eventuelle) scharf betont. Der Sprachgebrauch nennt freilich „politische Verbände“ nicht nur die Träger der als legitim geltenden Gewaltsamkeit selbst, sondern z. B. auch Parteien und Klubs, welche die (auch: ausgesprochen nicht gewaltsame) Beeinflussung des politischen Verbandshandelns bezwecken. Wir wollen diese Art des sozialen Handelns als „politisch orientiert“ von dem eigentlich „politischen“ Handeln (dem Verbandshandeln der politischen Verbände selbst im Sinn von § 12 Nr. 3)[213]A: Angelegenheit,
19
scheiden.[214] Kap. I, § 12, oben, S. 205
3. Den Staatsbegriff empfiehlt es sich, da er in seiner Vollentwicklung durchaus modern ist, auch seinem modernen Typus entsprechend – aber wiederum: unter Abstraktion von den, wie wir ja gerade jetzt erleben, wandelbaren inhaltlichen Zwecken – zu definieren. Dem heutigen Staat formal charakteristisch ist: eine Verwaltungs- und Rechtsordnung, welche durch Satzungen abänderbar ist
f
, an der der Betrieb des Verbandshandelns des (gleichfalls durch Satzung geordneten) Verwaltungsstabes sich orientiert und welche Geltung beansprucht nicht nur für die – im wesentlichen durch Geburt in den Verband hineingelangenden – Verbandsgenossen, sondern in weitem Umfang für alles auf dem beherrschten Gebiet stattfindende Handeln (also: gebietsanstaltsmäßig). Ferner aber: daß es „legitime“ Gewaltsamkeit heute nur noch insoweit gibt, als die staatliche Ordnung sie zuläßt oder vorschreibt (z. B. dem Hausvater das „Züchtigungsrecht“ beläßt, einen Rest einstmaliger eigenlegitimer, bis zur Verfügung über Tod und Leben des Kindes oder Sklaven gehender Gewaltsamkeit des Hausherren). Dieser Monopolcharakter der staatlichen Gewaltherrschaft ist ein ebenso wesentliches Merkmal ihrer Gegenwartslage wie ihr rationaler „Anstalts“- und kontinuierlicher „Betriebs“-Charakter.[214]A: sind
4. Für den Begriff des hierokratischen Verbandes kann die Art der in Aussicht gestellten Heilsgüter – diesseitig, jenseitig, äußerlich, innerlich – kein entscheidendes Merkmal bilden, sondern die Tatsache, daß ihre Spendung die Grundlage geistlicher Herrschaft über Menschen bilden kann. Für den Begriff „Kirche“ ist dagegen nach dem üblichen (und zweckmäßigen) Sprachgebrauch ihr in der Art der Ordnungen und des Verwaltungsstabs sich äußernder (relativ) rationaler Anstalts- und Betriebscharakter und die beanspruchte monopolistische Herrschaft charakteristisch. Dem normalen Streben der kirchlichen Anstalt nach eignet ihr hierokratische Gebietsherr[215]schaft und (parochiale) territorale Gliederung, wobei im Einzelfall die Frage sich verschieden beantwortet: durch welche Mittel diesem Monopolanspruch Nachdruck verliehen wird. Aber derart wesentlich wie dem politischen Verband ist das tatsächliche Gebietsherrschaftsmonopol für die Kirchen historisch nicht gewesen und heute vollends nicht. Der „Anstalts“-Charakter, insbesondere der Umstand, daß man in die Kirche „hineingeboren“ wird, scheidet sie von der „Sekte“, deren Charakteristikum darin liegt: daß sie „Verein“ ist und nur die religiös Qualifizierten persönlich in sich aufnimmt. (Das Nähere gehört in die Religionssoziologie.)
20
[215] Weber wollte auch sein Vorkriegsmanuskript über religiöse Gemeinschaften (MWG I/22-2) für diese neue Fassung überarbeiten. Entsprechende Ausführungen sind nicht überliefert. Vgl. die Einleitung, oben, S. 69, und die Übersicht zum Editorischen Bericht, oben, S. 109–111.
[216][A 31]Kapitel II. Soziologische Grundkategorien des Wirtschaftens.
Vorbemerkung. Nachstehend soll keinerlei „Wirtschaftstheorie“ getrieben, sondern es sollen lediglich einige weiterhin oft gebrauchte Begriffe definiert und gewisse allereinfachste soziologische Beziehungen innerhalb der Wirtschaft festgestellt werden. Die Art der Begriffsbestimmung ist auch hier rein durch Zweckmäßigkeitsgründe bedingt. Der viel umstrittene Begriff „Wert“
1
konnte terminologisch ganz umgangen werden. – Gegenüber der Terminologie K[arl] Büchers[216]„Die Lehre vom Wert steht sozusagen im Mittelpunkt der gesamten nationalökonomischen Doktrin. […] Trotz unzähliger Bestrebungen war und blieb die Lehre vom Wert eine der unklarsten, verworrensten und strittigsten Partien unserer Wissenschaft. Sie ist es auch noch heute.“ Vgl. Böhm-Bawerk, Eugen von, Grundzüge der Theorie des wirtschaftlichen Güterwertes, in: Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, N. F. Band 13, 1886, S. 1–82, Zitat: S. 3. Als „berüchtigten ‚Grundbegriff‘ der Nationalökonomie“ und als „Schmerzenskind unserer Disziplin“ hat Max Weber den wirtschaftlichen Wert schon 1904 bezeichnet, vgl. Weber, Objektivität, S. 70 und 83.
2
sind hier in den betreffenden Partien (über die Arbeitsteilung) nur solche Abweichungen vorgenommen, welche für die hier verfolgten Zwecke wünschenswert schienen. – Jegliche „Dynamik“ bleibt vorerst noch beiseite.Max Weber schließt sich insbesondere in den §§ 15 bis 18, unten, S. 295–314, weitgehend der Terminologie Büchers an und nennt dort (unten, S. 297 mit Hg.-Anm. 35) als Referenztexte Bücher, Gewerbe3 und Bücher, Entstehung der Volkswirtschaft2. Büchers Werk „Die Entstehung der Volkswirtschaft“ wird hier und im Folgenden nicht nach der 1. Auflage von 1893, sondern nach der 2. Auflage von 1898 zitiert, zu der ein mit Marginalien versehenes Handexemplar Max Webers überliefert ist (Max Weber-Arbeitsstelle, BAdW München).
3
Der in der seinerzeitigen Fachsprache unterschiedlich verwendete Begriff „Dynamik“ wird in Kap. II nicht erläutert. Am Schluß des Kapitels (unten, S. 448 mit Hg.-Anm. 52) findet sich ein weiterer (nicht eingelöster) Verweis auf eine spätere Behandlung der „ökonomischen Dynamik“.
§ 1. „Wirtschaftlich orientiert“ soll ein Handeln insoweit heißen, als es seinem gemeinten Sinne nach an der Fürsorge für einen Begehr nach Nutzleistungen
4
orientiert ist. „Wirtschaften“ soll eine friedliche Ausübung von Verfügungsgewalt heißen, welche primär, „rationales Wirtschaften“ eine solche, welche zweckrational, also planvoll, wirtschaftlich orientiert ist. „Wirtschaft“ [217]soll ein autokephal, „Wirtschaftsbetrieb“ ein betriebsmäßig geordnetes kontinuierliches Wirtschaften heißen. Max Weber definiert den von Eugen von Böhm-Bawerk geprägten Begriff „Nutzleistungen“ unten, S. 223.
1. Es wurde schon oben (zu § 1, II, 2 S. 173
a
) hervorgehoben, daß Wirtschaften an sich nicht schon soziales Handeln sein muß. [217]A: 11 unten
Die
b
Definition des Wirtschaftens hat möglichst allgemein zu sein und hat zum Ausdruck zu bringen, daß alle „wirtschaftlichen“ Vorgänge und Objekte ihr Gepräge als solche gänzlich durch den Sinn erhalten, welchen menschliches Handeln ihnen – als Zweck, Mittel, Hemmung, Nebenerfolg – gibt. – Nur darf man das doch nicht so ausdrücken, wie es gelegentlich geschieht: Wirtschaften sei eine „psychische“ Erscheinung.In A geht voraus: 2.
7
Die Ziffer 2. ist im Erstdruck versehentlich zur Kennzeichnung dieses und des nächsten Absatzes (unten, S. 218) doppelt vergeben worden. Sachlich gehört das im ersten und zweiten Absatz Ausgeführte zusammen. Deshalb ist hier die Ziffer 2 als Mar[218]kierung eines neuen Abschnitts emendiert worden. Die folgenden Absatzziffern bleiben unverändert.
5
Es fällt ja der Güterproduktion oder dem Preis oder selbst der „subjektiven Bewertung“ von Gütern – wenn anders sie reale Vorgänge sind – gar nicht ein, „psychisch“ zu bleiben. Gemeint ist mit diesem mißverständlichen Ausdruck aber etwas Richtiges: sie haben einen besondersartigen gemeinten Sinn: dieser allein konstituiert die Einheit der betreffenden Vorgänge und macht sie allein verständlich. – Die Definition des „Wirtschaftens“ muß ferner so gestaltet werden, daß sie die moderne Erwerbswirtschaft mit umfaßt, darf also ihrerseits zunächst nicht von „Konsum-Bedürfnissen“ und deren „Befriedigung“ ausgehen,[217]Dies ist von zahlreichen Ökonomen ganz unterschiedlicher Richtungen behauptet und von Max Weber mehrfach kritisiert worden, vgl. u. a. Weber, Objektivität, S. 63 ff.; Weber, Grenznutzlehre, S. 546 ff.; Weber, „Energetische“ Kulturtheorien, S. 586 ff. Als „psychologisch“ bezeichnete auch Robert Liefmann die Theorie, die er in zwei Max Weber zugeschickten Bänden seiner „Grundsätze der Volkswirtschaftslehre“ entwickelt hat (vgl. Liefmann, Grundsätze I, S. 9). Weber hat einen großen Teil des 1. Bandes während der Drucklegung seines hier edierten Textes gelesen und sich brieflich dazu geäußert: „Unbegreiflich ist mir, daß Sie als streng rationaler Theoretiker (ein anderer als ein solcher ist gar nicht möglich) irgend etwas von der Psychologie erwarten. Die Theorie ist eine idealtypische Konstruktion, der sich die Realitäten in verschiedenfachem Grade fügen. Für die irrationalen Abweichungen vom Rationalen könnte vielleicht eine Psychologie Nutzen stiften, aber was soll ein nach Mitteln und Zweck streng determiniertes Handeln, welches wir rational verstehen, denn von irgendeiner ‚Psychologie‘ zu erwarten haben? Da stecken m. E. noch starke Rückstände (Irrtümer auch vieler Grenznutzler).“ Vgl. den Brief Max Webers an Robert Liefmann vom 9. März 1920, MWG II/10, S. 953.
6
sondern einerseits von der – auch für das nackte [218]Geldgewinnstreben zutreffenden – Tatsache: daß Nutzleistungen begehrt werden, andrerseits von der – auch für die reine, schon die ganz primitive, Bedarfsdeckungswirtschaft zutreffenden – Tatsache: daß für diesen Begehr eben durch eine (und sei es noch so primitive und traditional eingelebte) Fürsorge Deckung zu sichern versucht wird. Insbesondere in der deutschen Nationalökonomie war eine Definition dieser Art üblich, vgl. z. B.: „W[irtschaft] nennen wir die geregelte Tätigkeit und Fürsorge des Menschen zur Beschaffung und zweckmäßigen Verwendung der Mittel zur Befriedigung seiner Bedürfnisse.“ Lexis, W[ilhelm], Wirtschaft, in: WbVW3, Band 2, 1911, S. 1373 f., Zitat: S. 1373.
2. „Wirtschaftlich orientiertes Handeln“ im Gegensatz zu „Wirtschaften“ soll jedes Handeln heißen, welches a) primär an andern Zwecken orientiert ist, aber auf den „wirtschaftlichen Sachverhalt“ (die subjektiv erkannte Notwendigkeit der wirtschaftlichen Vorsorge) in seinem Ablauf Rücksicht nimmt, oder welches b) primär daran orientiert ist, aber aktuelle Gewaltsamkeit als Mittel verwendet. Also: alles nicht primär oder nicht friedlich sich wirtschaftlich orientierende Handeln, welches durch jenen Sachverhalt mitbestimmt ist. „Wirtschaften“ soll also die [A 32] subjektive und primäre wirtschaftliche Orientierung heißen. (Subjektiv: denn auf den Glauben an die Notwendigkeit der Vorsorge, nicht auf die objektive Notwendigkeit, kommt es an.) Auf den „subjektiven“ Charakter des Begriffs: darauf, daß der gemeinte Sinn des Handelns dies zum Wirtschaften stempelt, legt R[obert] Liefmann mit Recht Gewicht, nimmt aber meines Erachtens zu Unrecht bei allen andern das Gegenteil an.
8
Als „Wirtschaften“ bezeichnet Robert Liefmann im Gegensatz zu den meisten Nationalökonomen nicht die „Sachgüterbeschaffung“ oder ähnliche objektive Tätigkeiten, sondern eine spezifische Art von „Erwägungen“, insbesondere Nutzen-Kosten-Vergleiche. „Wirtschaftliche Handlungen“ nennt er solche, die von derartigen Erwägungen geleitet sind (vgl. Liefmann, Grundsätze I, u. a. S. 115). Mit diesem Ansatz beanspruchte Liefmann, eine Auffassung zu vertreten, „die von der bisher üblichen vollkommen verschieden ist und unsere Lehre zu einer völligen Neubegründung der ökonomischen Theorie macht.“ (ebd., S. 110). In zwei Briefen an Liefmann hat Max Weber die Überlastung des Werkes mit Kritik und Polemik beklagt und zahlreiche Einwände erhoben, zugleich aber Liefmanns „Streben im Kern ganz außerordentlich berechtigt“ befunden. Vgl. die Briefe Max Webers an Robert Liefmann vom 12. Dezember 1919 und 9. März 1920, MWG II/10, S. 862 und 946 ff., Zitat: S. 953 f.
3. Wirtschaftlich orientiert kann jede Art von Handeln, auch gewaltsames (z. B. kriegerisches) Handeln sein (Raubkriege, Handelskriege). Dagegen hat namentlich Franz Oppenheimer mit Recht das „ökonomische“ Mittel dem „politischen“ gegenüberstellt.
9
In der Tat ist es zweckmäßig, [219]das letztere gegenüber der „Wirtschaft“ zu scheiden. Das Pragma der Gewaltsamkeit ist dem Geist der Wirtschaft – im üblichen Wortsinn – sehr stark entgegengesetzt. Die unmittelbare aktuelle gewaltsame Fortnahme von Gütern und die unmittelbar aktuelle Erzwingung eines fremden Verhaltens durch Kampf soll also nicht Wirtschaften heißen. Selbstverständlich ist aber der Tausch nicht das, sondern nur ein ökonomisches Mittel, wennschon eins der wichtigsten. Und selbstverständlich ist die wirtschaftlich orientierte, formal friedliche Vorsorge für die Mittel und Erfolge beabsichtigter Gewaltsamkeiten (Rüstung, Kriegswirtschaft) genau ebenso „Wirtschaft“ wie jedes andere Handeln dieser Art. Bei Oppenheimer heißt es: „Ich habe […] vorgeschlagen, die eigne Arbeit und den äquivalenten Tausch eigner gegen fremde Arbeit das ‚ökonomische Mittel‘, und die unentgoltene Aneignung fremder Arbeit das ‚politische Mittel‘ der Bedürfnisbefriedigung zu nennen.“ (Oppenheimer, Der Staat, S. 14; Handexemplar Max Webers in der Max Weber-Arbeitsstelle, BAdW München). Systematisch entwickelt ist die Unterscheidung in: Oppenheimer, Franz, Theorie der reinen und politischen Ökonomie. Ein Lehr- und Lesebuch für Studierende und Gebildete, 3., unveränd. Aufl. – Berlin und Leipzig: de Gruyter 1919. Max Weber ist auf Oppenheimers Unterscheidung bereits früher eingegangen, vgl. Weber, Marktgemeinschaft, MWG I/22-1, S. 199. [219]c A: Staat“ d A: mehrere
Jede rationale „Politik“ bedient sich wirtschaftlicher Orientierung in den Mitteln, und jede Politik kann im Dienst wirtschaftlicher Ziele stehen. Ebenso bedarf zwar theoretisch nicht jede Wirtschaft, wohl aber unsre moderne Wirtschaft unter unsern modernen Bedingungen der Garantie der Verfügungsgewalt durch Rechtszwang des Staates. Also: durch Androhung eventueller Gewaltsamkeit für die Erhaltung und Durchführung der Garantie formell „rechtmäßiger“ Verfügungsgewalten. Aber die derart gewaltsam geschützte Wirtschaft selbst ist nicht: Gewaltsamkeit.
Wie verkehrt es freilich ist, gerade für die (wie immer definierte) Wirtschaft in Anspruch zu nehmen, daß sie begrifflich nur „Mittel“ sei – im Gegensatz z. B. zum „Staat“
c
usw. –[,] erhellt schon daraus, daß man gerade den Staat nur durch Angeben des von ihm heute monopolistisch verwendeten Mittels (Gewaltsamkeit) definieren kann. Wenn irgend etwas, dann bedeutet, praktisch angesehen, Wirtschaft vorsorgliche Wahl grade zwischen Zwecken, allerdings: orientiert an der Knappheit der Mittel, welche für diese mehreren[219]A: Staat“
d
Zwecke verfügbar oder beschaffbar erscheinen. A: mehrere
4. Nicht jedes in seinen Mitteln rationale Handeln soll „rationales Wirtschaften“ oder überhaupt „Wirtschaften“ heißen. Insbesondre soll der Ausdruck „Wirtschaft“ nicht identisch mit „Technik“ gebraucht werden. „Technik“ eines Handelns bedeutet uns den Inbegriff der verwendeten Mittel desselben im Gegensatz zu jenem Sinn oder Zweck, an dem es letztlich (in concreto) orientiert ist, „rationale“ Technik eine Verwendung von Mitteln, welche bewußt und planvoll orientiert ist an Erfahrungen und Nachdenken, im Höchstfall der Rationalität: an wissenschaftlichem Denken. Was in concreto als „Technik“ gilt, ist daher flüssig: der letzte Sinn eines konkreten Handelns kann, in einen Gesamtzusammenhang von Handeln gestellt, „technischer“ Art, d. h. Mittel im Sinn jenes umfassenderen Zusammenhanges sein; für das konkrete Handeln ist aber dann diese (von jenem aus gesehen:) technische Leistung der „Sinn“, und die von ihm dafür [220]angewendeten Mittel sind seine „Technik“. Technik in diesem Sinn gibt es daher für alles und jedes Handeln: Gebetstechnik, Technik der Askese, Denk- und Forschungstechnik, Mnemotechnik, Erziehungstechnik, Technik der politischen und hierokratischen Beherrschung, Verwaltungstechnik, erotische Technik, Kriegstechnik, musikalische Technik (eines Virtuosen z. B.), Technik eines Bildhauers oder Malers, juristische Technik usw., und sie alle sind eines höchst verschiedenen Rationalitätsgrades fähig. Immer bedeutet das Vorliegen einer „technischen Frage“: daß über die rationalsten Mittel bestehen. Maßstab des Rationalen ist dabei für die Technik neben andren auch das berühmte Prinzip des „kleinsten Kraftmaßes“: Optimum des Erfolges im Vergleich mit den aufzuwendenden Mitteln (nicht: „mit den – absolut – kleinsten Mitteln“). Das scheinbar gleiche Prinzip gilt nun natürlich auch für die Wirtschaft (wie für jedes rationale Handeln überhaupt). Aber: in anderem Sinn. Solange die Technik in unserem Wortsinn reine „Technik“ bleibt, fragt sie lediglich nach den für diesen Erfolg, der ihr als schlechthin und indiskutabel zu erstreben gegeben ist, geeignetsten und dabei, bei gleicher Vollkommenheit, Sicherheit, Dauerhaftigkeit des Erfolges vergleichsweise kräfteökonomischsten Mitteln. Vergleichsweise, nämlich soweit überhaupt ein unmittelbar vergleichbarer Aufwand bei Einschlagung verschiedener Wege vorliegt. Soweit sie dabei reine Technik bleibt, ignoriert sie die sonstigen Bedürfnisse. Ob z. B. ein technisch erforderlicher Bestandteil einer Maschine aus Eisen oder aus Platin herzustellen sei, würde sie – wenn [A 33]in concreto
f
A: inconcreto
e
von dem letzteren genügende Quantitäten für die Erreichung dieses konkreten Erfolgs vorhanden sein sollten, – nur unter dem Gesichtspunkt entscheiden: wie der Erfolg am vollkommensten erreicht wird und bei welchem von beiden Wegen die sonstigen vergleichbaren Aufwendungen dafür (Arbeit z. B.) am geringsten sind. Sobald sie aber weiter auch auf den Seltenheits-Unterschied von Eisen und Platin im Verhältnis zum Gesamtbedarf reflektiert, – wie es heut jeder „Techniker“, schon im chemischen Laboratorium, zu tun gewohnt ist, – ist sie nicht mehr (im hier gebrauchten Wortsinn): „nur technisch“ orientiert, sondern daneben wirtschaftlich. Vom Standpunkt des „Wirtschaftens“ aus gesehen bedeuten „technische“ Fragen: daß die „Kosten“ erörtert werden: eine für die Wirtschaft stets grundlegend wichtige, aber: eine Frage, die ihrem Problemkreis stets in der Form angehört: wie stellt sich die Versorgung anderer (je nachdem: qualitativ verschiedener jetziger oder qualitativ gleichartiger zukünftiger) Bedürfnisse, wenn für dies Bedürfnis jetzt diese Mittel verwendet werden. (Ähnlich die Aus[221]führungen von v. Gottl, dieser Grundriß Bd. II,[220]e–e (S. 303, bis: das andere, –) Zu dieser Textpassage sind Korrekturfahnen überliefert; vgl. dazu den Anhang unten, S. 605–663.
10
jetzt während des Druckes: – ausführlich und sehr gut – die Erörterungen von R[obert] Liefmann, Grunds[ätze] d. V[olks]W[irtschafts]L[ehre][221] Gemeint ist: Gottl-Ottlilienfeld, Wirtschaft und Technik, bes. Kapitel I: Die grundsätzlichen Beziehungen zwischen Wirtschaft und Technik, S. 205–226. Dem Verleger gegenüber nannte Max Weber Gottls Beitrag für den „Grundriß der Sozialökonomik“ „eine ganz vorzügliche geschlossene Theorie der Technik“; vgl. den Brief Max Webers an Paul Siebeck vom 30. Dezember 1913, MWG II/8, S. 449.
g
S. 336 f.,[221]A: Grundz. d. A. W.W.L.
11
in der Sache nicht neu gegenüber v. Gottl. Irrig ist die Reduktion aller „Mittel“ auf „letztlich Arbeitsmühe“. Die (fehlerhafte) Angabe bezieht sich auf Robert Liefmann, Grundsätze I, Dritter Teil; Kapitel V: Wirtschaft und Technik, S. 325–354. Liefmann zitiert Gottl-Ottlilienfeld, kann aber nicht finden, „daß die bisherigen Unterscheidungen von Wirtschaft und Technik auch nur einigermaßen dem Wesen der Sache nahe gekommen wären“ (ebd. S. 334). – Der bereits 1917 erschienene Band I von Liefmanns Grundsätzen wurde Max Weber erst Ende 1919 – zusammen mit dem 1919 erschienenen Band II: Grundlagen des Tauschverkehrs – vom Verfasser zugeschickt. Vgl. den Brief Max Webers an Robert Liefmann vom 12. Dezember 1919, MWG II/10, S. 862; darin sagt Max Weber die Lektüre „kurz nach Semesterschluß“ zu.
12
) Vermutlich bezieht sich Max Weber auf Robert Liefmanns „psychischen Kostenbegriff“. Danach seien alle aufzuwendenden Mittel „letzten Endes Arbeitsmühe“. Vgl. Liefmann, Grundsätze I, S. 301.
Denn die Frage: was, vergleichsweise, die Verwendung verschiedener Mittel für einen technischen Zweck „kostet“, ist letztlich verankert an der Verwendbarkeit von Mitteln (darunter vor allem auch: von Arbeitskraft) für verschiedene Zwecke. „Technisch“ (im hier gebrauchten Wortsinn) ist das Problem z. B.: welche Arten von Veranstaltungen getroffen werden müssen, um Lasten bestimmter Art bewegen oder um Bergwerksprodukte aus einer gewissen Tiefe fördern zu können, und welche von ihnen am „zweckmäßigsten“, d. h. u. a. auch: mit dem vergleichsweisen (zum Erfolg) Mindestmaß von aktueller Arbeit zum Ziele führen. „Wirtschaftlich“ wird das Problem bei der Frage: ob – bei Verkehrswirtschaft: –
h
sich diese Aufwendungen in Geld, durch Absatz der Güter bezahlt machen, ob – bei Planwirtschaft:Gedankenstrich fehlt in A; sinngemäß ergänzt.
13
– die dafür nötigen Arbeitskräfte und Produktionsmittel ohne Schädigung von andern, für wichtiger gehaltenen Versorgungsinteressen zur Verfügung gestellt werden können? – was beide Male ein Problem der Vergleichung von Zwecken ist. Wirtschaft ist primär orientiert am Verwendungszweck, Technik am Problem der (bei gegebenem Ziel) zu verwendenden Mittel. Daß ein bestimmter Verwendungszweck überhaupt dem technischen Beginnen zugrunde liegt, ist für die Frage der technischen Rationalität rein begrifflich (nicht natürlich: tatsächlich) im Prinzip gleich[222]gültig. Rationale Technik gibt es nach der hier gebrauchten Definition auch im Dienst von Zwecken, für die keinerlei Begehr besteht. Es könnte z. B. jemand etwa, um rein „technischer“ Liebhabereien willen, mit allem Aufwand modernster Betriebsmittel atmosphärische Luft produzieren, ohne daß gegen die technische Rationalität seines Vorgehens das geringste einzuwenden wäre: wirtschaftlich wäre das Beginnen in allen normalen Verhältnissen irrational, weil irgendein Bedarf nach Vorsorge für die Versorgung mit diesem Erzeugnis nicht vorläge (vgl. zum Gesagten: v. Gottl-Ottlilienfeld im G[rundriß] [der] S[ozial-]Ö[konomik] II). Max Weber definiert und erläutert „Verkehrs-“ und „Planwirtschaft“ unten, S. 288.
14
Die ökonomische Orientiertheit der heute sog. technologischen Entwicklung an Gewinnchancen ist eine der Grundtatsachen der Geschichte der Technik. Aber nicht ausschließlich diese wirtschaftliche Orientierung, so grundlegend wichtig sie war, hat der Technik in ihrer Entwicklung den Weg gewiesen, sondern z. T. Spiel und Grübeln weltfremder Ideologen, z. T. jenseitige oder phantastische Interessen, z. T. künstlerische Problematik und andre außerwirtschaftliche Motive. Allerdings liegt von jeher und zumal heute der Schwerpunkt auf der ökonomischen Bedingtheit der technischen Entwicklung; ohne die rationale Kalkulation als Unterlage der Wirtschaft, also ohne höchst konkrete wirtschaftsgeschichtliche Bedingungen, würde auch die rationale Technik nicht entstanden sein. [222]Vgl. Gottl-Ottlilienfeld, Wirtschaft und Technik, S. 218–226.
Daß hier nicht gleich in den Anfangsbegriff das für den Gegensatz gegenüber der Technik Charakteristische ausdrücklich aufgenommen ist, folgt aus dem soziologischen Ausgangspunkt. Aus der „Kontinuierlichkeit“ folgt für die Soziologie pragmatisch die Abwägung der Zwecke gegeneinander und gegen die „Kosten“ (soweit diese etwas anderes sind als Verzicht auf einen Zweck zugunsten dringlicherer). Eine Wirtschaftstheorie würde im Gegensatz dazu wohl gut tun, sofort dies Merkmal einzufügen.
5. Im soziologischen Begriff des „Wirtschaftens“ darf das Merkmal der Verfügungsgewalt nicht fehlen, schon weil wenigstens die Erwerbswirtschaft sich ganz und gar in Tauschverträgen, also planvollem Erwerb von Verfügungsgewalt, vollzieht. (Dadurch wird die Beziehung zum „Recht“ hergestellt.) Aber auch jede andre Organisation der Wirtschaft würde irgendeine tatsächliche Verteilung der Verfügungsgewalt bedeuten, nur nach ganz andern Prinzipien als die heutige Privatwirtschaft, [A 34]die sie autonomen und autokephalen Einzelwirtschaften rechtlich garantiert. Entweder die Leiter (Sozialismus)
15
oder die Glieder (Anarchismus) müssen auf Verfügungsgewalt über die gegebenen Arbeitskräfte und Nutzleistungen zählen können: das läßt sich nur terminologisch verschleiern, aber nicht fortinterpretieren. Wodurch – ob konventional oder rechtlich – diese Ver[223]fügung garantiert oder ob sie etwa äußerlich gar nicht garantiert ist, sondern nur kraft Sitte oder Interessenlage auf die Verfügung faktisch (relativ) sicher gezählt werden kann, ist an sich begrifflich irrelevant, so zweifellos für die moderne Wirtschaft die Unentbehrlichkeit der rechtlichen Zwangsgarantien sein mag: Die begriffliche Unentbehrlichkeit jener Kategorie für die wirtschaftliche Betrachtung sozialen Handelns bedeutet also nicht etwa eine begriffliche Unentbehrlichkeit der rechtlichen Ordnung der Verfügungsgewalten, mag man diese empirisch für noch so unentbehrlich ansehen. Zu Max Webers Begriff vom (planwirtschaftlichen) Sozialismus vgl. unten, S. 291.
6. Unter den Begriff „Verfügungsgewalt“ soll hier auch die – faktische oder irgendwie garantierte – Möglichkeit der Verfügung über die eigne Arbeitskraft gefaßt werden (sie ist – bei Sklaven – nicht selbstverständlich).
7. Eine soziologische Theorie der Wirtschaft ist genötigt, alsbald den „Güter“-Begriff in ihre Kategorien einzustellen (wie dies § 2 geschieht).
16
Denn sie hat es mit jenem „Handeln“ zu tun, dem das Resultat der (nur theoretisch isolierbaren) Überlegungen der Wirtschaftenden seinen spezifischen Sinn verleiht. Anders kann (vielleicht) die Wirtschaftstheorie verfahren,[223]Unten, S. 224.
17
deren theoretische Einsichten für die Wirtschaftssoziologie – so sehr diese nötigenfalls sich eigne Gebilde schaffen müßte – die Grundlage bilden. Der Begriff „Gut“ gehörte in der deutschen Volkswirtschaftslehre im allgemeinen zu den Grundbegriffen (vgl. Weber, Erstes Buch. Die begrifflichen Grundlagen der Volkswirtschaftslehre, MWG III/1, S. 124 ff., und Wieser, Friedrich von, Gut, in: HdStW3, Band 5, 1910, S. 205–209). Es war Robert Liefmann, der die herrschende Übung als „quantitativ-materialistisch“ ablehnte und ein Lehrgebäude errichtete, in dem für eine „Güterlehre“ kein Platz war (vgl. Liefmann, Grundsätze I, S. 244–249).
§ 2. Unter „Nutzleistungen“ sollen stets die von einem oder mehreren Wirtschaftenden als solche geschätzten konkreten einzelnen zum Gegenstand der Fürsorge werdenden (wirklichen oder vermeintlichen) Chancen gegenwärtiger oder künftiger Verwendungsmöglichkeiten gelten, an deren geschätzter Bedeutung als Mittel für Zwecke des (oder der) Wirtschaftenden sein (oder ihr) Wirtschaften orientiert wird.
18
Wie von Weber unten (S. 224) zitiert, schließt er sich im Wesentlichen an Böhm-Bawerk, Rechte, an, der den Begriff „Nutzleistungen“ geprägt und seine theoretische Funktion in der genannten Schrift ausführlich erläutert hat. Anders als Böhm-Bawerk nimmt Weber die persönlichen „Leistungen“ nicht als eine Kategorie in die Liste der Güter auf (Böhm-Bawerk, Rechte, S. 31), sondern betont die Unterscheidung zwischen (Sach-)Gütern und Leistungen.
[224]Die Nutzleistungen können Leistungen nicht menschlicher (sachlicher) Träger oder Leistungen von Menschen sein. Die im Einzelfall sprachgebräuchlich gemeinten Träger möglicher sachlicher Nutzleistungen gleichviel welcher Art sollen „Güter“, die menschlichen Nutzleistungen, sofern sie in einem aktiven Handeln bestehen, „Leistungen“ heißen. Gegenstand wirtschaftender Vorsorge sind aber auch soziale Beziehungen, welche als Quelle gegenwärtiger oder künftiger möglicher Verfügungsgewalt über Nutzleistungen geschätzt werden. Die durch Sitte, Interessenlage oder (konventionell oder rechtlich) garantierte Ordnung zugunsten einer Wirtschaft in Aussicht gestellten Chancen sollen „ökonomische Chancen“ heißen.
Vgl. v. Böhm-Bawerk, Rechte und Verhältnisse vom Standpunkt
19
der volksw[irthschaftlichen] Güterlehre (Innsbruck 1881). [224]Im Originaltitel heißt es: Standpunkte. Die Literaturangabe bezieht sich auf § 2, Abs. 1, oben, S. 223.
1. Sachgüter und Leistungen erschöpfen nicht den Umkreis derjenigen Verhältnisse der Außenwelt, welche für einen wirtschaftenden Menschen wichtig und Gegenstand der Vorsorge sein können. Das Verhältnis der „Kundentreue“ oder das Dulden von wirtschaftlichen Maßnahmen seitens derer, die sie hindern könnten[,] und zahlreiche andere Arten von Verhaltensweisen können ganz die gleiche Bedeutung für das Wirtschaften haben und ganz ebenso Gegenstand wirtschaftender Vorsorge und z. B. von Verträgen werden. Es ergäbe aber unpräzise Begriffe, wollte man sie mit unter eine dieser beiden Kategorien bringen. Diese Begriffsbildung ist also lediglich durch Zweckmäßigkeitsgründe bestimmt.
2. Ganz ebenso unpräzis würden die Begriffe werden (wie v. Böhm-Bawerk richtig hervorgehoben hat),
20
wenn man alle anschaulichen Einheiten des Lebens und des Alltagssprachgebrauches unterschiedslos als „Güter“ bezeichnen und den Güterbegriff dann mit den sachlichen Nutzleistungen gleichstellen wollte. „Gut“ im Sinn von Nutzleistung im strengen Sprachgebrauch ist nicht das „Pferd“ oder etwa ein „Eisenstab“, sondern deren einzelne als begehrenswert geschätzte und geglaubte Verwendungsmöglichkeiten, z. B. als Zugkraft oder als Tragkraft oder als was immer sonst. Erst recht nicht sind für diese Terminologie die als wirtschaftliche Verkehrsobjekte (bei Kauf und Verkauf usw.) fungierenden Chancen wie: „Kundschaft“, „Hypothek“, „Eigentum“[,] Güter. Sondern die Leistungen, welche durch diese von seiten der Ordnung (traditionaler oder [225]statutarischer) in [A 35]Aussicht gestellten oder garantierten Chancen von Verfügungsgewalten einer Wirtschaft über sachliche und persönliche Nutzleistungen dargeboten werden, sollen der Einfachheit halber als „ökonomische Chancen“ (als „Chancen“ schlechtweg, wo dies unmißverständlich ist) bezeichnet werden. Böhm-Bawerk, Rechte, S. 28 ff. und 51 ff.
3. Daß nur aktives Handeln als „Leistung“ bezeichnet werden soll (nicht ein „Dulden“, „Erlauben“, „Unterlassen“), geschieht aus Zweckmäßigkeitsgründen. Daraus folgt aber, daß „Güter“ und „Leistungen“ nicht eine erschöpfende Klassifikation aller ökonomisch geschätzten Nutzleistungen sind.
Über den Begriff „Arbeit“ s. u. § 15.
21
[225]Kap. II, § 15, unten, S. 296 f.
§ 3. Wirtschaftliche Orientierung kann traditional oder zweckrational vor sich gehen. Selbst bei weitgehender Rationalisierung des Handelns ist der Einschlag traditionaler Orientiertheit relativ bedeutend. Die rationale Orientierung bestimmt in aller Regel primär das leitende Handeln (s. § 15),
22
gleichviel welcher Art die Leitung ist. Die Entfaltung des rationalen Wirtschaftens aus dem Schoße der instinktgebundenen reaktiven Nahrungssuche oder der traditionalistischen Eingelebtheit überlieferter Technik und gewohnter sozialer Beziehungen ist in starkem Maß auch durch nicht ökonomische, außeralltägliche, Ereignisse und Taten, daneben durch den Druck der Not bei zunehmender absoluter oder (regelmäßig) relativer Enge des Versorgungsspielraums bedingt gewesen. In Kap. II, § 15, unten, S. 296, unterscheidet Max Weber „disponierende“ von „an Dispositionen“ orientierten Leistungen. In § 16, unten, S. 303, unterscheidet er „leitende“ von „ausführenden“ Leistungen.
1. Irgendeinen „wirtschaftlichen Urzustand“ gibt es für die Wissenschaft natürlich prinzipiell nicht. Man könnte etwa konventionell sich einigen, den Zustand der Wirtschaft auf einem bestimmten technischen Niveau: dem der (für uns zugänglichen) geringsten Ausstattung mit Werkzeugen, als solchen zu behandeln und zu analysieren. Aber wir haben keinerlei Recht, aus den heutigen Rudimenten Werkzeug armer Naturvölker zu schließen: daß alle im gleichen technischen Stadium befindlichen Menschengruppen der Vergangenheit ebenso (also nach Art der Weddah
23
oder [226]gewisser Stämme Innerbrasiliens)Mit den australischen Aborigines verwandte Ureinwohner Ceylons (Sri Lankas). Max Weber bezieht sich wiederholt auf die Weddah und ihre instrumentenlose Musik [226](vgl. Weber, Zur Musiksoziologie, MWG I/14; zu seinen Quellen ebd., S. 180, Hg. – Anm. 97).
24
gewirtschaftet hätten. Denn rein wirtschaftlich war in diesem Stadium sowohl die Möglichkeit starker Arbeitskumulation in großen Gruppen (s. unten § 16)Die primitive Wirtschaft innerbrasilianischer Stämme erwähnt Max Weber, Hinduismus, MWG I/20, S. 212 f., unter Bezugnahme auf Steinen, Karl von, Durch Central-Brasilien. Expedition zur Erforschung der Schingú im Jahre 1884. – Leipzig: F.A. Brockhaus 1886.
25
wie umgekehrt starker Vereinzelung in kleinen Gruppen gegeben. Für die Entscheidung zwischen beiden konnten aber neben naturbedingten ökonomischen auch außerökonomische (z. B. militaristische) Umstände ganz verschiedene Antriebe schaffen. Ohne dort den Begriff „Arbeitskumulation“ zu benützen, führt Max Weber in Kap. II, § 16, unten, S. 305, als Beispiel für „Leistungshäufung“ in Ägypten das Zusammenspannen Tausender von Zwangs-Arbeitern an Stricken für den Transport von Kolossen an.
2. Krieg und Wanderung sind zwar selbst nicht wirtschaftliche (wennschon gerade in der Frühzeit vorwiegend wirtschaftlich orientierte) Vorgänge, haben aber zu allen Zeiten oft, bis in die jüngste Gegenwart, radikale Änderungen der Wirtschaft im Gefolge gehabt. Auf zunehmende (klimatisch oder durch zunehmende Versandung oder Entwaldung bedingte) absolute Enge des Nahrungsspielraums haben Menschengruppen, je nach der Struktur der Interessenlagen und der Art des Hineinspielens nichtwirtschaftlicher Interessen, sehr verschieden, typisch freilich durch Verkümmerung der Bedarfsdeckung und absoluten Rückgang der Zahl, auf zunehmende Enge des relativen (durch einen gegebenen Standard der Bedarfsversorgung und der Verteilung der Erwerbschancen – s. u. § 11
26
– bedingten) Versorgungsspielraums zwar ebenfalls sehr verschieden, aber (im ganzen) häufiger als im ersten Fall durch steigende Rationalisierung der Wirtschaft geantwortet. Etwas Allgemeines läßt sich indessen selbst darüber nicht aussagen. Die (soweit der „Statistik“ dort zu trauen ist) ungeheure Volksvermehrung in China seit Anfang des 18. Jahrhunderts Kap. II, § 11, unten, S. 258, wo der Begriff „Erwerben“ definiert wird als an den Chancen der Gewinnung von neuer Verfügungsgewalt über Güter orientiertes Handeln.
27
hat entgegengesetzt gewirkt als die gleiche Erscheinung gleichzeitig [227]in EuropaUnter Hinweis auf die Unsicherheit der Quellen berichtet Max Weber, Konfuzianismus, MWG I/19, S. 217, von einem Anstieg der chinesischen Bevölkerung „von Mitte des 17. bis Ende des 19. Jahrhunderts von 60 auf etwa 350–409 Millionen“. Nach späteren, noch immer unsicheren Schätzungen ist die chinesische Bevölkerung zwischen 1700 und 1850 von ca. 150 Mio. auf ca. 430 Mio. Einwohner gestiegen. Vgl. Ping-ti Ho, Studies on the Population of China, 1368–1953. – Cambridge, Mass.: Harvard University Press 1959, S. 256, 281 f.
28
(aus Gründen, über die sich wenigstens einiges aussagen läßt), die chronische Enge des Nahrungsspielraumes in der arabischen Wüste nur in einzelnen Stadien die Konsequenz einer Änderung der ökonomischen und politischen Struktur gehabt, am stärksten unter der Mitwirkung außerökonomischer (religiöser) Entwicklung.[227]Nach zeitgenössischen Schätzungen ist die Bevölkerung Europas von 1800 bis 1910 von 187 Mio. auf 448 Mio. angestiegen. Vgl. Elster, Ludwig, Der Bevölkerungsstand und die Bevölkerungsbewegung der neuesten Zeit bis zum Ausbruch des Weltkrieges, in: HdStW4, Band 2, 1924, S. 687–689.
3. Der lange Zeit starke Traditionalismus der Lebensführung z. B. der Arbeiterschichten im Beginn der Neuzeit hat eine sehr starke Zunahme der Rationalisierung der Erwerbswirtschaften durch kapitalistische Leitung nicht gehindert, ebenso aber z. B. nicht: die fiskal-sozialistische Rationalisierung der Staatsfinanzen in Ägypten.
29
(Immerhin war jene traditionalistische Haltung im Okzident etwas, dessen wenigstens relative Überwindung die weitere Fortbildung zur spezifisch modernen kapitalistisch rationalen Wirtschaft erst ermöglichte.)Bei Weber, Agrarverhältnisse3 (MWG I/6, S. 365) heißt es: „Abgabe- und Robotpflichten der Untertanen können bis zum fast völligen Staatssozialismus (Ägypten) führen“. Wie Jürgen Deininger (ebd., S. 405, Hg.-Anm. 16) nachweist, spricht der französische Ägyptologe Revillout im Zusammenhang mit Ägypten von „socialisme d’Etat“; vgl. Revillout, Eugène, Précis du droit égyptien, comparé aux autres droits de l’antiquité, vol. 1. – Paris: V. Giard & E. Brière 1903, S. 31.
§ 4. Typische Maßregeln des rationalen Wirtschaftens sind:
1. planvolle Verteilung solcher Nutzleistungen, auf deren Verfügung der Wirtschaftende gleichviel aus welchem Grunde zählen zu können glaubt, auf Gegenwart und Zukunft (Sparen);
[A 36]2. planvolle Verteilung verfügbarer Nutzleistungen auf mehrere Verwendungsmöglichkeiten in der Rangfolge der geschätzten Bedeutung dieser: nach dem Grenznutzen.
30
Max Weber bezieht sich auf ein theoretisches Kalkül einzelwirtschaftlicher Nutzenmaximierung, speziell auf das sogenannte Zweite Gossensche Gesetz vom Ausgleich der Grenznutzen (vgl. Wieser, Friedrich von, Grenznutzen, in: HdStW3, Band 5, 1910, S. 56–66). Den Begriff „Grenznutzen“ und die entsprechenden Theoreme hat Weber in seinen frühen Vorlesungen „Allgemeine (‚theoretische‘) Nationalökonomie“ und in dem zugehörigen gedruckten Manuskript „Erstes Buch. Die begrifflichen Grundlagen der Volkswirtschaftslehre“ behandelt (vgl. Weber, Theoretische Nationalökonomie, MWG III/1, S. 234 ff. und 127 ff.). Zu Webers Verständnis der Grenznutzentheorie vgl. auch den Aufsatz von 1908: Weber, Grenznutzlehre.
[228]Diese (am strengsten: „statischen“)
31
Fälle kamen in Friedenszeiten in wirklich bedeutsamem Umfang, heute meist in Form von Geldeinkommensbewirtschaftung vor.[228]Die Begriffe „Statik“ bzw. „statisch“ bezeichneten in der zeitgenössischen Nationalökonomie u. a. Aussagen über wirtschaftliche Erscheinungen oder Prozesse, bei denen sich die betrachteten Variablen auf den selben Zeitpunkt oder den selben Zeitraum beziehen. Im Gegensatz zu den zuvor unter 1. genannten Entscheidungen, die sich auf verschiedene Zeiträume beziehen, ist dies hinsichtlich der unter 2. aufgeführten grenznutzentheoretischen Erwägung der Fall.
32
Der Sinn dieser Aussage liegt nicht offen zutage. In den überlieferten Korrekturfahnen ist dieser Satz mehrfach geändert worden; auch hat es noch weitere Änderungen im Ausdruck der 1. Lieferung gegeben, deren Urheber nicht bekannt ist. Auffällig ist eine Umkehrung des Sinnes gegenüber der Aussage in der ersten überlieferten Korrekturfahne, wo es heißt: „Diese (am strengsten „statischen“) Fälle kamen in ihrer Reinheit in wirklich bedeutsamem Umfang kaum vor, dürfen deshalb theoretisch aber nicht vernachlässigt werden.“ Vgl. Anhang, unten, S. 612, sowie den Editorischen Bericht, oben, S. 95.
3. planvolle Beschaffung – Herstellung und Herschaffung
33
– solcher Nutzleistungen, für welche alle Beschaffungsmittel sich in der eignen Verfügungsgewalt des Wirtschaftenden befinden. Im Rationalitätsfall erfolgt eine bestimmte Handlung dieser Art, sofern die Schätzung der Dringlichkeit des Begehrs dem erwarteten Ergebnis nach die Schätzung des Aufwands, das heißt: 1. der Mühe der etwa erforderlichen Leistungen, – 2. aber: der sonst möglichen Verwendungsarten der zu verwendenden Güter und also: ihres technisch andernfalls möglichen Endprodukts übersteigt (Produktion im weiteren Sinn, der die Transportleistungen einschließt); Max Weber faßt hier und im Folgenden – ebenfalls in Wortverbindungen wie „Beschaffungsmittel“, „Beschaffungsbetrieb“ – die seit dem 19. Jahrhundert allgemein übliche Bedeutung „Her(bei)schaffung, Anschaffung“ zusammen mit der sprachgeschichtlich ursprünglichen Bedeutung „Erschaffung“, im Sinne von lat. creare (vgl. Grimm, Jakob und Wilhelm Grimm, Deutsches Wörterbuch, I. Band. – Leipzig: S. Hirzel 1854, Sp. 1543). In ähnlicher Weise ersetzt Franz Oppenheimer den allgemein verwendeten Begriff „Produktion“ durch „Beschaffung“; vgl. Oppenheimer, Theorie, S. 197 ff.
4. planvoller Erwerb gesicherter Verfügungsgewalt oder Mitverfügungsgewalt über solche Nutzleistungen, welche
α. selbst oder
β. deren Beschaffungsmittel sich in fremder Verfügungsgewalt befinden oder welche
[229]γ. fremder, die eigne Versorgung gefährdender Beschaffungskonkurrenz ausgesetzt sind, –
durch Vergesellschaftung mit dem derzeitigen Inhaber der Verfügungsgewalt oder Beschaffungskonkurrenten.
Die Vergesellschaftung mit fremden derzeitigen Inhabern der Verfügungsgewalt kann erfolgen
- durch Herstellung eines Verbandes, an dessen Ordnung sich die Beschaffung oder Verwendung von Nutzleistungen orientieren soll;
- durch Tausch.
Zu a): Sinn der Verbandsordnung kann sein:
- Rationierung der Beschaffung oder der Benutzung oder des Verbrauchs zur Begrenzung der Beschaffungskonkurrenz (Regulierungsverband);
- Herstellung einer einheitlichen Verfügungsgewalt zur planmäßigen Verwaltung der bisher in getrennter Verfügung befindlichen Nutzleistungen (Verwaltungsverband).
Zu b): Tausch ist ein Interessenkompromiß der Tauschpartner, durch welches Güter oder Chancen als gegenseitiger Entgelt hingegeben werden. Der Tausch kann
1.
34
traditional oder konventional, also (namentlich im zweiten Fall) nicht wirtschaftlich rational, – oder [229]Zu erwarten wären hier – wie zuvor bei „zu a)“ – die Gliederungsbuchstaben α und β. Wie im Editorischen Bericht, oben, S. 103 f., ausgeführt, sind Inkonsistenzen der Bezeichnung der Gliederungsebenen in Kapitel II nicht selten. Sie werden nur dann korrigiert, wenn sie das Verständnis des Texts erheblich erschweren.
2. wirtschaftlich rational orientiert erstrebt und geschlossen werden. Jeder rational orientierte Tausch ist Abschluß eines vorhergehenden offenen oder latenten Interessenkampfes durch Kompromiß.
35
Der Tauschkampf der Interessenten, dessen Abschluß das Kompromiß bildet, richtet sich einerseits stets, als Preiskampf, gegen den als Tauschpartner in Betracht kommenden Tauschreflektanten (typisches Mittel: Feilschen), andrerseits gegebenenfalls, als Konkurrenzkampf, gegen wirkliche oder mögliche dritte (gegenwärtige oder für die Zukunft zu erwar[230]tende) Tauschreflektanten, mit denen Beschaffungskonkurrenz besteht (typisches Mittel: Unter- und Überbieten). Zu „Interessenkampf“ und „Interessenkompromiß“ sowie „Marktkampf“ vgl. unten, S. 262 und S. 286.
1. In der Eigenverfügung eines Wirtschaftenden befinden Nutzleistungen (Güter, Arbeit oder andre Träger von solchen) sich dann, wenn tatsächlich nach (mindestens: relativ) freiem Belieben ohne Störung durch Dritte auf ihren Gebrauch gezählt werden kann, einerlei ob diese Chance auf Rechtsordnung oder Konvention oder Sitte oder Interessenlage beruht. Keineswegs ist gerade nur die rechtliche Siche[A 37]rung der Verfügung die begrifflich (und auch nicht: die tatsächlich) ausschließliche, wennschon die heute für die sachlichen Beschaffungsmittel empirisch unentbehrliche Vorbedingung des Wirtschaftens.
2. Fehlende Genußreife kann auch in örtlicher Entferntheit genußreifer Güter vom Genußort bestehen. Der Gütertransport (zu scheiden natürlich vom Güterhandel, der Wechsel der Verfügungsgewalt bedeutet) kann hier daher als Teil der „Produktion“ behandelt werden.
3. Für die fehlende Eigenverfügung ist es prinzipiell irrelevant, ob Rechtsordnung oder Konvention oder Interessenlage oder eingelebte Sitte oder bewußt gepflegte Sittlichkeitsvorstellungen den Wirtschaftenden typisch hindern, die fremde Verfügungsgewalt gewaltsam anzutasten.
4. Beschaffungskonkurrenz kann unter den mannigfachsten Bedingungen bestehen. Insbesondere z. B. bei okkupatorischer Versorgung: Jagd, Fischfang, Holzschlag, Weide, Rodung. Sie kann auch und gerade innerhalb eines nach außen geschlossenen Verbandes bestehen. Die dagegen gerichtete Ordnung ist dann stets: Rationierung der Beschaffung, regelmäßig in Verbindung mit Appropriation der so garantierten Beschaffungschancen für eine fest begrenzte Zahl von einzelnen oder (meist) von Hausverbänden. Alle Mark- und Fischereigenossenschaften, die Regulierung der Rodungs-, Weide- und Holzungsrechte auf Allmenden und Marken, die „Stuhlung“ der Alpenweiden
36
usw. haben diesen Charakter. Alle Arten erblichen „Eigentums“ an nutzbarem Grund und Boden sind dadurch propagiert worden. [230]Bei der „Stuhlung“ wird die Alpweide in eine Zahl von „Stößen“, d. h. von Flächen, geteilt, die ein Stück Vieh im Jahr als Weideland benötigt. Vgl. Weber, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, MWG III/6, S. 106.
5. Der Tausch kann sich auf alles erstrecken, was sich in irgendeiner Art in die Verfügung eines andern „übertragen“ läßt und wofür ein Partner Entgelt zu geben bereit ist. Nicht nur auf „Güter“ und „Leistungen“ also, sondern auf ökonomische Chancen aller Art, z. B. auf eine rein kraft Sitte oder Interessenlage zur Verfügung stehende, durch nichts garantierte „Kundschaft“. Erst recht natürlich auf alle irgendwie durch irgendeine Ordnung garantierten Chancen. Tauschobjekte sind also nicht nur aktuelle [231]Nutzleistungen. Als Tausch soll für unsre Zwecke vorläufig, im weitesten Wortsinn, jede auf formal freiwilliger Vereinbarung ruhende Darbietung von aktuellen, kontinuierlichen, gegenwärtigen, künftigen Nutzleistungen von welcher Art immer gegen gleichviel welche Art von Gegenleistungen bezeichnet werden. Also z. B. die entgeltliche Hingabe oder Zurverfügungstellung der Nutzleistung von Gütern oder Geld gegen künftige Rückgabe gleichartiger Güter ebenso wie das Erwirken irgendeiner Erlaubnis, oder einer Überlassung der „Nutzung“ eines Objekts gegen „Miete“ oder „Pacht“, oder die Vermietung von Leistungen aller Art gegen Lohn oder Gehalt.
37
Daß heute, soziologisch angesehen, dieser letztgenannte Vorgang für die „Arbeiter“ im Sinn des § 15[231]Max Weber geht hier noch von der einstmals das Gemeine Recht beherrschenden römisch-rechtlichen Vorstellung der „Dienstmiete“ aus. Ihr zufolge war der „Vermieter“ einer Dienstleistung verpflichtet, die versprochenen Dienste zu leisten, der „Mieter“ war verpflichtet, das Mietgeld bzw. den Mietlohn zu zahlen (vgl. Windscheid, Bernhard, Lehrbuch des Pandektenrechts, Band 2, 9. Aufl. bearbeitet von Theodor Kipp. – Frankfurt a. Μ.: Rütten & Loening 1906, S. 744). Das 1900 in Kraft getretene Bürgerliche Gesetzbuch spricht nicht mehr von einem Mietverhältnis, sondern von einem Dienstvertrag, allerdings noch ohne Unterscheidung zwischen Verträgen mit Selbständigen (Angehörigen freier Berufe) und Verträgen mit Abhängigen, den Arbeitsverträgen. Vgl. auch unten, S. 376: „Miete gegen Lohn“, „Arbeitsmiete“.
38
den Eintritt in einen Herrschaftsverband bedeutet, bleibt vorläufig noch ebenso außer Betracht wie die Unterschiede von „Leihe“ und „Kauf“ usw. In Kap. II, § 15, unten, S. 296, wird der Begriff „Arbeit“ definiert. Der Begriff „Arbeiter“ erscheint in § 15 nur einmal beiläufig (unten, S. 301).
6. Der Tausch kann in seinen Bedingungen traditional und, in Anlehnung daran, konventional, oder aber rational bestimmt sein. Konventionale Tauschakte waren der Geschenkaustausch unter Freunden, Helden, Häuptlingen, Fürsten (cf. den Rüstungstausch des Diomedes und Glaukos),
39
nicht selten übrigens (vgl. die Tell-el-Amarna-Briefe)Max Weber bezieht sich auf das in Homers Ilias im VI. Gesang, Verse 119 ff., geschilderte Zusammentreffen von Glaukos, dem König der Lykier, und Diomedes, dem Führer der Aitolier, in der Schlacht um Troja. In Erinnerung an einen einstmals von ihren Großvätern geschlossenen Freundschaftsbund tauschten sie ihre Rüstungen, wobei Glaukos seine goldene gegen die eiserne Rüstung von Diomedes hingab, im Werte hundert Stiere gegen neun vertauschend (Verse 234–6).
40
schon sehr stark rational orientiert und kontrolliert. Der rationale Tausch ist nur möglich, wenn entweder beide Teile dabei Vorteil zu finden hoffen, oder eine durch ökonomische Macht oder Not bedingte Zwangslage für einen Teil [232]vorliegt. Er kann (s. § 11)1884 auf dem Ruinenhügel von Amarna in Mittelägypten entdecktes Tontafelarchiv, das die diplomatische Korrespondenz der Könige Amenophis III. (1402–1364 v. Chr.) und Amenophis IV-Echnaton (1364–1347 v. Chr.) enthielt. An anderer Stelle berichtet Max Weber unter Hinweis auf die Amarna-„Briefe“, daß der Handel in Ägypten lange die Form des Geschenkaustausches zwischen Staatshäuptern bewahrt habe (vgl. Weber, Agrarverhältnisse3, MWG I/6, S. 430, mit Hg.-Anm. 77 zu Webers Quelle).
41
entweder: naturalen Versorgungs- oder: Erwerbszwecken dienen, also: an der persönlichen Versorgung des oder der Eintauschenden mit einem Gut oder: an Marktgewinnchancen (s. § 11)[232]Kap. II, § 11, unten, S. 258.
42
orientiert sein. Im ersten Fall ist er in seinen Bedingungen weitgehend individuell bestimmt und in diesem Sinn irrational: Haushaltsüberschüsse z. B. werden in ihrer Wichtigkeit nach dem individuellen Grenznutzen der Einzelwirtschaft geschätzt und eventuell billig abgetauscht, zufällige Begehrungen des Augenblicks bestimmen den Grenznutzen der zum Eintausch begehrten Güter unter Umständen sehr hoch.Kap. II, § 11, unten, S. 258 f.
43
Die durch den Grenznutzen bestimmten Tauschgrenzen sind also hochgradig schwankend. Ein rationaler Tauschkampf entwickelt sich nur bei marktgängigen (über den Begriff s. § 8)Max Weber bezieht sich auf Carl Menger, der die Frage nach den „Grenzen des ökonomischen Austausches von Gütern“ zunächst am Modell des isolierten Tausches zwischen zwei Personen grenznutzentheoretisch abhandelt; vgl. Menger, Carl, Grundsätze der Volkswirthschaftslehre, Erster Allgemeiner Teil. – Wien: Wilhelm Braumüller 1871, S. 160–179.
44
und im Höchstmaß bei erwerbswirtschaftlich (Begriff s. § 11)Max Weber definiert „Marktgängigkeit“ in Kap. II, § 8, unten, S. 248.
45
genutzten oder abgetauschten Gütern. Kap. II, § 11, unten, S. 258.
7. Die zu a α genannten Eingriffe eines Regulierungsverbandes sind nicht etwa die einzig möglichen eines solchen, aber diejenigen, welche, als am unmittelbarsten aus Bedrohung der Bedarfsdeckung als solcher hervorgehend, hierher gehören. Über die Absatzregulierung s. später.
46
Zu Absatz- und (allgemeiner) zu Marktregulierungen siehe Kap. II, § 8, unten, S. 248–250.
§ 5. Ein wirtschaftlich orientierter Verband kann, je nach seinem Verhältnis zur Wirtschaft, sein:
a)
47
wirtschaftender Verband, – wenn das an seiner Ordnung orientierte primär außerwirtschaftliche Verbandshandeln ein Wirtschaften mit umschließt; Max Weber bezeichnet in der Mehrzahl der Paragraphen die erste Gliederungsebene mit arabischen Ziffern. Wie im Editorischen Bericht, oben, S. 104, ausgeführt, werden, wo Weber anders verfährt, in der Regel keine Angleichungen vorgenommen.
[A 38]b) Wirtschaftsverband, – wenn das durch die Ordnung geregelte Verbandshandeln primär ein autokephales Wirtschaften bestimmter Art ist;
[233]c) wirtschaftsregulierender Verband, – wenn und insoweit als an den Ordnungen des Verbandes sich das autokephale Wirtschaften der Verbandsglieder material heteronom orientiert.
d) Ordnungsverband, – wenn seine Ordnungen das autokephale und autonome Wirtschaften der Verbandsmitglieder nur formal durch Regeln normieren und die dadurch erworbenen Chancen garantieren.
Materiale Wirtschaftsregulierungen haben ihre faktischen Schranken da, wo die Fortsetzung eines bestimmten wirtschaftlichen Verhaltens noch mit vitalem Versorgungsinteresse der regulierten Wirtschaften vereinbar ist.
1. Wirtschaftende Verbände sind der (nicht sozialistische
i
oder kommunistische) „Staat“ und alle anderen Verbände (Kirchen, Vereine usw.) mit eigner Finanzwirtschaft, aber auch z. B. die Erziehungsgemeinschaften,[233]A: nichtsozialistische
48
die nicht primär ökonomischen Genossenschaften usw. [233]Das Gemeinte ist nicht eindeutig zu identifizieren. In der Korrekturfahne K3 ändert Max Weber eigenhändig „Hausgemeinschaft der Familie“ in „Erziehungsgemeinschaften“ (vgl. Anhang, unten, S. 615). Zur Idee der Erziehungsgemeinschaft in der Jugend- und reformstudentischen Bewegung am Anfang des 20. Jahrhunderts vgl. u. a. Bias-Engels, Sigrid, Zwischen Wandervogel und Wissenschaft. Zur Geschichte von Jugendbewegung und Studentenschaft 1896–1920. (Archiv der deutschen Jugendbewegung, Band 4). – Köln: Verlag Wissenschaft und Politik 1988, S. 108, 110 f.
2. Wirtschaftsverbände sind natürlich, im Sinn dieser Terminologie, nicht nur die üblicherweise so bezeichneten, wie etwa Erwerbs-(Aktien-)gesellschaften, Konsumvereine, Artjels,
49
Genossenschaften, Kartelle, sondern alle das Handeln mehrerer Personen umfassenden wirtschaftlichen „Betriebe“ überhaupt, von der Werkstattgemeinschaft zweier Handwerker bis zu einer denkbaren weltkommunistischen Assoziation. Zum Ausdruck „Artjel“ vgl. oben, S. 203, Hg.-Anm. 2.
3. Wirtschaftsregulierende Verbände sind z. B. Markgenossenschaften, Zünfte, Gilden, Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände, Kartelle und alle Verbände mit einer material den Inhalt und die Zielrichtung des Wirtschaftens regulierenden: „Wirtschaftspolitik“ treibenden Leitung, also: die Dörfer und Städte des Mittelalters ebenso wie jeder eine solche Politik treibende Staat der Gegenwart.
4. Ein reiner Ordnungsverband ist z. B. der reine Rechtsstaat, welcher das Wirtschaften der Einzelhaushalte und -betriebe material gänzlich autonom läßt und nur formal im Sinne der Streitschlichtung die Erledigung der frei paktierten Tauschverpflichtungen regelt.
[234]5. Die Existenz von wirtschaftsregulierenden und Ordnungsverbänden setzt prinzipiell die (nur verschieden große) Autonomie der Wirtschaftenden voraus. Also: die prinzipielle, nur in verschiedenem Maße (durch Ordnungen, an denen sich das Handeln orientiert) begrenzte, Freiheit der Verfügungsgewalt der Wirtschaftenden. Mithin: die (mindestens relative) Appropriation von ökonomischen Chancen an sie, über welche von ihnen autonom verfügt wird. Der reinste Typus des Ordnungsverbandes besteht daher dann, wenn alles menschliche Handeln inhaltlich autonom verläuft und nur an formalen Ordnungsbestimmungen orientiert ist, alle sachlichen Träger von Nutzleistungen aber voll appropriiert sind, derart, daß darüber, insbesondere durch Tausch, beliebig verfügt werden kann, wie dies der typischen modernen Eigentumsordnung entspricht. Jede andere Art von Abgrenzung der Appropriation und Autonomie enthält eine Wirtschaftsregulierung, weil sie menschliches Handeln in seiner Orientierung bindet.
6. Der Gegensatz zwischen Wirtschaftsregulierung und bloßem Ordnungsverband ist flüssig. Denn natürlich kann (und muß) auch die Art der „formalen“ Ordnung das Handeln irgendwie material, unter Umständen tiefgehend, beeinflussen. Zahlreiche moderne gesetzliche Bestimmungen, welche sich als reine „Ordnungs“-Normen geben, sind in der Art ihrer Gestaltung darauf zugeschnitten, einen solchen Einfluß zu üben (davon in der Rechtssoziologie).
50
Außerdem aber ist eine wirklich ganz strenge Beschränkung auf reine Ordnungsbestimmungen nur in der Theorie möglich. Zahlreiche „zwingende“ Rechtssätze – und solche sind nie zu entbehren – enthalten in irgendeinem Umfang auch für die Art des materialen Wirtschaftens wichtige Schranken. Grade „Ermächtigungs“-Rechtssätze aber enthalten unter Umständen (z. B. im Aktienrecht) recht fühlbare Schranken der wirtschaftlichen Autonomie.[234]Eine Neufassung der Rechtssoziologie ist nicht überliefert, vgl. dazu auch die Einleitung, oben, S. 69. In den älteren Fassungen von Webers Rechtssoziologie (vgl. Weber, „Recht“, MWG I/22-3) finden sich zum Gegensatz zwischen wirtschaftsregulierendem und bloßem Ordnungsverband noch keine systematischen Ausführungen.
51
Gemäß Aktiengesetz von 1884 war die Ermächtigung zur Gründung einer Aktiengesellschaft, einer Gesellschaft mit eigener Rechtspersönlichkeit bei nur begrenzter Haftung der Aktionäre, verbunden mit einer Fülle von Regelungen zum Schutz von Gläubigern und Anlegern. Zu den durch Ermächtigungsnormen gesetzten Schranken autonomen Handelns und zu Beispielen aus dem Aktienrecht hierfür vgl. Weber, Die Entwicklungsbedingungen des Rechts, MWG I/22-3, S. 339–343.
7. Die Begrenztheit der materialen Wirtschaftsregulierungen in ihrer Wirkung kann sich a) im Aufhören bestimmter Richtungen des Wirtschaf[235]tens (Bestellung von Land nur zum Eigenbedarf bei Preistaxen) oder b) in faktischer Umgehung (Schleichhandel) äußern.
52
[235]Zur prekären Wirksamkeit von behördlich angeordneten Preisen im Allgemeinen vgl. Weber, Die Wirtschaft und die Ordnungen, MWG I/22-3, S. 243 f. Für die von Weber hier geschilderten Ausweichreaktionen lieferte die Höchstpreispolitik im Ersten Weltkrieg massenhaft Beispiele. Vgl. Rohrscheidt, Kurt von, Preistaxen (Geschichtliches), in: HdStW4, Band 6, 1925, S. 1068–1074.
§ 6.
53
Tauschmittel soll ein sachliches Tauschobjekt insoweit heißen, als dessen Annahme beim Tausch in typischer Art primär an der Chance für [A 39]den Annehmenden orientiert ist, daß dauernd – das heißt: für die in Betracht gezogene Zukunft – die Chance bestehen werde, es gegen andre Güter in einem seinem Interesse entsprechenden Austauschverhältnis in Tausch zu geben, sei es gegen alle (allgemeines Tauschmittel), sei es gegen bestimmte (spezifisches Tauschmittel).In der Entfaltung der Begrifflichkeit der formalen Aspekte des Geldwesens folgt Max Weber in diesem und den nachfolgenden Paragraphen vielfach, aber keineswegs durchgehend Georg Friedrich Knapp, Staatliche Theorie des Geldes (1. Aufl. 1905; 2., durchgesehene und vermehrte Aufl. 1918), worauf er unten, S. 239 f., ausdrücklich hinweist. Knapp erklärt den eigentümlichen Charakter der von ihm neu geprägten Begriffe wie folgt: „Für meinen Zweck, die metallistische Auffassung durch eine staatswissenschaftliche zu ersetzen, war ich genötigt, eine ausgebildete Kunstsprache zu schaffen. Ob man die neuen Ausdrücke in deutscher Sprache hätte bilden können, weiß ich nicht. Viel wichtiger schien es mir für dies Wissensgebiet, das gar nichts Nationales an sich hat, Ausdrücke zu schaffen, die leicht in jede Sprache übergehen können, weil sie, wie ich zugebe, gelehrt und nicht volkstümlich sind. Dadurch habe ich, mit einigem Bedauern, die Vorzüge einer lobenswerten Schreibart preisgegeben, hoffentlich aber den größeren Vorzug einer theoretischen Behandlung errungen.“ Knapp, Staatliche Theorie, S. VII (Hervorhebung des Hg.).
54
Die Chance der Annahme in einem abschätzbaren Tauschverhältnis zu anderen (spezifisch angebbaren) Gütern soll materiale Geltung des Tauschmittels im Verhältnis zu diesen heißen, formale Geltung die Verwendung an sich.Zu den Begriffen „Tauschmittel“ und „Zahlungsmittel“ vgl. Webers Erläuterungen unten, S. 241 f., Ziffern 1–4.
55
Zur Unterscheidung von „formaler“ und „materialer“ Geltung vgl. auch unten, S. 388 f. und S. 404.
Zahlungsmittel soll ein typisches Objekt insoweit heißen, als für die Erfüllung bestimmter paktierter oder oktroyierter Leistungspflichten die Geltung seiner Hingabe als Erfüllung konventional oder rechtlich garantiert ist (formale Geltung des [236]Zahlungsmittels, die zugleich formale Geltung als Tauschmittel bedeuten kann).
Chartal
56
sollen Tauschmittel oder Zahlungsmittel heißen, wenn sie Artefakte sind, kraft der ihnen gegebenen Form ein konventionelles, rechtliches, paktiertes oder oktroyiertes Ausmaß formaler Geltung innerhalb eines personalen oder regionalen Bereichs[236]Wie Max Weber unten, S. 243, erklärt, ist „chartal“ ein Ausdruck von Knapp. Dieser hat ihn in Anlehnung an das lateinische Wort charta (Blatt, dünne Platte) geprägt. Zu den Gründen für diese Benennung vgl. Knapp, Staatliche Theorie, S. 27.
j
haben und gestückelt sind, das heißt: auf bestimmte Nennbeträge oder Vielfache oder Bruchteile von solchen lauten, so daß rein mechanische Rechnung mit ihnen möglich ist. [236]A: Gebiets
Geld soll ein chartales Zahlungsmittel heißen, welches Tauschmittel ist.
Tauschmittel-, Zahlungsmittel- oder Geld-Verband soll ein Verband heißen mit Bezug auf Tauschmittel, Zahlungsmittel oder Geld, welche und soweit sie innerhalb des Geltungsbereichs seiner Ordnungen durch diese in einem relevanten Maß wirksam als konventional oder rechtlich (formal) geltend oktroyiert sind: Binnengeld
k
bzw. Binnen-Tausch- bzw. -Zahlungsmittel. Im Tausch mit Ungenossen verwendete Tauschmittel sollen Außen-Tauschmittel heißen. A: Binnengeld,
Naturale Tausch- oder Zahlungsmittel sollen die nicht chartalen heißen. In sich sind sie unterschieden:
a) 1. technisch: je nach dem Naturalgut, welches sie darstellt (insbesondere: Schmuck, Kleider, Nutzobjekte und Geräte) –, oder nach
l
Fehlt in A; nach sinngemäß ergänzt
2. der Verwendung in Form der Wägung (pensatorisch)
57
oder nicht;Abgeleitet aus lat. pensare (wägen, abwiegen), sind pensatorische Zahlungsmittel solche, die bei Hingabe gewogen werden müssen, weil sie keine eindeutigen Zeichen ihrer (materialen) Geltung tragen. Vgl. Knapp, Staatliche Theorie, S. 22–24.
b) ökonomisch: je nach ihrer Verwendung
1. primär für Tauschzwecke oder für ständische Zwecke (Besitzprestige),
[237]2. primär als Binnen- oder als Außentausch- bzw. Zahlungsmittel.
Zeichenmäßig heißen Tausch- und Zahlungsmittel oder Geld insoweit, als sie primär eine eigene Schätzung außerhalb ihrer Verwendung als Tausch- oder Zahlungsmittel nicht (in der Regel: nicht mehr) genießen,
stoffmäßig
m
insoweit, als ihre materiale Schätzung als solche durch die Schätzung ihrer Verwendbarkeit als Nutzgüter beeinflußt wird oder doch werden kann. [237]A: Stoffmäßig
Geld ist entweder:
- monetär: Münze, oder
- notal: Urkunde.58[237]Hinsichtlich der Unterscheidung der Geldarten nach ihrem stofflichen Charakter weicht Max Weber von Knapp ab. Knapp unterscheidet „bares“ und „notales“ Geld. Bares Geld waren nach seinen Definitionsmerkmalen (Knapp, Staatliche Theorie, S. 53 f.) vor dem Ersten Weltkrieg in Deutschland nur Goldmünzen. Die nicht-baren Geldarten nennt Knapp notal, „gleichgültig ob sie Münzen sind oder Scheine.“ (Knapp, Geldtheorie, staatliche, in: HdStW3, Band 4, 1909, S. 610–618, Zitat S. 613).
Das notale Geld pflegt durchweg in seiner Form einer monetären Stückelung angepaßt oder im Nennbetrag historisch auf eine solche bezogen zu sein.
Monetäres Geld
59
soll heißen: In Kap. II, § 32, unten, S. 393 f., bezeichnet Weber die im Folgenden aufgeführten drei (Münz-)Geldarten als „effektives Kurantgeld“ bzw. „effektives Währungsgeld“. Die zweitgenannte Geldart wird dort als „unreguliertes Verwaltungsgeld“ bezeichnet.
1. „freies“ oder „Verkehrsgeld“,
60
wenn von der Geldausgabestelle auf Initiative jedes Besitzers des monetären Stoffs dieser in beliebigen Mengen in chartale „Münz“-Form verwandelt wird, material also die Ausgabe an Zahlungsbedürfnissen von Tauschinteressenten orientiert ist, – Auf Eigenschaften und Bedeutung des „freien Verkehrsgeldes“ geht Max Weber ausführlich in Kap. II, § 32, unten, S. 394 ff., ein.
2. „gesperrtes“ oder „Verwaltungsgeld“,
61
– wenn die Verwandlung in chartale Form nach dem formell freien, material [238]primär an Zahlungsbedürfnissen der Verwaltungsleitungsleitung eines Verbandes orientierten, Belieben dieser erfolgt, – Auf Eigenschaften und Bedeutung des „Sperrgelds“, das nicht von beliebigen Personen in beliebiger Menge durch Hingabe von Münzmetall frei geschaffen werden kann, geht Max Weber in Kap. II, § 33, unten, S. 397–400, ausführlich ein. Die Begriffe „Sperrgeld“ und „Verwaltungsgeld“ sind nicht dem System von Knapp entnommen. [238]Von „gesperrter Prägung“ zu sprechen, war verbreitet (vgl. Helfferich, Das Geld2, S. 79 ff.). Der von Weber gebrauchte Begriff Verwaltung meint in diesem Zusammenhang die mit der Emission des Geldes befaßten Autoritäten.
3. „reguliertes“,
62
wenn sie Gemeint ist: reguliertes Verwaltungsgeld.
n
zwar gesperrt, die Art und das Ausmaß ihrer Schaffung aber durch Normen wirksam geregelt ist. [238]Lies: die Verwandlung in chartale Form
[A 40]Umlaufsmittel
63
soll eine als notales Geld fungierende Urkunde Im System Knapps gibt es den Begriff „Umlaufsmittel“ nicht. Er spielt eine erhebliche Rolle bei Ludwig von Mises. Dieser definiert: „Das Umlaufsmittel ist […] eine nicht durch Gelddepots gedeckte, jederzeit fällige Forderung auf Auszahlung eines bestimmten Geldbetrages, die vermöge ihrer rechtlichen und technischen Ausstattung geeignet ist, an Stelle des Geldes in Erfüllung von auf Geld lautenden Zahlungsverpflichtungen gegeben und genommen zu werden.“ (vgl. Mises, Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel, S. 318). Anders als bei Max Weber, der auf Giralgeld nicht eingeht, gehört dieses bei Mises ebenfalls zu den Umlaufsmitteln.
64
heißen, wenn ihre Annahme als „provisorisches“ Geld Max Weber korrigierte im Prozeß der Drucklegung „Geldforderung“ in „Urkunde“ (vgl. den Anhang, unten, S. 619). Zur Bedeutung dieser Änderung vgl. Kap. II, § 34, unten, S. 402.
65
sich an der Chance orientiert: daß ihre jederzeitige Einlösung in „definitives“: Münzen oder pensatorische Metalltauschmittel[,] für alle normalen Verhältnisse gesichert sei. Zertifikat dann, wenn dies durch Regulierungen bedingt ist, welche Vorratshaltung im Betrag voller Deckung in Münze oder Metall sicherstellen. Vgl. die Definition Max Webers in Kap. II, § 32, unten, S. 393, sowie Knapp, Staatliche Theorie, S. 92–95.
Tausch- oder Zahlungsmittelskalen sollen die innerhalb eines Verbandes konventionalen oder rechtlich oktroyierten gegenseitigen Tarifierungen der einzelnen naturalen Tausch- und Zahlungsmittel heißen.
Kurantgeld sollen die von der Ordnung eines Geld-Verbands
66
mit nach Art und Maß unbeschränkter Geltung als Zahlungs[239]mittel ausgestatteten Geldarten heißen, Geldmaterial das Herstellungsmaterial eines Geldes, Währungsmetall das gleiche bei Verkehrsgeld, Geldtarifierung die bei der Stückelung und Benennung zugrunde gelegte Bewertung der einzelnen untereinanderWährend Max Weber den „politischen Verband“ oben, S. 212, definiert, wird der von ihm eingeführte Begriff „Geld-Verband“ nicht explizit definiert. Im Verlauf des 19. Jahrhunderts wurde es selbstverständlich, daß die staatliche Obrigkeit eine Geldordnung festlegte. Dies konnte aber auch – wie die Lateinische Münzunion (vgl. unten, S. 396) zeigt – eine überstaatliche sein.
o
stoffverschiedenen Verkehrs-[239]A: unter einander
p
oder Verwaltungsgeldarten, Währungsrelation das gleiche zwischen stoffverschiedenen Verkehrsgeldarten. A: naturalen
Intervalutarisches Zahlungsmittel soll dasjenige Zahlungsmittel heißen, welches zum Ausgleich des Zahlungssaldos zwischen verschiedenen Geldverbänden jeweils letztlich – das heißt[,] wenn nicht durch Stundung die Zahlung hinausgeschoben wird – dient. –
Jede neugeschaffene Verbandsordnung des Geldwesens legt unvermeidlich die Tatsache zugrunde: daß bestimmte Zahlmittel
67
für Schulden verwendet wurden. Sie begnügt sich entweder mit deren Legalisierung als Zahlungsmittel oder – bei Oktroyierung neuer Zahlungsmittel – rechnet bestimmte bisherige naturale oder pensatorische oder chartale Einheiten in die neuen Einheiten um (Prinzip der sogenannten „historischen Definition“ des Geldes als Zahlungsmittel,[239]Zur synonymen Verwendung von „Zahlungsmittel“ und „Zahlmittel“ in § 6 und §§ 32 ff. vgl. den Editorischen Bericht, oben, S. 106.
68
von der hier völlig dahingestellt bleibt, wieweit sie auf die Austauschrelation des Geldes als Tauschmittel zu den Gütern zurückwirkt). Max Weber folgt Knapp. Bei Einführung neuer Zahlungsmittel müsse der Staat in Hinblick auf die Regelung von bestehenden Schulden die neue Werteinheit im Verhältnis zur alten festlegen: „Eine andere als die historische Definition der neuen Werteinheit gibt es im allgemeinen nicht.“ (Knapp, Staatliche Theorie, S. 18). Nach Knapp gilt grundsätzlich, „daß die Geltung der Zahlungsmittel nicht an den stofflichen Gehalt gebunden und daß die Werteinheit nur historisch definiert ist.“ (ebd., S. 20).
Es sei nachdrücklich bemerkt: daß hier nicht eine „Geldtheorie“ beabsichtigt ist, sondern eine möglichst einfache terminologische Feststellung von Ausdrücken, die später öfter gebraucht werden. Weiterhin kommt es vorerst auf gewisse ganz elementare soziologische Folgen des Geldgebrauchs an. (Die mir im ganzen annehmbarste materiale Geldtheorie ist die von Mises.
69
Die „Staatliche Theorie“ G[eorg] F[riedrich] Knapps – das [240]großartigste Werk des Fachs – löst ihre formale Aufgabe in ihrer Art glänzend.Max Weber bezieht sich auf Mises, Theorie des Geldes von 1912. Mises bezeichnete als den Kern seiner Aufgabe, die Gesetze zu entwickeln, „die das zwischen dem [240]Gelde und den übrigen wirtschaftlichen Gütern bestehende Austauschverhältnis bestimmen; dies und nichts anderes ist die Aufgabe der nationalökonomischen Theorie des Geldes“ (ebd., S. 33). Mises suchte zu erklären, wie individuelle Nutzenvorstellungen und das Geldangebot auf die Güterpreise einwirken. Dabei gab er der alten Quantitätstheorie eine neue Begründung, bewies zugleich aber auch Nichtneutralität des Geldes in Hinblick auf die relativen Preise. Seine Theorie ruht auf von Carl Menger entwickelten Einsichten hinsichtlich der Entstehung des Geldes aus an Märkten gehandelten Gütern. Daß der Staat gleichsam Geld aus dem Nichts schaffen könne, bestritt er. Geldpolitisch war er ein radikaler Verfechter der Goldwährung und – zur Vermeidung von Inflationsgefahren – der 100-Prozent-Deckung von Banknoten. Zu Mises vgl. Pallas, Carsten, Ludwig von Mises als Pionier der modernen Geld- und Konjunkturlehre. Eine Studie zu den monetären Grundlagen der Austrian Economics. – Marburg: Metropolis-Verlag 2005.
70
Für materiale Geldprobleme ist sie unvollständig: s. später.Gemeint ist: Knapp, Staatliche Theorie. Die in Gedankenstrichen gesetzte, lobende Formulierung ist erst nach der letztüberlieferten Korrekturfahne eingefügt worden (vgl. Anhang, unten, S. 620, sowie den Editorischen Bericht, oben, S. 89). Weber wiederholt das Lob des Werkes mehrfach (vgl. unten, S. 388, 405 und S. 415). Das Wesentliche seiner Theorie faßt Knapp zusammen in: Geldtheorie, staatliche, in: HdStW3, Band 4, 1909, S. 610–618. Im Mittelpunkt des Werkes von Knapp steht die Erfassung der Gründe, weshalb Zahlungsmittel die Chance haben, verwendet zu werden – in der Terminologie Webers: „formale Geltung“ zu gewinnen. Die Zentralthese ist: „Das Geld ist ein Geschöpf der Rechtsordnung.“ (vgl. Knapp, Staatliche Theorie, S. 1). Zu Knapp vgl. Trautwein, Hans-Michael, G. F. Knapp: An Economist with Institutional Complexion, in: Samuels, Warren (Ed.), European Economists of the Early 20th Century, vol. 2: Studies of Neglected Continental Thinkers of Germany and Italy. – Cheltenham: Edward Elgar 2003, S. 167–178. Angeregt durch eine im wesentlichen positive Besprechung des Werkes von James Bonar im Economic Journal, vol. 32, 1922, S. 39–47, und auf Empfehlung von John Maynard Keynes veranlaßte die Royal Economic Society die Anfertigung und Veröffentlichung einer gekürzten englischen Ausgabe der 4. Aufl. der Staatlichen Theorie auf Kosten der Gesellschaft. Vgl. Knapp, Georg Friedrich, The State Theory of Money. – London: Macmillan & Company Ltd. 1924, S. V f.
71
Ihre sehr dankenswerte und terminologisch wertvolle Kasuistik wurde hier noch beiseite gelassen).Dieser Satz findet sich noch nicht in der Korrekturfahne K3 (vgl. den Anhang, unten, S. 621 ). – Bereits 1906 hat Max Weber in einem Brief an Knapp neben großem Lob auch Bedenken zum Ausdruck gebracht: „[…] nur wird man vielleicht bestreiten, daß die ‚staatliche‘ Theorie des Geldes die ganze Theorie des Geldes sei.“ (Vgl. Brief Max Webers an Georg Friedrich Knapp vom 22. Juli 1906, MWG II/5, S. 117). – Entgegen seiner Absicht, keine „Geldtheorie“ betreiben zu wollen, geht Max Weber unten, S. 404 ff., und insbesondere im „Exkurs“, unten S. 415–427, auf materiale Geldprobleme ein.
72
Knapps „Kasuistik“ – Weber hatte sie in der letztüberlieferten Korrekturfahne noch als „denkenswert“ und nicht „dankenswert“ bezeichnet (vgl. Anhang, unten, S. 621) – dient Max Weber bei der Behandlung der formalen Probleme der Geld- und Währungsordnung in Kap. II, §§ 32–36, unten, S. 382–427.
[241]1. Tauschmittel und Zahlungsmittel fallen historisch zwar sehr oft, aber doch nicht immer zusammen. Namentlich nicht auf primitiven Stufen. Die Zahlungsmittel für Mitgiften, Tribute, Pflichtgeschenke, Bußen, Wergelder z. B. sind oft konventional oder rechtlich eindeutig, aber ohne Rücksicht auf das tatsächlich umlaufende Tauschmittel bestimmt. Nur bei geldwirtschaftlichem Verbandshaushalt ist die Behauptung von Mises, Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel (München 1912) richtig, daß auch der Staat die Zahlungsmittel nur als Tauschmittel begehre.
73
Nicht für Fälle, wo der Besitz bestimmter Zahlungsmittel primär ständisches Merkmal war. (S[iehe] dazu H[einrich][241]Bei Mises, Theorie des Geldes, S. 56, heißt es: „Die Stellung des Staates auf dem Markte ist in keiner Weise von der der anderen am Verkehre teilnehmenden Subjekte verschieden. Wie diese schließt auch der Staat Tauschgeschäfte ab, bei denen das Austauschverhältnis dem Preisgesetze unterliegt.“
q
Schurtz, Grundriß einer Entstehungsgeschichte des Geldes, 1898[241]A: K.
r
).A: 1918
74
– Mit dem Beginn staatlicher Geldsatzungen wird Zahlungsmittel der rechtliche, Tauschmittel der ökonomische Begriff. Schurtz führt zahlreiche Beispiele dafür an, daß primitive Geldarten wie das Muschelgeld nicht unmittelbar dem Tauschverkehr, sondern vornehmlich dem Schmuck und damit der Betonung des Ranges bzw. der Geltung von Personen dienten. Vgl. Schurtz, Grundriß, S. 86–102. Das Werk war 1898 und nicht 1918 erschienen, wie es im gedruckten Text und der Korrekturfahne K3 (unten, S. 621) heißt.
2. Die Grenze zwischen einer „Ware“, welche gekauft wird[,] nur weil künftige Absatzchancen in Betracht gezogen werden, und einem „Tauschmittel“ ist scheinbar flüssig. Tatsächlich pflegen aber bestimmte Objekte derart ausschließlich die Funktion als Tauschmittel zu monopolisieren, – und zwar schon unter sonst primitiven Verhältnissen –, daß ihre Stellung als solche eindeutig ist. („Terminweizen“ ist dem gemeinten Sinn nach bestimmt, einen endgültigen Käufer zu finden, also weder ein „Zahlungs-“
s
noch gar „Tauschmittel“, noch vollends „Geld“).A: „Zahlungs“-
75
„Terminweizen“ meint die Kontrakte, die an der Terminbörse für Weizen gehandelt werden. Weil die Kontrakte bis zu ihrer Fälligkeit u.U. durch viele Hände gegangen sind, konnte die Idee aufkommen, sie mit Zahlungsmitteln zu vergleichen. Max Weber hat die Vorgänge am Terminmarkt für Waren bzw. Wertpapiere und Devisen beschrieben in: Weber, Die technische Funktion des Terminhandels, MWG I/5, S. 597–613, und Weber, Die Börse. II. Der Börsenverkehr, MWG I/5, S. 619–657.
3. Die Art der Tauschmittel ist, solange chartales Geld nicht besteht, in ihrer Entstehung primär durch Sitte, Interessenlage und Konventionen aller Art bestimmt, an denen sich die Vereinbarungen der Tauschpartner orientieren. Diese hier nicht näher zu erörternden Gründe, aus denen Tauschmittel primär diese Qualität [A 41]erlangten, waren sehr verschiedene, und zwar auch nach der Art des Tausches, um den es sich typisch handelte. Nicht jedes Tauschmittel war notwendig (auch nicht innerhalb des Perso[242]nenkreises, der es als solches verwendete) universell für Tausch jeder Art anwendbar (z. B. war Muschel-„Geld“ nicht spezifisches Tauschmittel für Weiber und Vieh).
76
[242]Vgl. auch Weber, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, MWG III/6, S. 288 f. Anders jedoch Heinrich Schurtz. Er schreibt, daß auf einer Insel in Papua-Neuguinea eine wertvollere Art Muscheln „hauptsächlich zum Kaufen von Frauen“ benützt worden sei, die wertvollste „besonders zum Kaufen von Frauen, Kanus usw.“ (vgl. Schurtz, Grundriß, S. 82 f.).
4. Auch „Zahlungsmittel“, welche nicht die üblichen „Tauschmittel“ waren, haben in der Entwicklung des Geldes zu seiner Sonderstellung eine beachtliche Rolle gespielt. Die „Tatsache“, daß Schulden existierten (G[eorg] Friedrich] Knapp):
77
– Tributschulden, Mitgift- und Brautpreisschulden, konventionale Geschenkschulden an Könige oder umgekehrt von Königen an ihresgleichen, WergeldschuldenVon „der Tatsache, daß es Schulden gibt“, spricht Knapp im Zusammenhang mit der historischen Definition der Werteinheit von Zahlungsmitteln (vgl. Knapp, Staatliche Theorie, S. 9).
78
und andre – und daß diese oft (nicht immer) in spezifischen typischen Güterarten abzuleisten waren (konventional oder kraft Rechtszwangs), schuf diesen Güterarten (nicht selten: durch ihre Form spezifizierten Artefakten) eine Sonderstellung. Vgl. den Glossar-Eintrag, unten, S. 752, sowie ausführlicher Weber, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, MWG III/6, S. 291 f.
5. „Geld“ (im Sinne dieser Terminologie) könnten auch die „Fünftelschekelstücke“ mit dem Stempel des (Händler-)Hauses sein, die sich in babylonischen Urkunden finden.
79
Vorausgesetzt, daß sie Tauschmittel waren. Dagegen rein „pensatorisch“ verwendete, nicht gestückelte Barren sollen hier nicht als „Geld“, sondern als pensatorisches Tausch- und ZahlungsmittelMax Weber hat sich auf „Fünftel-S(ch)ekel-Stücke mit dem Stempel der Firma X“ in verschiedenen Zusammenhängen bezogen. In einem Brief an Georg Friedrich Knapp dienen sie ihm zum Beweis seiner Kritik an Knapps Behauptung, daß (erst) der Staat den Begriff der Werteinheit schaffe. Vgl. den Brief Max Webers an Georg Friedrich Knapp vom 22. Juli 1906, MWG II/5, S. 116 mit Hg.-Anm. zur Sache und zu Webers Quelle; vgl. auch Weber, Agrarverhältnisse12, MWG I/6, S. 165, und Weber, Agrarverhältnisse3, MWG I/6, S. 395 f., ebenfalls mit Erläuterungen.
t
bezeichnet werden, so ungemein wichtig die Tatsache der Wägbarkeit für die Entwicklung der „Rechenhaftigkeit“ war. Die Übergänge (Annahme von Münzen nur nach Gewicht usw.) sind natürlich massenhaft. [242]A: Tauschmittel
80
Vgl. hierzu den Anhang, unten, S. 622, sowie den Editorischen Bericht, oben, S. 106. Wie es zur – hier emendierten – Korrektur in „Tauschmittel“ gekommen ist, ist nicht zu ermitteln.
[243]6. „Chartal“ ist ein Ausdruck, den Knapps „Staatliche Theorie des Geldes“ eingeführt hat.
81
Alle Arten durch Rechtsordnung oder Vereinbarung mit Geltung versehene gestempelte und gestückelte Geldsorten,[243]Vgl. hierzu oben, S. 236, Hg.-Anm. 56.
82
metallische ebenso wie nichtmetallische, gehören nach ihm dahin. Nicht abzusehen ist, warum nur staatliche Proklamation,Unter „Geldsorten“ verstand man, wie heute noch, ausländische Banknoten und Münzen. In den überlieferten Korrekturfahnen ist in Übereinstimmung mit dem Sprachgebrauch bei Knapp von „Geldarten“ die Rede (vgl. Anhang, unten, S. 622). Zu derartigen Unterschieden zwischen den letzten überlieferten Korrekturfahnen und der gedruckten Fassung vgl. den Editorischen Bericht, oben, S. 100 f.
83
nicht auch Konvention oder paktierter Zwang zur Annahme für den Begriff ausreichen sollen. Ebensowenig könnte natürlich die Herstellung in Eigenregie oder unter Kontrolle der politischen Gewalt – die in China wiederholt ganz fehlte, im Mittelalter nur relativ bestand, – entscheidend sein, sofern nur Normen für die entscheidende Formung bestehen. (So auch Knapp.)„Geltung durch Proklamation“ spielt im System von Knapp als Gegensatz zur „pensatorischen Auffindung der Geltung“ für die „Chartalität“ eine entscheidende Rolle (vgl. Knapp, Staatliche Theorie, S. 25). Knapp spricht in diesem Zusammenhang nicht ausdrücklich vom Staat als dem Proklamierenden, sondern von der „Rechtsordnung“.
84
Die Geltung als Zahlungs- und die formale Benutzung als Tauschmittel im Verkehr innerhalb des Machtgebietes des politischen Verbandes kann durch die Rechtsordnung erzwungen werden. S[iehe] später.Möglicherweise bezieht sich Weber auf Aussagen von Knapp wie die folgende: „In dem Augenblicke, als durch die Entscheidung des Richters die Chartalität der Zahlungsmittel entstand […].“ (Vgl. Knapp, Staatliche Theorie, S. 30).
85
Kap. II, §§ 32 ff., unten, S. 382 ff.
7. Die naturalen Tausch- und Zahlungsmittel sind primär teils das Eine, teils das Andere, teils mehr Binnen-[,] teils mehr Außen-Tausch- und Zahlungs-Mittel. Die Kasuistik gehört nicht hierher. Ebenso – noch nicht
86
– die Frage der materialen Geltung des Geldes. Max Weber geht unten, S. 404 ff. und 415 ff., auf Aspekte der von Knapp nicht behandelten „materialen Geltung“ ein, behandelt jedoch dort „die Frage der materialen Geltung des Geldes“ nicht systematisch.
8. Ebensowenig gehört eine materiale Theorie des Geldes in bezug auf die Preise schon an diese Stelle (soweit sie überhaupt in die Wirtschaftssoziologie gehört). Hier muß zunächst die Konstatierung der Tatsache des Geldgebrauchs (in seinen wichtigsten Formen) genügen, da es auf die ganz allgemeinen soziologischen Konsequenzen dieser an sich, ökonomisch angesehen, formalen Tatsache ankommt. Festgestellt sei vorerst nur, daß „Geld“ niemals nur eine harmlose „Anweisung“ oder eine bloß nominale „Rechnungseinheit“ sein wird und kann, solange es eben: Geld ist. Seine Wertschätzung ist (in sehr verwickelter Form) stets auch eine Seltenheits- [244](oder bei „Inflation“:
87
Häufigkeits-)Wertschätzung, wie gerade die Gegenwart,[244]Zum Begriff „Inflation“ bei Weber vgl. unten, S. 410, Hg.-Anm. 8.
88
aber auch jede Vergangenheit zeigt. Im Verlauf der Jahre 1919 und 1920 erhöhte sich in Deutschland der Bargeldumlauf um 51 bzw. 63 Prozent. Vgl. Deutsche Bundesbank (Hg.), Deutsches Geld- und Bankwesen in Zahlen 1876–1975. – Frankfurt a. Μ.: Fritz Knapp 1976, S. 14.
Eine sozialistische, etwa auf dem Grund von (als „nützlich“ anerkannter) „Arbeit“ eines bestimmten Maßes emittierte „Anweisung“ auf bestimmte Güter könnte zum Gegenstand der Thesaurierung oder des Tausches werden, würde aber den Regeln des (eventuell: indirekten) Naturaltausches folgen.
89
Der systematische Ort dieses Absatzes ist fraglich. In der Korrekturfahne K2 steht der Text zunächst nach Absatz 9 unter der fortlaufenden Numerierung 10. Jedoch hat Max Weber die Gliederungsziffer 10 eigenhändig gestrichen und die Verschiebung des Absatzes nach oben markiert (vgl. den Anhang, unten, S. 623).
9. Die Beziehungen zwischen monetärer und nicht monetärer Benutzung eines technischen Geldstoffes lassen sich an der chinesischen Geldgeschichte in ihren weittragenden Folgen für die Wirtschaft am deutlichsten verfolgen, weil bei Kupferwährung mit hohen Herstellungskosten und stark schwankender Ausbeute des Währungsmaterials die Bedingungen dort besonders klar lagen.
90
In China gehörte über Jahrhunderte hin Kupfer zu den Münzmetallen. Wann immer ein besonderer Bedarf an metallischem Kupfer, z. B. für Kriegszwecke, bestand, verminderte sich die Menge umlaufender Münzen drastisch. Nach Herstellung des Friedens wurde das Land regelmäßig mit Kupfermünzen überschwemmt. Vgl. hierzu Weber, Konfuzianismus, MWG I/19, S. 138–141; zu Webers Quellen ebd., S. 133.
§ 7. Die primären Konsequenzen typischen Geldgebrauches sind:
1. der sogenannte „indirekte Tausch“ als Mittel der Bedarfsversorgung von Konsumenten. Das heißt die Möglichkeit: a) örtlicher, b) zeitlicher, c) personaler, d) (sehr wesentlich auch:) mengenhafter Trennung der jeweils zum Abtauschen bestimmten Güter von den zum Eintausch begehrten. Dadurch: die außerordentliche Ausweitung der jeweils gegebenen Tauschmöglichkeiten, und, in Verbindung, damit:
2. die Bemessung gestundeter Leistungen, insbesondere: Gegenleistungen beim Tausch (Schulden), in Geldbeträgen;
[A 42]3. die sogenannte „Wertaufbewahrung“, das heißt: die Thesaurierung von Geld in natura
u
oder von jederzeit einzufordern[245]den Geldforderungen als Mittel der Sicherung von künftiger Verfügungsgewalt über Eintauschchancen; [244]A: Natura
4. die zunehmende Verwandlung ökonomischer Chancen in solche: über Geldbeträge verfügen zu können;
5. die qualitative Individualisierung und damit, indirekt, Ausweitung der Bedarfsdeckung derjenigen, die über Geld oder Geldforderungen oder die Chancen von Gelderwerb verfügen, und also: Geld für beliebige Güter und Leistungen anbieten können;
6. die heute typische Orientierung der Beschaffung von Nutzleistungen am Grenznutzen jener Geldbeträge, über welche der Leiter einer Wirtschaft in einer von ihm übersehbaren Zukunft voraussichtlich verfügen zu können annimmt. Damit:
7. Erwerbsorientierung an allen jenen Chancen, welche durch jene zeitlich, örtlich, personal und sachlich vervielfältigte Tauschmöglichkeit (Nr. 1) dargeboten werden. Dies alles auf Grund des prinzipiell wichtigsten Moments von allen, nämlich:
8. der Möglichkeit der Abschätzung aller für den Abtausch oder Eintausch in Betracht kommenden Güter und Leistungen in Geld: Geldrechnung.
Material bedeutet die Geldrechnung zunächst: daß Güter nicht nur nach ihrer derzeitigen, örtlichen und personalen, Nutzleistungsbedeutung geschätzt werden. Sondern daß bei der Art ihrer Verwendung (gleichviel zunächst ob als Konsum- oder als Beschaffungsmittel) auch alle künftigen Chancen der Verwertung und Bewertung, unter Umständen durch unbestimmt viele Dritte für deren Zwecke, insoweit mit in Betracht gezogen werden, als sie sich in einer dem Inhaber der Verfügungsgewalt zugänglichen Geldabtauschchance ausdrücken. Die Form, in welcher dies bei typischer Geldrechnung geschieht, ist: die Marktlage.
Das Vorstehende gibt nur die einfachsten und wohlbekannten Elemente jeglicher Erörterung über „Geld“ wieder und bedarf daher keines besonderen Kommentars. Die Soziologie des „Marktes“ wird an dieser Stelle noch nicht verfolgt (s. über die formalen Begriffe §§
v
8, 10).[245]A: §
1
[245]Kap. II, § 8, unten, S. 626–628, und § 10, unten, S. 629–634.
[246]„Kredit“ im allgemeinsten Sinn soll jeder Abtausch gegenwärtig innegehabter gegen Eintausch der Zusage künftig zu übertragender Verfügungsgewalt über Sachgüter gleichviel welcher Art heißen. Kreditgeben bedeutet zunächst die Orientierung an der Chance: daß diese künftige Übertragung tatsächlich erfolgen werde. Kredit in diesem Sinn bedeutet primär den Austausch gegenwärtig fehlender, aber für künftig im Überschuß erwarteter Verfügungsgewalt einer Wirtschaft über Sachgüter oder Geld – gegen derzeit vorhandene, nicht zur eignen Verwertung bestimmte Verfügungsgewalt einer andern. Wovon im Rationalitätsfall beide Wirtschaften sich günstigere Chancen (gleichviel welcher Art) versprechen, als sie die Gegenwartsverteilung ohne diesen Austausch darböte.
1. Die in Betracht gezogenen Chancen müssen keineswegs notwendig wirtschaftlicher Art sein. Kredit kann zu allen denkbaren Zwecken (karitativen, kriegerischen) gegeben und genommen werden.
2. Kredit kann in Naturalform oder in Geldform und in beiden Fällen gegen Zusage von Naturalleistungen oder von Geldleistungen gegeben und genommen werden. Die Geldform bedeutet aber die geldrechnungsmäßige Kreditgewährung und Kreditnahme mit allen ihren Konsequenzen (von denen alsbald zu reden ist).
2
[246]Der Ankündigung genau entsprechende Ausführungen befinden sich nicht in Kap. II. Zum aktiven und passiven Bankkredit in Geldform vgl. § 29a, unten, S. 370 ff.
3. Im übrigen entspricht auch diese Definition dem Landläufigen. Daß auch zwischen Verbänden jeder Art, insbesondere: sozialistischen oder kommunistischen Verbänden, Kredit möglich (und bei Nebeneinanderbestehen mehrerer nicht ökonomisch autarker Verbände dieser Art unumgänglich) ist, versteht sich von selbst. Ein Problem bedeutete dabei freilich im Fall völligen Fehlens des Geldgebrauches die rationale Rechnungsbasis.
3
Denn die bloße (unbestreitbare) Tatsache der Möglichkeit des „Kompensationsverkehrs“Die sich aus dem Fehlen eines Rechnungssystems in der Naturaltauschwirtschaft ergebenden Probleme behandelt Max Weber ausführlich in Kap. II, § 12, unten, S. 644–652.
4
würde, zumal für langfristigen Kredit, für die [247]Beteiligten noch nichts über die Rationalität der gewährten Bedingungen aus[A 43]sagen. Sie wären etwa in der Lage, wie in der Vergangenheit Oikenwirtschaften (s. später),Max Weber erweitert die Bedeutung dieses Begriffs, der zunächst nur für Abmachungen über den zwischenstaatlichen Austausch bestimmter Warenarten und Warenmengen im Verlauf des Ersten Weltkrieges verwendet wurde. Weber folgt möglicherweise Otto Neurath (vgl. unten, S. 280, Hg.-Anm.79), der den Kompensationsverkehr in den Zusammenhang seiner Theorie der Naturalwirtschaft gestellt hat; vgl. Neurath, Otto, Grundsätzliches über den Kompensationsverkehr im internationalen Warenhandel, in: Weltwirtschaftliches Archiv, Band 13, 1918, S. 23–35.
5
welche ihre Überschüsse gegen Bedarfsartikel abtauschten. Mit dem Unterschied jedoch, daß in der Gegenwart ungeheure Masseninteressen und dabei: solche auf lange Sicht, im Spiel wären, während für die schwach versorgten Massen grade der Grenznutzen der aktuellen Befriedigung besonders hoch steht.[247]Zu Oikenwirtschaft, Oikos siehe unten, S. 273 und 312.
6
Also: Chance ungünstigen Eintausches dringend bedurfter Güter. Max Weber formuliert im Sinne des sog. Ersten Gossenschen Gesetzes. Demzufolge sinkt bei steigendem Konsum eines Gutes dessen Grenznutzen. Entsprechend wäre bei einem geringen Versorgungsgrad des Individuums der Grenznutzen relativ hoch. Vgl. Wieser, Friedrich von, Grenznutzen, in: HdStW3, Band 5, 1910, S. 56–66, hier S. 57.
4. Kredit kann zum Zweck der Befriedigung gegenwärtiger unzulänglich gedeckter Versorgungsbedürfnisse (Konsumtivkredit) genommen werden. Im ökonomischen Rationalitätsfall wird er auch dann nur gegen Einräumung von Vorteilen gewährt. Doch ist dies (bei dem geschichtlich ursprünglichen Konsumtions-, insbesondre beim Notkredit) nicht das Ursprüngliche, sondern der Appell an Brüderlichkeitspflichten (darüber bei Erörterung des Nachbarschaftsverbandes Kap. V).
7
Ausführungen zu Kapitel V liegen nicht vor; vgl. dazu den Anhang zum Editorischen Bericht, oben, S. 109.
5. Die allgemeinste Grundlage des entgeltlichen Sach- oder Geld-Kredits ist selbstverständlich: daß bei dem Kreditgeber infolge besserer Versorgtheit (was, wohl zu beachten, ein relativer Begriff ist) meist der Grenznutzen der Zukunftserwartung höher steht als beim Kreditnehmer.
8
„Grenznutzen der Zukunftserwartung“ ist eine Wortschöpfung Webers – erst in der Korrekturfahne K2 hat Weber eigenhändig von „Zukunftswertung“ in „Zukunftserwartung“ geändert (vgl. Anhang, unten, S. 625). Der genaue theoretische Sinn der Formulierung kann nur vermutet werden. Max Weber scheint auch hier – in Übereinstimmung mit dem Gesetz des abnehmenden Grenznutzens (vgl. oben, Hg.-Anm. 6) – zu unterstellen, daß der aktuell besser versorgte Kreditgeber typischerweise einen niedrigen und der bedürftige Kreditnehmer einen hohen Grenznutzen der aktuellen Konsumsumme hat. Zudem scheint er, in Übereinstimmung mit anderen Autoren der Zeit, anzunehmen, daß das von Eugen von Böhm-Bawerk formulierte Theorem von der „Minderschätzung künftiger Bedürfnisse“ besonders für die schlechter Versorgten gilt (vgl. Böhm-Bawerk, Eugen von, Kapital und Kapitalzins, 2. Abteilung: Positive Theorie des Kapitals, 3. Aufl. – Innsbruck: Wagner’sche Universitäts-Buchhandlung 1909, S.266– 273, 293 f.). Demgemäß schätzen diese den Nutzen der Zukunftsgüter noch geringer ein als die besser Versorgten (vgl. Wieser, Theorie, S. 32). Aus beiden Annahmen folgt, daß der Kreditgeber eine größere Veränderung seines Nutzens in der Zukunft erwartet als der Kreditnehmer. Max Weber kommt wiederholt auf die Frage zurück, warum, rationales Handeln vorausgesetzt, Darlehen gegen Zins gegeben und genommen werden, vgl. unten, S. 268 und S. 269 f.
[248]§ 8. Marktlage eines Tauschobjektes soll die Gesamtheit der jeweils für Tauschreflektanten bei der Orientierung im Preis-und Konkurrenzkampf erkennbaren Aus- und Eintauschchancen desselben gegen Geld heißen, –
Marktgängigkeit das Maß von Regelmäßigkeit, mit welcher jeweils ein Objekt marktmäßiges Tauschobjekt zu werden pflegt, –
Marktfreiheit der Grad von Autonomie der einzelnen Tauschreflektanten im Preis- und Konkurrenzkampf, –
Marktregulierung dagegen der Zustand: daß für mögliche Tauschobjekte die Marktgängigkeit oder für mögliche Tauschreflektanten die Marktfreiheit material durch Ordnungen wirksam beschränkt ist. – Marktregulierungen können bedingt sein:
1. nur traditional: durch Gewöhnung an überlieferte Schranken des Tauschs oder an überlieferte Tauschbedingungen;
2. konventional:
w
durch soziale Mißbilligung der Marktgängigkeit bestimmter Nutzleistungen oder des freien Preis- oder Konkurrenzkampfs in bestimmten Tauschobjekten oder für bestimmte Personenkreise; [248]A: konventional,
3. rechtlich: durch wirksame rechtliche Beschränkung des Tausches oder der Freiheit des Preis- oder Konkurrenzkampfes, allgemein oder für bestimmte Personenkreise oder für bestimmte Tauschobjekte, im Sinne: der Beeinflussung der Marktlage von Tauschobjekten (Preisregulierung) oder der Beschränkung des Besitzes oder Erwerbes oder Abtauschs von Verfügungsgewalt über Güter auf bestimmte Personenkreise (rechtlich garantierte Monopole oder rechtliche Schranken der Freiheit des Wirtschaftens);
4. voluntaristisch:
9
durch Interessenlage: materiale Marktregulierung bei formaler Marktfreiheit. Sie hat die Tendenz zu entstehen, wenn bestimmte Tauschinteressenten kraft ihrer faktisch ganz oder annähernd ausschließlichen Chance des Besitzes [249]oder Erwerbes von Verfügungsgewalt über bestimmte Nutzleistungen (monopolistische[248]Als „voluntaristisch“ bezeichnet Max Weber am anderen Ort „auf dem Boden der freien Eigeninitiative […] geschaffene Organisationen“. Vgl. Weber, Wahlrecht und Demokratie in Deutschland, MWG I/15, S. 364.
x
Lage) imstande sind: die Marktlage unter tatsächlicher Ausschaltung der Marktfreiheit für andere zu beeinflussen. Insbesondere können sie zu diesem Zweck untereinander oder (und eventuell: zugleich) mit typischen Tauschpartnern marktregulierende Vereinbarungen (voluntaristische Monopole und Preiskartelle) schaffen. [249]Lies: kraft ihrer monopolistischen
1. Von Marktlage wird zweckmäßigerweise (nicht: notwendigerweise) nur bei Geldtausch gesprochen, weil nur dann ein einheitlicher Zahlenausdruck möglich ist. Die naturalen „Tauschchancen“ werden besser mit diesem Wort bezeichnet. Marktgängig waren und sind – was hier nicht im einzelnen auszuführen ist – bei Existenz des typischen Geldtauschs die einzelnen Arten von Tauschobjekten in höchst verschiedenem und wechselndem Grade. Generell nach Sorten angebbare Massenproduktions- und -Verbrauchsgegenstände im Höchstmaß, einzigartige Objekte eines Gelegenheitsbegehrs im Mindestmaß, Versorgungsmittel mit langfristiger und wiederholter Ge- und Verbrauchsperiode und Beschaffungsmittel mit langfristiger Verwendungs- und Ertragsperiode, vor allem: land- oder vollends [A 44]forstwirtschaftlich nutzbare Grundstücke in weit geringerem Maß als Güter des Alltagsverbrauchs in genußreifem Zustand, oder Beschaffungsmittel, welche schnellem Verbrauch dienen, oder nur einer einmaligen Verwendung fähig sind oder baldigen Ertrag geben.
2. Der ökonomisch rationale Sinn der Marktregulierungen ist geschichtlich mit Zunahme der formalen Marktfreiheit und der Universalität der Marktgängigkeit im Wachsen gewesen. Die primären Marktregulierungen waren teils traditional und magisch, teils sippenmäßig, teils ständisch, teils militärisch, teils sozialpolitisch, teils endlich durch den Bedarf von Verbandsherrschern bedingt, in jedem Fall aber: beherrscht von Interessen, welche nicht an der Tendenz zum Maximum der rein zweckrationalen marktmäßigen Erwerbs- oder Güterversorgungschancen von Marktinteressenten orientiert waren, oft mit ihm kollidierten. Sie schlossen entweder 1. wie die magischen oder sippenmäßigen oder ständischen Schranken (z. B. magisch: Tabu, sippenmäßig: Erbgut, ständisch: Ritterlehn) bestimmte Objekte von der Marktgängigkeit dauernd oder, wie teuerungspolitische Regulierungen (z. B. für Getreide), zeitweise aus. Oder sie banden ihren Absatz an Vorangebote (an Verwandte, Standesgenossen, Gilde- und Zunftgenossen, Mitbürger) oder Höchstpreise (z. B. Kriegspreisregulierungen) oder umgekehrt Mindestpreise (z. B. ständische Honorartaxen von Magiern, Anwälten, Ärzten). Oder 2. sie schlossen gewisse Kategorien von [250]Personen (Adel, Bauern, unter Umständen Handwerker) von der Beteiligung an marktmäßigem Erwerb überhaupt oder für bestimmte Objekte aus. Oder 3. sie schränkten durch Konsumregulierung (ständische Verbrauchsordnungen, kriegswirtschaftliche oder teuerungspolitische Rationierungen) die Marktfreiheit der Verbraucher ein. Oder 4. sie schränkten aus ständischen (z. B. bei den freien Berufen) oder konsumpolitischen, erwerbspolitischen, sozialpolitischen („Nahrungspolitik der Zünfte“)
10
Gründen die Marktfreiheit der konkurrierenden Erwerbenden ein. Oder 5. sie behielten der politischen Gewalt (fürstliche Monopole) oder den von ihr Konzessionierten (typisch bei den frühkapitalistischen Monopolisten) die Ausnutzung bestimmter ökonomischer Chancen vor. Von diesen war die fünfte Kategorie von Marktregulierungen am meisten, die erste am wenigsten marktrational, d. h. der Orientierung des Wirtschaftens der einzelnen am Verkauf und Einkauf von Gütern auf dem Markt interessierten Schichten an Marktlagen förderlich, die andern[250]Die auf der Zielsetzung beruhende Politik der Zünfte, daß alle Vollmeister die für den Unterhalt eines Handwerkshaushalts nötigen Erwerbseinkünfte erzielen sollten. Vgl. auch unten, S. 313. Insbesondere Werner Sombart hat behauptet, daß die „Idee der Nahrung“ aller vorkapitalistischen Wirtschaftsgestaltung ihr Gepräge gegeben habe. Vgl. Sombart, Der moderne Kapitalismus I2, S. 34 f.
y
, in absteigender Reihenfolge, hinderlich. Marktfreiheitsinteressenten waren diesen Marktregulierungen gegenüber alle jene Tauschreflektanten, welche am größtmöglichen Umfang der Marktgängigkeit der Güter, sei es als Verbrauchs-, sei es als Absatzinteressenten ein Interesse haben mußten. Voluntaristische Marktregulierungen traten zuerst und dauernd weitaus am stärksten auf seiten der Erwerbsinteressenten auf. Sie konnten im Dienst von monopolistischen Interessen sowohl nur 1. die Absatz- und Eintauschs-Chancen regulieren (typisch: die universell verbreiteten Händlermonopole), als 2. die Transporterwerbschancen (Schiffahrts- und Eisenbahnmonopole), als 3. die Güterherstellung (Produzentenmonopole), als 4. die Kreditgewährung und Finanzierung (bankmäßige Konditions-Monopole) erfassen. Die beiden letzteren bedeuteten am meisten eine Zunahme verbandsmäßiger, jedoch – im Gegensatz zu den primären, irrationalen Marktregulierungen – einer planmäßig an Marktlagen orientierten Regulierung der Wirtschaft. Die voluntaristischen Marktregulierungen gingen naturgemäß regelmäßig von solchen Interessenten aus, deren prominente tatsächliche Verfügungsgewalt über Beschaffungsmittel ihnen monopolistische Ausbeutung der formalen Marktfreiheit gestattete. Voluntaristische Verbände der Konsuminteressenten (Konsumvereine, Einkaufsgenossenschaften) gingen dagegen regelmäßig von ökonomisch schwachen Interessenten aus und ver[251]mochten daher zwar Kostenersparnisse für die Beteiligten, eine wirksame Marktregulierung aber nur vereinzelt und lokal begrenzt durchzusetzen. [250]Zu ergänzen wäre: waren
§ 9. Als formale Rationalität eines Wirtschaftens soll hier das Maß der ihm technisch möglichen und von ihm wirklich angewendeten Rechnung bezeichnet werden. Als materiale Rationalität soll dagegen bezeichnet werden der Grad, in welchem die jeweilige Versorgung von gegebenen Menschengruppen (gleichviel wie abgegrenzter Art) mit Gütern durch die Art eines wirtschaftlich orientierten sozialen Handelns sich gestaltet unter dem Gesichtspunkt bestimmter (wie immer gearteter) wertender Postulate, unter welchen sie betrachtet wurde, wird oder werden könnte.
11
Diese sind höchst vieldeutig. [251] Formale und materiale Rationalität stellt Max Weber auch gegenüber in: Weber, Zwischenbetrachtung, Theorie der Stufen und Richtungen religiöser Weltablehnung, MWG I/19, S. 488. Der bezügliche Satz stand noch nicht in der Erstfassung des Textes von 1915.
1. Die vorgeschlagene Art der Bezeichnung (übrigens lediglich eine Präzisierung dessen, was in den Erörterungen über „Sozialisierung“[,] „Geld“- und „Natural“-[A 45]Rechnung als Problem immer wiederkehrt) möchte lediglich der größeren Eindeutigkeit in der sprachgebräuchlichen Verwendung des Wortes „rational“ auf diesem Problemgebiet dienen.
2. Formal „rational“ soll ein Wirtschaften je nach dem Maß heißen, in welchem die jeder rationalen Wirtschaft wesentliche „Vorsorge“ sich in zahlenmäßigen, „rechenhaften“, Überlegungen ausdrücken kann und ausdrückt (zunächst ganz unabhängig davon, wie diese Rechnungen technisch aussehen, ob sie also als Geld- oder als Naturalschätzungen vollzogen werden). Dieser Begriff ist also (wenn auch, wie sich zeigen wird, nur relativ) eindeutig wenigstens in dem Sinn, daß die Geldform das Maximum dieser formalen Rechenhaftigkeit darstellt (natürlich auch dies: ceteris paribus!)[.]
3. Dagegen ist der Begriff der materialen Rationalität durchaus vieldeutig. Er besagt lediglich dies Gemeinsame: daß eben die Betrachtung sich mit der rein formalen (relativ) eindeutig feststellbaren Tatsache: daß zweckrational, mit technisch tunlichst adäquaten Mitteln, gerechnet wird, nicht begnügt, sondern ethische, politische, utilitarische, hedonische, ständische, egalitäre oder irgendwelche anderen Forderungen stellt und daran die Ergebnisse des – sei es auch formal noch so „rationalen“, d. h. rechenhaften – Wirtschaftens wertrational oder material zweckrational bemißt. [252]Der möglichen, in diesem Sinn rationalen, Wertmaßstäbe sind prinzipiell schrankenlos viele, und die unter sich wiederum nicht eindeutigen sozialistischen und kommunistischen, in irgendeinem Grade stets: ethischen und egalitären, Wertmaßstäbe sind selbstverständlich nur eine Gruppe unter dieser Mannigfaltigkeit (ständische Abstufung, Leistung für politische Macht-, insbesondere aktuelle Kriegszwecke und alle denkbaren sonstigen Gesichtspunkte sind in diesem Sinn gleich „material“). – Selbständig, gegenüber auch dieser materialen Kritik des Wirtschaftsergebnisses, ist dagegen überdies eine ethische, asketische, ästhetische Kritik der Wirtschaftsgesinnung sowohl wie der Wirtschaftsmittel möglich, was wohl zu beachten ist. Ihnen allen kann die „bloß formale“ Leistung der Geldrechnung als subaltern oder geradezu als ihren Postulaten feindlich erscheinen (noch ganz abgesehen von den Konsequenzen der spezifisch modernen Rechnungsart). Hier ist nicht eine Entscheidung, sondern nur die Feststellung und Begrenzung dessen, was „formal“ heißen soll, möglich. „Material“ ist hier also auch selbst ein „formaler“, d. h. hier: ein abstrakter[,]
12
Gattungsbegriff. [252]Zum eingefügten Komma vgl. Korrekturfahne K3 im Anhang, unten, S. 629.
§ 10. Rein technisch angesehen, ist Geld das „vollkommenste“ wirtschaftliche Rechnungsmittel, das heißt: das formal rationalste Mittel der Orientierung wirtschaftlichen Handelns.
Geldrechnung, nicht: aktueller Geldgebrauch, ist daher das spezifische Mittel zweckrationaler Beschaffungswirtschaft.
13
Geldrechnung bedeutet aber im vollen Rationalitätsfall primär: Zu Max Webers Begriff „Beschaffung“ vgl. Kap. II, § 4, oben, S. 228 mit Hg.-Anm. 33. In Kap. II, § 32, unten, S. 381 f., spricht Weber sowohl von „Güterherstellung“ als auch von „Güterbeschaffungswirtschaften“.
1. Schätzung aller für einen Beschaffungszweck jetzt oder künftig als benötigt erachteten[,] wirklich oder möglicherweise verfügbaren oder aus fremder Verfügungsgewalt beschaffbaren, in Verlust geratenen oder gefährdeten, Nutzleistungen oder Beschaffungsmittel, und ebenso aller irgendwie relevanten ökonomischen Chancen überhaupt, nach der (aktuellen oder erwarteten) Marktlage;
2. zahlenmäßige Ermittelung a) der Chancen jeder beabsichtigten und b) Nachrechnung des Erfolges jeder vollzogenen Wirtschaftshandlung in Form einer die verschiedenen Möglichkeiten vergleichenden „Kosten-“ und „Ertrags“-Rechnung in [253]Geld und vergleichende Prüfung des geschätzten „Reinertrags“
14
verschiedener möglicher Verhaltungsweisen an der Hand dieser Rechnungen; [253] In Korrekturfahne K3 verbessert Weber „Nutzens“ zu „Reinertrags“ (vgl. Anhang, unten, S. 630).
3. periodischer Vergleich der einer Wirtschaft insgesamt verfügbaren Güter und Chancen mit den bei Beginn der Periode verfügbar gewesenen, beide Male in Geld geschätzt;
4. vorherige Abschätzung und nachträgliche Feststellung derjenigen aus Geld bestehenden oder in Geld schätzbaren Zugänge und Abgänge, welche die Wirtschaft, bei Erhaltung der Geldschätzungssumme ihrer insgesamt verfügbaren Mittel (Nr. 3), die Chance hat, während einer Periode zur Verwendung verfügbar zu haben;
5. die Orientierung der Bedarfsversorgung an diesen Daten (Nr. 1–4) durch Verwendung des (nach Nr. 4) in der Rechnungsperiode verfügbaren Geldes für die begehrten Nutzleistungen nach dem Prinzip des Grenznutzens.
15
Zum Gemeinten vgl. Kap. II, § 4, oben, S. 227 mit Hg.-Anm. 30.
[A 46]Die kontinuierliche Verwendung und Beschaffung (sei es durch Produktion oder Tausch) von Gütern zum Zweck 1. der eignen Versorgung oder 2. zur Erzielung von selbst verwendeten anderen Gütern heißt Haushalt. Seine Grundlage bildet für einen einzelnen oder eine haushaltsmäßig wirtschaftende Gruppe im Rationalitätsfall der Haushaltsplan, welcher aussagt: in welcher Art die vorausgesehenen Bedürfnisse einer Haushaltsperiode (nach Nutzleistungen oder selbst zu verwendenden Beschaffungsmitteln) durch erwartetes Einkommen gedeckt werden sollen.
Einkommen eines Haushalts soll derjenige in Geld geschätzte Betrag von Gütern heißen, welcher ihm
a
[253]A: ihr
16
bei Rechnung nach dem in Nr. 4 angegebenen Prinzip in einer vergangenen Periode [254]bei rationaler Schätzung zur Verfügung gestanden hat, oder mit dessen Verfügbarkeit er In der Druckfassung bezieht sich Weber mit „ihr“ vermutlich auf die „haushaltsmäßig wirtschaftende Gruppe“. Weil aber, wie ebenfalls oben ausgeführt, auch Einzelne einen Haushalt führen können, wurde hier und im folgenden die neutralere Formulierung „ihm“ bzw. „er“ für den Haushalt, sei es ein Einzelner oder eine Gruppe, gewählt. Vgl. auch textkritische Anm. a–d.
b
für eine laufende oder künftige Periode bei rationaler Schätzung rechnen zu können die Chance hat. [254]A: sie
Die Gesamtschätzungssumme der in der Verfügungsgewalt eines Haushalts befindlichen, von ihm
c
zur – normalerweise – dauernden unmittelbaren Benutzung oder zur Erzielung von Einkommen verwendeten Güter (abgeschätzt nach Marktchancen, Nr. 3) heißt: seinA: ihr
d
Vermögen.A: ihr
17
[254] Mit der Einschränkung, daß nur Haushalte Träger von Vermögen sein können, weicht Max Weber vom seinerzeit üblichen Sprachgebrauch ab, dem er auch in seinen nationalökonomischen Vorlesungen noch gefolgt ist. Vgl. Weber, Theoretische Nationalökonomie, MWG III/1, S. 151, und Lexis, Wilhelm, Vermögen, in: WbVW3, Band 2, 1911, S. 1169.
Die Voraussetzung der reinen Geld-Haushalts-Rechnung ist: daß das Einkommen und Vermögen entweder in Geld oder in (prinzipiell) jederzeit durch Abtausch in Geld verwandelbaren, also im absoluten Höchstmaß marktgängigen, Gütern besteht.
Haushalt und (im Rationalitätsfall) Haushaltsplan kennt auch die weiterhin noch zu erörternde Naturalrechnung.
18
Ein einheitliches „Vermögen“ im Sinn der Geldabschätzung kennt sie so wenig wie ein einheitliches (d. h. geldgeschätztes) „Einkommen“. Sie rechnet mit „Besitz“ von Naturalgütern und (bei Beschränkung auf friedlichen Erwerb) konkreten „Einkünften“ Weber verweist auf das unmittelbar Folgende und auf Kap. II, § 12, unten, S. 273 285.
19
aus dem Aufwand von verfügbaren Gütern und Arbeitskräften in Naturalform, die sie unter Abschätzung des Optimums der möglichen Bedarfsdeckung als Mittel dieser verwaltet. Bei fest gegebenen Bedürfnissen ist die Art dieser Verwendung so lange ein relativ einfaches rein technisches Problem, als die Versorgungslage nicht eine genaue rechnerische Feststellung des Optimums des Nutzens der Verwendung von Bedarfsdekkungsmitteln unter Vergleichung sehr heterogener möglicher Verwendungsarten erfordert. Andernfalls treten schon an den [255]einfachen tauschlosen Einzelhaushalt Anforderungen heran, deren (formal exakte) rechnungsmäßige Lösung enge Schranken hat und deren tatsächliche Lösung teils traditional, teils an der Hand sehr grober Schätzungen zu geschehen pflegt, welche freilich bei relativ typischen, übersehbaren, Bedürfnissen und Beschaffungsbedingungen auch völlig ausreichen. Besteht der Besitz aus heterogenen Gütern (wie Zum Unterschied von „Einkommen“ und (naturalwirtschaftlichen) „Einkünften“ vgl. unten, S. 443 f.
e
es im Fall tauschlosen Wirtschaftens der Fall sein muß), so ist eine rechnerische, formal exakte Vergleichung des Besitzes am Beginn und Ende einer Haushaltsperiode ebenso wie eine Vergleichung der Einkünftechancen nur innerhalb der qualitativ gleichen Arten von Gütern möglich. Zusammenstellung zu einem naturalen Gesamtbesitzstand und Auswerfung naturaler Verbrauchs-Deputate, die ohne Minderung dieses Besitzstandes voraussichtlich dauernd verfügbar sind, ist dann typisch. Jede Änderung des Versorgungsstandes (z. B. durch Ernteausfälle) oder der Bedürfnisse bedingt aber neue Dispositionen, da sie die Grenznutzen verschiebt. Unter einfachen und übersehbaren Verhältnissen vollzieht sich die Anpassung leicht. Sonst technisch schwerer als bei reiner Geldrechnung, bei welcher jede Verschiebung der Preischancen (im Prinzip) nur die mit den letzten Geldeinkommenseinheiten zu befriedigenden Grenzbedürfnisse der Dringlichkeitsskala beeinflußt. [255]Klammer fehlt in A.
Bei ganz rationaler (also nicht traditionsgebundener) Naturalrechnung gerät überdies die Grenznutzrechnung, welche bei Verfügung über Geldvermögen und Geldeinkommen relativ einfach – an der Hand der Dringlichkeitsskala der Bedürfnisse
20
– verläuft, in eine starke Komplikation. Während dort als [256]„Grenz“-[A 47]Frage lediglich Mehrarbeit oder: die Befriedigung bzw. Opferung eines Bedürfnisses zugunsten eines (oder mehrerer) anderer auftaucht (denn darin drücken sich im reinen Geldhaushalt letztlich die „Kosten“ aus), findet sie sich hier in die Nötigung versetzt: neben der Dringlichkeitsskala der Bedürfnisse noch zu erwägen: 1. mehrdeutige Verwendbarkeit der Beschaffungsmittel einschließlich des bisherigen Maßes von Gesamtarbeit, also eine je nach der Verwendbarkeit verschiedene (und: wandelbare) Relation zwischen Bedarfsdeckung und Aufwand, also: 2. Maß und Art neuer Arbeit, zu welcher der Haushalter behufs Gewinnung neuer Einkünfte genötigt wäre, und: 3. Art der Verwendung des Sachaufwands im Fall verschiedener in Betracht kommender Güterbeschaffungen. Es ist eine der wichtigsten Angelegenheiten der ökonomischen Theorie, die rational mögliche Art dieser Erwägungen zu analysieren,[255]Im Rahmen seiner Ausführungen zum zweckrationalen Handeln führt Max Weber in Kap. I, oben, S. 176, aus, wie die subjektiven Bedürfnisregungen in eine „Skala ihrer von ihm [dem Handelnden] bewußt abgewogenen Dringlichkeit“ gebracht werden und danach das Handeln so orientiert wird, „daß sie in dieser Reihenfolge nach Möglichkeit befriedigt werden (Prinzip des ‚Grenznutzens‘).“ Das Konzept der Dringlichkeitsskala bzw. Bedürfnisskala wurde entwickelt, um dem gegen die Grenznutzentheorie erhobenen Einwand zu begegnen, daß das Bedürfnis resp. der Nutzen nicht direkt meßbar seien. Wohl aber sollen sich Intensitätsgrößen gegeneinander abschätzen lassen. Vgl. Wieser, Theorie, S. 149 ff. und 215 f.
21
der Wirtschaftsgeschichte: durch den Verlauf der Geschichtsepochen hindurch zu verfolgen, in welcher Art tatsächlich sich das naturale Haushalten damit abgefunden hat. Im wesentlichen läßt sich sagen: 1. daß der formale Rationalitätsgrad tatsächlich (im allgemeinen) das faktisch mögliche (vollends aber: das theoretisch zu postulierende) Niveau nicht erreichte, daß vielmehr die Naturalhaushaltsrechnungen in ihrer gewaltigen Mehrzahl notgedrungen stets weitgehend traditionsgebunden blieben, 2. also: den Großhaushaltungen, gerade weil die Steigerung und Raffinierung von Alltagsbedürfnissen unterblieb, eine außeralltägliche (vor allem: künstlerische) Verwertung ihrer [257]Überschußversorgtheit nahelag (Grundlage der künstlerischen, stilgebundenen Kultur naturalwirtschaftlicher Zeitalter). [256]Die von Weber ins Auge gefaßte Theorie ist die auf der Hypothese sinkenden Grenznutzens beruhende, im deutschen Sprachraum mit den Namen Menger, Wieser und Böhm-Bawerk verbundene neue Mikroökonomie. Sie war keineswegs die seinerzeit in Deutschland herrschende Theorie. Weber hatte sich, soweit es um die „abstrakte Theorie“ ging, schon in seinen Vorlesungen zur ‚Theoretischen Nationalökonomie‘ zu ihr bekannt. Dort hat er auch die Erwägungen in einer isolierten Wirtschaft ohne inneren und äußeren Tauschverkehr und ohne Geld skizziert (vgl. Weber, Die wirtschaftliche Wertschätzung in der isolierten Wirtschaft, in: ders., Erstes Buch, § 2. Die Wirtschaft und ihre elementaren Erscheinungen, MWG III/1, S. 127–131). In seinem Beitrag zum GdS hat Friedrich von Wieser der „Theorie der einfachen Wirtschaft“ eine umfassende Darstellung gewidmet (vgl. Wieser, Theorie, S. 17–108). Weber und Wieser meinen, daß sich die Überlegungen eines Robinson und eines „freien sozialistischen Zukunftsstaates“ (Wieser, ebd., S. 65) bzw. einer „etwaige[n] communistische[n] Zukunftsgesellschaft“ (Weber, MWG III/1, S. 127) nicht unterscheiden würden.
1. Zum „Vermögen“ gehören natürlich nicht nur Sachgüter. Sondern: alle Chancen, über welche eine[,] sei es durch Sitte, Interessenlage, Konvention oder Recht oder sonstwie verläßlich gesicherte[,] Verfügungsgewalt besteht (auch „Kundschaft“ eines Erwerbsbetriebs gehört – sei dies ein ärztlicher, anwältlicher oder Detaillisten-Betrieb – zum „Vermögen“ des Inhabers, wenn sie aus gleichviel welchen Gründen stabil ist: im Fall rechtlicher Appropriation kann sie ja nach der Definition im Kap. I § 10 „Eigentum“ sein).
22
[257]Kap. I, § 10, oben, S. 199.
2. Die Geldrechnung ohne aktuellen Geldgebrauch oder doch mit Einschränkung desselben auf in natura unausgleichbare Überschüsse der beiderseitigen Tauschgütermengen findet man typisch in ägyptischen und babylonischen Urkunden, die Geldrechnung als Bemessung einer Naturalleistung in der z. B. sowohl im Kodex Hammurabi
23
wie im vulgärrömischenAuf die 1901/02 aufgefundene Stele mit Rechtsaufzeichnungen des babylonischen Königs Hammurabi geht Max Weber mehrfach, u. a. in seinem Beitrag „Agrarverhältnisse im Altertum“ ein (vgl. Weber, Agrarverhältnisse3, MWG I/6, insbes. S. 395 mit Hg.-Anm. 32 zu Webers Quelle).
24
und frühmittelalterlichen Recht typischen Erlaubnis an den Schuldner, Als Vulgarrecht wird das gegenüber dem klassischen römischen Recht stark vereinfachte spätantike west-römische Recht des 3.–5. Jahrhunderts bezeichnet.
f
den Geldrechnungsbetrag zu leisten: „in quo potuerit“.[257]A: Schuldner:
25
(Die Umrechnung kann dabei nur auf der Basis traditionaler oder oktroyierter Binnenpreise vollzogen worden sein.) lat., „worin er kann“; gemeint ist: in welcher Form der Schuldner leisten kann.
3. Im übrigen enthalten die Darlegungen nur Altbekanntes im Interesse einer eindeutigen Feststellung des Begriffs des rationalen „Haushalts“ gegenüber dem gleich zu erörternden
26
gegensätzlichen Begriff der rationalen Erwerbswirtschaft. Zweck ist die ausdrückliche Feststellung: daß beide in rationaler Form möglich sind, „Bedarfsdeckung“ nicht etwas, im Rationalitätsfall, „Primitiveres“ ist als: „Erwerb“, „Vermögen“ nicht eine notwendig „primitivere“ Kategorie als: „Kapital“, oder „Einkommen“ als: „Gewinn“. Geschichtlich und hingesehen auf die in der Vergangenheit vorwaltende Form der Betrachtung wirtschaftlicher Dinge geht allerdings, und selbstverständlich, „Haushalten“ voran. Im folgenden § 11, unten S. 259, spricht Max Weber nicht von „rationaler Erwerbswirtschaft“, wohl aber vom „rationalen wirtschaftlichen Erwerben“.
[258]4. Wer Träger des „Haushalts“ ist, ist gleichgültig. Ein staatlicher „Haushaltsplan“ und das „Budget“ eines Arbeiters fallen beide unter die gleiche Kategorie.
5. Haushalten und Erwerben sind nicht exklusive Alternativen. Der Betrieb eines „Konsumvereins“ z. B. steht im Dienst (normalerweise) des Haushaltens, ist aber kein Haushalts-, sondern nach der Form seines Gebarens ein Erwerbsbetrieb ohne materialen Erwerbszweck. Haushalten und Erwerben können im Handeln des einzelnen derart ineinandergreifen (und dies ist der in der Vergangenheit typische Fall), daß nur der Schlußakt (Absatz hier, Verzehr dort) den Ausschlag für den Sinn des Vorgangs gibt (bei Kleinbauern insbesondere typisch). Der haushaltsmäßige Tausch (Konsumeintausch, Überschuß-Abtausch) ist Bestandteil des Haushalts. Ein Haushalt (eines Fürsten oder Grundherren) kann Erwerbsbetriebe im Sinn des folgenden §
27
einschließen und hat dies in typischer Art früher getan: ganze Industrien sind aus solchen heterokephalen und heteronomen „Nebenbetrieben“ zur Verwertung von eignen Forst- und Feldprodukten von Grundherren, Klöstern, [A 48] Fürsten entstanden. Allerhand „Betriebe“ bilden schon jetzt den Bestandteil namentlich kommunaler, aber auch staatlicher, Haushaltungen. Zum „Einkommen“ gehören natürlich bei rationaler Rechnung nur die für den Haushalt verfügbaren „Rein-Erträge“ dieser Betriebe. Ebenso können umgekehrt Erwerbsbetriebe sich, z. B. für die Ernährung ihrer Sklaven oder Lohnarbeiter, fragmentarische heteronome „Haushaltungen“ („Wohlfahrtseinrichtungen“, Wohnungen, Küchen) angliedern. „Rein-Erträge“ sind (Nr. 2) Geldüberschüsse abzüglich aller Geldkosten.[258]Kap. II, § 11, unten.
28
„Nr. 2“ bezieht sich auf Ziffer 2 in Kap. II, § 10, oben, S. 253. Die Definition von „Rein-Erträgen“ ist von Weber eigenhändig in die Korrekturfahnen eingefügt worden (vgl. Anhang, unten, S. 634). Inhaltlich ist sie bedenklich: Der Kostenabzug muß eigentlich erfolgt sein, bevor von einem Überschuß gesprochen werden kann.
6. Auf die Bedeutung der Naturalrechnung für die allgemeine Kulturentwicklung konnte hier nur mit den ersten Andeutungen eingegangen werden.
§ 11. Erwerben soll ein an den Chancen der (einmaligen oder regelmäßig wiederkehrenden: kontinuierlichen) Gewinnung von neuer Verfügungsgewalt über Güter orientiertes Verhalten, Erwerbstätigkeit die an Chancen des Erwerbes mitorientierte Tätigkeit, wirtschaftliches Erwerben ein an friedlichen Chancen orientiertes, marktmäßiges Erwerben ein an Marktlagen orien[259]tiertes, Erwerbsmittel solche Güter und Chancen, welche dem wirtschaftlichen Erwerben dienstbar gemacht werden, Erwerbstausch ein an Marktlagen zu Erwerbszwecken orientierter Ab- oder Eintausch im Gegensatz zum Ab- und Eintausch für Bedarfsdeckungszwecke (haushaltsmäßigem Tausch), Erwerbskredit der zur Erlangung der Verfügungsgewalt über Erwerbsmittel gegebene und genommene Kredit heißen.
Dem rationalen wirtschaftlichen Erwerben ist zugehörig eine besondre Form der Geldrechnung: die Kapitalrechnung.
29
Kapitalrechnung ist die Schätzung und Kontrolle von Erwerbschancen und -erfolgen durch Vergleichung des Geldschätzungsbetrages einerseits der sämtlichen Erwerbsgüter (in Natur oder Geld) bei Beginn und andererseits der (noch vorhandenen und neu beschafften) Erwerbsgüter bei Abschluß des einzelnen Erwerbsunternehmens oder, im Fall eines kontinuierlichen Erwerbsbetriebes: einer Rechnungsperiode, durch Anfangs- bzw. Abschluß-Bilanz. Kapital heißt die zum Zweck der Bilanzierung bei Kapitalrechnung festgestellte Geldschätzungssumme der für die Zwecke des Unternehmens verfügbaren Erwerbsmittel,[259]Der in diesem Kapitel 54 mal verwendete Begriff „Kapitalrechnung“ erscheint im Werk Max Webers sonst nur in der 1919 verfaßten „Vorbemerkung“ zu den „Gesammelten Aufsätzen zur Religionssoziologie“ und in den Aufzeichnungen zu seiner Vorlesung „Abriß der universalen Sozial- und Wirtschaftsgeschichte“ (vgl. Weber, Vorbemerkung, GARS I, S. 4 f. (MWG I/18) und Weber, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, MWG III/6, S. 86 f. 89, 228, 248, 301, 318 f., 322 f.). Der Begriff war zu Webers Zeit wenig gebräuchlich. In Lehrbüchern des betrieblichen Rechnungswesens betraf er, wenn er überhaupt gebraucht wurde, recht Verschiedenes: die Erstellung von Inventaren und ihren Vergleich, die Buchführung im Ganzen, die Bilanz, spezielle Abschluß-(Kapital-)konten bei der Bilanzierung u. a. Friedrich von Wieser handelt in seiner „Theorie der gesellschaftlichen Wirtschaft“ unter der Kapitelüberschrift „Die Kapitalrechnung“ die Ermittlung des Wertes der Kapitalgüter ab und meint, es gehöre „heute zur Ordnung jeder einzelnen Unternehmung […], genaue Kapitalrechnung zu führen“ (vgl. Wieser, Theorie, S. 224–229, Zitat: S. 224). Eine große Rolle spielt der Begriff im Werk Robert Liefmanns. Kapitalrechnung ist hier Definitionsmerkmal für den Begriff Unternehmung, damit verbunden der „kapitalistischen Epoche“ und des Kapitalismus. Vgl. Liefmann, Robert, Kapital und Kapitalismus, in: Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft, Band 72, 1916, S. 328–366, und Band 73, 1917, S. 45–100, bes. S. 62 und 93; Liefmann, Grundsätze I, bes. S. 588–600, und ders., Grundsätze der Volkswirtschaftslehre, Band II: Grundlagen des Tauschverkehrs. – Stuttgart und Berlin: Deutsche Verlags-Anstalt 1919, bes. S. 562–566.
30
Ge[260]winn bzw. Verlust der durch die Abschlußbilanz ermittelte Mehr- bzw. Minderbetrag der Schätzungssumme gegenüber derjenigen der Anfangsbilanz, Kapitalrisiko die geschätzte Chance bilanzmäßigen Verlustes, wirtschaftliches Unternehmen ein an Kapitalrechnung autonom orientierbares Handeln.Max Weber erläutert seinen, von dem in der Nationalökonomie seiner Zeit herrschenden Sprachgebrauch abweichenden Kapitalbegriff unten, S. 264 f. mit Hg.-Anm. 41.
31
Diese Orientierung erfolgt durch Kalkulation: Vorkalkulation des bei einer zu treffenden Maßnahme zu erwartenden Risikos und Gewinns, Nachkalkulation zur Kontrolle des tatsächlich eingetretenen Gewinn- oder Verlust-Erfolges. Rentabilität bedeutet (im Rationalitätsfall) 1. den, als möglich und durch die Maßregeln des Unternehmers zu erstrebenden[260]In den Korrekturfahnen K2 und K3 ist von einem an Kapitalrechnung „orientierte[n]“ – und noch nicht von einem „orientierbare[n]“ – Handeln die Rede (vgl. Anhang, unten, S. 635). Wie es zu der sachlich bemerkenswerten Änderung kam, ist unbekannt. Die geänderte Terminologie könnte eine Erklärung in einer späteren Bemerkung Max Webers finden: „Entscheidend ist also nicht die empirische Tatsache, sondern die prinzipielle Möglichkeit der materialen Kapitalrechnung.“ (vgl. unten, S. 365).
g
, durch Vorkalkulation errechneten –, 2. den laut Nachkalkulation tatsächlich erzielten und ohne Schädigung künftiger Rentabilitätschancen für den Haushalt des (oder der) Unternehmer verfügbaren Gewinn einer Periode, ausgedrückt üblicherweise im Quotienten- (heute: Prozent-) Verhältnis zum bilanzmäßigen Anfangskapital.[260]A: erstrebend
32
Der Bezug des Gewinns auf das „Anfangskapital“ (ohne Unterscheidung von Eigen- und Fremdkapital) deutet darauf hin, daß Max Weber das im Sinn hat, was der von ihm unten, S. 264, als Autor einschlägiger Texte genannte Friedrich Leitner als Rentabilität der Unternehmung, im Gegensatz zur Rentabilität des Unternehmerkapitals bezeichnet. Vgl. Leitner, Betriebslehre, S. 104.
Kapitalrechnungsmäßige Unternehmungen können an Markterwerbschancen oder an der Ausnutzung anderer – z. B. durch Gewaltverhältnisse bedingter (Steuerpacht-, Amtskauf-)
33
– Erwerbschancen orientiert sein. Zu Steuerpacht und Amtskauf vgl. unten, S. 379, sowie S. 444 f., und die dortigen Erläuterungen.
Alle Einzelmaßnahmen rationaler Unternehmen werden durch Kalkulation am geschätzten Rentabilitätserfolg orientiert.
34
Kapitalrechnung setzt bei Markterwerb voraus: 1. daß für [261]die Güter, welche der Erwerbsbetrieb beschafft, hinlänglich breite und gesicherte, durch Kalkulation abschätzbare, Absatzchancen bestehen, also (normalerweise): Marktgängigkeit, 2. daß ebenso die Erwerbsmittel: sachliche Beschaffungsmittel und Arbeitsleistungen, hinlänglich sicher und mit durch Kalkulation errechenbaren „Kosten“ auf dem Markt zu erwerben sind, endlich: 3. daß auch die technischen und rechtlichen Bedingungen der mit den Beschaffungsmitteln bis zur Absatzreife vorzunehmenden Maßregeln (Transport, Umformung, Lagerung usw.) prinzipiell berechenbare (Geld-)Kosten entstehen lassen. – Die außer[A 49]ordentliche Bedeutung optimaler Berechenbarkeit als Grundlage optimaler Kapitalrechnung wird uns in der Erörterung der soziologischen Bedingungen der Wirtschaft stets neu entgegentreten.In Korrekturfahne K2 heißt es statt „rationaler Unternehmen“ noch: „des Erwerbsunternehmens“ (vgl. Anhang, unten, S. 636). Nicht in Hinblick auf die Definition eines Idealtyps, sondern hinsichtlich der tatsächlichen Verbreitung systematischen Kalkulie[261]rens hat Weber an anderer Stelle ausgeführt: „Denn […] kalkuliert wird heute auch in der Industrie nur soweit, als es der Unternehmer für notwendig hält, und das hängt teils von äußeren Situationen, teils von Traditionen ab.“ Vgl. Weber, Probleme der Arbeiterpsychologie, MWG I/11, S. 409–425, Zitat: S. 418.
35
Weit entfernt, daß hier nur wirtschaftliche Momente in Betracht kämen, werden wir sehen, daß äußere und innere Obstruktionen verschiedenster Art an dem Umstand schuld sind, daß Kapitalrechnung als eine Grundform der Wirtschaftsrechnung nur im Okzident entstand. Max Weber verweist auf für später Geplantes (vgl. dazu den Anhang zum Editorischen Bericht, oben, S. 111 f.). In Kapitel II findet sich Entsprechendes noch nicht.
Die Kapitalrechnung und Kalkulation des Marktunternehmers kennt, im Gegensatz zur Haushaltsrechnung, keine Orientierung am „Grenznutzen“, sondern an der Rentabilität. Deren Chancen sind ihrerseits letztlich von den Einkommensverhältnissen und durch diese von den Grenznutzen-Konstellationen der verfügbaren Geldeinkommen bei den letzten Konsumenten der genußreifen Güter (an deren „Kaufkraft“ für Waren der betreffenden Art, wie man zu sagen pflegt) bedingt. Technisch aber sind Erwerbsbetriebsrechnung und Haushaltsrechnung ebenso grundverschieden, wie Bedarfsdeckung und Erwerb, denen sie dienen. Für die ökonomische Theorie ist der Grenzkonsument der Lenker der Richtung der Produktion. Tatsächlich, nach der Machtlage, ist dies für die Gegenwart nur bedingt richtig, da weitgehend der „Unternehmer“ die Bedürfnisse des [262]Konsumenten „weckt“ und „dirigiert“, – wenn dieser kaufen kann.
36
[262]Schon in seinen frühen Vorlesungen hat Max Weber dargelegt, daß zu den nicht hinterfragten Grundannahmen der Grenznutzentheorie der „gegebene Bedürfnisstand“ gehöre (vgl. u. a. Weber, Erstes Buch. Die begrifflichen Grundlagen der Volkswirtschaftslehre, MWG III/1, S. 128). Die Art der Umgestaltung der Bedürfnisstände zu erörtern, bezeichnete Weber als „die fundamentale Aufgabe der historischen Betrachtung.“ (Ebd., S. 141).
Jede rationale Geldrechnung und insbesondere daher jede Kapitalrechnung ist bei Markterwerb orientiert an Preischancen, die sich durch Interessenkampf (Preis- und Konkurrenzkampf) und Interessenkompromiß auf dem Markt bilden. Dies tritt in der Rentabilitätsrechnung besonders plastisch bei der technisch (bisher) höchst entwickelten Form der Buchführung (der sog. „doppelten“ Buchführung) darin hervor: daß durch ein Konten-System
37
die Fiktion von Tauschvorgängen zwischen den einzelnen Betriebsabteilungen oder gesonderten Rechnungsposten zugrunde gelegt wird, welches technisch am vollkommensten die Kontrolle der Rentabilität jeder einzelnen Maßregel gestattet. Die Kapitalrechnung in ihrer formal rationalsten Gestalt setzt daher den Kampf des Menschen mit dem Menschen voraus. Und zwar unter einer weiteren sehr besondersartigen Vorbedingung. Für keine Wirtschaft kann subjektiv vorhandene „Bedarfsempfindung“ gleich effektivem, das heißt: für die Deckung durch Güterbeschaffung in Rechnung zu stellendemDas Prinzip der in Ansätzen schon früher praktizierten doppelten Buchführung wurde erstmals in systematischer Form von dem Mathematiker Luca Pacioli (1445–1509) beschrieben. Es erfordert die Aufzeichnung aller in Geld bewerteten Geschäftsvorfälle in mindestens zwei Büchern bzw. Konten, die jeweils „belastet“ (debitiert) oder „entlastet“ (kreditiert) werden. In der modernen Buchführungslehre bedeutet es aber auch, daß „man neben den Konten für sämtliche Vermögensbestandteile noch die Konten über den Bestand, die Zu- und Abnahme des reinen Vermögens einführt.“ Vgl. Schär, Johann Friedrich, Einfache und doppelte Buchhaltung (Maier-Rothschild Bibliothek, Band 6/7), 4. Aufl. – Berlin: Verlag für Sprach- und Handelswissenschaft S. Simon 1909, S. 87.
h
, Bedarf sein. Denn ob jene subjektive Regung befriedigt werden kann, hängt von der Dringlichkeitsskala einerseits, den (vorhandenen, oder, in aller Regel, dem Schwerpunkt nach: erst zu beschaffenden) zur Deckung schätzungsweise verfügbaren Gütern andrer[263]seits ab. Die Deckung bleibt versagt, wenn Nutzleistungen für diese Bedarfsdeckung nach Deckung der an Dringlichkeit vorgehenden nicht vorhanden und gar nicht oder nur unter solchen Opfern an Arbeitskraft oder Sachgütern zu beschaffen wären, daß künftige, aber schon in ihrer Gegenwartsschätzung dringlichere Bedürfnisse leiden würden. So in jeder Konsumwirtschaft, auch einer kommunistischen. [262]A: stellenden
In einer Wirtschaft mit Kapitalrechnung, also: mit Appropriation der Beschaffungsmittel an Einzelwirtschaften, also: mit „Eigentum“ (s. Kap. I § 10)[,]
38
bedeutet dies Abhängigkeit der Rentabilität von den Preisen, welche die „Konsumenten“ (nach dem Grenznutzen des Geldes gemäß ihrem Einkommen) zahlen können und wollen: es kann nur für diejenigen Konsumenten rentabel produziert werden, welche (nach eben jenem Prinzip) mit dem entsprechenden Einkommen ausgestattet sind. Nicht nur wenn dringlichere (eigne) Bedürfnisse, sondern auch wenn stärkere (fremde) Kaufkraft (zu Bedürfnissen aller Art) vorgeht, bleibt die Bedarfsdeckung aus. Die Voraussetzung des Kampfes des Menschen mit dem Menschen auf dem Markt als Bedingung der Existenz rationaler Geldrechnung setzt also weiter auch die entscheidende Beeinflussung des Resultates durch die Überbietungsmöglichkeiten reichlicher mit Geldeinkommen versorgter Konsumenten und die Unterbietungsmöglichkeit vorteilhafter für die Güterbeschaffung ausgestatteter – insbesondere: mit Verfügungsgewalt über be[A 50]schaffungswichtige Güter oder Geld ausgestatteter – Produzenten absolut voraus. Insbesondere setzt sie effektive – nicht konventionell zu irgendwelchen rein technischen Zwecken fingierte – Preise und also effektives, als begehrtes Tauschmittel umlaufendes Geld voraus (nicht bloße Zeichen für technische Betriebsabrechnungen). Die Orientierung an Geldpreischancen und Rentabilität bedingt also:[263]Kap. I, § 10, oben, S. 199.
i
1. daß die Unterschiede der Ausstattung der einzelnen Tauschreflektanten mit Besitz an Geld oder an spezifisch markt[264]gängigen Gütern maßgebend werden[263]Doppelpunkt fehlt in A.
j
für die Richtung der Güterbeschaffung, soweit sie erwerbsbetriebsmäßig erfolgt: indem nur der „kaufkräftige“ Bedarf befriedigt wird und werden kann. Sie bedingt also: 2. daß die Frage, welcher Bedarf durch die Güterbeschaffung gedeckt wird, durchaus abhängig wird von der Rentabilität der Güterbeschaffung, welche ihrerseits zwar formal eine rationale Kategorie ist, aber eben deshalb materialen Postulaten gegenüber sich indifferent verhält, falls diese nicht in Form von hinlänglicher Kaufkraft auf dem Markt zu erscheinen fähig sind. [264]A: wird
Kapitalgüter (im Gegensatz zu Besitzobjekten oder Vermögensteilen) sollen alle solche Güter heißen, über welche und solange über sie unter Orientierung an einer Kapitalrechnung verfügt wird.
39
Kapitalzins soll – im Gegensatz zum Leihezins der verschiedenen möglichen Arten – 1. die in einer Rentabilitätsrechnung den sachlichen Erwerbsmitteln als normal angerechnete Mindest-Rentabilitätschance, – 2. der Zins, zu welchem Erwerbsbetriebe Geld oder Kapitalgüter beschaffen, heißen. [264]Max Webers Begriff „Kapitalgut“ darf nicht verwechselt werden mit dem, was seinerzeit in der herrschenden Lehre unter „Kapital im volkswirtschaftlichen Sinne“ verstanden wurde, nämlich „produzierte Produktionsmittel“. Vgl. Böhm-Bawerk, Eugen von, Kapital, in: HdStW3, Band 5, 1910, S. 777 f.; Lexis, Wilhelm, Kapital, in: WbVW3, Band 2, 1911, S. 14–16. Weder muß das Kapitalgut Produktionsmittel noch muß es produziert sein. Nach Weber können auch Geld sowie Grund und Boden Kapitalgüter sein, vgl. unten, S. 267 zu Geld und S. 378 zu Boden.
Die Darstellung enthält nur Selbstverständlichkeiten in einer etwas spezifischeren Fassung. Für das technische Wesen der Kapitalrechnung sind die üblichen, zum Teil vortrefflichen, Darstellungen der Kalkulationslehre (Leitner, Schär usw.)
40
zu vergleichen. Gemeint sind: Leitner, Selbstkosten-Berechnung; Leitner, Grundriß I und II; Leitner, Betriebslehre; sowie Schär, Buchhaltung. Friedrich Leitner und Johann Friedrich Schär waren die führenden Autoritäten im deutschen Sprachraum. Der Begriff „Kapitalrechnung“ kommt in ihren Schriften nur selten und nie in der von Weber oben, S. 259, geprägten Form vor. – Im kaufmännischen Sprachgebrauch der Zeit bedeutete „Kalkulation“ die Ermittlung der Selbstkosten eines Erzeugnisses und unter Umständen auch die Abschätzung des zu erzielenden Preises. Max Webers oben, S. 260, definierter Begriff „Kalkulation“ geht erheblich weiter. Er bezieht sich auf die Abschätzung von Erfolg und Risiken von Entscheidungen aller Art.
1. Der Kapitalbegriff ist hier streng privatwirtschaftlich und „buchmäßig“ gefaßt, wie dies zweckmäßigerweise zu geschehen hat. Mit dem übli[265]chen Sprachgebrauch kollidiert diese Terminologie weit weniger als mit dem leider mehrfach wissenschaftlich üblich gewesenen, freilich in sich bei weitem nicht einheitlichen.
41
Um den jetzt zunehmend wieder wissenschaftlich benutzten streng privatwirtschaftlichen Sprachgebrauch[265]Wie Max Weber im Folgenden anhand von Beispielen aus dem Wortschatz der Praktiker erläutert, entspricht sein oben, S. 259 f., definierter Kapitalbegriff dem Sprachgebrauch der Kaufleute. Im Sinne der seinerzeitigen Unterscheidung von Volks- und Privatwirtschaftslehre ist er „privatwirtschaftlich“. „Buchmäßig“ ist er insofern, als in der Buchhaltung und Bilanz von Unternehmen der Begriff Kapital ausschließlich im Sinne von Geldwertsummen verwendet wird. – In der Volkswirtschaftslehre „wissenschaftlich üblich“, ja herrschend, war zu Webers Zeit der von Eugen von Böhm-Bawerk geprägte Kapitalbegriff als „produziertes Produktionsmittel“. Zu Kapital im volkswirtschaftlichen und privatwirtschaftlichen Sinn vgl. Lexis, Wilhelm, Kapital, in: WbVW3, Band 2, 1911, S. 14–16. Zum „Sprachbegriff des Kapitals“ im Unterschied zum „wissenschaftlichen“ vgl. auch Wieser, Theorie, S. 331 ff.
42
in seiner Verwendbarkeit zu erproben, braucht man nur etwa sich folgende einfache Fragen zu stellen: Was bedeutet es, wenn 1. eine Aktiengesellschaft ein „Grundkapital“ von 1 Million hat, wenn 2. dies „herabgesetzt“ wird, wenn 3. die Gesetze über das Grundkapital Vorschriften machen und etwa angeben: was und wie etwas darauf „eingebracht“ werden darf?Unter den anerkannten Theoretikern war es vor allem Joseph Schumpeter, der sich hinsichtlich des Begriffs Kapital ebenfalls auf den Sprachgebrauch des täglichen Lebens berufen hat, allerdings in einem anderen Sinne als Weber. Vgl. Schumpeter, Joseph, Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung. – Leipzig: Duncker & Humblot 1912, S. 236; ders., Der heutige Stand der Diskussion. Nachtrag zu: Böhm-Bawerk, Eugen von, Kapital, in: HdStW4, Band 5, 1923, S. 582–584.
43
Es bedeutet, daß (zu 1) bei der Gewinnverteilung so verfahren wird, daß erst derjenige durch Inventur und ordnungsmäßige Geldabschätzung ermittelte Gesamtmehrbetrag der „Aktiva“ über die „Passiva“, der über 1 Million beträgt, als „Gewinn“ gebucht und an die Beteiligten zur beliebigen Verwendung verteilt werden darf (bei einem Einzelunternehmen: daß erst dieser Überschußbetrag für den Haushalt verbraucht werden darf), daß (zu 2) bei starken Verlusten nicht gewartet werden soll, bis durch Gewinste und deren Aufspeicherung, vielleicht nach langen Jahren, wieder ein Gesamtmehrbetrag von mehr als 1 Million errechnet wird, sondern schon bei einem niedrigeren Gesamtmehrbetrag „Gewinn“ verteilt werden kann: [266]dazu muß eben das „Kapital“ herabgesetzt werden, und dies ist der Zweck der Operation,Die die Aktiengesellschaft in Deutschland betreffenden Normen enthielt das Handelsgesetzbuch vom 10. Mai 1897. Als Grundkapital bezeichnet das Gesetz das in einer Geldsumme ausgedrückte Einlagekapital der Aktiengesellschaft. Es wird von den Gründern oder – bei späteren Kapitalerhöhungen – von den jeweiligen und auch von neuen Aktionären „eingebracht“. Das Grundkapital ist die öffentlich versprochene Kreditbasis der Gesellschaft. Die Erlangung des Grundkapitals in der Gründungsphase und dessen Erhaltung werden durch eingehende Vorschriften über Gründerverantwortlichkeit und Haftung aus Erwerb der Anteile sowie durch Normen für die Erstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung geregelt. Vgl. Ring, V., Aktiengesellschaften (Aktienrecht in Deutschland), in: HdStW3, Band 1, 1909, S. 256–274.
44
– 3. der Zweck von Vorschriften über die Art, wie das Grundkapital durch Einbringung „gedeckt“ und wann und wie es „herabgesetzt“ oder „erhöht“ werden darf, ist: den Gläubigern und Aktienerwerbern die Garantie zu geben, daß die Gewinnverteilung nach den Regeln der rationalen Betriebsrechnung „richtig“ erfolgt: so also, daß a) die Rentabilität nachhaltig bleibt, b) sie nicht die Haftobjekte der Gläubiger schmälert. Die Vorschriften über die „Einbringung“ sind sämtlich Vorschriften über die „Anrechnung“ von Objekten als „Kapital“.[266]Eine von einer qualifizierten Mehrheit der Aktionäre zu beschließende Herabsetzung des Grundkapitals ist entweder eine nominelle oder eine effektive. Die nominelle dient dem bilanziellen Ausgleich von Verlusten. Die effektive erfolgt zum Zwecke der Kapitalrückzahlung an die Aktionäre oder der Umwandlung von Grundkapital in offene Rücklagen.
45
– 4. Was bedeutet es, wenn gesagt wird: „das Kapital wendet sich anderen Anlagen zu“ (infolge Unrentabilität)? Entweder ist hier „Vermögen“ gemeint.Max Weber bezieht sich u. a. auf die §§ 186 und 279 des Handelsgesetzbuchs von 1897, in denen die Einbringung von Wirtschaftsgütern im Fall der Gründung und der Kapitalerhöhung einer Aktiengesellschaft geregelt war.
46
Denn „Anlegen“ ist eine Kategorie der Vermögensverwaltung, nicht des Erwerbsbetriebs. Oder (selten) es heißt: daß Kapitalgüter dieser Eigenschaft teils durch Veräußerung der Bestände als Alteisen und Ramschware entkleidet werden, teils anderweit sie neu gewinnen. – 5. Was bedeutet es, wenn von „Kapitalmacht“ gesprochen wird? Daß die Inhaber der Verfügungsgewalt über Erwerbsmittel und ökonomischeMax Weber definiert „Vermögen“ oben, S. 254.
k
Chancen, welche als Kapitalgüter in einem Erwerbsbetrieb verwendbar sind, kraft dieser Verfügungsge[A 51]walt und kraft der Orientierung des Wirtschaftens an den Prinzipien kapitalistischer Erwerbsrechnung eine spezifische Machtstellung gegenüber andern einnehmen. [266]A: ökonomischen
Schon in den frühesten Anfängen rationaler Erwerbsakte taucht das Kapital (nicht unter diesem Namen!) als Geldrechnungsbetrag auf: so in der Commenda.
47
Güter verschiedener Art wurden einem reisenden Kaufmann zur Veräußerung auf fremdem Markt und – eventuell – Einkauf anderer für den einheimischen Markt gegeben, der Gewinn und Verlust zwischen dem reisenden und dem kapitalgebenden Interessenten des Unternehmens dann in bestimmtem Verhältnis geteilt. Damit aber dies geschehen konnte, mußten sie in Geld geschätzt – also: eine Anfangs- und eine Abschlußbilanz des Unternehmens aufgestellt – werden: das „Kapi[267]tal“ der Commenda (oder societas maris)Vgl. hierzu das Erstlingswerk Max Webers, Geschichte der Handelsgesellschaften, MWG I/1, S. 157 ff. et passim, sowie den Glossar-Eintrag, unten, S. 741.
48
war dieser Schätzungsbetrag, der ganz und gar nur Abrechnungszwecken zwischen den Beteiligten und keinen anderen diente. [267]Speziell auf die Bedürfnisse des Seehandels abgestellte mittelalterliche Form der Kapitalbeteiligung in Gesellschaftsform; vgl. Weber, Geschichte der Handelsgesellschaften, MWG I/1, S. 165–169.
Was bedeutet es, wenn man von „Kapitalmarkt“ spricht? Daß Güter – insbesondre: Geld – zu dem Zwecke begehrt werden, um als Kapitalgüter Verwendung zu finden, und daß Erwerbsbetriebe (insbesondere: „Banken“ bestimmter Art) bestehen, welche aus der betriebsweisen Beschaffung dieser Güter (insbesondre: von Geld) für diesen Zweck Gewinn ziehen. Beim sog. „Leihkapital“: – Hergeben von Geld gegen Rückgabe des gleichen Nennbetrags mit oder ohne „Zinsen“
l
– werden wir von „Kapital“ nur für den reden, dem das Darleihen Gegenstand seines Erwerbsbetriebes bildet, sonst aber nur von „Geldleihe“. Der vulgäre Sprachgebrauch pflegt von „Kapital“ zu reden, sofern „Zinsen“ gezahlt werden, weil diese als eine Quote des Nennbetrags berechnet zu werden pflegen: nur wegen dieser rechnerischen Funktion heißt der Geldbetrag des Darlehens oder Deposits[267]A: „Zinsen“,
49
ein „Kapital“. Freilich ist dies Ausgangspunkt des Sprachgebrauchs (capitale = Hauptsumme des Darlehens, angeblich – nicht: nachweislich – von den „Häuptern“ der Viehleihverträge). Indessen dies ist irrelevant. Schon die geschichtlichen Anfänge zeigen übrigens die Hergabe von Naturalgütern zu einem Geldrechnungsbetrag, von dem dann der Zins berechnet wurde, so daß auch hier „Kapitalgüter“ und „Kapitalrechnung“ in der seither typischen Art nebeneinander standen. Wir wollen bei einem einfachen Darlehen, welches ja einen Teil einer Vermögensverwaltung bildet, auf seiten des Darleihenden nicht von „Leihkapital“ reden, wenn es Haushaltszwecken dient. Ebensowenig natürlich beim DarlehnsempfängerEnglische Bezeichnung eines Depositums, hier: (Bank-)Einlage.
51
Vom „Darleihenden“ ist unmittelbar zuvor die Rede, weshalb hier zu „Darlehnsempfänger“ emendiert worden ist.
m
. – A: Darleiher
Der Begriff des „Unternehmens“
50
entspricht dem Üblichen, nur daß die Orientierung an der Kapitalrechnung, die meist als selbstverständlich vorausgesetzt wird, ausdrücklich hervorgehoben ist, um damit anzudeuten: daß nicht jedes Aufsuchen von Erwerb als solches schon „Unternehmung“ heißen soll, sondern eben nur sofern es an Kapitalrechnung (einerlei ob groß- oder „zwerg“-kapitalistisch) orientierbar ist. Ob diese Kapitalrechnung auch tatsächlich rational vollzogen und eine Kalkulation nach ratio[268]nalen Prinzipien durchgeführt wird, soll dagegen indifferent sein.Max Weber bezieht sich auf die Definition des wirtschaftlichen Unternehmens oben, S. 260.
52
Von „Gewinn“ und „Verlust“ soll ebenfalls nur in Kapitalrechnungs-Unternehmungen die Rede sein. Auch der kapitallose Erwerb (des Schriftstellers, Arztes, Anwalts, Beamten, Professors, Angestellten, Technikers, Arbeiters) ist uns natürlich „Erwerb“, aber er soll nicht „Gewinn“ heißen (auch der Sprachgebrauch nennt ihn nicht so). „Rentabilität“ ist ein Begriff, der auf jeden mit den Mitteln der kaufmännischen Rechnungstechnik selbständig kalkulierbaren Erwerbsakt (Einstellung eines bestimmten Arbeiters oder einer bestimmten Maschine, Gestaltung der Arbeitspausen usw.) anwendbar ist. [268]Ähnlich unten, S. 365: „Entscheidend ist also nicht die empirische Tatsache, sondern die prinzipielle Möglichkeit der materialen Kapitalrechnung.“
Für die Bestimmung des Kapitalzins-Begriffs kann zweckmäßigerweise nicht vom bedungenen Darlehens-Zins ausgegangen werden. Wenn jemand einem Bauern
n
mit Saatgetreide aushilft und sich dafür einen Zuschlag bei der Rückleistung ausbedingt, oder wenn das gleiche mit Geld geschieht, welches ein Haushalt bedarf, ein anderer hergeben kann, so wird man das zweckmäßigerweise noch nicht einen „kapitalistischen“ Vorgang nennen. Der Zuschlag (die „Zinsen“) wird – im Falle rationalen Handelns – bedungen, weil der Darlehensnehmer den Unterschied seiner Versorgungschance für den Fall des Darlehens um mehr als den zugesagten Zuschlag verbessert zu sehen erwartet, gegenüber denjenigen Chancen seiner Lage, die er für den Fall des Verzichts auf das Darlehen voraussieht, der Darlehensgeber aber diese Lage kennt und ausnutzt in dem Maße, daß der Grenznutzen der gegenwärtigen eignen Verfügung über die dargeliehenen Güter durch den geschätzten Grenznutzen des für die Zeit der Rückgabe bedungenen Zuschlags überboten wird.[268]A: Bauer
53
Es handelt sich dabei noch um Kategorien des Haushaltens und der Vermögensverwaltung, nicht aber um solche der Kapitalrechnung. Auch wer von einem „Geldjuden“Zu einer anderen grenznutzentheoretischen Erklärung Webers für das Geben und Nehmen von Darlehen gegen Zins vgl. oben, S. 247.
54
sich ein Notdarlehen für Eigenbedarfszwecke geben läßt, „zahlt“ im Sinn dieser Terminologie keinen „Kapitalzins“ und der Darleihende empfängt keinen, – sondern: Darlehensentgelt. Der betriebsmäßig Darleihende rechnet sich von seinem Geschäftskapital (bei rationaler Wirtschaft) „Zins“ an und hat mit „Verlust“ [A 52]gewirtschaftet, wenn durch Ausfälle von Darlehens-Rückzah[269]lungenSeit dem 18. Jahrhundert verwendeter Begriff zur Bezeichnung jüdischer Geldverleiher, zunehmend mit antisemitischem Unterton. Hier speziell bezogen auf die Tatsache, daß vor Aufkommen eines anstaltlich organisierten Marktes für Konsumkredit Juden am Darlehens-Geschäft mit kleinen Leuten auf dem Lande einen auffällig großen Anteil hatten.
o
dieser Rentabilitätsgrad nicht erreicht wird. Dieser Zins ist uns „Kapitalzins“, jener andre einfach: „Zins“. Kapitalzins im Sinn dieser Terminologie ist also stets Zins vom Kapital, nicht Zins für Kapital, knüpft stets an Geldschätzungen und also an die soziologische Tatsache der „privaten“, d. h. appropriierten Verfügungsgewalt über marktmäßige oder andre Erwerbsmittel an, ohne welche eine „Kapital“rechnung, also auch eine „Zins“rechnung gar nicht denkbar wäre. Im rationalen Erwerbsbetrieb ist jener Zins, mit welchem z. B. ein als „Kapital“ erscheinender Posten rechnungsmäßig belastet wird, das Rentabilitäts-Minimum, an dessen Erzielung oder Nichterreichung die Zweckmäßigkeit der betreffenden Art von Verwendung von Kapitalgütern geschätzt wird („Zweckmäßigkeit“ natürlich unter Erwerbs-[,] d. h. Rentabilitäts-Gesichtspunkten). Der Satz für dieses Rentabilitätsminimum richtet sich bekanntlich nur in einer gewissen Annäherung nach den jeweiligen Zinschancen für Kredite auf dem „Kapitalmarkt“, obwohl natürlich deren Existenz ebenso der Anlaß für diese Maßregel der Kalkulation ist, wie die Existenz des Markttausches für die Behandlung der Buchungen auf den Konten. Die Erklärung jenes Grundphänomens kapitalistischer Wirtschaft aber: daß für „Leihkapitalien“ – also von Unternehmern – dauernd Entgelt gezahlt wird, kann nur durch Beantwortung der Frage gelöst werden: warum die Unternehmer durchschnittlich dauernd hoffen dürfen, bei Zahlung dieses Entgelts an die Darleihenden dennoch Rentabilität zu erzielen, bzw. unter welchen allgemeinen Bedingungen es eben durchschnittlich zutrifft: daß der Eintausch von gegenwärtigen 100 gegen künftige 100 + x rational ist. Die ökonomische Theorie wird darauf mit der Grenznutzrelation künftiger im Verhältnis zu gegenwärtigen Gütern antworten wollen.[269]A: Darlehen-Rückzahlungen
55
Gut! Den Soziologen würde dann interessieren: in welchem Handeln von Menschen diese angebliche Relation derart zum Ausdruck kommt: daß sie die Konsequenzen dieser Differenzialschätzung in der Form eines „Zinses“ ihren Operationen zugrunde legen können. Denn wann und wo dies der Fall ist, das wäre nichts weniger als selbstverständlich. Tatsächlich geschieht es bekanntlich in den Erwerbswirtschaften. Dafür aber ist primär die ökonomische Machtlage maßgebend zwischen einerseits den Erwerbsunternehmen und andrerseits den Haushaltungen, sowohl den die dargebotenen Güter kon[270]sumierenden, wie den gewisse Beschaffungsmittel (Arbeit vor allem) darbietenden. Nur dann werden Unternehmungen begründet und dauernd (kapitalistisch) betrieben, wenn das Minimum des „Kapitalzins“ erhofft wird. Die ökonomische Theorie – die höchst verschieden aussehen könnte – würde dann wohl sagen: daß jene Ausnutzung der Machtlage[269]Max Weber bezieht sich auf die aus den Grundannahmen der österreichischen Grenznutzentheorie von Eugen von Böhm-Bawerk entwickelte Agiotheorie. Sie war eine unter mehreren der seinerzeit diskutierten Zinstheorien. Vgl. Böhm-Bawerk, Eugen von, Zinstheorie, in: HdStW3, Band 8, 1911, S. 1004–1017. Schon Friedrich von Wieser hat sich Böhm-Bawerk nicht angeschlossen; vgl. Wieser, Theorie, S. 153 ff. und 224 ff.
p
– eine Folge des Privateigentums an den Beschaffungsmitteln und Produkten – nur dieser Kategorie von Wirtschaftssubjekten ermögliche: so zu sagen „zinsgemäß“ zu wirtschaften. [270]A: Machtlage:
2. Vermögensverwaltung und Erwerbsbetrieb können sich einander äußerlich bis zur Identität zu nähern scheinen. Die erstere ist in der Tat nur durch den konkreten letzten Sinn des Wirtschaftens von dem letzteren geschieden: Erhöhung und Nachhaltigkeit der Rentabilität und der Marktmachtstellung des Betriebes auf der einen Seite, – Sicherung und Erhöhung des Vermögens und Einkommens auf der anderen Seite. Dieser letzte Sinn muß aber keineswegs in der Realität stets in der einen oder anderen Richtung exklusiv entschieden oder auch nur entscheidbar sein. Wo das Vermögen eines Betriebsleiters z. B. mit der Verfügungsgewalt über die Betriebsmittel und das Einkommen mit dem Gewinn völlig zusammenfällt, scheint beides völlig Hand in Hand zu gehen. Aber: persönliche Verhältnisse aller Art können den Betriebsleiter veranlassen: einen, von der Orientierung an der Betriebsrationalität aus gesehen,
q
irrationalen Weg der Betriebsführung einzuschlagen. Vor allem aber fällt Vermögen und Verfügung über den Betrieb sehr oft nicht zusammen. Ferner übt oft persönliche Überschuldung des Besitzers, persönliches Bedürfnis hoher Gegenwartseinnahmen, Erbteilung usw. einen, betriebsmäßig gewertet, höchst irrationalen Einfluß auf die Betriebsführung aus, was ja oft zur Ergreifung von Mitteln Anlaß gibt, diese Einflüsse ganz auszuschalten (Aktiengründung von Familienunternehmen z. B.).A: gesehen:
56
Diese Tendenz zur Scheidung von Haushalt und Betrieb ist nicht zufällig. Sie folgt eben daraus: daß das Vermögen und seine Schicksale vom Standpunkt des Betriebs aus und die jeweiligen Einkommensinteressen der Besitzer vom Standpunkt der Rentabilität aus irrational sind. So wenig wie die Rentabilitätsrechnung eines Betriebs etwas Eindeutiges über die Versorgungschancen der als Arbeiter oder als Verbraucher interessierten Menschen aussagt, ebensowenig hegen die Vermögens- und Einkommensinteressen eines mit der Verfügungsgewalt über den Betrieb ausgestatteten Einzelnen oder Verbandes notwendig in der [271]Richtung des nachhaltigen Betriebs-Rentabilitätsoptimums und der Marktmachtlage. (Natürlich auch dann nicht – und gerade dann oft nicht –[,] wenn der Erwerbsbetrieb in der Verfügungsgewalt einer „Produktivgenossenschaft“ steht.)[270]Gemeint ist die Umwandlung einer Einzelunternehmung oder einer aus Familienmitgliedern bestehenden Handelsgesellschaft in eine Aktiengesellschaft. Dies allein hat jedoch nie zur dauerhaften Ausschaltung von irrationalen Einflüssen der Familie geführt.
r
[A 53]Die sachlichen Interessen einer modernen rationalen Betriebsführung sind mit den persönlichen Interessen des oder der Inhaber der Verfügungsgewalt keineswegs identisch, oft entgegengesetzt: dies bedeutet die prinzipielle Scheidung von „Haushalt“ und „Betrieb“ auch da, wo beide, auf die Inhaber der Verfügungsgewalt und auf die Verfügungsobjekte hin angesehen, identisch sind. [271]Klammer fehlt in A.
Die Scheidung von „Haushalt“ und „Erwerbsbetrieb“ sollte zweckmäßigerweise auch terminologisch scharf festgehalten und durchgeführt werden. Ein Ankauf von Wertpapieren zum Zweck des Genusses der Gelderträge seitens eines Rentners ist keine „Kapital“-, sondern eine Vermögensanlage. Ein Gelddarlehen seitens eines Privatmanns zum Zweck des Erwerbes der Zinsansprüche ist von einem Gelddarlehen einer Bank an ganz denselben Empfänger vom Standpunkt des Gebers verschieden; ein Gelddarlehen an einen Konsumenten oder an einen Unternehmer (für Erwerbszwecke) sind voneinander vom Standpunkte des Nehmers verschieden: im ersten Fall Kapitalanlage der Bank, im letzten Kapitalaufnahme des Unternehmers. Die Kapitalanlage des Gebers im ersten Fall kann aber für den Nehmer einfache haushaltsmäßige Darlehensaufnahme, die Kapitalaufnahme des Nehmers im zweiten für den Geber einfache „Vermögensanlage“ sein. Die Feststellung des Unterschieds von Vermögen und Kapital, Haushalt und Erwerbsbetrieb ist nicht unwichtig, weil insbesondre das Verständnis der antiken Entwicklung und der Grenzen des damaligen Kapitalismus ohne diese Scheidung nicht zu gewinnen ist (dafür sind die bekannten Aufsätze von Rodbertus, trotz aller seiner Irrtümer und trotz ihrer Ergänzungsbedürftigkeit, immer noch wichtig
57
und mit den zutreffenden Ausführungen K[arl] Büchers[271]Gemeint sind: Rodbertus, Untersuchungen I und II aus den Jahren 1864 bis 1867. In diesen Aufsätzen hat Rodbertus das für die Wirtschaft der Antike Typische darin gesehen, daß Haushalt und Erwerbsbetrieb noch nicht getrennt gewesen seien. Alle Bedürfnisse seien durch Eigenproduktion im „Oikos“ befriedigt worden (vgl. auch Webers Ausführungen in § 18, unten, S. 312). An der Diskussion über diese Theorie hat sich auch Max Weber beteiligt, vgl. Weber, Die römische Agrargeschichte, MWG I/2, bes. S. 317, und Weber, Agrarverhältnisse3, MWG I/6, bes. S. 327 f., 727.
58
zusammenzuhalten).Karl Bücher hat sich – trotz der inzwischen an Rodbertus geäußerten Kritik – diesem im wesentlichen angeschlossen. Im Rahmen seiner Stufenlehre der wirtschaftlichen Entwicklung ordnet er auch die Wirtschaft der Antike der „Stufe der geschlossenen Hauswirtschaft (reine Eigenproduktion, tauschlose Wirtschaft)“ zu. Vgl. Bücher, Entstehung der Volkswirtschaft2, S. 58–86.
[272]3. Keineswegs alle Erwerbsbetriebe mit Kapitalrechnung waren und sind „doppelseitig“ marktorientiert in dem Sinn, daß sie sowohl die Beschaffungsmittel auf dem Markt kaufen, wie die Produkte (oder Endleistungen) dort anbieten. Steuerpacht und Finanzierungen verschiedenster Art werden mit Kapitalrechnung betrieben, ohne das letztere zu tun. Die sehr wichtigen Konsequenzen sind später zu erörtern.
59
Dies ist dann: nicht marktmäßiger kapitalrechnungsmäßiger Erwerb. [272]In Kap. II, § 32, unten, S. 379, und Kap. III, § 9a, unten, S. 486, stellt Weber die Steuerpacht in den Zusammenhang seiner Überlegungen zum „politischen Kapitalismus“.
4. Erwerbstätigkeit und Erwerbsbetrieb sind hier, aus Zweckmäßigkeitsgründen, geschieden. Erwerbstätig ist jeder, der in einer bestimmten Art tätig ist mindestens auch, um Güter (Geld oder Naturalgüter), die er noch nicht besitzt, neu zu erwerben. Also der Beamte
60
und Arbeiter nicht minder als der Unternehmer. Markt-Erwerbsbetrieb aber wollen wir nur eine solche Art von Erwerbstätigkeit nennen, welche kontinuierlich an Marktchancen orientiert ist, indem sie Güter als Erwerbsmittel darauf verwendet, um a) durch Herstellung und Absatz begehrter Güter, – oder b) um durch Darbietung begehrter Leistungen Geld zu ertauschen, es sei durch freien Tausch oder durch Ausnutzung appropriierter Chancen, wie in den in der vorigen Nummer bezeichneten Fällen. Nicht „erwerbstätig“ ist im Sinn dieser Terminologie der Besitz-Rentner jeder Art, mag er noch so rational mit seinem Besitz „wirtschaften“. Max Weber verwendet den Begriff „Beamter“ für Inhaber sehr verschiedener Ämter. Hier sind alle Arbeitnehmer von privaten Unternehmen gemeint, die nicht Lohnarbeiter sind. Das entsprach gegen Ende des 19. Jahrhunderts, als sich der Begriff Angestellter noch nicht durchgesetzt hatte, dem Sprachgebrauch. Vgl. Potthoff, Heinz, Privatbeamte, in: HdStW3, Band 6, 1910, S. 1208–1218.
5. So selbstverständlich theoretisch festzuhalten ist, daß die je nach dem Einkommen sich gestaltenden Grenznutzen-Schätzungen der letzten Konsumenten die Rentabilitätsrichtung der Güterbeschaffungs-Erwerbsbetriebe bestimmen, so ist soziologisch doch die Tatsache nicht zu ignorieren: daß die kapitalistische Bedarfsdeckung a) Bedürfnisse neu „weckt“
s
und alte verkümmern läßt, – b) in hohem Maß, durch ihre aggressive Reklame, Art und Maß der Bedarfsdeckung der Konsumenten beeinflußt.[272]A: „weckt“,
61
Es gehört dies geradezu zu ihren wesentlichen Zügen. Richtig ist: daß es sich dabei meist um Bedürfnisse nicht ersten Dringlichkeitsgrades handelt. Indessen auch die Art der Ernährung und Wohnung wird in einer kapitalistischen Wirtschaft sehr weitgehend durch die Anbieter bestimmt. Max Weber bezieht sich auf das oben, S. 261 f., Ausgeführte; vgl. dort auch Hg.-Anm. 36.
[273]§ 12. Naturalrechnung kann in den verschiedensten Kombinationen vorkommen. Man spricht von Geldwirtschaft im Sinn einer Wirtschaft mit typischem Geldgebrauch und also: Orientierung an geldgeschätzten Marktlagen, von Naturalwirtschaft im Sinn von Wirtschaft ohne Geldgebrauch, und kann darnach die historisch gegebenen Wirtschaften je nach dem Grade ihrer Geld- oder Naturalwirtschaftlichkeit scheiden.
Naturalwirtschaft aber ist nichts Eindeutiges, sondern kann sehr verschiedener Struktur sein. Sie kann
- absolut tauschlose Wirtschaft bedeuten oder
- eine Wirtschaft mit Naturaltausch ohne Gebrauch von Geld als Tauschmittel.
Im ersten Fall (a) kann sie sowohl
[A 54]α. eine 1. vollkommunistisch oder eine 2. genossenschaftlich (mit Anteilsrechnung) wirtschaftende Einzelwirtschaft und in beiden Fällen ohne alle Autonomie oder Autokephalie einzelner Teile: geschlossene Hauswirtschaft,
62
sein, wie [273]Max Weber übernimmt den Begriff von Karl Bücher, Entstehung der Volkswirtschaft2, S. 58 ff.
ß. eine Kombination verschiedener sonst autonomer und autokephaler Einzelwirtschaften, alle belastet mit naturalen Leistungen an eine (für herrschaftliche oder für genossenschaftliche Bedürfnisse bestehende) Zentralwirtschaft: Naturalleistungswirtschaft („Oikos“,
63
streng leiturgischerAnders als Karl Bücher unterscheidet Max Weber „geschlossene Hauswirtschaft“ und „Oikos“. Während erstere von Weber auch als „autonome ,Einheitswirtschaft‘“ bezeichnet wird (vgl. unten, S. 309, ist „Oikos“ für ihn ein aus Einzelwirtschaften bestehender, autoritär geleiteter Großhaushalt, wie z. B. der des ägyptischen Pharao. Ausführlich hierzu Weber, Hausgemeinschaften, in: MWG I/22-1, S. 155–161; auch Weber, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, MWG III/6, S. 196, 198 und 203.
64
politischer Verband). Zum Begriff „leiturgisch“ vgl. den Glossar-Eintrag, unten, S. 746.
In beiden Fällen kennt sie, im Fall der Reinheit des Typus (oder soweit dieser reicht)[,] nur Naturalrechnung.
t
[273]Absatz fehlt in A.
Im zweiten Fall (b) kann sie
α. Naturalwirtschaft mit reinem Naturaltausch ohne Geldgebrauch und ohne Geldrechnung (reine Naturaltauschwirtschaft) sein oder
[274]ß. Naturaltauschwirtschaft mit (gelegentlicher oder typischer) Geldrechnung (typisch im alten Orient nachweisbar,
65
aber sehr verbreitet gewesen). [274]Für Beispiele im alten Orient vgl. Weber, Agrarverhältnisse3, MWG I/6, S. 395, 402, 420.
Für die Probleme der Naturalrechnung bietet nur der Fall a, α in seinen beiden Formen oder aber eine solche Gestaltung des Falles a, ß Interesse, bei welcher die Leiturgien in rationalen Betriebseinheiten abgeleistet werden, wie dies bei Aufrechterhaltung der modernen Technik bei einer sog. „Vollsozialisierung“
66
unvermeidlich wäre. Max Weber definiert „Vollsozialisierung“ unten, S. 291, als „rein haushaltsmäßige Planwirtschaft“. Zu dem u. a. von Otto Neurath in der aktuellen Sozialisierungsdiskussion vertretenen Konzept der „Vollsozialisierung“ im Unterschied zu den vielen Formen von „Teilsozialisierung“ vgl. Heimann, Eduard, Die Sozialisierung, in: AfSSp, Band 45, Heft 3, 1919, S. 527–590, insbes. S. 557–563. Zu Neurath vgl. unten, S. 280.
Alle Naturalrechnung ist ihrem innersten Wesen nach am Konsum: Bedarfsdeckung, orientiert. Selbstverständlich ist etwas dem „Erwerben“ ganz Entsprechendes auf naturaler Basis möglich. Entweder so, daß a) bei tauschloser Naturalwirtschaft: verfügbare naturale Beschaffungsmittel und Arbeit planvoll zur Güterherstellung oder Güterherbeischaffung verwendet werden auf Grund einer Rechnung, in welcher
u
der so zu erzielende Zustand der Bedarfsdeckung mit dem ohne diese oder bei einer andern Art der Verwendung bestehenden verglichen und als haushaltsmäßig vorteilhafter geschätzt wird. Oder daß b) bei Naturaltauschwirtschaft im Wege des streng naturalen Abtauschs und Eintauschs (eventuell: in wiederholten Akten) eine Güterversorgung planmäßig erstrebt wird, welche, mit der ohne diese Maßregeln vorher bestehenden verglichen, als eine ausgiebigere Versorgung von Bedürfnissen bewertet wird. Nur bei Unterschieden qualitativ gleicher Güter aber kann dabei eine ziffermäßige Vergleichung eindeutig und ohne ganz subjektive Bewertung durchgeführt werden. Natürlich kann man typische Konsum-Deputate zusammenstellen, wie sie den Naturalgehalts- und Naturalpfründen-Ordnungen besonders des Orients zugrunde [275]lagen (sogar Gegenstände des Tauschverkehrs, wie unsre Staatspapiere, wurden).[274]A: welchem
67
Bei typisch sehr gleichartigen Gütern (Niltal-Getreide) war Lagerung mit Giroverkehr (wie in Ägypten) natürlich technisch ebenso möglich,[275]Über Naturaldeputate zur Alimentierung der Beamten und Arbeiter, die u.U. – auch in Bruchteilen – handelbar und so Vorläufer moderner Staatsschuldpapiere waren, vgl. Weber, Patrimonialismus, MWG I/22-4, S. 296.
68
wie für Silberbarren bei Bankowährungen.Ägyptische „Getreidegirobanken“ erwähnt Weber auch in der Vorlesung „Abriß der universalen Sozial- und Wirtschaftsgeschichte“. Bauern lieferten nicht nur ihre Naturalabgaben, sondern ihre gesamte Produktion an die Speicher des Pharao, um dann „Schecks“ darauf zu ziehen (vgl. Weber, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, MWG III/6, S. 145). Wie dort aus einer Nachschrift hervorgeht (ebd., S. 439), hat Weber als Quelle genannt: Preisigke, Friedrich, Girowesen im griechischen Ägypten, enthaltend Korngiro, Geldgiro, Girobanknotariat mit Einschluß des Archivwesens. Ein Beitrag zur Geschichte des Verwaltungsdienstes im Altertume. – Straßburg: Schlesier & Schweikhardt 1910.
69
Ebenso kann (und dies ist wichtiger) ziffermäßig der technische Erfolg eines bestimmten Produktionsprozesses ermittelt und mit technischen Prozessen anderer Art verglichen werden. Entweder, bei gleichem Endprodukt, nach der Art des Beschaffungsmittelbedarfs nach Art und Maß. Oder, bei gleichen Beschaffungsmitteln, nach den – bei verschiedenem Verfahren – verschiedenen Endprodukten. Nicht immer, aber oft, ist hier ziffermäßiger Vergleich für wichtige Teilprobleme möglich. Das Problematische der bloßen „Rechnung“ beginnt aber, sobald Produktionsmittel verschiedener Art und mehrfacher Verwendbarkeit oder qualitativ verschiedene Endprodukte in Betracht kommen. Banco/Banko-Geld war in Deutschland eine bis 1873 gebräuchliche Verrechnungseinheit (Mark Banco) für den bargeldlosen Zahlungsverkehr auf der Grundlage von bei der Hamburger Girobank errichteten Edelmetalldepots. Eine entsprechend durch Umbuchungen zirkulierende Mark-Valuta gab es bis 1874 auch in Schweden. Max Weber verallgemeinert den Begriff, so daß dieser – wie in China – auch durch Edelmetall gedeckte Zertifikate von Bankiers umfaßt. Vgl. unten, S. 371 mit Hg.-Anm. 61 sowie S. 373 mit Hg.-Anm. 67.
Jeder kapitalistische Betrieb vollzieht allerdings in der Kalkulation fortwährend Naturalrechnungsoperationen: Gegeben ein Webstuhl bestimmter Konstruktion, Kette und Garn
70
bestimmter Qualität. Festzustellen: bei gegebener Leistungsfähigkeit der Maschinen, gegebenem Feuchtigkeitsgehalt der Luft, gegebenem Kohlen-, Schmieröl-, Schlichtmaterial- usw. Verbrauch: die [276]Schußzahl pro Stunde und Arbeiter, – und zwar für den einzelnen Arbeiter – und darnach das Maß der in der Zeiteinheit von ihm fälligen Einheiten des erstrebten Produkts.Weber meint hier das „Schuß-Garn“. Vgl. dazu die nachfolgende Erläuterung.
71
Derartiges [A 55]ist für Industrien mit typischen Abfall- oder Nebenprodukten ohne jede Geldrechnung feststellbar, und wird auch so festgestellt. Ebenso kann, unter gegebenen Verhältnissen, der bestehende normale Jahresbedarf des Betriebes an Rohstoffen, bemessen nach seiner technischen Verarbeitungsfähigkeit, die Abnutzungsperiode für Gebäude und Maschinen, der typische Ausfall durch Verderb oder andern Abgang und Materialverlust naturalrechnungsmäßig festgestellt werden, und dies geschieht. Aber: die Vergleichung von Produktionsprozessen verschiedener Art und mit Beschaffungsmitteln verschiedener Art und mehrfacher Verwendbarkeit erledigt die Rentabilitätsrechnung der heutigen Betriebe für ihre Zwecke spielend an der Hand der Geldkosten, während für die Naturalrechnung hier schwierige, „objektiv“ nicht zu erledigende, Probleme liegen. Zwar – scheinbar ohne Not – nimmt die tatsächliche Kalkulation in der Kapitalrechnung eines heutigen Betriebs die Form der Geldrechnung tatsächlich schon ohne diese Schwierigkeiten an.[276]Im Webstuhl werden die längsverlaufenden Kettfäden (Kette) mit den querverlaufenden Schußfäden (Weber nennt sie „Garn“) verwoben. Die Schußzahl gibt an, wie oft der Weber in einer Zeiteinheit die Garnspule mit dem Schußfaden durch die geöffneten Fächer der Kettfäden „schießt“. – Max Weber hat einen Leinenwebereibetrieb bei seinen Verwandten in Oerlinghausen kennengelernt und die hier gewonnenen Erfahrungen in die Serie seiner 1908/09 veröffentlichten Literaturberichte über die „Psychophysik der industriellen Arbeit“ eingearbeitet. Vgl. Weber, Psychophysik, MWG I/11, S. 162 ff., und Weber, Marianne, Lebensbild, S. 397 f.
v
Aber mindestens zum Teil nicht zufällig. Sondern z. B. bei den „Abschreibungen“ deshalb, weil dies diejenige Form der Vorsorge für die Zukunftsbedingungen der Produktion des Betriebes ist, welche die maximal anpassungsbereite Bewegungsfreiheit (die ja bei jeder realen Aufspeicherung von Vorräten oder gleichviel welchen anderen rein naturalen Vorsorgemaßregeln ohne dieses Kontrollmittel irrational und schwer gehemmt wäre) mit maximaler Sicherheit verbindet.[276]A: an,
72
Es ist schwer abzusehen, welche [277]Form denn bei Naturalrechnung „Rücklagen“ haben sollten, die nicht spezifiziert wären. Ferner aber ist innerhalb eines Unternehmens die Frage: ob und welche seiner Bestandteile, rein technisch-natural angesehen, irrational (= unrentabel) arbeiten und weshalb?[,] d. h. welche Bestandteile des naturalen Aufwandes„Abschreibung“ (vom Ausgangswert) wird die rechnerische Berücksichtigung der im Laufe der Nutzungsdauer von betrieblichen Anlagegegenständen durch Verschleiß [277]oder auf andere Weise eintretenden Wertminderungen genannt. Unmittelbar dienen Abschreibungen der korrekten Ermittlung des Periodengewinns. Vorsorge für die Aufrechterhaltung der Produktionskapazität in der Zukunft kann dadurch getroffen werden, daß die Abschreibungssummen in der Bilanz einem „Erneuerungsfonds“ bzw. einer (offenen) „Rücklage“ zugeführt werden.
w
(kapitalrechnerisch: der „Kosten“)[277]A: Aufwandes,
x
zweckmäßigerweise erspart oder, und vor allem: anderweit rationaler verwendet werden könnten? zwar relativ leicht und sicher aus einer Nachkalkulation der buchmäßigen „Nutzen“- und „Kosten“-Verhältnisse in Geld, – wozu als Index auch die Kapitalzinsbelastung des Kontos gehört,A: „Kosten“),
73
– äußerst schwer aber und überhaupt nur in sehr groben Fällen und Formen durch Naturalrechnung gleichviel welcher Art zu ermitteln. (Es dürfte sich schon hierbei nicht um zufällige, durch „Verbesserungen“ der Rechnungsmethode zu lösende, sondern um prinzipielle Schranken jedes Versuchs wirklich exakter Naturalrechnung handeln. Doch könnte dies immerhin bestritten werden, wenn auch natürlich nicht mit Argumenten aus dem Taylor-System und mit der Möglichkeit, durch irgendwelche Prämien- oder Point-Rechnung „Fortschritte“ ohne Geldverwendung zu erzielen.Gemeint ist vermutlich, daß ein Zins auf die eingesetzten Kapitalgüter zu berechnen wäre, wie dies ebenfalls Friedrich von Wieser im Falle eines naturalwirtschaftlich organisierten „sozialen Musterstaats“ unter planwirtschaftlicher Leitung für erforderlich hält (vgl. Wieser, Theorie, S. 144 und 224 ff.). Die Bedeutung von „Index“ in diesem Zusammenhang ist unklar.
74
Die Frage wäre ja gerade: [278]wie man entdeckt, an welcher Stelle eines Betriebs diese Mittel eventuell in Ansatz zu bringen wären, weil gerade an dieser Stelle noch zu beseitigende Irrationalitäten stecken, – die ihrerseits exakt zu ermitteln die Naturalrechnung eben auf Schwierigkeiten stößt, welche einer Nachkalkulation durch Geldrechnung nicht erwachsen). Die Naturalrechnung als Grundlage einer Kalkulation in Betrieben (die bei ihr als heterokephale und heteronome Betriebe einer planwirtschaftlichen Leitung der Güterbeschaffung zu denken wären) findet ihre Rationalitätsgrenze am Zurechnungsproblem, welches für sie ja nicht in der einfachen Form der buchmäßigen Nachkalkulation, sondern in jener höchst umstrittenen Form auftritt, die es in der „Grenznutzlehre“ besitzt.Der amerikanische Ingenieur Frederick Winslow Taylor, Begründer der wissenschaftlichen Betriebslehre, hat ein System der Steuerung von Arbeitsabläufen entwickelt, das unter dem Namen Taylorismus auch in Deutschland große Beachtung gefunden hat. Im Zentrum standen Zeit- und Bewegungsstudien zur Leistungsmessung und ein darauf aufbauendes Entlohnungs-, Prämien- und Kontrollsystem (vgl. Taylor, Frederick Winslow, The Principies of Scientific Management. – New York, London: Harper & Brothers 1911; dt.: Die Grundsätze wissenschaftlicher Betriebsführung, übersetzt und hg. von Rudolf Roesler. – München, Berlin: Oldenbourg 1913). Max Weber bezieht sich wahrscheinlich auf Ausführungen von Otto Neurath (zu diesem unten, S. 280). Dieser hat dem Taylor-System und seinen speziellen Methoden des Leistungsanreizes [278]eine Rolle auch in einer auf Naturalrechnung gegründeten Wirtschaft zugewiesen. Vgl. Neurath, Kriegswirtschaft, S. 217 und 224.
75
Die Naturalrechnung müßte ja zum Zwecke der rationalen Dauerbewirtschaftung von Beschaffungsmitteln „Wert-Indices“ für die einzelnen Objekte ermitteln, welche die Funktion der „Bilanz-Preise“ in der heutigen Kalkulation zu übernehmen hätten. Ohne daß abzusehen wäre, wie sie denn entwickelt und kontrolliert werden könnten: einerseits für jeden Betrieb (standortmäßig) verschieden, andrerseits einheitlich unter Berücksichtigung der „gesellschaftlichen Nützlichkeit“, d. h. des (jetzigen und künftigen) Konsumbedarfs? Im Anschluß an Carl Menger haben u. a. Eugen von Böhm-Bawerk und Friedrich von Wieser die von Menger nicht überzeugend behandelte Frage zu beantworten gesucht, nach welchen Gesetzmäßigkeiten sich die Anteile bestimmen, die vom (grenznutzentheoretisch bestimmten) Wert der Produkte den zu ihrer Erzeugung dienenden Produktionsmitteln „zuzurechnen“ seien. Die verschiedenen vorgeschlagenen Lösungen blieben umstritten, wie auch die von einer anderen theoretischen Basis, nämlich der Grenzproduktivitätstheorie, aus entwickelten Lösungen des „Zurechnungsproblems“. Vgl. Mayer, Hans, Zurechnung: in: HdStW4, Band 8, 1928, S. 1206–1228.
Mit der Annahme, daß sich ein Rechnungssystem „schon finden“ bzw. erfinden lassen werde, wenn man das Problem der geldlosen Wirtschaft nur resolut anfasse, [A 56]ist hier nicht geholfen: das Problem ist ein Grundproblem aller „Vollsozialisierung“, und von einer rationalen „Planwirtschaft“ jedenfalls kann keine Rede sein, solange in dem alles entscheidenden Punkt kein Mittel zur rein rationalen Aufstellung eines „Planes“ bekannt ist.
76
Max Weber definiert „Planwirtschaft“ unten, S. 288.
[279]Die Schwierigkeiten der Naturalrechnung wachsen weiter, wenn ermittelt werden soll: ob ein gegebener Betrieb mit konkreter Produktionsrichtung an dieser Stelle seinen rationalen Standort habe oder – stets: vom Standpunkt der Bedarfsdeckung einer gegebenen Menschengruppe – an einer andern, möglichen, Stelle, und ob ein gegebener naturaler Wirtschaftsverband vom Standpunkt rationalster Verwendung der Arbeitskräfte und Rohmaterialien, die ihm verfügbar sind, richtiger durch „Kompensationstausch“ mit andern oder durch Eigenherstellung sich bestimmte Produkte beschafft. Zwar sind die Grundlagen der Standortsbestimmung natürlich rein naturale, und auch ihre einfachsten Prinzipien sind in Naturaldaten formulierbar (s. darüber Alfred Weber in diesem Grundriß).
77
Aber die konkrete Feststellung: ob nach den an einem konkreten Ort gegebenen standortswichtigen Umständen ein Betrieb mit einer bestimmten Produktionsrichtung oder ein anderer mit einer modifizierten rational wäre, ist – von absoluter Ortsgebundenheit durch Monopolrohstoffvorkommen abgesehen – naturalrechnungsmäßig nur in ganz groben Schätzungen möglich, geldrechnungsmäßig aber trotz der Unbekannten, mit denen stets zu rechnen ist, eine im Prinzip stets lösbare Kalkulationsaufgabe. Die davon wiederum verschiedene Vergleichung endlich der Wichtigkeit, d. h. Begehrtheit, spezifisch verschiedener Güterarten, deren Herstellung oder Eintausch nach den gegebenen Verhältnissen gleich möglich ist: ein Problem, welches in letzter Linie in jede einzelne Betriebskalkulation mit seinen Konsequenzen hineinreicht, unter Geldrechnungsverhältnissen die Rentabilität entscheidend bestimmt und damit die Richtung der Güterbeschaffung der Erwerbsbetriebe bedingt, ist für eine Naturalrechnung prinzipiell überhaupt nur löslich in Anlehnung entweder: an die Tradition, oder: an einen diktatorischen Machtspruch, der den Konsum eindeutig (einerlei ob ständisch verschieden oder egalitär) reguliert und: Fügsamkeit findet. Auch dann aber bliebe die Tatsache bestehen: daß die Naturalrechnung das Problem der Zurechnung der Gesamtleistung eines [280]Betriebes zu den einzelnen „Faktoren“ und Maßnahmen nicht in der Art zu lösen vermag, wie dies die Rentabilitätsrechnung in Geld nun einmal leistet, daß also gerade die heutige Massenversorgung durch Massenbetriebe ihr die stärksten Widerstände entgegenstellt. [279]Gemeint ist: Weber, Alfred, Standortslehre.
1. Die Probleme der Naturalrechnung sind anläßlich der „Sozialisierungs“ – Tendenzen in letzter Zeit,
78
besonders eindringlich von Dr. O[tto] Neurath, in seinen zahlreichen Arbeiten,[280]Zu einer Frage der praktischen Politik ist die Idee der Sozialisierung erst am Ende des Weltkriegs geworden. Zu den unterschiedlichen Konzepten und den konkreten Durchsetzungsversuchen vgl. Novy, Klaus, Strategien der Sozialisierung. Die Diskussion der Wirtschaftsreform in der Weimarer Republik. – Frankfurt a. Μ.: Campus 1978.
79
angeregt worden. Für eine „Vollsozialisierung“, d. h. eine solche, welche mit dem Verschwinden effektiver Preise rechnet, ist das Problem in der Tat durchaus zentral. (Seine rationale Unlösbarkeit würde, wie ausdrücklich bemerkt sei, nur besagen: was alles, auch rein ökonomisch, bei einer derartigen Sozialisierung „in den Kauf zu nehmen“ wäre, nie aber die „Berechtigung“ dieses Bestrebens, sofern es sich eben nicht auf technische, sondern, wie aller Gesinnungs-Sozialismus, auf ethische oder andre absolute Postulate stützt, „widerlegen“ können: – was keine Wissenschaft vermag. Rein technisch angesehen, wäre aber die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, daß auf Gebieten mit nur auf der Basis exakter Rechnung zu unterhaltender Volksdichte die Grenze der möglichen Sozialisierung nach Form und Umfang durch den Fortbestand effektiver Preise gegeben wäre. Doch gehört das nicht hierher. Nur sei bemerkt: daß die begriffliche Scheidung von „Sozialismus“ und „Sozialreform“, wenn irgendwo, dann gerade hier liegt.)Vgl. Neurath, Kriegswirtschaft; Neurath, Vollsozialisierung, und Neurath, System der Sozialisierung. Der 1917 in Heidelberg habilitierte Privatdozent Otto Neurath war herausragender nicht-marxistischer Vertreter der Idee einer „Vollsozialisierung“. Er war vom 31. März bis 14. Mai 1919 Leiter des auf seinen Vorschlag hin in Bayern errichteten Zentralwirtschaftsamts. Über Webers Verhältnis zu Neurath und seine Einschätzung von dessen Planwirtschaftsidee vgl. Weber, Zeugenaussage im Prozeß gegen Otto Neurath, MWG I/16, S. 492–495, einschließlich des Editorischen Berichts, und den Brief Max Webers an Otto Neurath vom 4. Oktober 1919, in: MWG II/10, S. 798 ff. Vgl. auch Merz, Johannes, Zur Sozialisierungsbewegung 1918/19. Konzeption und Wirksamkeit Otto Neuraths in Österreich, Sachsen und Bayern, in: Historisches Jahrbuch, Jg. 121, 2001, S. 267–285.
80
Max Weber erläutert den Unterschied unten, S. 282.
2. Es ist natürlich vollkommen zutreffend, daß „bloße“ Geldrechnungen, sei es von Einzelbetrieben, sei es noch so vieler oder selbst aller Einzelbetriebe[,] und daß auch die umfassendste Güterbewegungsstatistik usw. in Geld noch gar nichts über die Art der Versorgung einer gegebenen Menschengruppe mit dem, was sie letztlich benötigt: Naturalgütern, aussagen, [281]daß ferner die vielberedeten „Volksver[A 57]mögens“-Schätzungen in Geld
81
nur soweit ernst zu nehmen sind, als sie fiskalischen Zwecken dienen (und also: nur das steuerbare Vermögen feststellen). Für Einkommensstatistiken in Geld gilt jedoch das gleiche, auch vom Standpunkt der naturalen Güterversorgung, schon bei weitem nicht in gleichem Maße, wenn die Güterpreise in Geld statistisch bekannt sind. Nur fehlt auch dann jegliche Möglichkeit einer Kontrolle unter materialen Rationalitätsgesichtspunkten. Richtig ist ferner (und an dem Beispiel der römischen Campagna von Sismondi und W[erner] Sombart vortrefflich dargelegt),[281]Seit dem Ausgang des 19. Jahrhunderts sind zahlreiche Schätzungen des deutschen Volksvermögens vorgelegt worden (vgl. Winkler, Wilhelm, Volksvermögen, in: HdStW4, Band 8, 1929, S. 770–786). Vielberedet waren derartige Rechnungen, seit im Friedensvertrag von Versailles in den Artikeln 231–247 die Pflicht Deutschlands zur Wiedergutmachung von Schäden festgelegt worden war und nach Kriterien für die Zahlungsfähigkeit des Reiches gesucht wurde. – Bereits in seinen frühen Vorlesungen hat Weber die Rede von einem Volks- oder Nationalvermögen kritisiert; vgl. Weber, Theoretische Nationalökonomie, MWG III/1, S. 305; Weber, Erstes Buch. Die begrifflichen Grundlagen der Volkswirtschaftslehre, MWG III/1, S. 152.
y
daß befriedigende Rentabilität (wie sie die höchst extensive Campagna-Wirtschaft zeigte, und zwar für alle Beteiligten) in zahlreichen Fällen nicht das mindeste mit einer, vom Standpunkt optimaler Nutzung gegebener Güterbeschaffungsmittel für einen Güterbedarf einer gegebenen Menschengruppe befriedigenden Gestaltung der Wirtschaft gemein hat;[281]A: dargelegt:),
82
die Art der AppropriationGemeint sind: Sismondi, Études II, S. 1–79 und 80–141 (= 11. Essay „Comment rappeler la population et la culture dans la campagne de Rome); Sombart, Römische Campagna. Die römische Campagna war ein dünn besiedeltes, größten Teils aus Weideland bestehendes Gebiet. Wie Sismondi und Sombart herausgefunden haben, war das hier entwickelte System extensiver Bewirtschaftung für die Eigentümer riesiger Ländereien und deren Großpächter rentabel. Beide Autoren haben den Gegensatz von privatwirtschaftlicher Rentabilität und ethisch-politischen Zielsetzungen betont. – Auf Sombarts Studie hat sich Weber in seiner Debattenrede auf der Tagung des Vereins für Sozialpolitik berufen, um die Problematik des Begriffs „Volkswohlstand“ zu erörtern. Vgl. Weber, Max, [Über die Produktivität der Volkswirtschaft], in: Verhandlungen des Vereins für Socialpolitik, Generalversammlung in Wien, 27., 28. und 29. September 1909 (Schriften des Vereins für Socialpolitik, Band 132). – Leipzig: Duncker & Humblot 1910, S. 580–585, 603–607 (MWG I/12), hier S. 581.
a
(insbesondre – wie, insoweit, F[ranz] Oppenheimer schlechthin zuzugeben ist: – der Bodenappropriation,A: Appropriation,
83
aber freilich: nicht nur dieser)Im Zentrum der Lehre Franz Oppenheimers steht die Idee, daß die ursprünglich aus Gewalt erwachsenen Eigentumsrechte an Boden Quelle dauerhafter Monopol-Renten seien. Wegen der damit verbundenen Folgen für die Lage der Arbeiter sei die „Bodensperre“ das Grundübel des modernen Kapitalismus. Vgl. Oppenheimer, Großgrundeigentum; Oppenheimer, Theorie, S. 254–289.
b
stiftet Renten- und Verdienstchancen mannigfacher Art, welche die Entwicklung zur [282]technisch optimalen Verwertung von Produktionsmitteln dauernd obstruieren können. (Allerdings ist dies sehr weit davon entfernt, eine Eigentümlichkeit gerade der kapitalistischen Wirtschaft zu sein: – insbesondre die vielberedeten Produktionseinschränkungen im Interesse der Rentabilität beherrschten gerade die Wirtschaftsverfassung des Mittelalters restlos,A: dieser),
84
und die Machtstellung der Arbeiterschaft in der Gegenwart kann Ähnliches zeitigen. Aber unstreitig existiert der Tatbestand auch in ihrer Mitte.) – Die Tatsache der Statistik von Geldbewegungen oder in Form von Geldschätzungen hat aber doch die Entwicklung einer Naturalstatistik nicht etwa, wie man nach manchen Ausführungen glauben sollte, gehindert, man mag nun von idealen Postulaten aus deren Zustand und Leistungen im übrigen tadeln wie immer. Neun Zehntel und mehr unserer Statistik sind nicht Geld-, sondern Naturalstatistik.[282]Daß es zum Wesen der mittelalterlichen Zünfte gehörte, die Produktion zu regulieren, war unumstritten. Umstritten war der Charakter des Monopolismus der Zünfte. Werner Sombart sah das Handwerk vom „Bedarfsdeckungsprinzip“, der „Idee der Nahrung“, beherrscht. Seine Kritiker (u. a. Georg von Below, Lujo Brentano, Gustav Schmoller) betonten die Evidenz von Erwerbsorientierung. Vgl. hierzu unten, S. 313 f., Hg.-Anm. 76. „Rentabilität“ hat Max Weber oben, S. 260 und 268, in einer Weise definiert, die die Verwendung des Begriffs hier problematisch erscheinen läßt.
85
Im ganzen hat die Arbeit einer vollen Generation letztlich fast nichts andres getan, als eine Kritik der Leistungen der reinen Rentabilitäts-Orientiertheit der Wirtschaft für die naturale Güterversorgung (denn darauf lief alle und jede Arbeit der sog. „Kathedersozialisten“Die Begriffe „Geldstatistik“ und „Naturalstatistik“ sind keine eingeführten Fachbegriffe. Die Amtsstatistik unterscheidet zwischen Angaben in Mengen und Werten bzw. Preisen. Im Statistischen Jahrbuch für das Deutsche Reich, 35. Jg., 1914, entfallen fast 50 Prozent der Seiten auf Tabellen mit Werten bzw. Preisen. Berücksichtigt man die umfangreichen Angaben zum auswärtigen Handel nicht, verbleiben noch gut 30 Prozent für „Geldstatistik“.
86
doch letztlich, und zwar ganz bewußt, hinaus): nur hat sie allerdings als Beurteilungsmaßstab eine sozialpolitisch – und das heißt im Gegensatz gegen die Naturalrechnungswirtschaft: eine an fortbestehenden effektiven Preisen – orientierte Sozialreform, nicht eine Vollsozialisierung, für das (sei es derzeit, sei es definitiv) in Massenwirtschaften allein mögliche angesehen. Diesen Standpunkt für eine „Halbheit“ zu halten,Der Begriff „Kathedersozialismus“ ist ein 1871 von Heinrich Bernhard Oppenheim geprägter Spottname für Professoren, die sich für Eingriffe des Staates auf dem Gebiet der Sozial- und Wirtschaftspolitik aussprachen. „Kathedersozialist“ ist alsbald von den Betroffenen, die sich im Verein für Socialpolitik engagiert hatten, als ehrenvolle Selbstbezeichnung übernommen worden. Vgl. Lexis, Wilhelm, Kathedersozialismus, in: HdStW3, Band 5, 1910, S. 804–806.
87
steht [283]natürlich frei; nur war er an sich nicht in sich widersinnig. Daß den Problemen der Naturalwirtschaft und insbesondre der möglichen Rationalisierung der Naturalrechnung nicht sehr viel Aufmerksamkeit, jedenfalls im ganzen nur historische, nicht aktuelle, Beachtung geschenkt worden ist, trifft zu. Der Krieg hat – wie auch in der Vergangenheit jeder Krieg – diese Probleme in Form der Kriegs- und Nachkriegs-Wirtschaftsprobleme mit gewaltiger Wucht aufgerollt. (Und unzweifelhaft gehört zu den Verdiensten des Herrn Dr. O[tto] Neurath eine besonders frühe und eindringliche, im einzelnen sowohl wie im Prinzipiellen gewiß bestreitbare, Behandlung eben dieser Probleme.Möglicherweise bezieht sich Max Weber auf Otto Neurath, der vor „Unsicherheit und Halbheit“ warnt. Vgl. Neurath, Otto, Wesen und Weg der Sozialisierung, in: Neurath, Kriegswirtschaft, S. 218.
88
Daß „die Wissenschaft“ zu seinen Formulierungen wenig Stellung genommen habe,[283]Schon vor dem Ersten Weltkrieg hat Otto Neurath für eine „Kriegswirtschaftslehre“ als Sonderdisziplin neben der auf die Verkehrswirtschaft konzentrierten Nationalökonomie geworben (vgl. Neurath, Otto, Die Kriegswirtschaftslehre als Sonderdisziplin, in: Weltwirtschaftliches Archiv, Band 1, 1913, S. 343–348). Dieser und weitere Beiträge zur theoretischen und praktischen Behandlung der Kriegswirtschaft sind veröffentlicht in: Neurath, Kriegswirtschaft. Max Weber hatte Neurath für die Abfassung eines Artikels über die Kriegswirtschaft für den GdS ins Auge gefaßt; vgl. den Brief Max Webers an Paul Siebeck, vor dem 14. April 1916, in: MWG II/9, S. 384 f.
89
ist insofern nicht erstaunlich, als bisher nur höchst anregende, aber doch mehr Kapitelüberschrift-artige Prognosen vorliegen, mit denen eine eigentliche „Auseinandersetzung“ schwer ist. Das Problem beginnt da, wo seine öffentlichen Darlegungen – bisher – enden). Max Weber bezieht sich möglicherweise auf die Feststellung Neuraths: „Jedenfalls haben wir gesehen, daß eine ganze Reihe von Erscheinungen den Eindruck erweckt, die naturale Verwaltungswirtschaft sei in der Ausdehnung begriffen […]. Wenn all das heute von der Wissenschaft nicht beachtet wird, so erklärt sich dies ähnlich, wie die anfangs erwähnte Nichtverwendung der Erfahrungen der Napoleonischen Zeit. Spricht die gegenwärtige Wirtschaftslehre von Naturalwirtschaft, so tut sie dies meist nur mit einem mitleidigen Achselzucken“. Vgl. Neurath, Otto, Krieg und Naturalwirtschaft. Vortrag, gehalten am 27.3.1917 in der 243. Plenarversammlung der Gesellschaft österreichischer Volkswirte, in: Jahrbuch der Gesellschaft österreichischer Volkswirte, Wien, 1918, S. 43–51; wieder abgedruckt in: Neurath, Otto, Gesammelte ökonomische, soziologische und sozialpolitische Schriften, Teil II (Gesamtausgabe, Band 5), hg. von Rudolf Haller und Ulf Höfer. – Wien: Hölder-Pichler-Tempsky 1998, S. 582 (Hervorhebung im Original).
3. Die Leistungen und Methoden der Kriegswirtschaft können nur mit großer Vorsicht für die Kritik auch der materialen Rationalität einer Wirtschaftsverfassung verwendet werden. Kriegswirtschaft ist an einem (im Prinzip) eindeutigen Zwecke orientiert und in der Lage, Machtvollkommenheiten auszunutzen, wie sie der Friedenswirtschaft nur bei „Staatssklaverei“ der „Untertanen“ zur Verfügung stehen. Sie ist ferner „Bankerotteurswirtschaft“ ihrem innersten Wesen nach: der überragende Zweck läßt fast jede Rücksicht auf die kommende Friedenswirtschaft schwinden. Es wird nur technisch präzis, ökonomisch aber, bei allen nicht mit völligem Versiegen bedrohten Materialien und vollends mit den Arbeitskräften, nur [284]im groben „gerechnet“
c
. Die Rechnungen haben daher vorwiegend (nicht: ausschließlich) technischen Charakter; soweit sie wirtschaftlichen Charakter haben, d. h. die Konkurrenz von Zwecken – nicht nur: von Mitteln zum gegebenen Zweck – berücksichtigen, begnügen sie sich mit (vom Standpunkt jeder genauen Geldkalkulation aus gesehen) ziemlich primitiven Erwägungen und Berechnungen nach dem Grenznutzprinzip, sind dem Typus nach „Haushalts“-Rechnungen und haben gar nicht den Sinn, dauernde Rationalität der gewählten Aufteilung von Arbeit und Beschaffungsmitteln zu garantieren. Es ist daher, – so belehrend gerade die Kriegswirtschaft und Nachkriegswirtschaft für die Erkenntnis ökonomischer „Möglichkeiten“ ist, – bedenklich, aus den ihr gemäßen naturalen Rech[A 58]nungsformen Rückschlüsse auf deren Eignung für die Nachhaltigkeits-Wirtschaft des Friedens zu ziehen. [284]A: gerechnet“
Es ist auf das bereitwilligste zuzugestehen: 1. daß auch die Geldrechnung zu willkürlichen Annahmen genötigt ist bei solchen Beschaffungsmitteln, welche keinen Marktpreis haben (was besonders in der landwirtschaftlichen Buchführung in Betracht kommt), – 2. daß in abgemindertem Maß etwas Ähnliches für die Aufteilung der „Generalunkosten“
90
bei der Kalkulation insbesondre von vielseitigen Betrieben gilt, – 3. daß jede, auch noch so rationale, d. h. an Marktchancen orientierte, Kartellierung sofort den Anreiz zur exakten Kalkulation schon auf dem Boden der Kapitalrechnung herabsetzt, weil nur da und soweit genau kalkuliert wird, wo und als eine Nötigung dafür vorhanden ist.[284]Früher gebräuchliche Bezeichnung für Kosten, die nicht für einzelne Aufträge erfaßt werden können und bei der Kalkulation nach Schlüsseln umgelegt werden müssen. Heute: Gemeinkosten.
91
Bei der Naturalrechnung würde aber der Zustand zu 1 universell bestehen, zu 2 jede exakte Berechnung der „Generalunkosten“, welche immerhin von der Kapitalrechnung geleistet wird, unmöglich und, – zu 3 jeder Antrieb zu exakter Kalkulation ausgeschaltet und durch Mittel von fraglicher Wirkung (s. o.)Max Weber verschärft, was er 1911 behutsamer formuliert hat: „Wenn ich in einem Kartell sitze, warum soll ich da eigentlich noch die Kosten kalkulieren? wird sich ein erheblicher Teil der kartellierten Unternehmungen fragen.“ Weber, Probleme der Arbeiterpsychologie, MWG I/11, S. 419.
92
künstlich neu geschaffen werden müssen. Der Gedanke einer Verwandlung des umfangreichen, mit Kalkulation befaßten Stabes „kaufmännischer Angestellter“ in ein Personal einer Universalstatistik, von der geglaubt wird, daß sie die Kalkulation bei Naturalrechnung ersetzen könne,Kap. II, § 12, oben, S. 273 ff.
93
verkennt nicht nur die [285]grundverschiedenen Antriebe, sondern auch die grundverschiedene Funktion von „Statistik“ und „Kalkulation“. Sie unterscheiden sich wie Bureaukrat und Organisator. Otto Neurath hat mehrfach die Notwendigkeit einer „Universalstatistik“ betont. Sie sollte, als Grundlage für eine naturale Wirtschaftsplanung, jeder Einzelstatistik Sinn und Bedeutung verleihen. Vgl. u. a. Neurath, Kriegswirtschaft, S. 212 und 226 f.
4. Sowohl die Naturalrechnung wie die Geldrechnung sind rationale Techniken. Sie teilen keineswegs die Gesamtheit alles Wirtschaftens unter sich auf Vielmehr steht daneben das zwar tatsächlich wirtschaftlich orientierte, aber rechnungsfremde Handeln. Es kann traditional orientiert oder affektuell bedingt sein. Alle primitive Nahrungssuche der Menschen ist der instinktbeherrschten tierischen Nahrungssuche verwandt. Auch das voll bewußte, aber auf religiöser Hingabe, kriegerischer Erregung, Pietätsempfindungen und ähnlichen affektuellen Orientierungen ruhende Handeln ist in seinem Rechenhaftigkeitsgrad sehr wenig entwickelt. „Unter Brüdern“ (Stammes-, Gilde-, Glaubens-Brüdern) wird nicht gefeilscht,
94
im Familien-, Kameraden-, Jüngerkreise nicht gerechnet oder doch nur sehr elastisch, im Fall der Not, „rationiert“: ein bescheidener Ansatz von Rechenhaftigkeit. Über das Eindringen der Rechenhaftigkeit in den urwüchsigen Familienkommunismus s. unten Kap. V.[285]In ähnlichem Zusammenhang formuliert Max Weber: „Wo ein Tausch stattfindet, gilt der Satz: ‚Unter Brüdern feilscht man nicht‘, der das rationale ‚Marktprinzip‘ für die Preisbestimmung ausschaltet“. (Vgl. Weber, Hausgemeinschaften, MWG I/22-1, S. 123). Laut Hg.-Anm. 16, ebd., handelt es sich bei dem Zitat um eine sprichwörtliche Abwandlung von Bestimmungen in der Bibel, z. B. 3. Mose 25,14 und 1. Thessaloniker 4,6.
95
Träger des Rechnens war überall das Geld, und dies erklärt es, daß in der Tat die Naturalrechnung technisch noch unentwickelter geblieben ist[,] als ihre immanente Natur dies erzwingt (insoweit dürfte O[tto] Neurath Recht zu geben sein).Ausführungen zu Kapitel V liegen nicht vor; vgl. dazu den Anhang zum Editorischen Bericht, oben, S. 109.
96
Max Weber bezieht sich möglicherweise auf Aussagen Otto Neuraths wie die folgende: „Die bisherige volkswirtschaftliche Theorie steht meist in einem überengen Zusammenhang mit der Geldwirtschaft und hat bisher die Naturalwirtschaft fast ganz vernachlässigt.“ Vgl. Neurath, Otto, Die Naturalwirtschaftslehre und der Naturalkalkül, in: Weltwirtschaftliches Archiv, Band 1916 II, Heft 2, S. 245–258, Zitat: S. 246.
Während des Druckes erscheint (im Archiv f[ür] Sozialwiss[enschaft] 47) die mit diesen Problemen befaßte Arbeit von L[udwig] Mises.
97
Gemeint ist: Mises, Wirtschaftsrechnung. Das Archiv-Heft vom April 1920 ist kurz vor Webers Tod ausgeliefert worden. Als Mitherausgeber des AfSSp hat Max Weber wahrscheinlich schon das Manuskript lesen können. Wann es eingereicht worden ist, ist nicht bekannt.
§ 13. Die formale „Rationalität“ der Geldrechnung ist also an sehr spezifische materiale Bedingungen geknüpft, welche hier soziologisch interessieren, vor allem:
[286]1. den Marktkampf
1
(mindestens: relativ) autonomer Wirtschaften. Geldpreise sind Kampf- und Kompromißprodukte, also Erzeugnisse von Machtkonstellationen. „Geld“ ist keine harmlose „Anweisung auf unbestimmte Nutzleistungen“,[286]Während die sich um 1900 herausbildende neoklassische Theorie das Modell der „vollkommenen Konkurrenz“ an statischen Gleichgewichts-Märkten in den Mittelpunkt stellt, unterstellt Max Weber, modelltheoretisch gesprochen, oligopolistische Strukturen mit strategischem Verhalten der Marktteilnehmer.
2
welche man ohne grundsätzliche Ausschaltung des durch Kampf von Menschen mit Menschen geprägten Charakters der Preise beliebig umgestalten könnte, sondern primär: Kampfmittel und Kampfpreis, Rechnungsmittel aber nur in der Form des quantitativen Schätzungsausdrucks von Interessenkampfchancen. Friedrich Bendixen bezeichnete „Geld [als] eine Anweisung seines Besitzers auf Güter“ (vgl. Bendixen, Friedrich, Das Wesen des Geldes. Zugleich ein Beitrag zur Reform der Reichsbankgesetzgebung, 2. Aufl. – München, Leipzig: Duncker & Humblot 1918, S. 23). Ihm folgend spricht Joseph Schumpeter von „Anweisungen“, die „nicht auf bestimmte Objekte, sondern auf Anteile an einer Gütermasse lauten.“ Vgl. Schumpeter, Joseph, Das Sozialprodukt und die Rechenpfennige. Glossen und Beiträge zur Geldtheorie von heute, in: AfSSp, Band 44, Heft 3, Juli 1918, S. 627–715, Zitat: S. 648.
2. Das Höchstmaß von Rationalität als rechnerisches Orientierungsmittel des Wirtschaftens erlangt die Geldrechnung in der Form der Kapitalrechnung, und dann unter der materialen Voraussetzung weitestgehender Marktfreiheit im Sinn der Abwesenheit sowohl oktroyierter und ökonomisch irrationaler wie voluntaristischer und ökonomisch rationaler (d. h. an Marktchancen orientierter) Monopole. Der mit diesem Zustand verknüpfte Konkurrenzkampf um Abnahme der Produkte erzeugt, insbesondre als Absatzorganisation und Reklame (im weitesten Sinn), eine Fülle von Aufwendungen, welche ohne jene Konkurrenz (also bei Planwirtschaft oder rationalen Vollmonopolen) fortfallen. Strenge Kapitalrechnung ist ferner sozial an „Betriebsdisziplin“ und Appropriation der sachlichen Beschaffungsmittel, also: an den Bestand eines Herrschaftsverhältnisses, gebunden.
3
Vgl. hierzu Weber, Erhaltung des Charisma, MWG I/22-4, S. 557 f.: „Die Betriebsdisziplin ruht, im Gegensatz zur Plantage, hier [im kapitalistischen Werkstattbetrieb, Hg.] völlig auf rationaler Basis, sie kalkuliert zunehmend, mit Hilfe geeigneter Messungsmethoden, den einzelnen Arbeiter ebenso, nach seinem Rentabilitätsoptimum, wie irgendein sachliches Produktionsmittel.“ Zur Betriebsdisziplin als Grundlage des tech[287]nischen Funktionierens im Herrschaftsverband eines kapitalistischen Betriebs vgl. Weber, Die drei reinen Typen der legitimen Herrschaft, MWG I/22-4, S. 727.
[287][A 59]3. Nicht „Begehr“ an sich, sondern: kaufkräftiger Begehr nach Nutzleistungen regelt durch Vermittlung der Kapitalrechnung material die erwerbsmäßige Güterbeschaffung. Es ist also die Grenznutzen-Konstellation bei der letzten jeweils nach der Art der Besitzverteilung noch für eine bestimmte Nutzleistung typisch kaufkräftigen und kaufgeneigten Einkommensschicht maßgebend für die Richtung der Güterbeschaffung. In Verbindung mit der – im Fall voller Marktfreiheit – absoluten Indifferenz gerade der formal vollkommensten Rationalität der Kapitalrechnung gegen alle, wie immer gearteten, materialen Postulate begründen diese im Wesen der Geldrechnung liegenden Umstände die prinzipielle Schranke ihrer Rationalität. Diese ist eben rein formalen Charakters. Formale und materiale (gleichviel an welchem Wertmaßstab orientierte) Rationalität fallen unter allen Umständen prinzipiell auseinander, mögen sie auch in noch so zahlreichen (der theoretischen, unter allerdings völlig irrealen Voraussetzungen zu konstruierenden, Möglichkeit nach selbst: in allen) Einzelfällen empirisch Zusammentreffen. Denn die formale Rationalität der Geldrechnung sagt an sich nichts aus über die Art der materialen Verteilung der Naturalgüter. Diese bedarf stets der besonderen Erörterung. Vom Standpunkt der Beschaffung eines gewissen materiellen Versorgungs-Minimums einer Maximal-Zahl von Menschen als Rationalitätsmaßstab treffen allerdings, nach der Erfahrung der letzten Jahrzehnte, formale und materiale Rationalität in relativ hohem Maße zusammen, aus Gründen, die in der Art der Antriebe liegen, welche die der Geldrechnung allein adäquate Art des wirtschaftlich orientierten sozialen Handelns in Bewegung setzt. Aber unter allen Umständen gilt: daß die formale Rationalität erst in Verbindung mit der Art der Einkommensverteilung etwas über die Art der materiellen Versorgung besagt.
4
Max Webers Kommentare zu § 13 finden sich im Anschluß an die Ausführungen zu § 14, unten, S. 290 ff.
[288]§ 14. „Verkehrswirtschaftliche“ Bedarfsdeckung soll alle, rein durch Interessenlage ermöglichte, an Tauschchancen orientierte und nur durch Tausch vergesellschaftete wirtschaftliche Bedarfsdeckung heißen. „Planwirtschaftliche“ Bedarfsdeckung
5
soll alle an gesatzten, paktierten oder oktroyierten, materialen Ordnungen systematisch orientierte Bedarfsdeckung innerhalb eines Verbandes heißen. [288]Max Weber erläutert die Entscheidung für diesen Begriff unten, S. 290 f.
Verkehrswirtschaftliche Bedarfsdeckung setzt, normalerweise und im Rationalitätsfall, Geldrechnung und, im Fall der Kapitalrechnung, ökonomische Trennung von Haushalt und Betrieb voraus. Planwirtschaftliche Bedarfsdeckung ist (je nach ihrem Umfang in verschiedenem Sinn und Maß) auf Naturalrechnung als letzte Grundlage der materialen Orientierung der Wirtschaft, formal aber, für die Wirtschaftenden, auf Orientierung an den Anordnungen eines, für sie unentbehrlichen, Verwaltungsstabes angewiesen. In der Verkehrswirtschaft orientiert sich das Handeln der autokephalen Einzelwirtschaften autonom: beim Haushalten am Grenznutzen des Geldbesitzes und des erwarteten Geldeinkommens, beim Gelegenheitserwerben an den Marktchancen, in den Erwerbsbetrieben an der Kapitalrechnung. In der Planwirtschaft wird alles wirtschaftliche Handeln – soweit sie durchgeführt ist – streng haushaltsmäßig und heteronom an gebietenden und verbietenden Anordnungen, in Aussicht gestellten Belohnungen und Strafen orientiert. Soweit als Mittel der Weckung des Eigeninteresses in der Planwirtschaft Sonder-Einkunftchancen in Aussicht gestellt sind, bleibt mindestens die Art und Richtung des dadurch belohnten Handelns material heteronom normiert. In der Verkehrswirtschaft kann zwar, aber in formal voluntaristischer Art, weitgehend das gleiche geschehen. Überall da nämlich, wo die Vermögens-, insbesondere die Kapitalgüter-Besitzdifferenzierung die Nichtbesitzenden zwingt, sich Anweisungen zu fügen, um überhaupt Entgelt für die von ihnen angebotenen Nutzleistungen zu erhalten. Sei es den
d
Anweisungen eines vermögenden Hausherrn, oder den an einer [289]Kapitalrechnung orientierten Anweisungen von Kapitalgüter-Besitzenden (oder der von diesen zu deren Verwertung designierten Vertrauensmänner). [A 60]Dies ist in der rein kapitalistischen Betriebswirtschaft das Schicksal der gesamten Arbeiterschaft. [288] Fehlt in A; den sinngemäß ergänzt.
Entscheidender Antrieb für alles Wirtschaftshandeln ist unter verkehrswirtschaftlichen Bedingungen normalerweise 1. für die Nichtbesitzenden: a) der Zwang des Risikos völliger Unversorgtheit für sich selbst und für diejenigen persönlichen „Angehörigen“ (Kinder, Frauen, eventuell Eltern), deren Versorgung der einzelne typisch übernimmt, b) – in verschiedenem Maß – auch innere Eingestelltheit auf die wirtschaftliche Erwerbsarbeit als Lebensform, – 2. für die durch Besitzausstattung oder (besitzbedingte) bevorzugte Erziehungsausstattung tatsächlich Privilegierten: a) Chancen bevorzugter Erwerbseinkünfte, b) Ehrgeiz, c) die Wertung der bevorzugten (geistigen, künstlerischen, technisch fachgelernten) Arbeit als „Beruf“, – 3. für die an den Chancen von Erwerbsunternehmungen Beteiligten: a) eignes Kapitalrisiko und eigne Gewinnchancen in Verbindung mit b) der „berufsmäßigen“ Eingestelltheit auf rationalen Erwerb als α) „Bewährung“ der eignen Leistung und ß) Form autonomen Schaltens über die von den eignen Anordnungen abhängigen Menschen, daneben γ) über kultur- oder lebenswichtige Versorgungschancen einer unbestimmten Vielheit: Macht. Eine an Bedarfsdeckung orientierte Planwirtschaft muß – im Fall radikaler Durchführung – von diesen Motiven den Arbeitszwang durch das Unversorgtheits-Risiko mindestens abschwächen, da sie im Fall materialer Versorgungsrationalität jedenfalls die Angehörigen nicht beliebig stark unter der etwaigen Minderleistung des Arbeitenden leiden lassen könnte. Sie muß ferner, im gleichen Fall, die Autonomie der Leitung von Beschaffungsbetrieben sehr weitgehend, letztlich: vollkommen, ausschalten, kennt das Kapitalrisiko und die Bewährung durch formal autonomes Schalten ebenso wie die autonome Verfügung über Menschen und lebenswichtige Versorgungschancen entweder gar nicht oder nur mit sehr stark beschränkter Autonomie. Sie hat also neben (eventuell) rein materiellen Sondergewinn[290]chancen wesentlich ideale Antriebe „altruistischen“ Charakters (im weitesten Sinn) zur Verfügung, um ähnliche Leistungen in der Richtung planwirtschaftlicher Bedarfsdeckung zu erzielen, wie sie erfahrungsgemäß die autonome Orientierung an Erwerbschancen innerhalb der Erwerbswirtschaft in der Richtung der Beschaffung kaufkräftig begehrter Güter vollbringt. Sie muß dabei ferner[,] im Fall radikaler Durchführung, die Herabminderung der formalen, rechnungsmäßigen Rationalität in Kauf nehmen, wie sie (in diesem Fall) der Fortfall der Geld- und Kapitalrechnung unvermeidlich bedingt. Materiale und (im Sinn exakter Rechnung:) formale Rationalität fallen eben unvermeidlich weitgehend auseinander: diese grundlegende und letztlich unentrinnbare Irrationalität der Wirtschaft ist eine der Quellen aller „sozialen“ Problematik, vor allem: derjenigen alles Sozialismus.
Zu §§ 13 und 14:
1. Die Ausführungen geben offensichtlich nur allgemein bekannte Dinge mit einer etwas schärferen Pointierung (s. die Schlußsätze von § 14) wieder. Die Verkehrswirtschaft ist die weitaus wichtigste Art alles an „Interessenlage“ orientierten typischen und universellen sozialen Handelns. Die Art, wie sie zur Bedarfsdeckung führt, ist Gegenstand der Erörterungen der Wirtschaftstheorie und hier im Prinzip als bekannt vorauszusetzen. Daß der Ausdruck „Planwirtschaft“ verwendet wird, bedeutet natürlich keinerlei Bekenntnis zu den bekannten Entwürfen des früheren Reichswirtschaftsministers;
6
der Ausdruck ist aber allerdings deshalb gewählt, weil er, an sich nicht sprachwidrig gebildet, seit diesem offiziellen Gebrauch sich [291]vielfach eingebürgert hat (statt des von O[tto] Neurath gebrauchten, an sich auch nicht unzweckmäßigen Ausdrucks „Verwaltungswirtschaft“).[290]Im Mai 1919 hat der damalige sozialdemokratische Reichswirtschaftsminister Rudolf Wissell (1869–1962) dem Reichskabinett eine Denkschrift zur wirtschaftspolitischen Lage vorgelegt. Ihr war ein „Wirtschaftsprogramm des Reichswirtschaftsministeriums“ beigefügt. Es wendete sich gegen alle Verstaatlichungspläne und empfahl eine als „Gemeinwirtschaft“ bezeichnete Organisation der Wirtschaft. In ihr sollten paritätisch besetzte Selbstverwaltungskörper der Wirtschaftszweige eine „gebundene Planwirtschaft“, jedoch ohne zentrale Lenkungsbehörde, herbeiführen (Vgl. Wissel, Rudolf und Wichard von Moellendorf, Wirtschaftliche Selbstverwaltung (Deutsche Gemeinwirtschaft, hg. von E. Schairer, Heft 10). – Jena: Eugen Diederichs 1919). Der Begriff „Planwirtschaft“ wurde insbesondere von den Gegnern gemeinwirtschaftlicher Ideen rasch in polemischer Absicht aufgenommen und von Rudolf Wissell später nicht verteidigt.
7
[291]Bei Neurath heißt es: „Wir haben nicht einmal einen allgemeinen Namen dafür, daß nicht der Einzelne durch seine Tauscherwägungen den Ausschlag gibt, sondern eine Zentralstelle, welche unter Umständen die Willensentschließungen aller vereinigen mag. Wir bringen dafür den Ausdruck ,Verwaltungswirtschaft‘ in Vorschlag.“ Vgl. Neurath, Kriegswirtschaft, S. 148.
2. Nicht unter den Begriff „Planwirtschaft“ in diesem Sinn fällt alle Verbandswirtschaft oder verbandsregulierte Wirtschaft, die an Erwerbschancen (zunftmäßig oder kartellmäßig oder trustmäßig) orientiert ist. Sondern lediglich eine an Bedarfsdeckung orientierte Verbandswirtschaft. Eine an Erwerbschancen orientierte, sei es auch noch so straff regulierte oder durch einen Verbandsstab geleitete Wirtschaft setzt stets effektive „Preise“, gleichviel wie sie formell entstehen (im Grenzfall des Pankartellismus:
8
durch interkartellmäßiges Kompro[A 61]miß, Lohntarife von „Arbeitsgemeinschaften“So nannte erstmals Wilhelm Neurath (1840–1901), der Vater Otto Neuraths, eine von Verbänden regulierte Wirtschaft; vgl. Neurath, Wilhelm, Gemeinverständliche nationalökonomische Vorträge. Geschichtliche und letzte eigene Forschungen, hg. v. Edmund v. Lippmann. – Braunschweig: Vieweg 1902, S. 271.
9
usw.), also Kapitalrechnung und Orientierung an dieser voraus. „Vollsozialisierung“ im Sinn einer rein haushaltsmäßigen Planwirtschaft und Partialsozialisierung (von Beschaffungsbranchen) mit Erhaltung der Kapitalrechnung hegen trotz Identität des Ziels und trotz aller Mischformen technisch nach prinzipiell verschiedenen Richtungen. Vorstufe einer haushaltsmäßigen Planwirtschaft ist jede Rationierung des Konsums, überhaupt jede primär auf die Beeinflussung der naturalen Verteilung der Güter ausgehende Maßregel. Die planmäßige Leitung der Güterbeschaffung, einerlei ob sie durch voluntaristische oder oktroyierte Kartelle oder durch staatliche Instanzen unternommen wird, geht primär auf rationale Gestaltung der Verwendung der Beschaffungsmittel und Arbeitskräfte aus und kann eben deshalb den Preis nicht – mindestens (nach ihrem eigenen Sinn:) noch nicht – entbehren. Es ist daher kein Zufall, daß der „Rationie[292]rungs“-SozialismusUnter dem Eindruck der Revolution ist in Deutschland am 15. November 1918 von Industriellen und Gewerkschaftsführern die „Zentralarbeitsgemeinschaft der industriellen und gewerblichen Arbeitgeber und Arbeitnehmer Deutschlands“ gegründet worden. Ihr Zweck war die Regelung bislang heftig umstrittener Fragen der Wirtschafts- und Sozialordnung, insbesondere des Verhältnisses von Gewerkschaften und Arbeitgebern, bei Aufrechterhaltung des Privateigentums an Produktionsmitteln. Der abgeschlossene Vertrag sah u. a. die Gründung von branchenbezogenen, paritätisch besetzten Reichsarbeitsgemeinschaften vor. Mitte 1920 gab es 14 Reichsarbeitsgemeinschaften. Die Verabredung von Lohntarifen gehörte nicht zu ihren Aufgaben. Sie blieb der direkten Aushandlung der jeweiligen Tarifpartner vorbehalten. Vgl. Feldman, Gerald D. und Irmgard Steinisch, Industrie und Gewerkschaften 1918–1924. Die überforderte Zentralarbeitsgemeinschaft (Schriftenreihe der Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, Band 50). – Stuttgart: Deutsche Verlagsanstalt 1985.
10
mit dem „Betriebsrats“-Sozialismus,[291] Der von Max Weber gebildete Begriff nimmt eine Idee des sozialdemokratischen Reichstagsabgeordneten Paul Lensch auf. Dieser sah in der kriegswirtschaftlichen Güterzuteilung, insbesondere der Einführung der Brotkarte, den bisher größten Schritt zu einer Durchorganisierung der Wirtschaft im sozialistischen Sinn. Vgl. Lensch, Paul, Die deutsche Sozialdemokratie und der Weltkrieg. Eine politische Studie. – Berlin: Paul Singer 1915; ders., Die Sozialdemokratie, ihr Ende und ihr Glück. – Leipzig: S. Hirzel 1916.
11
der (gegen den Willen seiner rationalsozialistischen Führer)Insbesondere von Arbeiter- und Soldatenräten ist in der Revolution 1918/19 die Forderung erhoben worden, Betriebs-Räten die Kontrolle, gar die Leitung von Unternehmen zu übergeben. Die vom Rat der Volksbeauftragten am 23. Dezember 1918 erlassene „Verordnung über Tarifverträge, Arbeiter- und Angestelltenausschüsse und Schlichtung von Arbeitsstreitigkeiten“ sah jedoch für Betriebsräte in wirtschaftlichen Angelegenheiten nur Informationsrechte vor. In der Folgezeit blieb die Rolle von Betriebsräten in Deutschland heftig umstritten. Das am 13. Januar 1920 verabschiedete Betriebsrätegesetz übertrug ihnen lediglich sozialpolitische und begrenzte tarifpolitische Aufgaben.
12
an Appropriationsinteressen der Arbeiter anknüpfen muß, sich gut verträgt. Zum Begriff „rationalsozialistisch“ vgl. die Formulierung Webers im folgenden Absatz: „heute wieder ‚kommunistisch‘ genannte rational-planwirtschaftliche Form des Sozialismus“. Max Weber bezieht sich wahrscheinlich auf Lenin und Trotzki, die bereits 1918 wegen der Versorgungslage und den katastrophalen Verhältnissen in der industriellen Produktion in Rußland die Arbeiterkomitees entmachteten und die Verstaatlichung der Industrie mit zentraler Lenkung der Betriebe und der Verteilung ihrer Produktion durchsetzten. Ihre programmatischen Reden wurden rasch in Übersetzungen bekannt. Vgl. Lenin, N., Die nächsten Aufgaben der Sowjet-Macht. – Belp-Bern: Promachos-Verlag 1918; Trotzki, L., Arbeit, Disziplin und Ordnung werden die sozialistische Sowjet-Republik retten. Vortrag auf der Moskauer städtischen Konferenz der Russischen Kommunistischen Partei am 28. März 1918. – Basel: Verlag der Buchhandlung des Arbeiterbundes 1918. Diese Reden werden auch von Eduard Heimann zitiert, der sich sehr kritisch über die „Führungskompetenzen“ der Betriebsräte geäußert hat, vgl. Heimann, Eduard, Die Sozialisierung, in: AfSSp, Band 45, Heft 3, 1919, S. 527–590, hier S. 580 mit Anm. 52.
3. Die kartell-, zunft- oder gildenmäßige wirtschaftliche Verbandsbildung, also die Regulierung oder monopolistische Nutzung von Erwerbschancen, einerlei ob oktroyiert oder paktiert (regelmäßig: das erstere, auch wo formal das letztere vorliegt)[,] ist an dieser Stelle nicht besonders zu erörtern. Vgl. über sie (ganz allgemein) oben Kap. I § 10
13
und weiterhin bei Besprechung der Appropriation ökonomischer Chancen (dieses Kapitel, §§ Kap. I, § 10, oben, S. 198 ff.
e
19 ff.).[292]A: §
14
Der Gegensatz der evolutionistisch und am Produktionsproblem orientierten, vor allem: marxistischen, gegen die von der Verteilungsseite ausgehende, heute wieder „kommunistisch“ genannte ratio[293]nal-planwirtschaftliche Form des Sozialismus Gemeint ist Kap. II, §§ 19–24a, unten, S. 314–355.
15
ist seit Marx’ Misère de la philosophie (in der deutschen Volksausgabe der „Intern[ationalen] Bibl[iothek]“ vor allem S. 38 und vorher und nachher)[293]Der Begriff „Kommunismus“ bzw. „kommunistisch“ war im deutschsprachigen Raum um 1900 praktisch aus der politischen Diskussion verschwunden. Mit der von Lenin vorgenommenen Unterscheidung von „Sozialismus“ und „Kommunismus“ kam es zu einer unerwarteten Wiederbelebung. In diesem Zusammenhang ist als Merkmal vor allem betont worden, daß im Kommunismus nicht nur die Produktionsmittel, sondern auch die Konsumtionsmittel der Verfügung einzelner Personen entzogen wären. So formulierte Robert Liefmann: „Kommunismus ist nach der zweckmäßigsten Abgrenzung eine Wirtschaftsordnung, bei welcher der ganze Konsum einheitlich und für alle gleich geregelt ist. Das braucht beim Sozialismus [gekennzeichnet durch die Verstaatlichung der Produktionsmittel, Hg.] nicht der Fall zu sein.“ Liefmann, Robert, Bringt uns der Krieg dem Sozialismus näher? (Der Deutsche Krieg. Politische Flugschriften, hg. v. Ernst Jäckh, Heft 56). – Stuttgart, Berlin: Deutsche Verlagsanstalt 1915, S. 10. Zur Begriffsgeschichte vgl. Schieder, Wolfgang, Kommunismus, in: Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, hg. von Otto Brunner u. a., Band 3. – Stuttgart: Klett-Cotta 1982, S. 455–529.
16
nicht wieder erloschen; der Gegensatz innerhalb des russischen Sozialismus mit seinen leidenschaftlichen Kämpfen zwischen Plechanoff und Lenin Bei Marx, Elend der Philosophie, heißt es: „In einer künftigen Gesellschaft, wo der Klassengegensatz verschwunden ist, wo es keine Klassen mehr giebt, würde der Gebrauch nicht mehr von dem Minimum der Produktionszeit abhängen, sondern die Produktionszeit, die man den verschiedenen Gegenständen widmet, würde bestimmt werden durch ihre gesellschaftliche Nützlichkeit.“ (Ebd., S. 38). Weber hat Marx, „Misère de la philosophie“ von 1847 bereits in seinen frühen Vorlesungen nach der deutschen Ausgabe zitiert, vgl. Weber, Grundriß zu den Vorlesungen, MWG III/1, S. 107.
17
war letztlich ebenfalls dadurch bedingt, und die heutige Spaltung des Sozialismus ist zwar primär durch höchst massive Kämpfe um die Führerstellungen (und: -Pfründen), daneben und dahinter aber durch diese Problematik bedingt, welche durch die Kriegswirtschaft ihre spezifische Wendung zugunsten des Planwirtschaftsgedankens einerseits, der Entwicklung der Appropriationsinteressen andrerseits, erhielt. – Die Frage: ob man „Planwirtschaft“ (in gleichviel welchem Sinn und Umfang) schaffen soll, ist in dieser Form natürlich kein wissenschaftliches Problem. Es kann wissenschaftlich nur gefragt werden: welche Konsequenzen wird sie (bei gegebener Form) voraussichtlich haben, was also muß mit in den Kauf genommen werden, wenn der Versuch gemacht wird. Dabei ist es Gebot der Ehrlichkeit, von allen Seiten zuzugeben, daß zwar mit einigen bekannten, aber mit ebensoviel teilweise unbekannten Faktoren gerechnet wird. Die Einzelheiten des Pro[294]blems können in dieser Darstellung materiell entscheidend überhaupt nicht und in den hergehörigen Punkten nur stückweise und im Zusammenhang mit den Formen der Verbände (des Staates insbesondre) berührt werden. Über die Auseinandersetzungen zwischen dem ersten Parteiführer der russischen Sozialdemokratie G. W. Plechanow (1856–1918) und W. I. Lenin (1870–1924) sowie die Spaltung der russischen Sozialdemokratie in Menschewiki und Bolschewiki vgl. Weber, Zur Lage der bürgerlichen Demokratie in Rußland, MWG I/10, S. 165 ff.
18
An dieser Stelle konnte nur die (unvermeidliche) kurze Besprechung der elementarsten technischen Problematik in Betracht kommen. Das Phänomen der regulierten Verkehrswirtschaft ist hier, aus den eingangs dieser Nr. angegebenen Gründen, gleichfalls noch nicht behandelt.[294]Entsprechende Ausführungen liegen nicht vor; vgl. dazu die Einleitung, oben, S. 69.
19
Zur regulierten Verkehrswirtschaft finden sich im Folgenden keine systematischen Ausführungen; eine knappe Erwähnung unten, S. 443. Gründe für die aufschiebende Behandlung des Themas werden oben, S. 292, Ziffer 3, nicht genannt.
4. Verkehrswirtschaftliche Vergesellschaftung des Wirtschaftens setzt Appropriation der sachlichen Träger von Nutzleistungen einerseits, Marktfreiheit andererseits voraus. Die Marktfreiheit steigt an Tragweite 1. je vollständiger die Appropriation der sachlichen Nutzleistungsträger, insbesondre der Beschaffungs- (Produktions- und Transport-)Mittel ist. Denn das Maximum von deren Marktgängigkeit bedeutet das Maximum von Orientierung des Wirtschaftens an Marktlagen. Sie steigt aber ferner 2. je mehr die Appropriation auf sachliche Nutzleistungsträger beschränkt ist. Jede Appropriation von Menschen (Sklaverei, Hörigkeit) oder von ökonomischen Chancen (Kundschaftsmonopole) bedeutet Einschränkung des an Marktlagen orientierten menschlichen Handelns. Mit Recht hat namentlich Fichte (im „Geschlossenen Handelsstaat“) diese Einschränkung des „Eigentums“-Begriffs auf Sachgüter (bei gleichzeitiger Ausweitung des im Eigentum enthaltenen Gehalts an Autonomie der Verfügungsgewalt) als Charakteristikum der modernen verkehrswirtschaftlichen Eigentumsordnung bezeichnet.
20
An dieser Gestaltung des Eigentums waren alle Marktinteressenten zugunsten der Unbeengtheit ihrer Orientierung an den Gewinnchancen, welche die Marktlage ergibt, interessiert, und die Entwicklung zu dieser Ausprägung der Eigentumsordnung war daher vornehmlich das Werk ihres Einflusses. Bezug genommen wird auf Fichte, Handelsstaat, Buch I, 7. Kapitel, S. 470 ff.: „Weitere Erörterungen der hier aufgestellten Grundsätze über das Eigentumsrecht“. In gleichem Sinne bereits Weber, Die Wirtschaft und die Ordnungen, MWG I/22-3, S. 232 f.
5. Der sonst oft gebrauchte Ausdruck „Gemeinwirtschaft“
21
ist aus Zweckmäßigkeitsgründen vermieden, weil er ein „Gemeininteresse“ oder [295]„Gemeinschaftsgefühl“ als normal vortäuscht, welches begrifflich nicht erfordert ist: die Wirtschaft [A 62]eines Fronherren oder Großkönigs (nach Art des pharaonischen im „Neuen Reich“) gehört, im Gegensatz zur Verkehrswirtschaft, zur gleichen Kategorie wie die eines Familienhaushalts. Zur Geschichte und Vielfalt der Bedeutungen des Begriffs „Gemeinwirtschaft“ in der Nationalökonomie und in der politischen Rede vgl. Ritschl, Gemeinwirtschaft, in: HdStW5, Band 4, 1965, S. 331–346. – Max Weber hat in den frühen Vorlesungen zur Nationalökonomie noch „Verkehrswirtschaft“ und „organisierte Wirtschaft: Gemeinwirtschaft“ einander gegenüber gestellt; vgl. Weber, Theoretische Nationalökonomie, MWG III/1, S. 274 f.
6. Der Begriff der „Verkehrswirtschaft“ ist indifferent dagegen, ob „kapitalistische“, d. h. an Kapitalrechnung orientierte[,] Wirtschaften und in welchem Umfang sie bestehen. Insbesondre ist dies auch der Normaltypus der Verkehrswirtschaft: die geldwirtschaftliche Bedarfsdeckung. Es wäre falsch, anzunehmen, daß die Existenz kapitalistischer Wirtschaften proportional der Entfaltung der geldwirtschaftlichen Bedarfsdeckung stiege, vollends: in der Richtung sich entwickelte, welche sie im Okzident angenommen hat. Das Gegenteil trifft zu. Steigender Umfang der Geldwirtschaft konnte 1. mit steigender Monopolisierung der mit Großprofit verwertbaren Chancen durch einen fürstlichen Oikos Hand in Hand gehen: so in Ägypten in der Ptolemäerzeit bei sehr umfassend – nach Ausweis der erhaltenen Haushaltsbücher – entwickelter Geldwirtschaft:
22
diese blieb eben haushaltsmäßige Geldrechnung und wurde nicht: Kapitalrechnung; – 2. konnte mit steigender Geldwirtschaft „Verpfründung“[295]Vgl. hierzu Weber, Agrarverhältnisse3, MWG I/6, S. 553–556, wo Weber – gestützt auf Untersuchungen von Ulrich Wilcken – Informationen aus erhaltenen Ostraka und Fragmenten von Wirtschaftsbüchern des 3. bis 1. Jahrhunderts v. Chr. behandelt.
23
der fiskalischen Chancen eintreten, mit dem Erfolg der traditionalistischen Stabilisierung der Wirtschaft (so in China, wie am gegebenen Ort zu besprechen sein wird);Max Weber definiert und erläutert den Begriff „Verpfründung“ unten, S. 432 und den Begriff „Pfründe“, unten, S. 481.
24
– 3. konnte die kapitalistische Verwertung von Geldvermögen Anlage in nicht an Tauschchancen eines freien Gütermarkts und also nicht an Güterbeschaffung orientierten Erwerbsgelegenheiten suchen (so, fast ausschließlich, in allen außer den modern okzidentalen Wirtschaftsgebieten, aus weiterhin zu erörternden Gründen).Weber gibt einen Hinweis auf die geplante Fortsetzung des Werkes. Ausführungen hierzu finden sich in Weber, Konfuzianismus, MWG I/19, u. a. S. 219–226 und 282–284.
25
Entsprechende Ausführungen liegen in Kap. II nicht vor.
§ 15.
26
Jede innerhalb einer Menschengruppe typische Art von wirtschaftlich orientiertem sozialem Handeln und wirtschaftlicher Vergesellschaftung bedeutet in irgendeinem Umfang eine [296]besondere Art von Verteilung und Verbindung menschlicher Leistungen zum Zweck der Güterbeschaffung. Jeder Blick auf die Realitäten wirtschaftlichen Handelns zeigt eine Verteilung verschiedenartiger Leistungen auf verschiedene Menschen und eine Verbindung dieser zu gemeinsamen Leistungen in höchst verschiedenen Kombinationen mit den sachlichen Beschaffungsmitteln. In der unendlichen Mannigfaltigkeit dieser Erscheinungen lassen sich immerhin einige Typen unterscheiden.Mit § 15 beginnt eine bis § 24, unten, S. 355, reichende Kategorisierung von Typen der technischen und sozialen Leistungsverteilung und Leistungsverbindung. Eine knappe Zusammenfassung dessen hat Max Weber in der Vorlesung „Abriß der universalen Sozial- und Wirtschaftsgeschichte“ (MWG III/6, S. 87–94) vorgetragen.
f
[296] Durchschuß fehlt in A.
Menschliche Leistungen wirtschaftlicher Art können unterschieden werden als
- disponierende,27oder[296]Zur Appropriation disponierender Leistungen vgl. § 21, unten, S. 333 f.
- an Dispositionen orientierte: Arbeit (in diesem, hier weiterhin gebrauchten, Sinne des Wortes).
Disponierende Leistung ist selbstverständlich auch und zwar im stärksten denkbaren Maße Arbeit, wenn „Arbeit“ gleich Inanspruchnahme von Zeit und Anstrengung gesetzt wird. Der nachfolgend gewählte Gebrauch des Ausdrucks im Gegensatz zur disponierenden Leistung ist aber heute aus sozialen Gründen sprachgebräuchlich und wird nachstehend in diesem besonderen Sinne gebraucht. Im allgemeinen soll aber von „Leistungen“ gesprochen werden.
Die Arten, wie innerhalb einer Menschengruppe Leistung und Arbeit sich vollziehen können, unterscheiden sich in typischer Art:
1. technisch, – je nach der Art, wie für den technischen Hergang von Beschaffungsmaßnahmen die Leistungen mehrerer Mitwirkender untereinander verteilt und unter sich und mit sachlichen Beschaffungsmitteln verbunden sind;
28
Vgl. hierzu die Ausführungen in den folgenden §§ 16 und 17, unten, S. 303–308. Max Weber teilt den Stoff auf zwei Paragraphen auf, ohne schon hier die maßgeblichen Gliederungsbuchstaben A und B einzuführen.
2. sozial, – und zwar:
A) je nach der Art, wie die einzelnen Leistungen Gegenstand autokephaler und autonomer Wirtschaften
29
sind oder nicht, [297]und je nach dem ökonomischen Charakter dieser Wirtschaften; – damit unmittelbar zusammenhängend: Vgl. hierzu die Ausführungen in § 18, unten, S. 308–314.
B) je nach Maß und Art, in welchen a) die einzelnen Leistungen,
30
– b) die sachlichen Beschaffungsmittel,[297]Vgl. hierzu die Ausführungen in § 19, unten, S. 314–323.
31
– c) die ökonomischen Erwerbschancen (als Erwerbsquellen oder -Mittel) appropriiert sind oder nicht[,]Vgl. hierzu die Ausführungen in § 20, unten, S. 323–333.
32
und der dadurch bedingten Art α) der Berufsgliederung (sozial)Zur Expropriation des einzelnen Arbeiters von den sachlichen Beschaffungs-(Produktions-)Mitteln vgl. die Ausführungen in § 22, unten, S. 334–336; zur Expropriation aller Arbeiter vgl. § 23, unten, S. 337–339.
33
und ß) der Marktbildung (ökonomisch). Vgl. zur Berufsgliederung die Ausführungen in § 24, unten, S. 339–345.
Endlich
3. muß bei jeder Art der Verbindung von Leistungen unter sich und mit sachlichen Beschaffungsmitteln und bei der Art ihrer Verteilung auf [A 63]Wirtschaften und Appropriation ökonomisch gefragt werden: handelt es sich um haushaltsmäßige oder um erwerbsmäßige Verwendung?
34
Die Frage der haushaltsmäßigen oder erwerbswirtschaftlichen Verwendung behandelt Weber nicht in einem eigenen Paragraphen, sondern in den folgenden Paragraphen am gegebenen Ort mit.
Zu diesem und den weiter folgenden §§ ist vor allem zu vergleichen die dauernd maßgebende Darstellung von K[arl] Bücher in dem Art. „Gewerbe“ im HWB. d. Staatswiss[enschaften] und von demselben: „Die Entstehung der Volkswirtschaft“:
35
grundlegende Arbeiten, von deren Terminologie und Schema nur aus Zweckmäßigkeitsgründen in manchem abgewichen wird. Sonstige Zitate hätten wenig Zweck, da im nachstehenden ja keine neuen Ergebnisse, sondern ein für uns zweckmäßiges Schema vorgetragen wird. Gemeint sind: Bücher, Gewerbe3, und Bücher, Entstehung der Volkswirtschaft2; zu den Ausgaben vgl. oben, S. 216, Hg.-Anm. 2.
1. Es sei nachdrücklich betont, daß hier nur – wie dies in den Zusammenhang gehört – die soziologische Seite der Erscheinungen in tunlichster Kürze rekapituliert wird, die ökonomische aber nur so weit, als sie eben in formalen soziologischen Kategorien Ausdruck findet. Material ökonomisch würde die Darstellung erst durch Einbeziehung der bisher lediglich theoretisch berührten Preis- und Marktbedingungen. Es ließen sich diese mate rialen Seiten der Problematik aber nur unter sehr bedenklichen Einseitig[298]keiten in Thesenform in eine derartige allgemeine Vorbemerkung hineinarbeiten. Und die rein ökonomischen Erklärungsmethoden sind ebenso verführerisch wie anfechtbar. Beispielsweise so: Die für die Entstehung der mittelalterlichen, verbandsregulierten, aber „freien Arbeit“ entscheidende Zeit sei die „dunkle“ Epoche vom 10.–12. Jahrhundert und insbesondre die an Rentenchancen der Grund-, Leib- und Gerichtsherren – lauter partikulärer, um diese Chancen konkurrierender Gewalten – orientierte Lage der qualifizierten: bäuerlichen, bergbaulichen, gewerblichen Arbeit.
36
Die für die Entfaltung des Kapitalismus entscheidende Epoche sei die große chronische Preisrevolution des 16. Jahrhunderts.[298]Max Weber spricht mehrere Themen an, darunter die seinerzeit heftig umstrittene Frage der Entstehung freier Arbeit und der Zünfte sowie die Bedeutung des Grundrentenbezugs als Quelle der Nachfrage nach den Produkten unfreier und freier Arbeit. Speziell könnte er sich hier auf die sog. „hofrechtliche Theorie“ beziehen, deren Protagonist Karl W. Nitzsch gewesen ist und der sich u. a. Gustav Schmoller angeschlossen hat, während Georg von Below zu den entschiedensten Gegnern gehörte. Vgl. Nitzsch, K[arl] W., Ministerialität und Bürgerthum im 11. und 12. Jahrhundert. Ein Beitrag zur deutschen Städtegeschichte (Vorarbeiten zur Geschichte der staufischen Periode, Band 1). – Leipzig: B. G. Teubner 1859; Below, G[eorg] von, Zünfte, in: WbVW3, Band 2, 1911, S. 1384–1495; dazu auch Weber, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, MWG III/6, S. 212–219.
37
Sie bedeute absolute und relative Preissteigerung für (fast) alle (okzidentalen) Bodenprodukte, damit – nach bekannten Grundsätzen der landwirtschaftlichen ÖkonomikMaßgebend hierfür Wiebe, Georg, Zur Geschichte der Preisrevolution des XVI. und XVII. Jahrhunderts (Staats- und socialwissenschaftliche Beiträge, hg. v. August von Miaskowski, 2. Band, 2. Heft). – Leipzig: Duncker & Humblot 1895. Vgl. auch Sommerlad, Theo, Preis (Mittelalter), Abschnitt 5: Preisrevolution und Geldentwertung im 16. und 17. Jahrhundert, in: HdStW3, Band 6, 1910, S. 1178–1181. In der Vorlesung „Abriß der universalen Sozial- und Wirtschaftsgeschichte“ hat Max Weber das hier konjunktivisch Formulierte als eigene Auffassung vorgetragen; vgl. Weber, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, MWG III/6, S. 347 f.
38
– sowohl Anreiz wie Möglichkeit der Absatzunternehmung und damit des teils (in England) kapitalistischen, teils (in den Zwischengebieten zwischen der Elbe und Rußland) fronhofsmäßigen großen Betriebs. Andrerseits bedeute sie zwar teilweise (und zwar meist) absolute, nicht aber (im allge[299]meinen) relative Preissteigerung, sondern umgekehrt in typischer Art relative Preissenkung von wichtigen gewerblichen Produkten und damit, soweit die betriebsmäßigen und sonstigen äußeren und inneren Vorbedingungen dazu gegeben waren, – was in Deutschland, dessen „Niedergang“ ökonomisch eben deshalb damit einsetze, nicht der Fall gewesen sei: – Anreiz zur Schaffung konkurrenzfähiger Marktbetriebsformen. Weiterhin später in deren Gefolge: der kapitalistischen gewerblichen Unternehmungen. Vorbedingung dafür seiAlbrecht Daniel Thaers „Grundsätze der rationellen Landwirtschaft“, 4 Bände. – Berlin: Realschulbuchhandlung 1809–1812, standen in Deutschland am Anfang einer naturwissenschaftliche und ökonomische Kenntnisse verbindenden Landwirtschaftswissenschaft. In seinen Vorlesungen zur Theoretischen Nationalökonomie stützte sich Max Weber bei der Behandlung der Landwirtschaft vornehmlich auf Johann Heinrich von Thünen (vgl. Weber, Theoretische Nationalökonomie, MWG III/1, S. 584–586). Die entscheidende Rolle der Preise für die Bodennutzung, insbesondere auch für die Ausbildung von Großbetrieben mit überwiegender Marktproduktion, betonte zur Zeit Webers vor allem Friedrich Aereboe (1865–1942); vgl. Aereboe, Friedrich, Die Bewirtschaftung von Landgütern und Grundstücken. Ein Lehrbuch für Landwirte, Volkswirte, Verwaltungsbeamte und Studierende, I. Teil. Allgemeine landwirtschaftliche Betriebslehre. – Berlin: Paul Parey 1917; 4. Aufl. 1919.
g
die Entstehung von Massenmärkten. Dafür, daß diese im Entstehen gewesen seien[299]A: seien
h
, seien vor allem bestimmte Wandlungen der englischen Handelspolitik ein Symptom (von andern Erscheinungen abgesehen). – Derartige und ähnliche Behauptungen müßten zum Beleg theoretischer Erwägungen über die materialen ökonomischen Bedingtheiten der Entwicklung der Wirtschaftsstruktur verwertet werden. Das aber geht nicht an. Diese und zahlreiche ähnliche, durchweg bestreitbare, Thesen können nicht in diese absichtlich nur soziologischen Begriffe hineingenommen werden, auch soweit sie nicht ganz falsch sein sollten. Mit dem Verzicht auf diesen Versuch in dieser Form verzichten aber die folgenden Betrachtungen dieses Kapitels auch (ganz ebenso wie die vorangegangenen durch den Verzicht auf Entwicklung der Preis- und Geldtheorie) vorerst bewußt auf wirkliche „Erklärung“ und beschränken sich (vorläufig) auf soziologische Typisierung. Dies ist sehr stark zu betonen. Denn nur ökonomische Tatbestände liefern das Fleisch und Blut für eine wirkliche Erklärung des Ganges auch der soziologisch relevanten Entwicklung. Es soll eben vorerst hier nur ein Gerippe gegeben werden, hinlänglich, um mit leidlich eindeutig bestimmten Begriffen operieren zu können. A: sei
Daß an dieser Stelle, also bei einer schematischen Systematik, nicht nur die empirisch-historische, sondern auch die typisch-genetische Aufeinanderfolge der einzelnen möglichen Formen nicht zu ihrem Recht kommt, ist selbstverständlich.
2. Es ist häufig und mit Recht beanstandet worden, daß in der nationalökonomischen Terminologie „Betrieb“ und „Unternehmung“ oft nicht getrennt werden. „Betrieb“ ist auf dem Gebiet des wirtschaftlich orientierten Handelns an sich eine technische, die Art der kontinuierlichen Verbindung bestimmter Arbeitsleistungen untereinander und mit sachlichen Beschaffungsmitteln bezeichnende Kategorie. Sein Gegensatz ist: entweder a) unstetes oder b) technisch diskontinuierliches Handeln, wie es in jedem rein empirischen Haushalt fortwährend vorkommt. Der Gegensatz zu „Unternehmen“: einer Art der wirtschaftlichen Orien[A 64]tierung (am Gewinn) ist dagegen: „Haushalt“ (Orientierung an Bedarfsdeckung). Aber der Gegensatz von „Unternehmen“ und „Haushalt“ ist nicht erschöpfend. [300]Denn es gibt Erwerbshandlungen, welche nicht unter die Kategorie des „Unternehmens“ fallen: aller nackte Arbeitserwerb, der Schriftsteller-, Künstler-, Beamten-Erwerb sind weder das eine noch das andre. Während der Bezug und Verbrauch von Renten offenkundig „Haushalt“ ist.
Vorstehend ist, trotz jener Gegensätzlichkeit, von „Erwerbsbetrieb“ überall da gesprochen worden,
39
wo ein kontinuierlich zusammenhängendes dauerndes Unternehmerhandeln stattfindet: ein solches ist in der Tat ohne Konstituierung eines „Betriebes“ (eventuell: Alleinbetriebes ohne allen Gehilfenstab) nicht denkbar. Und es kam hier hauptsächlich auf die Betonung der Trennung von Haushalt und Betrieb an. Passend (weil eindeutig) ist aber – wie jetzt festzustellen ist – der Ausdruck „Erwerbsbetrieb“ statt: kontinuierliches Erwerbsunternehmen nur für den einfachsten Fall des Zusammenfallens der technischen Betriebseinheit mit der Unternehmungseinheit. Es können aber in der Verkehrswirtschaft mehrere, technisch gesonderte, „Betriebe“ zu einer „Unternehmungseinheit“ verbunden sein. Diese letztere ist dann aber natürlich nicht durch die bloße Personalunion des Unternehmers, sondern wird durch die Einheit der Ausrichtung auf einen[300]Oben, S. 258 f., 261, 264, 269–272.
i
irgendwie einheitlich gestalteten Plan der Ausnutzung zu Erwerbszwecken konstituiert (Übergänge sind daher möglich). Wo nur von „Betrieb“ die Rede ist, soll jedenfalls darunter immer jene technisch – in Anlagen, Arbeitsmitteln, Arbeitskräften und (eventuell: heterokepha1er und heteronomer) technischer Leitung – gesonderte Einheit verstanden werden, die es ja auch in der kommunistischen Wirtschaft (nach dem schon jetzt geläufigen Sprachgebrauch)[300]A: einem
40
gibt. Der Ausdruck „Erwerbsbetrieb“ soll fortan nur da verwendet werden, wo technische und ökonomische (Unternehmungs-)Einheit identisch sind. Wie oben, S. 293, Hg.-Anm. 15, erläutert, hat der Begriff „Kommunismus“ bzw. „kommunistisch“ durch Lenin eine Wiederbelebung und spezifische Deutung erfahren. Die Oktoberrevolution in Rußland und die Programmatik kommunistischer Parteien in mehreren Ländern brachten es mit sich, daß der Begriff „kommunistische Wirtschaft“ im Sinne einer zentral verwalteten Wirtschaft innerhalb kurzer Zeit geläufig wurde.
Die Beziehung von „Betrieb“ und „Unternehmung“ wird terminologisch besonders akut bei solchen Kategorien wie „Fabrik“
41
und „Hausindustrie“.Zu Max Webers Begriff „Fabrik“, insbesondere zu Merkmalen der ‚heutigen‘ Fabrik, vgl. unten, S. 331 ff., sowie Weber, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, MWG III/6, S. 227–229.
42
Die letztere ist ganz klar eine Kategorie der Unternehmung. [301]„Betriebsmäßig“ angesehen stehen ein kaufmännischer Betrieb und Betriebe als Teil der Arbeiterhaushaltungen (ohne – außer bei ZwischenmeisterorganisationMax Weber weicht von Karl Bücher ab. Dieser hat den Begriff „Hausindustrie“ als „mißverständlich“ bezeichnet und spricht von „Verlagssystem“ (vgl. Bücher, Entstehung der Volkswirtschaft2, S. 151). In diesem Kapitel bevorzugt Weber durchge[301]hend den Begriff „Hausindustrie“, während er in der Vorlesung „Abriß der universalen Sozial- und Wirtschaftsgeschichte“ zumeist von „Verlagssystem“ redet; vgl. Weber, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, MWG III/6, S. 219–227.
43
– Werkstattarbeit) mit spezifizierten Leistungen an den kaufmännischen Betrieb und umgekehrt dieses an jene nebeneinander; der Vorgang ist also rein betriebsmäßig gar nicht verständlich, sondern es müssen die Kategorien: Markt, Unternehmung, Haushalt (der Einzelarbeiter), erwerbsmäßige Verwertung der entgoltenen Leistungen dazutreten. „Fabrik“ könnte man an sich – wie dies oft vorgeschlagen istIn den hausindustriellen Organisationen des 19. Jahrhunderts traten häufig, insbesondere im Bekleidungsgewerbe, zwischen den Verleger und die Heimarbeiter Personen, Zwischenmeister genannt, die die Aufträge und evtl. Rohstoffe auf die von ihnen organisierten Heimarbeiter verteilten und deren Produkte wieder einsammelten und sie gegebenenfalls vor Ablieferung beim Verleger noch in ihrer eigenen Werkstatt weiter verarbeiteten. Vgl. Bücher, Gewerbe3, S. 867 f.
44
– ökonomisch indifferent insofern definieren, als die Art der Arbeiter (frei oder unfrei), die Art der Arbeitsspezialisierung (innere technische Spezialisierung oder nicht) und der verwendeten Arbeitsmittel (Maschinen oder nicht) beiseite gelassen werden kann. Also einfach: als Werkstattarbeit. Immerhin muß aber außerdem die Art der Appropriation der Werkstätte und der Arbeitsmittel (an einen Besitzer) in die Definition aufgenommen werden, sonst zerfließt der Begriff wie der des „Ergasterion“.In der nationalökonomischen Fachliteratur sind derartige Vorschläge nicht nachweisbar. Max Weber bezieht sich vermutlich auf Historiker wie Hugo Blümner, Eduard Meyer, Julius Beloch und Walter Otto, welche hellenisch-byzantinische Werkstätten als „Fabrik“ bezeichnet haben. Vgl. Blümner, Hugo, Technologie und Terminologie der Gewerbe und Künste bei Griechen und Römern, 4 Bände. – Leipzig: B. G. Teubner 1875–1887; Meyer, Eduard, Die Sclaverei im Altertum. Vortrag, gehalten in der Gehe-Stiftung zu Dresden am 15. Januar 1898 (Vorträge der Gehe-Stiftung, 16). – Dresden: Zahn & Jaensch 1898, S. 13; Beloch, Julius, Großindustrie im Altertum, in: Zeitschrift für Sozialwissenschaft, Band 2, 1899, S. 17–26. Max Weber kritisiert dies mehrfach in: Weber, Agrarverhältnisse3, MWG I/6 u. a. S. 329 f., 523, 528.
45
Und geschieht einmal dies, dann scheint es prinzipiell zweckmäßiger, „Fabrik“ wie „Hausindustrie“ zu zwei streng ökonomischen Kategorien der Kapitalrechnungsunternehmung zu stempeln. Bei streng sozialistischer Ordnung würde die „Fabrik“ dann so wenig wie die „Hausindustrie“ vorkommen, sondern nur: naturale Werkstätten, Anlagen, Maschinen, Werkzeuge, Werkstatt- und Heimarbeitsleistungen aller Art.Zum Begriff und zur Mannigfaltigkeit der Erscheinungsformen des Ergasterions (griech. Werkstätte) vgl. unten, S. 331, sowie Weber, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, MWG III/6, S. 199 ff.
[302]3. Es ist nachstehend über das Problem der ökonomischen „Entwicklungsstufen“
46
noch nichts bzw. nur soweit nach der Natur der Sache absolut unvermeidlich und beiläufig etwas zu sagen. Nur soviel sei hier vorweg bemerkt: [302]Das Konzept der Entwicklungsstufen war ein zu Webers Zeit heftig umstrittener Gegenstand. Vorstellungen von einer Abfolge von Produktionsweisen oder Arten der wirtschaftlichen Vergemeinschaftung gibt es seit der Antike. Im 19. Jahrhundert, insbesondere bei Friedrich List und Karl Marx sowie Hauptvertretern der Historischen Schule der Nationalökonomie, rückte die Frage nach der zweckmäßigen Typisierung der Phasen wirtschaftlicher Entwicklung und der Gesetzmäßigkeit ihrer Abfolge in den Vordergrund. Vgl. Schönberg, Gustav von, Die Volkswirtschaft, in: Handbuch der Politischen Ökonomie, 3. Aufl., 1. Band. – Tübingen: H. Laupp’sche Buchhandlung 1890, S. 1062–1065; Below, Georg von, Wirtschaftsstufen, in: WbVW3, Band 2, 1911, S. 1382–1384; Bücher, Karl, Volkswirtschaftliche Entwicklungsstufen, in: GdS, Abt. I, 1914, S. 1–18.
Mit Recht zwar unterscheidet man neuerdings genauer: Arten der Wirtschaft und Arten der Wirtschaftspolitik. Die von Schönberg präludierten Schmollerschen und seitdem abgewandelten Stufen: Hauswirtschaft, Dorfwirtschaft – dazu als weitere „Stufe“: grundherrliche und patrimonialfürstliche Haushalts-Wirtschaft –, Stadtwirtschaft, Territorialwirtschaft, Volkswirtschaft waren in seiner Terminologie bestimmt durch die Art des wirtschaftsregulierenden Verbandes.
47
Aber es ist nicht gesagt, daß auch nur die Art dieser Wirtschaftsregulierung bei Verbänden verschiedenen Umfangs verschieden wäre. So ist die deutsche „Territorialwirtschaftspolitik“ in ziemlich weitgehendem Umfang nur eine Übernahme der stadtwirtschaftlichen Regulierungen gewesen und waren ihre neuen Maßnahmen nicht spezifisch verschieden von der „merkantilistischen“Gustav Schönberg beschrieb 1867 eine Abfolge von drei „Wirtschaftszuständen“: Haus-, Stadt- und Volkswirtschaft. Hieran anknüpfend unterschied Gustav Schmoller vier „Grundstufen“: Dorf-, Stadt-, Territorial- und Volkswirtschaft. Vgl. Schönberg, Gustav, Zur wirthschaftlichen Bedeutung des deutschen Zunftwesens im Mittelalter, in: Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, Band 9, 1867, S. 1–72 u. 97–169; Schmoller, Gustav, Studien über die wirthschaftliche Politik Friedrichs des Großen und Preußens überhaupt von 1680 bis 1786. II. Das Merkantil-System in seiner historischen Bedeutung: städtische, territoriale und staatliche Wirthschaftspolitik, in: Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft im Deutschen Reich, N. F. 8. Jg., Heft 1, 1884, S. 15–61.
48
Politik spezifisch patrimonialer, dabei aber schon relativ rationaler Staatenverbände (also insoweit „Volkswirtschaftspolitik“ nach dem üblichen, wenig glückli[303]chen Ausdruck).Als Merkantilsystem bzw. Merkantilismus wird einerseits ein Konglomerat nationalökonomischer Lehren des 16. bis 18. Jahrhunderts bezeichnet, andererseits die fiskal-, geld-, handels- und gewerbepolitische Praxis der absolutistisch regierten Territorialstaaten Europas in diesem Zeitraum. Vgl. Leser, Emanuel, Merkantilsystem, in: HdStW3, Band 6, 1910, S. 650–658; Lexis, Wilhelm, Merkantilsystem, in: WbVW3, Band 2, 1911, S. 374–377.
49
Vollends aber ist nicht gesagt, daß die innere Struktur der Wirtschaft: die Art der Leistungsspezifikation oder -Spezialisierung[303]Konkrete Anhaltspunkte dafür, warum Weber den Begriff „Volkswirtschaftspolitik“, den er in seiner Freiburger Antrittsrede „Der Nationalstaat und die Volkswirtschaftspolitik“ (MWG I/4, S. 543 ff.) ohne jede Einschränkung verwendet hat, wenig glücklich nennt, lassen sich in seinem Werk nicht nachweisen. Weil Weber häufig von „Wirtschaftspolitik“ ohne Einschränkungen spricht, ist zu vermuten, daß der Grund für seine Kritik in dem Begriffselement „Volk“ und den mit ihm verbundenen Unklarheiten liegt. Hierzu vgl. u. a. Weber, Roscher und Knies I, S. 9 ff.
50
und -Verbindung, die Art der Verteilung dieser Leistungen auf selbständige Wirtschaften und die Art [A 65]der Appropriation von Arbeitsverwertung, Beschaffungsmitteln und Erwerbschancen mit demjenigen Umfang des Verbandes parallel ging, der (möglicher!) Träger einer Wirtschaftspolitik war und vollends: daß sie mit dem Umfang dieses immer gleichsinnig wechsle. Die Vergleichung des Okzidents mit Asien und des modernen mit dem antiken Okzident würde das Irrige dieser Annahme zeigen. Dennoch kann bei der ökonomischen Betrachtung niemals die Existenz oder Nicht-Existenz material wirtschaftsregulierender Verbände – aber freilich nicht nur gerade: politischer Verbände – und der prinzipielle Sinn ihrer Regulierung beiseite gelassen werden. Die Art des Erwerbs wird dadurch sehr stark bestimmt. Zu Max Webers Unterscheidung zwischen Leistungsspezifikation (auch Leistungsspezifizierung genannt) und Leistungsspezialisierung vgl. unten, S. 304 und 339.
4. Zweck der Erörterung ist auch hier vor allem: Feststellung der optimalen Vorbedingungen formaler Rationalität der Wirtschaft und ihrer Beziehung zu materialen „Forderungen“ gleichviel welcher Art.
§ 16. I.
51
Technisch unterscheiden sich die Arten der Leistungs-Gliederung: Zum Gliederungszusammenhang vgl. oben, S. 296 f.
A. je nach der Verteilung und Verbindung der Leistungen. Und zwar:
1. je nach der Art der Leistungen, die ein und dieselbe Person auf sich nimmt. Nämlich:
a) entweder liegen in ein und derselben Hand
- zugleich leitende und ausführende, oder
- nur das eine oder das andere, –e[303]e(S. 220, ab: in concreto)–e Zu dieser Textpassage sind Korrekturfahnen überliefert; vgl. dazu den Anhang, unten, S. 605–663.
[304]Zu a: der Gegensatz ist natürlich relativ, da gelegentliches „Mitarbeiten“ eines normalerweise nur Leitenden (großen Bauern z. B.) vorkommt. Im übrigen bildet jeder Kleinbauer oder Handwerker oder Kleinschiffer den Typus von α.
b) entweder
j
vollzieht ein und dieselbe Person [304]A: Entweder
α. technisch verschiedenartige und verschiedene Endergebnisse hervorbringende Leistungen (Leistungskombination) und zwar entweder
- wegen mangelnder Spezialisierung der Leistung in ihre technischen Teile,
- im Saison-Wechsel, – oder
- zur Verwertung von Leistungskräften, die durch eine Hauptleistung nicht in Anspruch genommen werden (Nebenleistung).
Oder es vollzieht eine und dieselbe Person
ß. nur besondersartige Leistungen, und zwar entweder
- besondert nach dem Endergebnis: so also, daß der gleiche Leistungsträger alle zu diesem Erfolg erforderlichen, technisch untereinander verschiedenartigen simultanen und sukzessiven Leistungen vollzieht (so daß also in diesem Sinn Leistungskombination vorliegt): Leistungsspezifizierung; – oder
- technisch spezialisiert nach der Art der Leistung, so daß erforderlichenfalls das Endprodukt nur durch (je nachdem) simultane oder sukzessive Leistungen mehrerer erzielt werden kann: Leistungsspezialisierung.
Der Gegensatz ist vielfach relativ, aber prinzipiell vorhanden und historisch wichtig.
Zu b, α: Der Fall αα besteht typisch in primitiven Hauswirtschaften, in welchen – vorbehaltlich der typischen Arbeitsteilung der Geschlechter (davon in Kap. V)
52
– jeder alle Verrichtungen je nach Bedarf besorgt. [304] Ein entsprechendes Kapitel liegt nicht vor; vgl. den Anhang zum Editorischen Bericht, oben, S. 109.
Für den Fall ßß war typisch der Saison-Wechsel zwischen Landwirtschaft und gewerblicher Winterarbeit.
[305]Für γγ der Fall ländlicher Nebenarbeit von städtischen Arbeitern und die zahlreichen „Nebenarbeiten“, die – bis in moderne Büros hinein – übernommen wurden, weil Zeit frei blieb.
Zu b, ß: Für den Fall αα ist die Art der Berufsgliederung des Mittelalters typisch: eine Unmasse von Gewerben, welche sich je auf ein Endprodukt spezifizierten, aber ohne alle Rücksicht darauf, daß technisch oft heterogene Arbeitsprozesse zu diesem hinführten, also: Leistungskombination bestand. Der Fall ßß umschließt die gesamte moderne Entwicklung der Arbeit. Doch ist vom streng psychophysischen [A 66]Standpunkt aus kaum irgendeine[,] selbst die höchstgradig „spezialisierte“ Leistung wirklich bis zum äußersten Maße isoliert; es steckt immer noch ein Stück Leistungs-Spezifikation darin, nur nicht mehr orientiert nach dem Endprodukt, wie im Mittelalter.
Die Art der Verteilung und Verbindung der Leistungen (siehe oben A)
53
ist ferner verschieden: [305]Max Weber verweist auf den Anfang von Kap. II, § 16, oben, S. 303.
2. Je nach der Art, wie die Leistungen mehrerer Personen zur Erzielung eines Erfolges verbunden werden. Möglich ist:
a) Leistungshäufung: technische Verbindung gleichartiger Leistungen mehrerer Personen zur Herbeiführung eines Erfolges:
α. durch geordnete, technisch unabhängig voneinander verlaufende Parallel-Leistungen, –
ß. durch technisch zu einer Gesamtleistung vergesellschaftete (gleichartige) Leistungen.
Für den Fall α können parallel arbeitende Schnitter
54
oder Pflästerer,Auf großen Ackerflächen arbeiteten bei der Getreideernte u.U. eine größere Zahl von mit der Sense Mähenden hintereinander gestaffelt in parallelen Streifen im selben Tempo.
55
für den Fall ß die, namentlich in der ägyptischen Antike im größten Maßstab (Tausende von Zwangs-Arbeitern) vorkommenden Transportleistungen von Kolossen durch Zusammenspannen zahlreicher die gleiche Leistung (Zug an Stricken) Vollbringender als Beispiele gebraucht werden. Bei der Verlegung eines aus einzelnen Steinen bestehenden Straßenpflasters waren in der Regel mehrere Arbeiter gestaffelt in parallelen Bahnen tätig.
b) Leistungsverbindung: technische Verbindung qualitativ verschiedener, also: spezialisierter (A 1 b ß, ßß) Leistungen zur Herbeiführung eines Erfolges:
[306]α. durch technisch unabhängig voneinander
- simultan, also: parallel –
- sukzessiv spezialisiert vorgenommene Leistungen, oder
ß. durch technisch vergesellschaftete spezialisierte (technisch komplementäre) Leistungen in simultanen Akten.
1. Für den Fall α, αα sind die parallel laufenden Arbeiten etwa des Spinnens an Kette und Schuß ein besonders
k
einfaches Beispiel,[306]A: besonderes
56
dem sehr viele ähnliche, letztlich alle schließlich auf ein Gesamt-Endprodukt hinzielenden[,] nebeneinander technisch unabhängig herlaufenden Arbeitsprozesse zur Seite zu stellen sind. Zu Kette und Schuß vgl. oben, S. 276, Hg.-Anm. 71. Weil Kett- und Schußfäden beim Weben unterschiedlichen Belastungen ausgesetzt sind, werden die grundsätzlich in verschiedenen Spinnprozessen hergestellt.
2. Für den Fall α, ßß gibt die Beziehung zwischen Spinnen, Weben, Walken, Färben, Appretieren das übliche und einfachste, in allen Industrien sich wiederfindende Beispiel.
3. Für den Fall ß gibt, von dem Halten des Eisenstücks und dem Hammerschlag des Schmiedes angefangen (das sich im großen in jeder modernen Kesselschmiede wiederholt), jede Art des einander „In-die-Hand-Arbeitens“ in modernen Fabriken – für welche dies zwar nicht allein spezifisch, aber doch ein wichtiges Charakteristikum ist – den Typus. Das Ensemble eines Orchesters oder einer Schauspielertruppe sind ein außerhalb des Fabrikhaften liegender höchster Typ.
§ 17. (noch: I. vgl. § 16).
57
Gemeint ist die Fortsetzung des in § 16 mit I A Begonnenen, oben, S. 303. Zur Aufteilung des Stoffes zu Abschnitt I auf zwei Paragraphen vgl. oben, S. 296, Hg.-Anm. 28.
Technisch unterscheiden sich die Arten der Leistungs-Gliederung ferner:
B. je nach Maß und Art der Verbindung mit komplementären sachlichen Beschaffungsmitteln. Zunächst,
1. je nachdem sie
a) reine Dienstleistungen darbieten
Beispiele: Wäscher, Barbiere, künstlerische Darbietungen von Schauspielern usw.
[307]b) Sachgüter herstellen oder umformen, also: „Rohstoffe“ bearbeiten, oder transportieren. Näher: je nachdem sie
- Anbringungsleistungen, oder
- Güterherstellungsleistungen, oder
- Gütertransportleistungen sind. Der Gegensatz ist durchaus flüssig.
[A 67]Beispiele von Anbringungsleistungen: Tüncher, Dekorateure, Stukkateure usw.
Ferner:
2. je nach dem Stadium der Genußreife, in welches sie die beschafften Güter versetzen. –
Vom landwirtschaftlichen bzw. bergbaulichen Rohprodukt bis zum genußreifen und: an die Stelle des Konsums verbrachten Produkt.
3. endlich: je nachdem sie benützen:
a) „Anlagen“ und zwar:
αα) Kraftanlagen, d. h. Mittel zur Gewinnung von verwertbarer Energie und zwar
1. naturgegebener (Wasser, Wind, Feuer), – oder
2. mechanisierter (vor Allem: Dampf- oder elektrischer oder magnetischer) Energie;
ßß) gesonderte Arbeitswerkstätten,
b) Arbeitsmittel,
58
und zwar [307]Der Begriff „Arbeitsmittel“ ist von Karl Marx in die politische Ökonomie eingeführt und wie folgt definiert worden: „Das Arbeitsmittel ist ein Ding oder ein Komplex von Dingen, die der Arbeiter zwischen sich und den Arbeitsgegenstand schiebt und die ihm als Leiter seiner Thätigkeit auf diesen Gegenstand dienen.“ Vgl. Marx, Karl, Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie, 3 Bände, Band 1: Der Produktionsproceß des Capitals, 3. Aufl. – Hamburg: Otto Meissner 1883, S. 157. Die von Weber davon unterschiedenen „Anlagen“ hat Marx in seine Darstellung der Elemente des Arbeitsprozesses nicht einbezogen.
- Werkzeuge,
- Apparate,
- Maschinen,
eventuell: nur das eine oder andere oder keine dieser Kategorien von Beschaffungsmitteln. Reine „Werkzeuge“ sollen solche Arbeitsmittel heißen, deren Schaffung an den psychophysischen Bedingungen menschlicher Handarbeit orientiert ist, [308]„Apparate“ solche, an deren Gang menschliche Arbeit sich als „Bedienung“ orientiert, „Maschinen“: mechanisierte Apparate. Der durchaus flüssige Gegensatz hat für die Charakterisierung bestimmter Epochen der gewerblichen Technik eine gewisse Bedeutung.
59
[308]Dafür, daß die Besonderheit der Maschine in ihrem epocheprägenden Charakter erfaßt worden ist, gibt es zahlreiche literarische Beispiele, z. B. Suttner, Bertha von, Das Maschinenzeitalter. Zukunftsvorlesungen über unsere Zeit. – Zürich: Verlags-Union 1889; Schmoller, Gustav von, Über das Maschinenzeitalter in seinem Zusammenhang mit dem Volkswohlstand und der sozialen Verfassung der Volkswirtschaft. – Berlin: Julius Springer 1903.
Die für die heutige Großindustrie charakteristische mechanisierte Kraftanlagen- und Maschinen-Verwendung ist technisch bedingt durch a) spezifische Leistungsfähigkeit und Ersparnis an menschlichem Arbeitsaufwand, und b) spezifische Gleichmäßigkeit und Berechenbarkeit der Leistung nach Art und Maß. Sie ist daher rational nur bei hinlänglich breitem Bedarf an Erzeugnissen der betreffenden Art. Unter den Bedingungen der Verkehrswirtschaft also: bei hinlänglich breiter Kaufkraft für Güter der betreffenden Art, also: entsprechender Geldeinkommengestaltung.
Eine Theorie der Entwicklung der Werkzeug- und Maschinentechnik und -Ökonomik könnte hier natürlich nicht einmal in den bescheidensten Anfängen unternommen werden. Unter „Apparaten“ sollen Arbeitsgeräte wie etwa der durch Treten in Bewegung gesetzte Webstuhl und die zahlreichen ähnlichen verstanden werden, die immerhin schon die Eigengesetzlichkeit der mechanischen Technik gegenüber dem menschlichen (oder: in andern Fällen: tierischen) Organismus zum Ausdruck brachten und ohne deren Existenz (namentlich die verschiedenen „Förderungsanlagen“ des Bergbaues gehörten dahin) die Maschine in ihren heutigen Funktionen nicht entstanden wäre. (Lionardo’s „Erfindungen“ waren „Apparate“.)
60
Von Lionardo oder Leonardo da Vinci ist eine Fülle von Zeichnungen technischen Inhalts überliefert, in denen Ideen für neuartige Gerätschaften zu erkennen sind. Vgl. dazu Feldhaus, Franz Maria, Leonardo der Techniker und Erfinder. – Jena: Eugen Diederichs 1913.
§ 18. II.
61
Sozial unterscheidet sich die Art der Leistungsverteilung: Folgt Abschnitt I in den §§ 16 und 17, oben, S. 303 ff. Zum Gliederungszusammenhang vgl. oben, S. 296 f.
[309]A. je nach der Art, wie qualitativ verschiedene oder wie insbesondere komplementäre Leistungen auf autokephale und (mehr oder minder) autonome Wirtschaften verteilt sind und alsdann weiterhin ökonomisch, je nachdem diese sind: a) Haushaltungen, b) Erwerbsbetriebe.
62
Es kann bestehen: [309]Entsprechend der von Max Weber oben, S. 299 f., getroffenen Unterscheidung zwischen „Betrieb“ und „Unternehmen“ würde man hier „Erwerbsunternehmen“ erwarten, wie Weber auch im Folgenden formuliert hat.
1. Einheitswirtschaft mit rein interner, also: völlig heterokephaler und heteronomer, rein technischer, Leistungsspezialisierung (oder: -Spezifizierung) und Leistungsverbindung (einheitswirtschaftliche Leistungsverteilung). Die Einheitswirtschaft kann ökonomisch sein:
- ein Haushalt,
- ein Erwerbsunternehmen.
Ein Einheits-Haushalt wäre im größten Umfang eine kommunistische Volkswirtschaft, im kleinsten war es die primitive Familienwirtschaft, welche alle [A 68]oder die Mehrzahl aller Güterbeschaffungsleistungen umschloß (geschlossene Hauswirtschaft).
63
Der Typus des Erwerbsunternehmens mit interner Leistungsspezialisierung und -Verbindung ist natürlich die kombinierte Riesenunternehmung bei ausschließlich einheitlichem händlerischem Auftreten gegen Dritte. Diese beiden Gegensätze eröffnen und schließen (vorläufig) die Entwicklung der autonomen „Einheitswirtschaften“. Zum Begriff „geschlossene Hauswirtschaft“ vgl. oben, S. 273.
2. Oder es besteht Leistungsverteilung zwischen autokephalen Wirtschaften. Diese kann sein:
a) Leistungsspezialisierung oder -Spezifizierung zwischen heteronomen, aber autokephalen Einzelwirtschaften, welche sich an einer paktierten oder oktroyierten Ordnung orientieren. Diese Ordnung kann, material, ihrerseits orientiert sein:
1. an den Bedürfnissen einer beherrschenden Wirtschaft, und zwar entweder:
α. eines Herrenhaushalts (oikenmäßige Leistungsverteilung), oder
ß. einer herrschaftlichen Erwerbswirtschaft;
l
[309]A: Erwerbswirtschaft.
[310]2. an den Bedürfnissen der Glieder eines genossenschaftlichen Verbandes (verbandswirtschafliche Leistungsverteilung), und zwar, ökonomisch angesehen, entweder
- haushaltsmäßig, oder
- erwerbswirtschaftlich.
Der Verband seinerseits kann in allen diesen Fällen denkbarer Weise sein:
I. nur (material) wirtschaftsregulierend, oder
II. zugleich Wirtschaftsverband. – Neben allem dem steht
b) Verkehrswirtschaftliche Leistungsspezialisierung zwischen autokephalen und autonomen Wirtschaften, welche sich material lediglich an der Interessenlage, also formal lediglich an der Ordnung eines Ordnungsverbandes (II § 5
m
, d)[310]A: I § 15
64
orientieren. [310]Oben, S. 233. Die Verweisangaben im Erstdruck wurden emendiert; Kap. I, § 15, d, gibt es nicht. Die Referenzstelle befindet sich in Kap. II, § 5.
1. Typus für den Fall I: nur wirtschaftsregulierender Verband, vom Charakter 2 (Genossenverband) und α (Haushalt): das indische Dorfhandwerk („establishment“);
65
für den Fall II: Wirtschaftsverband, vom Charakter 1 (Herrenhaushalt) ist es die Umlegung fürstlicher oder grundherrlicher oder leibherrlicher Haushaltsbedürfnisse (oder auch, bei Fürsten: politischer Bedürfnisse) auf Einzelwirtschaften der Untertanen, Hintersassen, Hörigen oder Sklaven oder DorfkötterZum Charakter des indischen Dorfhandwerks und der besonderen Rolle jener Handwerker, die für ihre Leistungen nicht im einzelnen entlohnt wurden, sondern kleine Landparzellen zu erblichem Besitz nutzten und darüber hinaus Ernteanteile oder Deputate erhielten (in englischer Terminologie „establishment“) vgl. Weber, Hinduismus, MWG I/20, S. 118 f., und Weber, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, MWG III/6, S. 115 f.
66
oder demiurgischenIn Norddeutschland Bezeichnung für Dorfbewohner, die einen Kotten, d. h. ein kleines landwirtschaftliches Anwesen, bewirtschafteten, welches zu ihrem Lebensunterhalt beitrug. Vornehmlich waren sie Arbeitskräfte auf dem Herrenhof und bei Bauern, vielfach auch handwerklich tätig.
n
(s. u.)A: demiurgische
67
Dorfhandwerker, die sich in der ganzen Welt urwüchsig fand. Nur wirtschaftsregulierend (1) im Fall 1 waren oft z. B. die kraft Bannrechts des Grundherren, im Fall 2 die kraft Bannrechts der Stadt gebotenen GewerbeleistungenUnten, S. 311.
o
(soweit sie, wie häufig, nicht materiale, sondern lediglich fiskalische Zwecke verfolgten). Erwerbswirtschaftlich (Fall a 1 ß): Umlegung hausindustrieller Leistungen auf Einzelhaushalte. A: Gewerbeleistungen,
[311]Der Typus für a 2 ß im Falle II sind alle Beispiele oktroyierter Leistungsspezialisierung in manchen sehr alten Kleinindustrien. In der Solinger Metallindustrie war ursprünglich genossenschaftlich paktierte Leistungsspezialisierung vorhanden, die erst später herrschaftlichen (Verlags-)Charakter annahm.
68
[311]Solingen war seit dem 13. Jahrhundert ein Zentrum der Schwert- und Messerschmiede. Bis zum 16. Jahrhundert bestand das Gewerbe aus zahlreichen horizontal und vertikal hoch spezialisierten Werkstätten von Handwerksmeistern, die in Zünften organisiert waren. Im 17. Jahrhundert vollzog sich ein Wechsel des Betriebssystems hin zur Hausindustrie, in der die Meister Lohnempfänger der Verleger wurden. Dabei entwickelte sich in Solingen eine eigentümlich-herrschaftliche Verfassung des Arbeitsmarktes. Vgl. Thun, Alphons, Die Industrie am Niederrhein und ihre Arbeiter, 2. Theil: Die Industrie des bergischen Landes (Solingen, Remscheid und Elberfeld-Barmen) (Staats- und socialwissenschaftliche Forschungen, hg. v. Gustav Schmoller, Band II, Heft 3). – Leipzig: Duncker & Humblot 1879, S. 5–105; Dransfeld, Friedrich Wilhelm, Solinger Industrie-Verhältnisse im 18. Jahrhundert. Ein Beitrag zum Kapitel: Kampf zwischen Kapital und Arbeit. – Solingen: Schmitz & Olbert 1914.
Für den Fall a 2 ß I (nur regulierender Verband) sind alle „dorf“- oder „stadtwirtschaftlichen“ Ordnungen des Verkehrs, soweit sie material in die Art der Güterbeschaffung eingriffen, Typen.
Der Fall 2 b ist der der modernen Verkehrswirtschaft.
Im einzelnen sei noch folgendes hinzugefügt:
2. Hauswirtschaftlich orientiert sind die Verbandsordnungen im Fall a 2 α I in besonderer Art: dadurch, daß sie am vorausgesehenen Bedarf der einzelnen Genossen orientiert sind, nicht an Haushaltszwecken des (Dorf-)Verbandes. Derartig orientierte spezifizierte Leistungspflichten sollen demiurgische Naturalleiturgien heißen, diese Art der Bedarfsvorsorge: demiurgische Bedarfsdeckung.
69
Stets handelt es sich um verbandsmäßige Regulierungen der Arbeitsverteilung und – eventuell – Arbeitsverbindung. In „Agrarverhältnisse im Altertum“ beschreibt Max Weber den Demiurgos (griech. Handwerker) als einen auf gewerblichem Gebiet „für das Volk“, d. h. für jeden, der sein Kunde werden will, arbeitenden Berufshandwerker. Dabei greife der Ausdruck „von jeher viel weiter als unser ‚Handwerk‘, er umfaßt allen Erwerb aus Dienst für eine unbestimmte Vielheit, auch den der Ärzte, Sänger, Wahrsager usw.“ Vgl. Weber, Agrarverhältnisse3, MWG I/6, S. 475–477, Zitate: S. 476 und 477. Über demiurgische Leistungen für einen Konsumenten-Verband vgl. auch unten, S. 349 f.
Wenn dagegen (Fälle 2 a II) der Verband selbst (sei es ein herrschaftlicher oder genossenschaftlicher) eine eigene Wirtschaft hat, für welche Leistungen spezialisiert umgelegt werden, so soll diese Bezeichnung nicht verwendet werden. Für diese Fälle bilden die Typen die spezialisierten oder spezifizierten Naturalleistungsordnungen von Fronhöfen, Grundherrschaften
70
und anderen Großhaushaltungen. Aber auch die von Fürsten, [312]politischen und kommunalen oder anderen primär außerwirtschaftlich orientierten Verbänden für den herrschaftlichen oder Verbandshaushalt umgelegten Leistungen. Derart qualitativ spezifizierend geordnete Robott- oder Lieferungs[A 69]pflichten von Bauern, Handwerkern, Händlern sollen bei persönlichen Großhaushaltungen als Empfängern oikenmäßige, bei Verbandshaushaltungen als Empfängern verbandsmäßige Naturalleiturgien heißen, das Prinzip dieser Art von Versorgung des Haushalts eines wirtschaftenden Verbandes: leiturgische Bedarfsdeckung. Diese Art von Bedarfsdeckung hat eine außerordentlich bedeutende historische Rolle gespielt, von der noch mehrfach zu sprechen sein wird.Zum Begriff vgl. den Glossar-Eintrag, unten, S. 743; zu den Strukturmerkmalen der Grundherrschaft vgl. unten, S. 327 f. und 347. Max Weber hat Probleme der Grundherrschaft wiederholt ausführlich behandelt, vgl. Weber, Patrimonialismus, MWG I/22-[312]4, S. 235–370; Weber, Feudalismus, MWG I/22-4, S. 371–453, Weber, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, MWG III/6, S. 149–157.
71
In politischen Verbänden hat sie die Stelle der modernen FinanzenMax Weber verweist nach unten, S. 339, 341, 433 und 438.
72
vertreten, in Wirtschaftsverbänden bedeutete sie eine „Dezentralisierung“ des Großhaushalts durch Umlegung des Bedarfs desselben auf nicht mehr im gemeinsamen Haushalt unterhaltene und verwendete, sondern je ihre eignen Haushaltungen führende, aber dem Verbandshaushalt leistungspflichtige, insoweit also von ihm abhängige, Fron- und Naturalzins-Bauern, Gutshandwerker und Leistungspflichtige aller Art. Für den Großhaushalt der Antike hat Rodbertus zuerst den Ausdruck „Oikos“ verwendet, dessen Begriffsmerkmal die – prinzipielle – Autarkie der Bedarfsdeckung durch Hausangehörige oder haushörige Arbeitskräfte, welchen die sachlichen Beschaffungsmittel tauschlos zur Verfügung stehen, sein sollte.Zu den „Finanzen“ im weiten, auch die Naturalbeschaffung einbeziehenden, und im modernen Sinn vgl. unten, S. 429 ff.
73
In der Tat stellen die grundherrlichen und noch mehr die fürstlichen Haushaltungen der Antike (vor allem: des „Neuen Reichs“ in Ägypten)Zum Begriff „Oikos“ vgl. den Glossar-Eintrag, unten, S. 748. Auf Karl Rodbertus, dessen Leistung und zugestandene Irrtümer weist Max Weber schon oben (S. 271) hin, ohne dort den Begriff „Oikos“ zu erwähnen; zu den Quellen vgl., ebd., Hg.-Anm. 57.
74
in einer allerdings sehr verschieden großen Annäherung (selten: reine) Typen solcher, die Beschaffung des Großhaushaltsbedarfs auf abhängige Leistungspflichtige (Robott- und Abgabepflichtige) umlegende Haushaltungen dar. Das gleiche findet sich zeitweise in China und Indien und, in geringerem Maß, in unserem Mittelalter, vom Kapitulare de villis angefangen:Hinsichtlich der Chronologie der ägyptischen Geschichte folgt Max Weber, Agrarverhältnisse3 (MWG I/6, S. 300–747), der Einteilung von: Erman, Adolf, Ägypten und ägyptisches Leben im Altertum, Band 1. – Tübingen: H. Laupp 1885, S. 63. Danach erstreckte sich das Neue Reich, die 18. bis 20. Dynastie umfassend, über den Zeitraum von etwa 1530–1050 v. Chr. (vgl. MWG I/6, S. 418, Hg.-Anm. 15).
75
Tausch nach [313]außen fehlte meist dem Großhaushalt nicht, hatte aber den Charakter des haushaltsmäßigen Tausches. Geldumlagen fehlten ebenfalls oft nicht, spielten aber für die Bedarfsdeckung eine Nebenrolle und waren traditional gebunden. – Tausch nach außen fehlte auch den leiturgisch belasteten Wirtschaften oft nicht. Aber das Entscheidende war: daß dem Schwerpunkt nach die Bedarfsdeckung durch die als Entgelt der umgelegten Leistungen verliehenen Naturalgüter: Deputate oder Landpfründen erfolgte. Natürlich sind die Übergänge flüssig. Stets aber handelt es sich um eine verbandswirtschaftliche Regulierung der Leistungsorientierung hinsichtlich der Art der Arbeitsverteilung und Arbeitsverbindung. Das „capitulare de villis vel curtis imperialibus bzw. imperii“ ist eine in Kapitel unterteilte, um 800 vermutlich von Karl dem Großen erlassene Instruktion für die Ord[313]nung und den Betrieb seiner Krongüter. Sie enthält u. a. Aufstellungen zur Ausstattung der Güter, die Aufsichtspflichten der Verwalter und die Organisation der landwirtschaftlichen und gewerblichen Arbeit. Vgl. Die Landgüterordnung Kaiser Karls des Großen. (Capitulare de villis vel curtis imperii). Text-Ausgabe mit Einleitung und Anmerkungen hg. von Karl Gareis. – Berlin: J. Guttentag 1895. Max Weber hat das capitulare de villis bereits in seinen Vorlesungen über „Allgemeine (‚theoretische‘) Nationalökonomie“ (MWG III/1, S. 450) behandelt. Im Manuskriptbestand zu diesen Vorlesungen findet sich ein Exzerpt aus der Übersetzung und dem Kommentar von Benjamin-Edme-Charles Guérard, Explication du Capitulaire de Villis, in: Mémoires de l’Institut impérial de France, Académie des inscriptions et belles-lettres, Tome 21,I, 1857, S. 165–309. Vgl. hierzu: MWG I/22-4, S. 260 f., Hg.-Anm. 32.
3. Für den Fall a 2 I (wirtschaftsregulierender Verband) sind für den Fall ß (erwerbswirtschaftliche Orientierung) diejenigen Wirtschaftsregulierungen in den okzidentalen mittelalterlichen Kommunen, ebenso in den Gilden und Kasten von China und Indien ein ziemlich reiner Typus, welche die Zahl und Art der Meisterstellen und die Technik der Arbeit, also: die Art der Arbeitsorientierung in den Handwerken regulierten. Soweit der Sinn nicht: Versorgung des Konsumbedarfs mit Nutzleistungen der Handwerker, sondern, – was nicht immer, aber häufig der Fall war: – Sicherung der Erwerbschancen der Handwerker war: insbesondre Hochhaltung der Leistungsqualität und Repartierung der Kundschaft. Wie jede Wirtschaftsregulierung bedeutete selbstverständlich auch diese eine Beschränkung der Marktfreiheit und daher der autonomen erwerbswirtschaftlichen Orientierung der Handwerker: sie war orientiert an der Erhaltung der „Nahrung“ für die gegebenen Handwerksbetriebe
76
und also insoweit der haus[314]haltswirtschaftlichen Orientierung trotz ihrer erwerbswirtschaftlichen Form doch innerlich material verwandt. Es war ein wichtiges Ziel der Regelungen des Handwerksbetriebs im Mittelalter und der frühen Neuzeit, den Zunftgenossen ein standesgemäßes Einkommen und die wirtschaftliche Selbständigkeit zu sichern. Dafür stand in den Quellen häufig der Begriff „Nahrung“. Werner Sombart sah in der „Idee der Nahrung“ ein wesentliches Merkmal der „Idee des Handwerks“ überhaupt (vgl. Sombart, Werner, Der moderne Kapitalismus, Band I: Die Genesis des Kapitalismus. – Leipzig: Duncker & Humblot 1902, S. 86–88; ausführlicher Sombart, Der moderne Kapitalismus I2, S. 188). Sombarts Ansicht, daß die „Idee der Nahrung“ der vorkapitalistischen Wirtschaftsgestaltung ihr Gepräge verliehen habe, ist Gegenstand anhaltender Auseinandersetzungen gewe[314]sen, eingeleitet mit einer scharfen Kritik Georg von Belows. Vgl. Below, Georg von, Die Entstehung des modernen Kapitalismus, in: HZ, Band 41, 1903, S. 432–485.
4. Für den Fall a 2 II im Fall ß sind außer den schon angeführten reinen Typen der Hausindustrie vor allem die Gutswirtschaften unseres Ostens mit den an ihren Ordnungen orientierten Instmanns-Wirtschaften,
77
die des Nordwestens mit den Heuerlings-WirtschaftenInstleute waren auf ostdeutschen Gütern kontraktlich gebundene Landarbeiter. Das Instenverhältnis beruhte auf gegenseitiger Hilfe und Interessengemeinschaft. Der Instmann stellte sich sowie u.U. weitere Personen dem Gutsherrn als Arbeitskräfte zur Verfügung. Er erhielt dafür neben einem vergleichsweise geringen Tagelohnsatz Land zur eigenen Bebauung, Viehweide, Futter sowie Anteil am Gesamtertrag des ausgedroschenen Getreides der Gutswirtschaft. Der besondere Typ der ostdeutschen Gutswirtschaft ist von Max Weber erstmals in „Die Lage der Landarbeiter im ostelbischen Deutschland“ behandelt worden (vgl. MWG I/3 passim). Vgl. auch Weber, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, MWG III/6, S. 169–172.
78
Typen. Die Gutswirtschaft sowohl, wie die Verlagswirtschaft sind Erwerbsbetriebe des Gutsherrn bzw. Verlegers; die Wirtschaftsbetriebe der Instleute und hausindustriellen Arbeiter orientieren sich in der Art der ihnen oktroyierten Leistungsverteilung und Arbeitsleistungsverbindung sowohl wie in ihrer Erwerbswirtschaft überhaupt primär an den Leistungspflichten, welche ihnen die Arbeitsordnung des Gutsverbandes bzw. die hausindustrielle Abhängigkeit auferlegt. Im übrigen sind sie: Haushaltungen. Ihre Erwerbsleistung ist nicht autonom, sondern heteronome Erwerbsleistung für den Erwerbsbetrieb des Gutsherrn bzw. Verlegers. Je nach dem Maß der materialen Uniformierung dieser Orientierung kann der Tatbestand sich der rein technischen Leistungsverteilung innerhalb eines und desselben Betriebes annähern, wie sie bei der „Fabrik“ besteht. Im deutschen Nordwesten vorkommender Typ eines auf einem Bauernhof tätigen Landarbeiters und Kleinpächters. Der Heuerling pachtete gegen geringe Bezahlung Land und Unterkunft vom Bauern, der ihm mit dem Gespann bei der Bewirtschaftung half. Als Gegenleistung erbrachte der Heuerling eine bestimmte Anzahl von Arbeitstagen für den Bauern.
§ 19. (noch: II[,] vgl. § 18).
79
Sozial unterscheidet sich die Art der Leistungsverteilung ferner: Gemeint ist die Fortsetzung des in § 18 mit II Begonnenen, oben, S. 308. Zum Gliederungszusammenhang vgl. oben, S. 296 f.
B. je nach der Art, wie die als Entgelte bestimmter
p
Leistungen bestehenden Chancen appropriiert[314]A: bestimmten
q
sind. Gegenstand der Appropriation können sein: A: appropriert
[315][A 70]1. Leistungsverwertungschancen, –
2. sachliche Beschaffungsmittel, –
3. Chancen von Gewinn durch disponierende Leistungen.
Über den soziologischen Begriff der „Appropriation“ s. oben Kap. I § 10.
r
[315]In A folgt nach einem Absatz: Erste Möglichkeit: ; es folgt ein weiterer Absatz.
83
Die im Erstdruck erwähnte Angabe „Erste Möglichkeit:“ wird später, wo es entsprechend der Systematik notwendig gewesen wäre (am Beginn der §§ 20 und 21), nicht durch eine „zweite“ oder „dritte Möglichkeit“ fortgeführt. Zudem verwirrt an dieser Stelle, daß Weber die Bezeichnungen „Erste“ bis „vierte Möglichkeit“ sogleich in einer [316]anderen Gliederungsebene benutzt. Deshalb wurde die Angabe „Erste Möglichkeit“ hier emendiert.
80
[315]Kap. I, § 10, oben, S. 198 f.
1.
81
Appropriation von Arbeitsverwertungschancen: Möglich ist dabei: Max Weber beginnt hier die bis § 21, unten, S. 334, reichende Erörterung der zuvor genannten drei Objekte der Appropriation. Zu den nachfolgenden Punkten vgl. § 20, unten, S. 323 ff. (2. Appropriation sachlicher Beschaffungsmittel) und § 21, unten, S. 333 ff. (3. Appropriation der disponierenden Leistungen).
- daß die Leistung an einen einzelnen Empfänger (Herren) oder Verband erfolgt,
- daß die Leistung auf dem Markt abgesetzt wird.
In beiden Fällen bestehen folgende vier einander radikal entgegengesetzte
s
Möglichkeiten:A: entgegengesetzten
t
Absatz und Durchschuß fehlen in A.
Erste Möglichkeit
u
: Fehlt in A; Möglichkeit sinngemäß ergänzt.
a) Monopolistische Appropriation der Verwertungschancen an den einzelnen Arbeitenden („zünftig freie Arbeit“), und zwar:
- erblich und veräußerlich, oder
- persönlich und unveräußerlich, oder
- zwar erblich, aber unveräußerlich, – in allen diesen Fällen entweder unbedingt oder an materiale Voraussetzungen geknüpft.
Für 1 a α sind für I indische Dorfhandwerker, für II mittelalterliche „Real“-Gewerberechte,
82
für 1 a ß in dem Fall I alle „Rechte auf ein [316]Amt“,Im Unterschied zur Befugnis, die eine Person als solche zum Betrieb eines Gewerbes besaß, war das Realgewerberecht in der Regel mit dem Besitz eines Grundstücks oder Hauses verbunden (Mühle, Brauerei, Apotheke). Es war veräußerlich und erblich.
84
für 1 a γ I und II gewisse mittelalterliche, vor allem aber indische Gewerberechte und mittelalterliche „Ämter“ verschiedenster ArtZur Entwicklung von „Ämtern“ sowie zur Versorgung von Amtsträgern und in diesem Zusammenhang zu persönlichen Besitz-Rechten auf ein Amt seit dem Altertum vgl. die ausführliche Darstellung in: Weber, Bürokratismus, MWG I/22-4, S. 168–182, und Weber, Patrimonialismus, MWG I/22-4, S. 285 ff.
85
Beispiele. Über das indische Gewerbe vgl. Webers Ausführungen in „Hinduismus“, MWG I/20, S. 171–181; zur Erblichkeit der Stellen vor allem S. 179. – Im Mittelalter gab es eine Vielzahl von erblichen, aber unveräußerlichen Positionen, die monopolistische Arbeitsverwertungschancen boten; u. a. vielfach als Ämter bezeichnete Meisterstellen im Handwerk und die Zunft als Zwangsverband, dessen Mitgliedschaft Voraussetzung für die Ausübung eines Gewerbes war. Zum Amtsbegriff in diesem Zusammenhang vgl. Keutgen, F[riedrich], Ämter und Zünfte. Zur Entstehung des Zunftwesens. – Jena: Gustav Fischer 1903, S. 138 f. u. 183 f.
Zweite Möglichkeit:
86
Die hier genannte „zweite Möglichkeit“ bezieht sich auf die oben, S. 315, Zeile 11 f., erwähnten vier Möglichkeiten.
b) Appropriation der Verwertung der Arbeitskraft an einen Besitzer der Arbeiter („unfreie Arbeit“)
α. frei, d. h. erblich und veräußerlich (Vollsklaverei), oder
ß. zwar erblich, aber nicht oder nicht frei veräußerlich, sondern z. B. nur mit den sachlichen Arbeitsmitteln – insbesondere Grund und Boden – zusammen (Hörigkeit, Erbuntertänigkeit).
Die Appropriation der Arbeitsverwertung an einen Herren kann material beschränkt sein (b, ß: Hörigkeit). Weder kann dann der Arbeiter seine Stelle einseitig verlassen, noch kann sie ihm einseitig genommen werden.
Diese Appropriation der Arbeitsverwertung kann vom Besitzer benutzt werden
a) haushaltsmäßig und zwar
α. als naturale oder Geld-Rentenquelle
v
, oder [316]A: Geld Rentenquelle
ß. als Arbeitskraft im Haushalt (Haus-Sklaven oder Hörige);
b) erwerbsmäßig
a. als αα. Lieferanten von Waren oder ßß. Bearbeiter gelieferten Rohstoffes für den Absatz (unfreie Hausindustrie),
w
A: Hausindustrie,)
ß. als Arbeitskraft im Betrieb (Sklaven- oder Hörigenbetrieb).
[317]Unter „Besitzer“ wird hier und weiterhin stets ein (normalerweise) nicht als solcher notwendig, sei es leitend, sei es arbeitend, am Arbeitsprozeß Beteiligter bezeichnet. Er kann, als Besitzer, „Leiter“ sein; indessen ist dies nicht notwendig und sehr häufig nicht der Fall.
Die „haushaltsmäßige“ Benützung von Sklaven und Hörigen (Hintersassen jeder Art): nicht als Arbeiter in einem Erwerbsbetriebe: sondern als Rentenquelle, war typisch in der Antike und im frühen Mittelalter. Keilschriften kennen z. B. Sklaven eines persischen Prinzen, die in die Lehre gegeben werden, vielleicht, um für den Haushalt als Arbeitskraft tätig zu sein, vielleicht aber auch, um gegen Abgabe (griechisch ,,ἀποφορά“, russisch „obrok“, deutsch „Hals“- oder „Leibzins“) material frei für Kunden zu arbeiten.
87
Das war bei den hellenischen Sklaven geradezu die (freilich nicht ausnahmslose) Regel, in Rom hat sich die selbständige Wirtschaft mit peculium oder merx peculiaris[317]Wie sich aus Parallelstellen ergibt, dürfte Weber hier einen Vertrag des persischen Kronprinzen Kambyses (um 558–522 v. Chr.) meinen (vgl. Weber, Hausgemeinschaften, MWG I/22-1, S. 160 mit der direkten Erwähnung, und Weber, Agrarverhältnisse3, MWG I/6, S. 399 mit dem Nachweis des Vertrages in Hg.-Anm.60). Zu den verschiedenen Abgabeformen vgl. die Glossar-Einträge, unten, S. 738 (Apophora), 746 (Leihzins) und 747 (obrok).
88
(und, selbstverständlich, Abgaben an [A 71]den Herrn) zu Rechtsinstituten verdichtet. Im Mittelalter ist die Leibherr schaft vielfach, in West- und Süddeutschland z. B. ganz regelmäßig, in ein bloßes Rentenrecht an im übrigen fast unabhängigen Menschen verkümmert,peculium (lat.: Viehbesitz, auch Vermögen, Eigentum), hier im Sinn von Sondervermögen: Vom Herrn dem Sklaven zur eigenen Bewirtschaftung überlassenes, jedoch im Eigentum des Herrn verbleibendes Gut. merx peculiaris (lat.: zu Eigenbesitz gehörende Ware) bezeichnet Güter, die der Besitzer einem anderen zum Gebrauch überläßt, z. B. Werkzeuge. Vgl. auch Weber, Hausgemeinschaften, MWG I/22-1, S. 160 f., Hg.-Anm. 90 und 91.
89
in Rußland die tatsächliche Beschränkung des Herren auf obrok-Bezug von tatsächlich (wenn auch rechtlich prekär) freizügigen Leibeigenen sehr häufig (wenn auch nicht die Regel) gewesen. Leibherrschaft in dem von Weber gemeinten Sinn bezeichnet ein Herrschaftsverhältnis, in dem der Leibeigene einem Herren zu Diensten und/oder Abgaben verpflichtet war (vgl. dazu auch den Glossar-Eintrag, unten, S. 746). Leibeigenschaft war in der Regel erblich, sodaß noch im 18. Jahrhundert in Westdeutschland selbst hochgestellte Personen wegen der Leibeigenschaft ihrer Vorfahren zu fortgesetzten, wenn auch geringfügigen Abgaben an einen Herren verpflichtet sein konnten.
Die „erwerbsmäßige“ Nutzung unfreier Arbeiter hatte insbesondre in den grundherrlichen (daneben wohl auch in manchen fürstlichen, so vermutlich den pharaonischen) Hausindustrien die Form angenommen entweder:
[318]a) des unfreien Lieferungsgewerbes: der Abgabe von Naturalien, deren Rohstoff (etwa: Flachs) die Arbeiter (hörige Bauern) selbst gewonnen und verarbeitet hatten, oder
b) des unfreien Verwertungsgewerbes: der Verarbeitung von Material, welches der Herr lieferte. Das Produkt wurde möglicherweise, wenigstens teilweise, vom Herren zu Geld gemacht. In sehr vielen Fällen (so in der Antike) hielt sich aber diese Marktverwertung in den Schranken des Gelegenheitserwerbes, – was in der beginnenden Neuzeit namentlich in den deutsch-slavischen Grenzgebieten nicht der Fall war: besonders (nicht: nur) hier sind grund- und leibherrliche Hausindustrien entstanden. – Zu einem kontinuierlichen Betrieb konnte der leibherrliche Erwerb sowohl in Form
a) der unfreien Heimarbeit wie
b) der unfreien Werkstattarbeit
werden. Beide finden sich, die letztere als eine der verschiedenen Formen des Ergasterion in der Antike, in den pharaonischen und Tempel-Werkstätten und (nach Ausweis der Grabfresken)
90
auch privater Leibherren, im Orient, ferner in Hellas (Athen: Demosthenes),[318]Ein entsprechender Quellenbeleg konnte nicht gefunden werden.
91
in den römischen Gutsnebenbetrieben (vgl. die Darstellung von Gummerus),Max Weber bezieht sich auf die häufig zitierten Werkstätten des Vaters von Demosthenes (383–322 v. Chr.). Ausführlicher Weber, Hausgemeinschaften, MWG I/22-1, S. 157–160, sowie Weber, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, MWG III/6, S. 199.
92
in Byzanz, im karolingischen „genitium“ (= Gynaikeion)Herman Gummerus wendete sich insbesondere gegen die Charakterisierung des römischen Gutsbetriebs als „geschlossene Hauswirtschaft“ (vgl. Gummerus, Römischer Gutsbetrieb, S. 1–14, bes. S. 6 f.). Auf dieses Werk stützte sich Max Weber, Agrarverhältnisse3, MWG I/6, S. 678–680, 746.
93
und in der Neuzeit z. B. in der russischen Leibeignenfabrik (vgl. v. Tugan-Baranowskis Buch über die russische Fabrik).Im karolingischen „capitulare de villis vel curtis imperialibus“ (vgl. oben, S. 312 mit Hg.-Anm.74) sind „genitia“ erwähnt. Der Begriff ist von verschiedenen Kommentatoren als lateinische Anverwandlung des griechischen „gynaikeion“, Frauengemach, Weiberhaus, Arbeitsraum der Frauen, gedeutet worden. Dem ist Max Weber bereits 1896 in seinem Aufsatz „Die sozialen Gründe des Untergangs der antiken Kultur“ (MWG I/6, S. 113) gefolgt. Frauen verrichteten damals typischerweise die Arbeit des Spinnens und auch noch des Webens, was später ein Männerhandwerk war.
94
Gemeint ist: Tugan-Baranowsky, Russische Fabrik. Anders als Weber schreibt, hatte Michail Tugan-Baranowskij kein Adelsprädikat. – Zum Begriff „leibeigene Fabrik“ vgl. ebd. S. 97. Die von Tugan-Baranowskij „Fabrik“ genannten Betriebe waren bis weit in das 19. Jahrhundert hinein Manufakturen, d. h. (Groß-)Betriebe mit Handarbeit.
[319]Dritte Möglichkeit:
c) Fehlen jeder Appropriation (formal „freie Arbeit“ in diesem Sinn des Wortes): Arbeit kraft formal beiderseits freiwilligen Kontraktes. Der Kontrakt kann dabei jedoch material in mannigfacher Art reguliert sein durch konventional oder rechtlich oktroyierte Ordnung der Arbeitsbedingungen.
Die freie Kontraktarbeit kann verwertet werden und wird typisch verwendet
a) haushaltsmäßig:
α. als Gelegenheitsarbeit (von Bücher „Lohnwerk“ genannt);
1
[319]Der von Karl Bücher im Rahmen seiner Stufenlehre der gewerblichen Betriebssysteme geprägte Begriff „Lohnwerk“ bezeichnet gewerbliche Berufsarbeit, bei welcher der Rohstoff dem Kunden, das Werkzeug dem Arbeiter gehört. Vgl. Bücher, Entstehung der Volkswirtschaft2, S. 141–149.
αα) im eignen Haushalt des Mieters:
2
Stör;Zum Begriff „Mieter“ vgl. oben, S. 231, Hg.-Anm. 37.
3
Wie Max Weber unten, S. 342, ausführt, handelt es sich um ein reines Wanderhandwerk oder um „seßhafte, aber in einem örtlichen Kreis von Haushaltungen ambulante Arbeit.“
ßß) vom Haushalt des Arbeiters aus (von Bücher „Heimwerk“ genannt);
4
Vgl. Bücher, Entstehung der Volkswirtschaft2, S. 142.
ß. als Dauerarbeit
αα) im eignen Haushalt des Mieters (gemieteter Hausdienstbote);
ßß) vom Haushalt des Arbeiters aus (typisch: Kolone);
5
Zum Begriff „Kolone“ vgl. den Glossar-Eintrag, unten, S. 745. Zu den wirtschaftlichen Aufgaben und Rechtsverhältnissen der römischen coloni vgl. Weber, Agrarverhältnisse3, MWG I/6, S. 680 ff.
b) erwerbsmäßig und zwar
α. als Gelegenheits- oder
ß. als Dauerarbeit, – in beiden Fällen ebenfalls entweder
1. vom Haushalt des Arbeiters aus (Heimarbeit), oder
2. im geschlossenen Betrieb des Besitzers (Guts- oder Werkstattarbeiter, insbesondere: Fabrikarbeiter).
Im Fall a steht der Arbeiter kraft Arbeitskontrakts im Dienst eines Konsumenten, welcher die Arbeit „leitet“, im zweiten im Dienst eines Erwerbsunternehmers: ein, bei oft rechtlicher Gleichheit der Form, ökonomisch [320]grundstürzender Unterschied. Kolonen können beides sein, sind aber typisch Oiken-Arbeiter.
Vierte Möglichkeit:
d) Die Appropriation von Arbeitsverwertungschancen kann endlich erfolgen an einen Arbeiterverband ohne jede oder doch ohne freie Appropriation an die einzelnen Arbeiter, durch
α. absolute oder relative Schließung nach außen;
[A 72]ß. Ausschluß oder Beschränkung der Entziehung der Arbeitserwerbschancen durch den Leiter ohne Mitwirkung der Arbeiter.
Jede Appropriation an eine Kaste von Arbeitern oder an eine „Berggemeinde“ von solchen (wie im mittelalterlichen Bergbau)
6
oder an einen hofrechtlichen Ministerialenverband[320]Berg- und Hüttenleute genossen im hohen Mittelalter wegen ihrer Seltenheit erhebliche Privilegien. Dazu gehörte das Recht, sich an ihren Arbeitsorten außerhalb von Grundherrschaften und bäuerlichen Gemeinden zum Zwecke des Abbaus von Erzen zu genossenschaftlichen Verbänden der Arbeiter zusammenzuschließen, den Berggemeinden. Vgl. hierzu Weber, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, MWG III/6, S. 246–248; Gothein, Eberhard, Bergbau, in: GdS, Abt. VI, 1914, S. 282–349, hier S. 299.
7
oder an die „Dreschgärtner“Zum Begriff „Ministerialen“ vgl. den Glossar-Eintrag, unten, S. 747. Sie unterstanden einem besonderen, sich aus der Hausherrschaft ergebenden Hofrecht. Zu Herkunft, Stellung, Aufgaben gemäß Dienstordnungen sowie zur Bildung monopolistischer Rechtsgemeinschaften (Verbänden) der Dienstleute vgl. Weber, Patrimonialismus, MWG I/22-4, S. 286–290.
8
eines Gutsverbandes gehört hierher. In unendlichen Abstufungen zieht sich diese Form der Appropriation durch die ganze Sozialgeschichte aller Gebiete. – Die zweite, ebenfalls sehr verbreitete Form ist durch die „closed shops“ der Gewerkschaften, vor allem aber durch die „Betriebsräte“, sehr modern geworden.Bezeichnung für Landarbeiter, vornehmlich in Schlesien, die kleine Hofstellen mit Gärten und Ackerflächen besaßen, aus denen sie einen Teil ihres Unterhalts erwirtschafteten. Für ihre Beteiligung an den Ernte- und Drescharbeiten auf den Gütern erhielten sie Anteile des Rohertrags. Auf Dreschgärtner geht Max Weber u. a. ein in: Weber, Die Lage der Landarbeiter im ostelbischen Deutschland, MWG I/3, S. 594 ff.
9
Zu den „closed shops“ und den Regelungen des Betriebsrätegesetzes vom 4. Februar 1920 vgl. oben, S. 201 mit Hg.-Anm. 86.
Jede Appropriation der Arbeitsstellen von Erwerbsbetrieben an Arbeiter, ebenso aber umgekehrt die Appropriation der Verwertung von Arbeitern („Unfreien“) an Besitzer, bedeutet eine Schranke freier Rekrutierung der Arbeitskräfte, also: der Auslese nach dem technischen Leistungsoptimum der Arbeiter, und [321]also eine Schranke der formalen Rationalisierung des Wirtschaftens. Sie befördert material die Einschränkung der technischen Rationalität, sofern
I. die Erwerbsverwertung der Arbeitserzeugnisse einem Besitzer appropriiert ist:
a) durch die Tendenz zur Kontingentierung der Arbeitsleistung (traditional, konventional oder kontraktlich), –
b) durch Herabsetzung oder – bei freier Appropriation der Arbeiter an Besitzer (Vollsklaverei) – völliges Schwinden des Eigeninteresses der Arbeiter am Leistungsoptimum, –
II. bei Appropriation an die Arbeiter: durch Konflikte des Eigeninteresses der Arbeiter an der traditionalen Lebenslage mit dem Bestreben des Verwertenden a) zur Erzwingung des technischen Optimums ihrer Leistung oder b) zur Verwendung technischer Ersatzmittel für ihre Arbeit. Für den Herren wird daher stets die Verwandlung der Verwertung in eine bloße Rentenquelle naheliegen. Eine Appropriation der Erwerbsverwertung der Erzeugnisse an die Arbeiter begünstigt daher, unter sonst dafür geeigneten Umständen, die mehr oder minder vollkommene Expropriation
10
des Besitzers von der Leitung. Weiterhin aber regelmäßig: die Entstehung von materialen Abhängigkeiten der Arbeiter von überlegenen Tauschpartnern (Verlegern) als Leitern.[321]Zum Begriff „Expropriation“ vgl. den Glossar-Eintrag, unten, S. 742, sowie unten, S. 334.
11
Max Weber spricht die Verhältnisse im Verlagssystem bzw. der Hausindustrie an. Die Leitung und Verwertung der dezentralisiert in den Betriebsstätten der Arbeiter stattfindenden Produktion erfolgt durch den disponierenden Kaufmann, den Verleger. Vgl. oben, S. 300 f., Hg.-Anm. 42.
1. Die beiden formal entgegengesetzten Richtungen der Appropriation: der Arbeitsstellen an Arbeiter und der Arbeiter an einen Besitzer, wirken praktisch sehr ähnlich. Dies hat nichts Auffallendes. Zunächst sind beide sehr regelmäßig schon formal miteinander verbunden. Dies dann, wenn Appropriation der Arbeiter an einen Herren mit Appropriation der Erwerbschancen der Arbeiter an einen geschlossenen Verband der Arbeiter zusammentrifft, wie z. B. im hofrechtlichen Verbände.
12
In diesem Fall [322]ist weitgehende Stereotypierung der Verwertbarkeit der Arbeiter, also Kontingentierung der Leistung, Herabsetzung des Eigeninteresses daran und daher erfolgreicher Widerstand der Arbeiter gegen jede Art von technischer „Neuerung“, selbstverständlich. Aber auch wo dies nicht der Fall ist, bedeutet Appropriation von Arbeitern an einen Besitzer tatsächlich auch das Hingewiesensein des Herren auf die Verwertung dieser Arbeitskräfte, die er nicht, wie etwa in einem modernen Fabrikbetrieb, durch Auslese sich beschafft, sondern auslesefrei hinnehmen muß. Dies gilt insbesondre für Sklavenarbeit. Jeder Versuch, andre als traditional eingelebte Leistungen aus appropriierten Arbeitern herauszupressen, stößt auf traditionalistische Obstruktion und könnte nur durch die rücksichtslosesten und daher, normalerweise, für das Eigeninteresse des Herren nicht ungefährlichen, weil die Traditionsgrundlage seiner Herrenstellung gefährdenden Mittel erzwungen werden. Fast überall haben daher die Leistungen appropriierter Arbeiter die Tendenz zur Kontingentierung gezeigt, und wo diese durch die Macht der Herren gebrochen wurde (wie namentlich in Osteuropa im Beginn der Neuzeit)[,]Nicht nur die oben, S. 320, erwähnten Ministerialen, sondern alle an Fürstenhöfen und Fronhöfen von Grundherren lebenden freien, minderfreien und unfreien Leute unterlagen einem besonderen Verbandsrecht. Es regelte die Rechtsverhältnisse des [322]Herren zu seinen Leuten sowie die Beziehungen der Leute untereinander. Vgl. Maurer, Georg Ludwig von, Geschichte der Fronhöfe, der Bauernhöfe und der Hofverfassung in Deutschland, 4 Bde. – Erlangen: Ferdinand Enke 1862–63.
13
hat die fehlende Auslese und das fehlende Eigeninteresse und Eigenrisiko der appropriierten Arbeiter die Entwicklung zum technischen Optimum obstruiert. – Bei formaler Appropriation der Arbeitsstellen an die Arbeiter ist der gleiche Erfolg nur noch schneller eingetreten. Im 16. und 17. Jahrhundert vollzog sich in Ostdeutschland und im weiteren Osteuropa ein grundlegender Wandel der feudalen Abhängigkeitsverhältnisse. Während im altdeutschen Gebiet die Grundherrschaft weitgehend erhalten blieb, in der die Bauern erbliche Ansprüche an den Boden hatten und zu in der Regel fixierten Abgaben verpflichtet waren, dehnte sich im Osten im Wege der Verschlechterung der Rechtsstellung der Bauern die Eigenwirtschaft der Herren auf ihren Gütern aus. Die „Gutsherren“ waren vornehmlich an der Arbeitsleistung (Fronen) ihrer bäuerlichen Untertanen interessiert. Nach Verlust ihres Rechts auf Freizügigkeit waren die Bauern als erbuntertänig der kaum kontrollierten Ausbeutung ihrer Arbeitskraft und der ihrer Kinder (Gesindezwangsdienst) unterworfen. In Polen sind die Bauern im 16. Jahrhundert, in Rußland im 17. Jahrhundert in völlige Leibeigenschaft geraten. Vgl. Wittich, Werner, Gutsherrschaft (Grundherrschaft, Leibeigenschaft, Eigenbehörigkeit, Erbuntertänigkeit), in: HdStW3, Band 5, 1910, S. 209–216; Knapp, Georg Friedrich, Bauernbefreiung in den östlichen Provinzen des preußischen Staates, in: HdStW3, Band 1, 1909, S. 541–543; Simkhowitsch, Wladimir G., Die Bauernbefreiung in Rußland, in: HdStW3, Band 1, 1909, S. 602–605.
[A 73]2. Der im letzten Satz bezeichnete Fall ist typisch für die Entwicklung des frühen Mittelalters (10.–13. Jahrhundert). Die „Beunden“
14
der Karolingerzeit und alle andern Ansätze landwirtschaftlicher „Großbetriebe“ [323]schrumpften und verschwanden. Die Rente des Bodenbesitzers und des Leibherren stereotypierte sich, und zwar auf sehr niedrigem Niveau, das naturale Produkt ging zu steigenden Bruchteilen (Landwirtschaft, Bergbau), der Erwerbsertrag in Geld (Handwerk) fast ganz in die Hände der Arbeiter über. Die „begünstigenden Umstände“ dieser so nur im Okzident eingetretenen Entwicklung waren: 1. die durch politisch-militärische Inanspruchnahme der Besitzerschicht, und – 2. durch das Fehlen eines geeigneten Verwaltungsstabes geschaffene Unmöglichkeit: ihrerseits die Arbeiter anders denn als Rentenquelle zu nutzen, verbunden – 3. mit der schwer zu hindernden faktischen Freizügigkeit zwischen den um sie konkurrierenden partikularen Besitzinteressenten, – 4. den massenhaften Chancen der Neurodung und Neuerschließung von Bergwerken und lokalen Märkten, in Verbindung mit – 5. der antiken technischen Tradition. – Je mehr (klassische Typen: der Bergbau und die englischen Zünfte) die Appropriation der Erwerbschancen an die Arbeiter an die Stelle der Appropriation der Arbeiter an den Besitzer eintrat und dann die Expropriation der Besitzer zunächst zu reinen Rentenempfängern (schließlich auch schon damals vielfach die Ablösung oder Abschüttelung der Rentenpflicht: „Stadtluft macht frei“) Bezeichnung für ein im 8. bis 10. Jahrhundert häufig durch Rodung entstandenes, eingezäuntes Landstück des Grundherren, das außerhalb der gemeinen Mark in sei[323]nem Sondereigentum stand. Es wurde durch frondienstpflichtige Bauern bestellt. Seit dem 12. Jahrhundert waren Beunden zumeist verpachtet.
15
vorschritt, desto mehr begann, fast sofort, die Differenzierung der Chancen, Marktgewinn zu machen in ihrer (der Arbeiter) eignen Mitte (und: von außen her durch Händler). Seit dem 12. Jahrhundert ist der Rechtssatz bezeugt, daß der leibeigene oder hörige Zuwanderer einer Stadt, der sich durch „Jahr und Tag“ dort aufhält, ohne von seinem Herren in Anspruch genommen zu werden, die persönliche Freiheit erwirbt. Die nach einem Rechtssprichwort klingende Formel „Stadtluft macht frei“ ist erst von der Wissenschaft des 19. Jahrhunderts geprägt worden. Vgl. Brunner, Heinrich, Luft macht eigen. Eine rechtsgeschichtliche Untersuchung, in: Festgabe der Berliner juristischen Fakultät für Otto Gierke zum Doktor-Jubiläum 21. August 1910. – Breslau: Μ. & H. Marcus 1910, S. 1–46, sowie Weber, Die Stadt, MWG I/22-5, S. 104 f. mit Hg.-Anm. 13.
§ 20. (noch: II B[,] vgl. § 19
a
).[323]A: §§ 18, 19
16
2. Appropriation der zur Arbeit komplementären sachlichen Beschaffungsmittel. Sie kann sein Appropriation Fortsetzung der in § 19 (oben, S. 314) begonnenen Ausführungen zu II B, der Art, in der als Entgelte bestimmter Leistungen bestehende Chancen appropriiert sind. Es folgt der 2. der S. 315 genannten Gegenstände der Appropriation, die sachlichen Beschaffungsmittel. Die Angabe „§§ 18,19“ in der Druckfassung wurde emendiert (vgl. textkritische Anm. a).
[324]a) an Arbeiter, einzelne oder Verbände von solchen, oder
b) an Besitzer oder
c) an regulierende Verbände Dritter.
b
[324]A: Dritter; Durchschuß fehlt in A.
Zu a) Appropriation an Arbeiter. Sie ist möglich
α. an die einzelnen Arbeiter, die dann „im Besitz“ der sachlichen Beschaffungsmittel sind,
ß. an einen, völlig oder relativ, geschlossenen Verband von Arbeitenden (Genossen), so daß also zwar nicht der einzelne Arbeiter, aber ein Verband von solchen im Besitz der sachlichen Beschaffungsmittel ist.
Der Verband kann wirtschaften:
- als Einheitswirtschaft (kommunistisch),
- mit Appropriation von Anteilen (genossenschaftlich).
Die Appropriation kann in all diesen Fällen
- haushaltsmäßig, oder
- erwerbsmäßig verwertet werden.
Der Fall α bedeutet entweder volle verkehrswirtschaftliche Ungebundenheit der im Besitz ihrer sachlichen Beschaffungsmittel befindlichen Kleinbauern oder Handwerker („Preiswerker“ der Bücherschen Terminologie)
17
oder Schiffer oder Fuhrwerksbesitzer. Oder es bestehen unter ihnen wirtschaftsregulierende Verbände s. u.[324] Bei Bücher, Entstehung der Volkswirtschaft2, S. 149, heißt es: „Man könnte es [das Handwerk, Hg.] auch Preiswerk nennen, um den Gegensatz gegen das Lohnwerk zu markieren. Denn der Handwerker unterscheidet sich von dem Lohnwerker nur dadurch, daß er im Besitze sämtlicher Produktionsmittel ist und daß er das fertige Produkt, welches aus dem von ihm gelieferten Rohstoff und der darin verkörperten Arbeit zusammengesetzt ist, um einen bestimmten Preis verkauft, während der Lohnwerker bloß Vergütung für seine Arbeit empfängt.“ Vgl. auch Bücher, Gewerbe3, S. 861 f.
18
Der Fall ß umschließt sehr heterogene Erscheinungen, je nachdem haushaltsmäßig oder erwerbsmäßig gewirtschaftet wird. Die – im Prinzip, nicht notwendig „ursprünglich“ oder tatsächlich (s. Kap. V) „Wirtschaftsregulierende Verbände“ definiert Max Weber Kap. II, § 5, oben, S. 233; im Fortgang von Kap. II geht er, von der Erwähnung auf dieser Seite abgesehen, nicht näher auf sie ein. – In älteren Ausführungen spricht Weber in ähnlichem Zusammenhang von „wirtschaftsregulierenden Gemeinschaften“. Vgl. Weber, Wirtschaftliche Beziehungen der Gemeinschaften im allgemeinen, MWG I/22-1, S. 80.
19
kommunistische – Hauswirtschaft kann [325]rein eigenbedarfsmäßig orientiert sein. Oder sie kann, zunächst gelegentlich, Überschüsse an Ein entsprechendes Kapitel liegt nicht vor. Vgl. dazu den Anhang zum Editorischen Bericht, oben, S. 109.
c
durch Standortsvorzüge (Rohstoffe spezifischer Art) oder spezifisch fachgelernte Kunstübung monopolistisch von ihr hergestellten Erzeugnissen[325]A: einer
d
durch Bedarfstausch absetzen. Weiterhin kann sie zum regelmäßigen Erwerbstausch übergehen. Dann pflegen sich „Stammesgewerbe“ mit – da die Absatzchancen auf Monopol und, meist, auf ererbtem Geheimnis ruhen – interethnischer Spezialisierung und interethnischem Tausch zu entwickeln,A: hergestellte Erzeugnisse
20
die dann entweder zu Wandergewerben und Pariagewerben oder (bei Vereinigung in einem politischen Verband) zu Kasten (auf der Grundlage interethnischer ritueller Fremdheit) werden, wie in Indien. – Der Fall ββ ist der Fall der „Produktivgenossenschaft“. Hauswirtschaften können sich, bei Eindringen der Geldrechnung, ihm nähern. Sonst findet er sich, als Arbeiterverband, als Gelegenheitserscheinung. In typischer Art wesentlich in einem freilich wichtigen Fall: bei den Bergwerken des frühen Mittelalters.[325]Max Weber definiert unten, S. 349, „Stammesgewerbe“ als Hausgewerbe mit „interethnischer Leistungsspezialisierung“. Bei Karl Bücher meint „Stammgewerbe“ die auf jeweils besondere Naturbedingungen an den Wohnorten von Stämmen zurückgehende Spezialisierung mit Austausch der Überschußproduktion. Vgl. Bücher, Gewerbe3, S. 853.
21
Vgl. dazu oben, S. 320, Hg.-Anm. 6.
[A 74]Zu b)
e
Appropriation an Besitzer oder Verbände solcher kann – da die Appropriation an einen Arbeiterverband schon besprochen istA: b)
23
Analog zu „Zu a)“, oben, S. 324, Zeile 4, ergänzt.
22
– hier nur bedeuten: Expropriation der Arbeiter von den Beschaffungsmitteln, nicht nur als Einzelne, sondern als Gesamtheit. Appropriiert sein können dabei Oben, S. 324.
1. an Besitzer alle oder einige oder einer der folgenden Posten:
- der Boden (einschließlich von Gewässern)[,]
- die unterirdischen Bodenschätze,
- die Kraftquellen,
- die Arbeitswerkstätten,
- die Arbeitsmittel (Werkzeuge, Apparate, Maschinen),
- die Rohstoffe.
Alle können im Einzelfall in einer und derselben Hand oder sie können auch in verschiedenen Händen appropriiert sein.
[326]Die Besitzer können die ihnen appropriierten Beschaffungsmittel verwerten
α. haushaltsmäßig,
αα. als Mittel eigner Bedarfsdeckung,
ββ. als Rentenquellen, durch Verleihen und zwar
I. zu haushaltsmäßiger Verwendung,
II. zur Verwertung als Erwerbsmittel, und zwar
ααα) in einem Erwerbsbetrieb ohne Kapitalrechnung,
βββ) als Kapitalgüter (in fremder Unternehmung), endlich
β. als eigne Kapitalgüter (in eigner Unternehmung).
f
[326]A: Unternehmung);
Möglich ist ferner:
2. Appropriation an einen Wirtschaftsverband, für dessen Gebarung dann die gleichen Alternativen wie bei 1
g
bestehen.A: b
h
Durchschuß fehlt in A.
Zu c)
i
Endlich ist möglich: Fehlt in A; Zu c) ergänzt.
25
Analog zu „Zu a)“, oben, S. 324, Zeile 4, ergänzt.
Appropriation
j
an einen wirtschaftsregulierenden Verband, der die Beschaffungsmittel weder selbst als Kapitalgüter verwertet noch zu einer Rentenquelle macht, sondern den Genossen darbietet. In A geht voran: 3.
1.
24
Bodenappropriation findet sich an Einzelwirtschaften primär: [326]Das in Ziffer 1 Ausgeführte bezieht sich auf II B, 2, b), 1 a „der Boden“, oben, S. 325.
a) auf die Dauer der aktuellen Bestellung bis zur Ernte,
b) soweit der Boden Artefakt war, also:
α. bei Rodung,
β. bei Bewässerung
für die Dauer der kontinuierlichen Bestellung.
Erst bei fühlbarer Bodenknappheit findet sich
c) Schließung der Zulassung zur Bodenbestellung, Weide- und Holznutzung und Kontingentierung des Maßes der Benutzung für die Genossen des Siedelungsverbandes.
Träger der dann eintretenden Appropriation kann sein
1. ein Verband, – verschieden groß je nach der Art der Nutzbarkeit (für Gärten, Wiesen, Äcker, Weiden, Holzungen: Verbände aufsteigender Größe von den Einzelhaushaltungen bis zum „Stamm“).
[327]Typisch:
a) ein Sippen- (oder: daneben)
b) ein Nachbarschaftsverband (normal: Dorfverband) für die Äcker, Wiesen und Weiden,
c) ein wesentlich umfassenderer Markverband
26
verschiedenen Charakters und Umfanges für die Holzungen, [327]Diesem Verband mehrerer Dörfer oblag vor allem die Regelung der gemeinsamen Nutzung der außerhalb der Dorfländereien und Dorfallmenden liegenden Wald- und Weideflächen (Mark), somit auch des Holzeinschlags. Vgl. den Glossar-Eintrag zu „Markgenossenschaft“, unten, S. 747.
d) die Haushaltungen für Gartenland und Hofstätte unter anteilsmäßiger Beteiligung an Acker und Weiden. Diese anteilsweise Beteiligung kann ihren Ausdruck finden
α. in empirischer Gleichstellung bei den Neubrüchen bei ambulantem Ackerbau (Feldgraswirtschaft),
27
„Ambulanten Ackerbau“ definiert Max Weber unten, S. 346, als solchen, bei dem „nach Ausnutzung des Bodens“ der Standort gewechselt wird. Bei Feldgraswirtschaft werden nicht die Hofstätten gewechselt, sondern nur die Nutzungsweisen des verfügbaren Bodens. Dabei erfolgt ein – „geregelter“ oder „wilder“ – Wechsel zwischen der Nutzung als Ackerfläche (Feld) und einer längeren Ruhephase, in der der Boden sich mit Gras und anderen Grünpflanzen überzieht. Vgl. Goltz, Theodor von der, Landwirtschaft. I. Teil, in: Handbuch der Politischen Ökonomie, Band 2, 3. Aufl. – Tübingen: H. Laupp’sche Buchhandlung 1891, S. 1–126, hier S. 16 f.
β. in rationaler systematischer Neuumteilung bei seßhaftem Ackerbau: regelmäßig erst Folge
α. fiskalischer Ansprüche mit Solidarhaft der Dorfgenossen, oder
β. der politischen Gleichheitsansprüche der Genossen.
[A 75]Träger des Betriebes sind normalerweise die Hausgemeinschaften (über deren Entwicklung Kap. V).
28
Ein entsprechendes Kapitel liegt nicht vor. Vgl. dazu den Anhang zum Editorischen Bericht, oben, S. 109.
2. Ein Grundherr,
29
gleichviel ob (was später zu erörtern ist) diese Herrenlage ihre Quelle in primärer Sippenhauptsstellung oder Häuptlingswürde mit Bittarbeitsansprüchen (Kap. V)Zu Grundherr und Grundherrschaft vgl. oben, S. 311 f., Hg.-Anm. 70.
30
oder in fiskalischen oder militärischen Oktroyierungen oder systematischen Neubrüchen oder Bewässerungen hat. Wie oben, Hg.-Anm. 28.
Die Grundherrschaft kann genutzt werden:
a) mit unfreier (Sklaven- oder Hörigen-)Arbeit
1. haushaltsmäßig
α. durch Abgaben
β. durch Dienstleistungen;
2. erwerbsmäßig:
[328]als Plantage[;]
b) mit freier Arbeit:
I. haushaltsmäßig als Rentengrundherrschaft
αα) durch Naturalrenten (Naturalteilbau oder Naturalabgabe) von Pächtern,
ββ) durch Geldrenten von Pächtern. Beides:
ααα) mit eignem Inventar (Erwerbspächter),
βββ) mit grundherrlichem Inventar (Kolonen);
II. erwerbsmäßig: als rationaler Großbetrieb.
Im Fall a, 1 pflegt der Grundherr in der Art der Ausnutzung traditional gebunden zu sein sowohl an die Person der Arbeiter (also: ohne Auslese) wie an ihre Leistungen. Der Fall a, 2 ist nur in den antik-karthagischen und römischen, in den kolonialen und in den nordamerikanischen Plantagen, der Fall b, II nur im modernen Okzident eingetreten. Die Art der Entwicklung der Grundherrschaft (und, vor allem, ihrer Sprengung) entschied über die Art der modernen Appropriationsverhältnisse. Diese kennen im reinen Typus nur die Figuren des a) Bodenbesitzers – b) kapitalistischen Pächters – c) besitzlosen Landarbeiters. Allein dieser reine Typus ist nur die (in England bestehende) Ausnahme.
31
[328]Am Ende des 19. Jahrhunderts herrschte in weiten Teilen Englands (nicht überall) die folgende Funktions-, Besitz- und Einkommensverteilung: Eine kleine Gruppe z. T. sehr reicher Landeigentümer stellte den Boden und das in den Farmen investierte Anlagekapital zur Verfügung. Sie erhielt von den Farmern bzw. Pächtern Rente. Diese bewirtschafteten den Boden, hatten das Betriebskapital (Vieh, Vorräte etc.) beizubringen und trugen das unternehmerische Risiko. Sie bezogen Unternehmerlohn und allen Gewinn. Die Masse der Arbeit wurde von landlosen Arbeitskräften verrichtet, die dafür kontraktliche Löhne erhielten.
2.
32
Bergbaulich nutzbare Bodenschätze sind entweder Das in Ziffer 2 Gesagte bezieht sich auf den Ordnungsbuchstaben β in der Gliederung zu b) 1. „unterirdische Bodenschätze“, oben, S. 325.
a) dem Grundbesitzer (in der Vergangenheit meist: Grundherren) oder
b) einem politischen Herren (Regalherren)
33
appropriiert, oder Das Recht, gewisse Mineralien unter Ausschluß jedes anderen, auch der Grundeigentümer, entweder selbst zu gewinnen oder – was weit überwiegend der Fall gewesen ist – ihre Gewinnung gegen Abgaben Dritten zu überlassen, stand ursprünglich dem König zu; daher der Name Regal. Seit dem 12. Jahrhundert waren Regalherren faktisch und schließlich auch förmlich zunehmend die Landesherren. Vgl. Arndt, Adolf, Zur Geschichte und Theorie des Bergregals. – Halle: Pfeffer 1879; 2. Aufl., Freiburg: J. Bielefelds Verlag 1916.
c) jedem „Finder“ abbauwürdigen Vorkommens („Bergbaufreiheit“)[,] oder
k
[328]Fehlt in A; oder sinngemäß ergänzt.
d) einem Arbeiterverband[,] oder
l
Fehlt in A; oder sinngemäß ergänzt.
[329]e) einer Erwerbs-Unternehmung.
Grund- und Regalherren konnten die ihnen appropriierten Vorkommen entweder in eigner Regie abbauen (so im frühen Mittelalter gelegentlich) oder als Rentenquelle benutzen, also verleihen, und zwar entweder
α. an einen Verband von Arbeitern (Berggemeinde), – Fall d – oder
β. an jeden (oder jeden einem bestimmten Personenkreis zugehörigen) Finder (so auf den „gefreiten Bergen“ im Mittelalter,
34
von wo die Bergbaufreiheit ihren Ausgang nahm). [329]Mittelalterliche Bezeichnung für eine Gegend, in der abbauwürdige Mineralien nachgewiesen waren oder vermutet wurden und für die der Grund- oder Landesherr jedermann das Aufsuchen und Abbauen der Mineralien – gegen Abgaben – erlaubte; Vorstufe der später in Deutschland allgemein geltenden „Bergbaufreiheit“, welche den Findern von Mineralvorkommen das Recht des Abbaus einräumte, dem sich der Grundeigentümer nicht entgegenstellen konnte. Ausführlich hierzu Weber, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, MWG III/6, S. 246.
Die Arbeiterverbände nahmen im Mittelalter typisch die Form von Anteilsgenossenschaften mit Pflicht zum Bau (gegenüber den an der Rente interessierten Bergherren oder den solidarisch haftenden Genossen) und Recht auf Ausbeuteanteil, weiterhin von reinen Besitzer-„Genossenschaften“ mit Anteilen an Ausbeute und Zubuße an. Der Bergherr wurde zunehmend zugunsten der Arbeiter expropriiert, diese selbst aber mit zunehmendem Bedarf nach Anlagen von Kapitalgüter besitzenden Gewerken, so daß als Endform der Appropriation sich die kapitalistische „Gewerkschaft“ (oder Aktiengesellschaft) ergab.
35
Die „kapitalistische“, mit der Aktiengesellschaft vergleichbare Unternehmungsform der bergrechtlichen Gewerkschaft ist 1865 in den §§ 94 ff. des Preußischen Allgemeinen Berggesetzes kodifiziert und anschließend auch in anderen deutschen Staaten eingeführt worden. Danach blieb die Gewerkschaft Personengesellschaft ohne festgelegtes Grundkapital, wurde aber – wie die Aktiengesellschaft – Körperschaft mit eigener Rechtspersönlichkeit. Auch wurden nun die Anteile an der Gewerkschaft (Kuxe) übertragbar wie bewegliche Sachen und an Börsen gehandelt.
3.
36
Beschaffungsmittel, welche den Charakter von „Anlagen“ hatten (Kraftanlagen, besonders Wasserkraftanlagen, „Mühlen“ aller Arten von Zweckverwendung,Das in Ziffer 3 Gesagte bezieht sich auf die Ordnungsbuchstaben γ, δ und ε in der Gliederung zu b) 1., oben, S. 325.
37
und Werkstätten, eventuell mit stehenden Apparaten) sind in der Vergangenheit, besonders im Mittelalter, sehr regelmäßig appropriiert worden: Der Begriff „Mühle“ bezog sich ursprünglich auf eine Vorrichtung zum Mahlen von Getreide und anderen Materialien. Seit dem Mittelalter wurden auch Räderwerke zum Sägen, Schneiden, Schleifen, Stampfen, Bohren, Walken, Zwirnen „Mühlen“ genannt. Im Englischen bezeichnet „mill“ bis heute eine Fabrik. Über die Besitzverhältnisse und die herrschaftliche bzw. landesherrliche Regulierung der Nutzung von Mühlen sprach Max Weber in seiner Vorlesung „Abriß der universalen Sozial- und Wirtschaftsgeschichte“, MWG III/6, S. 230 f.
[330]a) an Fürsten und Grundherren (Fall 1),
b) an Städte (Fall 1 oder 2),
c) an Verbände der Arbeitenden (Zünfte, Gewerkschaften, Fall 2), ohne daß ein Einheitsbetrieb hergestellt worden wäre.
Sondern im Fall a und b findet sich dann Verwertung als Rentenquelle durch Gestattung der Benutzung gegen Entgelt und sehr oft mit Monopolbann und -Zwang zur Nutzung. Die Nutzung erfolgte im Einzelbetrieb reihum oder nach Bedarf, unter Umständen war sie ihrerseits Monopol eines geschlossenen Regulierungsverbandes. Backöfen, Mahlmühlen aller Art (für Getreide und Öl), Walkmühlen, auch Schleifwerke, Schlachthäuser, Färbekessel, Bleichanlagen (z. B. klösterliche), Hammerwerke (diese allerdings regelmäßig zur Verpachtung an Betriebe), ferner Brauereien, Brennereien und andre Anlagen, insbesondre auch Werften (in der Hansa städtischer Besitz)
38
und Verkaufsstände aller Gattungen waren [A 76]in dieser Art präkapitalistisch durch Gestattung der Nutzung durch Arbeiter gegen Entgelt, also als Vermögen des Besitzers, nicht als Kapitalgut, von diesem (einem einzelnen oder einem Verband, insbesondre einer Stadt) genutzt. Diese Herstellung und haushaltsmäßige Ausnutzung als Rentenquelle besitzender Einzelner oder Verbände oder die produktivgenossenschaftliche Beschaffung ging der Verwandlung in „stehendes Kapital“ von Eigenbetrieben voran. Die Benutzer der Anlagen ihrerseits nutzten sie teils haushaltsmäßig (Backöfen, auch Brauanlagen und Brennanlagen) teils erwerbswirtschaftlich. [330]Zur Zeit der Deutschen Hanse (12.–17. Jahrhundert) hat es Werften als dauerhafte Werkstätten noch nicht gegeben. Wohl aber waren die „Lastadie“ genannten Bauplätze, auf denen allein die Zimmermeister die Schiffe bauen durften, städtischer Grundbesitz. Für die Nutzung hatten die Meister in den meisten Städten Abgaben bzw. Pacht zu zahlen.
4.
39
Für die Seeschiffahrt der Vergangenheit war die Appropriation des Schiffs an eine Mehrheit von Besitzern (Schiffspartenbesitzern), Nach der Gliederung oben, S. 325, und dem Vorhergehenden wären hier Erläuterungen zu „Arbeitswerkstätten“ zu erwarten. Über sie sowie „Anlagen“ und „Betriebsmittel“ spricht Max Weber in den folgenden Ziffern 5 und 6. Zu Webers Unterscheidung von Anlagen (Kraftanlagen, gesonderte Arbeitswerkstätten) und Betriebsmitteln (Werkzeuge, Apparate, Maschinen) vgl. oben, S. 307 f.
40
die ihrerseits zunehmend von den nautischen Arbeitern getrennt waren, typisch. Daß die Seefahrt dann zu einer Risiko-Vergesellschaftung mit den Befrachtern führteZu „Schiffsparten“ vgl. den Glossar-Eintrag, unten, S. 750.
m
und daß Schiffsbesitzer, nautische Leiter und Mannschaft auch als Befrachter mitbeteiligt waren, schuf keine prinzipiell abweichenden Appropriationsverhältnisse, sondern nur Besonderheiten der Abrechnung und also der Erwerbschancen. [330]A: führte,
[331]5.
41
Daß alle Beschaffungsmittel: Anlagen (jeder Art) und Werkzeuge in einer Hand appropriiert sind, wie es für die heutige Fabrik konstitutiv ist, war in der Vergangenheit die Ausnahme. Insbesondre ist das hellenisch-byzantinische Ergasterion (römisch: ergastulum) in seinem ökonomischen Sinn durchaus vieldeutig, was von Historikern beharrlich verkannt wird.[331]Max Webers Erläuterungen in den Ziffern 5 und 6 sind nicht einzelnen Buchstaben der Gliederung S. 325 zuzuordnen, sondern betreffen γ, δ und ε gemeinsam.
42
Es war eine „Werkstatt“, welche 1. Bestandteil eines Haushalts sein konnte, in welcher a) Sklaven bestimmte Arbeiten für den Eigenbedarf (z. B. der Gutswirtschaft) des Herrn verrichteten, oder aber b) Stätte eines „Nebenbetriebes“ für den Absatz, auf Sklavenarbeit ruhend. Oder 2. die Werkstatt konnte als Rentenquelle Bestandteil des Besitzes eines Privatmanns oder eines Verbandes (Stadt – so die Ergasterien im Peiraieus)Vermutlich bezieht sich Max Weber u. a. auf die oben, S. 301 in Hg.-Anm. 44, genannten Historiker.
43
sein, welche gegen Entgelt vermietet wurde an einzelne oder an Arbeitergenossenschaften. – Wenn also im Ergasterion (insbesondere im städtischen) gearbeitet wurde, so fragt es sich stets: wem gehörte das E[rgasterion] selbst? wem die sonstigen Beschaffungsmittel, die bei der Arbeit verwendet wurden? Arbeiteten freie Arbeiter darin? auf eigne Rechnung? Oder: Sklaven? eventuell: wem gehörten die Sklaven, die darin arbeiteten? arbeiteten sie auf eigne Rechnung (gegen Apophora)Zu dem erwähnten Sachverhalt konnte kein Quellenbeleg gefunden werden.
44
oder auf Rechnung des Herrn? Jede Art von Antwort auf diese Fragen ergab ein qualitativ radikal verschiedenes wirtschaftliches Gebilde. In der Masse der Fälle scheint das Ergasterion – wie noch die byzantinischen und islamischen Stiftungen zeigenZu „Apophora“ vgl. den Glossar-Eintrag, unten, S. 738.
45
– als Rentenquelle gegolten zu haben, war also etwas grundsätzlich anderes als jede „Fabrik“Zum Charakter der byzantinischen Klosterstiftungen und islamischen „Wakuf“- Stiftungen vgl. Weber, Staat und Hierokratie, MWG I/22-4, S. 628 f.
46
oder selbst deren Vorläufer, an ökonomischer Vieldeutigkeit am ehesten den verschiedenen „Mühlen“-Arten des Mittelalters vergleichbar. Zum Begriff „Fabrik“ vgl. Max Webers Ausführungen oben, S. 300 f. In den historischen Quellen bezeichnet „Fabrik“ ganz Unterschiedliches, z. B. auch gewerbliche Kleinbetriebe, wenn sie außerhalb der Zunftordnung standen. Zur seinerzeitigen Fachdiskussion über Begriff und Wesen der modernen Fabrik vgl. Stieda, Wilhelm, Fabrik, in: HdStW3, Band 4, 1909, S. 1–15, hier S. 1–6.
6. Auch wo Werkstatt und Betriebsmittel einem Besitzer appropriiert sind und er Arbeiter mietet, ist ökonomisch noch nicht jener Tatbestand erreicht, welchen wir üblicherweise heute „Fabrik“ nennen, solange 1. die mechanische Kraftquelle, 2. die Maschine, 3. die innere Arbeitsspezialisierung und Arbeitsverbindung nicht vorliegen. Die „Fabrik“ ist heute eine [332]Kategorie der kapitalistischen Wirtschaft. Es soll der Begriff auch hier nur im Sinn eines Betriebes gebraucht werden, der Gegenstand einer Unternehmung mit stehendem Kapital sein kann, welcher also die Form eines Werkstattbetriebes mit innerer Arbeitsteilung und Appropriation aller sachlichen Betriebsmittel, bei mechanisierter, also Motoren- und Maschinen-orientierter Arbeit besitzt. Die große, von Zeitdichtern besungene Werkstatt des „Jack of Newbury“ (16. Jahrhundert),
47
in welcher angeblich hunderte von Hand-Webstühlen standen, die sein Eigentum waren, an welchen selbständig, wie zu Hause, nebeneinander gearbeitet und die Rohstoffe für den Arbeiter vom Unternehmer gekauft wurden und allerhand „Wohlfahrtseinrichtungen“ bestanden, entbehrte aller dieser Merkmale. Ein im Besitz eines Herren von (unfreien) Arbeitern befindliches ägyptisches, hellenistisches, byzantinisches, islamisches Ergasterion konnte – solche Fälle finden sich unzweifelhaft – mit innerer Arbeitsspezialisierung und Arbeitsverbindung arbeiten. Aber schon der Umstand, daß auch in diesem Fall der Herr sich gelegentlich mit Apophora (von jedem Arbeiter, vom Vorarbeiter mit erhöhter Apophora) begnügte (wie die griechischen Quellen deutlich ergeben),[332]Die angeblich 100 bis 200 Webstühle umfassenden Werkstätten des John Winchcombe (gest. 1519), genannt „Jack of Newbury“, sind in phantasievollen Texten aus dem 16. und 17. Jahrhundert beschrieben. In einem findet sich ein Gedicht, in dem ein angeblich mehr als tausend Personen beschäftigender Tuchmacherbetrieb in allen seinen Produktionsstufen vom Wollzupfen bis zum Färben und Walken geschildert wird. Das Gedicht ist häufiger nachgedruckt worden. Max Weber könnte es gekannt haben aus Ashley, William James, Englische Wirtschaftsgeschichte. Eine Einleitung in die Entwickelung von Wirtschaftsleben und Wirtschaftslehre, Band 2: Vom 14. bis zum 16. Jahrhundert (Sammlung älterer und neuerer staatswissenschaftlicher Schriften des In- und Auslandes, hg. v. Lujo Brentano und Emanuel Leser, Nr. 8). – Leipzig: Duncker & Humblot 1896, S. 241 f. und S. 270 f.
48
muß davor warnen, es einer „Fabrik“, ja selbst nur einem Werkstattbetriebe von der Art des „Jack of Newbury“, ökonomisch gleichzusetzen. Die fürstlichen Manufakturen, so die kaiserlich chinesische Porzellanmanufaktur und die ihr nachgebildeten europäischen Werkstattbetriebe für höfische Luxusbedürfnisse, vor allem aber: für Heeresbedarf, stehen der „Fabrik“ im üblichen Wortsinn am nächsten. Es kann niemand verwehrt werden, sie „Fabriken“ zu nennen. Erst recht nahe standen äußerlich der modernen Fabrik die russischen Werkstattbetriebe mit Leibeigenenarbeit. Der Appropriation der Beschaffungsmittel trat hier die Appropriation der Arbeiter hinzu. Hier soll der Begriff „Fabrik“ aus dem angegebenen Grunde nur für Werkstattbetriebe mit 1. an Besitzer voll appropriierten sachlichen Beschaffungsmitteln, [A 77]ohne Appropriation der [333]Arbeiter, – 2. mit innerer Leistungsspezialisierung, – 3. mit Verwendung mechanischer Kraftquellen und Maschinen, welche „Bedienung“ erfordern, gebraucht werden. Alle andren Arten von „Werkstattbetrieben“ werden mit diesem Namen und entsprechenden Zusätzen bezeichnet. Worauf sich Max Weber bezieht, ist nicht mit Sicherheit anzugeben. Für Hinweise auf griechische Quellen vgl. den Artikel „άποφορά“ in: Paulys Real-Enzyklopädie der classischen Altertumswissenschaft. Neue Bearbeitung, hg. von Georg Wissowa, Bd. 1,2. – Stuttgart: J.B. Metzler 1896, Sp. 174.
§ 21. (noch: II B, vgl. §§ 19, 20
n
). 3.[333]A: B 1, §§ 18, 19
49
Appropriation der disponierenden Leistungen. Sie ist typisch: [333]Das im Folgenden Ausgeführte wird von Max Weber in seiner Gliederung oben, S. 314 f., genannt: „Gegenstand der Appropriation können sein: […] 3. Chancen von Gewinn durch disponierende Leistungen.“ Das dort (§ 19) Begonnene wird hier fortgesetzt; die Angabe „II B 1, §§ 18, 19“ in der Druckfassung wurde emendiert.
1. für alle Fälle der traditionalen Haushaltsleitung;
a) zugunsten des Leiters (Familien- oder Sippenhaupt) selbst,
b) zugunsten seines für die Leitung des Haushalts bestimmten Verwaltungsstabs (Dienstlehen der Hausbeamten).
50
Im Lehensfeudalismus ist die verbreitete Form der Sicherung des Unterhalts des zum Dienst berufenen Verwaltungsmannes seine Ausstattung mit Rechten, insbesondere an Grund und Boden (Lehen), aus deren Nutzung der Belehnte jene Einkünfte bezieht, die ihm den Dienst ermöglichen. Vgl. hierzu Kap. III, § 8, unten, S. 481 ff., sowie Weber, Feudalismus, MWG I/22-4, S. 382.
Sie kommt vor:
2. für die Erwerbsbetriebe
a) im Falle völligen (oder annähernd völligen) Zusammenfalles von Leitung und Arbeit. Sie ist in diesem Fall typisch identisch mit der Appropriation der sachlichen Beschaffungsmittel an die Arbeiter (B
o
, 2, a).Klammer fehlt in A.
51
Sie kann in diesem Fall sein: Siehe oben, S. 323 f.
α. unbeschränkte Appropriation, also vererblich und veräußerlich garantierte Appropriation an die einzelnen,
αα) mit, oder
ββ) ohne garantierte Kundschaft, oder
β. Appropriation an einen Verband, mit nur persönlicher oder material regulierter und also nur bedingter oder an Voraussetzungen geknüpfter Appropriation an die einzelnen, mit der gleichen Alternative;
b) bei Trennung der Erwerbsleitung und der Arbeit kommt [334]sie vor als monopolistische Appropriation von Unternehmungschancen in ihren verschiedenen möglichen Formen durch
α. genossenschaftliche – gildenmäßige – oder
β. von der politischen Gewalt verliehene Monopole.
3. Im Fall des Fehlens jeder formalen Appropriation der Leitung ist die Appropriation der Beschaffungsmittel – oder der für die Beschaffung der Kapitalgüter erforderlichen Kreditmittel – praktisch, bei Kapitalrechnungsbetrieben, identisch mit Appropriation der Verfügung über die leitenden Stellen an die betreffenden Besitzer. Diese Besitzer können diese Verfügung ausüben
- durch Eigenbetrieb,
- durch Auslesep(eventuell, bei mehreren Besitzern: Zusammenwirken bei der Auslese) des Betriebsleiters. –[334]A: Auslese,
Ein Kommentar erübrigt sich wohl bei diesen Selbstverständlichkeiten.
Jede Appropriation der sachlichen komplementären Beschaffungsmittel bedeutet natürlich praktisch normalerweise auch mindestens entscheidendes Mitbestimmungsrecht auf die Auslese der Leitung und die (mindestens relative) Expropriation der Arbeiter von diesen. Aber nicht jede Expropriation der einzelnen Arbeiter bedeutet Expropriation der Arbeiter überhaupt, sofern ein Verband von Arbeitern, trotz formaler Expropriation in der Lage ist, material die Mitleitung oder Mitauslese der Leitung zu erzwingen.
§ 22. Die Expropriation des einzelnen Arbeiters vom Besitz der sachlichen Beschaffungsmittel ist rein technisch bedingt:
a) im Fall die Arbeitsmittel die simultane und sukzessive Bedienung durch zahlreiche Arbeiter bedingen,
b) bei Kraftanlagen, welche nur bei simultaner Verwendung für zahlreiche einheitlich organisierte gleichartige Arbeitsprozesse rational auszunutzen sind,
52
[334]Max Weber hat die seinerzeit übliche Technik zentraler Kraftanlagen vor Augen. Insbesondere Wasserräder und Dampfmaschinen haben häufig über ein System von Transmissionsapparaturen eine Vielzahl von Maschinen angetrieben.
[335]c) wenn die technisch rationale Orientierung des Arbeitsprozesses nur in Verbindung mit komplementären Arbeitsprozessen unter gemeinsamer kontinuierlicher Aufsicht erfolgen kann,
[A 78]d) wenn das Bedürfnis gesonderter fachmäßiger Schulung für die Leitung von zusammenhängenden Arbeitsprozessen besteht, welche ihrerseits nur bei Verwertung im großen rational voll auszunutzen ist,
e) durch die Möglichkeit straffer Arbeitsdisziplin und dadurch Leistungskontrolle und dadurch gleichmäßiger Produkte im Fall der einheitlichen Verfügung über Arbeitsmittel und Rohstoffe.
Diese Momente würden aber die Appropriation an einen Verband von Arbeitern (Produktivgenossenschaft) offen lassen, also nur die Trennung des einzelnen Arbeiters von den Beschaffungsmitteln bedeuten.
Die Expropriation der Gesamtheit der Arbeiter (einschließlich der kaufmännisch und technisch geschulten Kräfte) vom Besitz der Beschaffungsmittel ist ökonomisch vor allem bedingt:
a) allgemein durch die unter sonst gleichen Umständen größere Betriebsrationalität bei freier Disposition der Leitung über die Auslese und die Art der Verwendung der Arbeiter, gegenüber den durch Appropriation der Arbeitsstellen oder der Mitleitungsbefugnis entstehenden technisch irrationalen Hemmungen und ökonomischen Irrationalitäten, insbesondre: Hineinspielen von betriebsfremden Kleinhaushalts- und Nahrungs-Gesichtspunkten,
b) innerhalb der Verkehrswirtschaft durch überlegene Kreditwürdigkeit einer durch keine Eigenrechte der Arbeiter in der Verfügung beschränkten, sondern in uneingeschränkter Verfügungsgewalt über die sachlichen Kredit-(Pfand-)Unterlagen befindlichen Betriebsleitung durch geschäftlich geschulte und als „sicher“ geltende, weil durch kontinuierliche Geschäftsführung bekannte, Unternehmer.
c) Geschichtlich entstand sie innerhalb einer sich seit dem 16. Jahrhundert durch extensive und intensive Markterweiterung entwickelnden Wirtschaft durch die absolute Überlegenheit und tatsächliche Unentbehrlichkeit der individuell marktorientiert [336]disponierenden Leitung einerseits, durch reine Machtkonstellationen andererseits.
Über diese allgemeinen Umstände hinaus wirkt die an Marktchancen orientierte Unternehmung aber im Sinn jener Expropriation:
a) durch Prämiierung der rational technisch
q
nur bei Vollappropriation an Besitzer möglichen Kapitalrechnung gegenüber jeder rechnungsmäßig minder rationalen Wirtschaftsgebarung, [336]Lies: rationalen, technisch
b) durch Prämiierung der rein händlerischen Qualitäten der Leitung gegenüber den technischen, und der Festhaltung des technischen und kommerziellen Geheimwissens,
c) durch die Begünstigung spekulativer Betriebsführung, welche jene Expropriation voraussetzt. Diese wird letztlich ohne Rücksicht auf den Grad ihrer technischen Rationalität ermöglicht:
d) durch die Überlegenheit, welche
α. auf dem Arbeitsmarkt, jede Besitzversorgtheit als solche, gegenüber den Tauschpartnern (Arbeitern),
β. auf dem Gütermarkt die mit Kapitalrechnung, Kapitalgüterausstattung und Erwerbskredit arbeitende Erwerbswirtschaft über jeden minder rational rechnenden oder minder ausgestatteten und kreditwürdigen Tauschkonkurrenten besitzt. – Daß das Höchstmaß von formaler Rationalität der Kapitalrechnung nur bei Unterwerfung der Arbeiter unter die Herrschaft von Unternehmern möglich ist, ist eine weitere spezifische materiale Irrationalität der Wirtschaftsordnung.
53
[336]Den Begriff „Wirtschaftsordnung“ definiert Max Weber in diesem Kapitel nicht, jedoch an anderer Stelle: „Die durch die Art des Interessenausgleichs jeweils einverständnismäßig entstandene Verteilung der faktischen Verfügungsgewalt über Güter und ökonomische Dienste und die Art, wie beide kraft jener auf Einverständnis ruhenden faktischen Verfügungsgewalt dem gemeinten Sinn nach faktisch verwendet werden, nennen wir ‚Wirtschaftsordnung‘.“ Vgl. Weber, Die Wirtschaft und die Ordnungen, in: MWG I/22-3, S. 192 f.; zur Entstehung dieser speziellen Formulierung vgl. den textkritischen Apparat ebd.
Endlich
e) ist die Disziplin bei freier Arbeit und Vollappropriation der Beschaffungsmittel optimal.
[337]§ 23. Die Expropriation aller Arbeiter von den Beschaffungsmitteln kann praktisch bedeuten:
[A 79]1. Leitung durch den Verwaltungsstab eines Verbandes: auch (und gerade) jede rational sozialistische Einheitswirtschaft würde die Expropriation aller Arbeiter beibehalten und nur durch die Expropriation der privaten Besitzer vervollständigen; –
2. Leitung kraft Appropriation der Beschaffungsmittel an Besitzer durch diese oder ihre Designatäre.
54
[337]Die von den Besitzern der Beschaffungsmittel für die Leitung des Unternehmens Designierten, d. h. ausgewählten und bestimmten Personen, wie nachfolgend unter b) von Max Weber erläutert.
Die Appropriation der Verfügung über die Person des Leitenden an Besitzinteressenten kann bedeuten:
a) Leitung durch einen (oder mehrere) Unternehmer, die zugleich die Besitzer sind: unmittelbare Appropriation der Unternehmerstellung. Sie schließt aber nicht aus, daß tatsächlich die Verfügung über die Art der Leitung kraft Kreditmacht oder Finanzierung (s. später!)
55
weitgehend in den Händen betriebsfremder Erwerbsinteressenten (z. B. kreditgebender Banken oder FinanzerAuf Finanzinstitute geht Max Weber unten, S. 370 ff., auf die Finanzierung politischer Verbände unten, S. 428–437, ein.
r
)[337]A: Finanzen
56
liegt; Gemeint sind Personen oder Personengruppen (Finanzkonsortien), die Max Weber unten, S. 373 und S. 375, explizit „Finanzer“ nennt, so daß hier „Finanzen“ im Erstdruck entsprechend geändert worden ist. Weber unterscheidet die „Finanzer“ wegen ihrer speziellen Finanzierungsgeschäfte, nämlich des Erwerbs von Unternehmensanteilen, von den Banken.
b) Trennung von Unternehmerleitung
s
und appropriiertem Besitz, insbesondere durch Beschränkung der Besitzinteressenten auf die Designierung des Unternehmers und anteilsmäßige freie (veräußerliche) Appropriation des Besitzes nach Anteilen des Rechnungskapitals (Aktien, Kuxe). Dieser Zustand (der durch Übergänge aller Art mit der rein persönlichen Appropriation verbunden ist) ist formal rational in dem Sinn, als erA: Unternehmerleistung
t
– im Gegensatz zur dauernden und erblichen Appropriation der Leitung selbst an den zufällig ererbten BesitzA: er,
u
– die Auslese des [338](vom Rentabilitätsstandpunkt aus) qualifizierten Leiters gestattet. Aber praktisch kann dies verschiedenerlei bedeuten: A: Besitz,
α. die Verfügung über die Unternehmerstellung liegt kraft Besitzappropriation in den Händen von betriebsfremden Vermögensinteressenten: Anteilsbesitzern, die vor allem: hohe Rente suchen,
ß. die Verfügung über die Unternehmerstellung liegt kraft temporären Markterwerbs in den Händen von betriebsfremden Spekulationsinteressenten (Aktienbesitzern, die nur Gewinn durch Veräußerung suchen),
γ. die Verfügung über die Unternehmerstellung liegt kraft Markt- oder Kreditmacht in den Händen von betriebsfremden Erwerbsinteressenten (Banken oder Einzelinteressenten
v
– z. B. den „Finanzern“[338]A: Einzelinteressenten,
w
–[,] welche ihren, oft dem Einzelbetrieb fremden, Erwerbsinteressen nachgehen). A: „Finanzen“
„Betriebsfremd“ heißen hier diejenigen Interessenten, welche nicht primär an nachhaltiger
x
Dauer-Rentabilität des Unternehmens orientiert sind. Dies kann bei jeder Art von Vermögensinteresse eintreten. In spezifisch hohem Maß aber bei Interessenten, welche die Verfügung über ihren Besitz an Anlagen und Kapitalgütern oder eines Anteils daran (Aktie, Kux) nicht als dauernde Vermögensanlage, sondern als Mittel: einen rein aktuell spekulativen Erwerbsgewinn daraus zu ziehen, verwenden. Am relativ leichtesten sind reine Renteninteressen (α) mit den sachlichen Betriebsinteressen (das heißt hier: an aktueller und Dauer-Rentabilität) auszugleichen. A: nachhaltige
Das Hineinspielen jener „betriebsfremden“ Interessen in die Art der Verfügung über die leitenden Stellen, gerade im Höchstfall der formalen Rationalität ihrer Auslese, ist eine weitere spezifische materiale Irrationalität der modernen Wirtschaftsordnung (denn es können sowohl ganz individuelle Vermögensinteressen wie: an ganz andern, mit dem Betrieb in keinerlei Verbindung stehenden, Zielen orientierte Erwerbsinteressen, wie endlich: reine Spiel-Interessen sich der appropriierten Besitzanteile bemächtigen und über die Person des Leiters und [339]– vor allem – die ihm oktroyierte Art der Betriebsführung entscheiden). Die Beeinflussung der Marktchancen, vor allem der Kapitalgüter und damit der Orientierung der erwerbsmäßigen Güterbeschaffung durch betriebsfremde, rein spekulative Interessen ist eine der Quellen der als „Krisen“ bekannten Erscheinungen der modernen Verkehrswirtschaft (was hier nicht weiter zu verfolgen ist).
[A 80]§ 24. Beruf soll jene Spezifizierung, Spezialisierung und Kombination
y
von Leistungen einer Person heißen, welche für sie Grundlage einer kontinuierlichen Versorgungs- oder Erwerbschance ist. Die Berufsverteilung kann [339]A: Kombination,
1. durch heteronome Zuteilung von Leistungen und Zuwendung von Versorgungsmitteln innerhalb eines wirtschaftsregulierenden Verbandes (unfreie Berufsteilung), oder durch autonome Orientierung an Marktlagen für Berufsleistungen (freie Berufsteilung) geschehen, –
2. auf Leistungsspezifikation
a
oder auf Leistungsspezialisierung beruhen, – A: Leitungsspezifikation
3. wirtschaftlich autokephale oder heterokephale Verwertung der Berufsleistungen durch ihren Träger bedeuten.
Typische Berufe und typische Arten von Einkommens-Erwerbschancen stehen im Zusammenhang miteinander, wie bei Besprechung der „ständischen“ und „Klassenlagen“ zu erörtern sein wird.
Über „Berufsstände“ und Klassen im allgemeinen s. Kap. IV.
57
[339]Beginn des nicht abgeschlossenen Kapitels, unten, S. 592–600.
1.
58
Unfreie Berufsteilung: leiturgisch oder oikenmäßig durch Zwangsrekrutierung der einem Beruf Zugewiesenen innerhalb eines fürstlichen, staatlichen, fronherrlichen, kommunalen Verbandes. – Freie Berufsteilung: kraft erfolgreichen Angebots von Berufsleistungen auf dem Arbeitsmarkt oder erfolgreicher Bewerbung um freie „Stellungen“. Die Ausführungen beziehen sich auf Punkt 1. (oben, Z. 12), die nachfolgenden Punkte 2. und 3. stellen ebenfalls Erläuterungen zu den oben genannten Punkten dar.
[340]2. Leistungsspezifikation, wie schon § 16 bemerkt:
59
die Berufsteilung des Gewerbes im Mittelalter, Leistungsspezialisierung: die Berufsteilung in den modernen rationalen Betrieben. Die Berufsteilung in der Verkehrswirtschaft ist, methodisch angesehen, sehr vielfach technisch irrationale Leistungsspezifikation und nicht rationale Leistungsspezialisierung schon deshalb, weil sie an Absatzchancen und deshalb an Käufer-, also Verbraucher-Interessen orientiert ist, welche das Ensemble der von einem und demselben Betrieb angebotenen Leistungen abweichend von der Leistungsspezialisierung determinieren und zu Leistungsverbindungen methodisch irrationaler Art nötigen. [340]Kap. II, § 16, oben, S. 304, A.1.b. β mit Definitionen.
3. Autokephale Berufsspezialisierung: Einzelbetrieb (eines Handwerkers, Arztes[,] Rechtsanwalts, Künstlers). Heterokephale Berufsspezialisierung: Fabrikarbeiter, Beamter.
Die Berufsgliederung gegebener Menschengruppen ist verschieden:
a) je nach dem Maß der Entwicklung von typischen und stabilen Berufen überhaupt. Entscheidend dafür ist namentlich
α. die Bedarfsentwicklung,
ß. die Entwicklung der (vor allem:) gewerblichen Technik,
b
[340]A: Technik.
γ.
c
die Entwicklung entweder c–c (S. 365, bis: (Bindung auch ) Zu dieser Textpassage sind Korrekturfahnen überliefert; vgl. dazu den Anhang, unten, S. 664–688.
αα) von Großhaushalten: – für unfreie Berufsverteilung, oder
ßß) von Marktchancen: – für freie Berufsverteilung;
d
A: Berufsverteilung,
b) je nach dem Grade und der Art der berufsmäßigen Spezifikation oder der Spezialisierung der Wirtschaften.
Entscheidend dafür ist vor allem
α. die durch Kaufkraft bestimmte Marktlage für die Leistungen spezialisierter Wirtschaften,
ß. die Art der Verteilung der Verfügung über Kapitalgüter;
c) je nach dem Maße und der Art der Berufskontinuität oder des Berufswechsels. Für diesen letztgenannten Umstand sind entscheidend vor allem
α. das Maß von Schulung, welches die spezialisierten Leistungen voraussetzen,
ß. das Maß von Stabilität oder Wechsel der Erwerbschancen, welches abhängig ist von dem Maß der Stabilität einerseits der Einkommensverteilung und von deren Art, andererseits von der Technik.
[341]Für alle Gestaltungen der Berufe ist schließlich wichtig: die ständische Gliederung mit den ständischen Chancen
60
und Erziehungsformen, welche sie für bestimmte Arten gelernter Berufe schafft. [341]In der überlieferten Korrekturfahne K2 heißt es statt „ständischen Chancen“ noch „Prestige-Chancen“. Vgl. Anhang, unten, S. 665 mit textkrit. Anm. d.
Zum Gegenstand selbständiger und stabiler Berufe werden nur Leistungen, welche ein Mindestmaß von Schulung voraussetzen und für welche kontinuierliche Erwerbschancen bestehen. Berufe können traditional (erblich) überkommen oder aus zweckrationalen (insbesondre: Erwerbs-)Erwägungen gewählt oder charismatisch eingegeben oder affektuell, insbesondere aus ständischen („Ansehens“-)Interessen
e
[341]A: („Ansehens“)-Interessen
61
ausgeübt werden. Die individuellen Berufe waren primär durchaus charismatischen (magischen) Charakters, der gesamte Rest der Berufsgliederung – soweit Ansätze einer solchen überhaupt bestanden – traditional bestimmt. Die nicht spezifisch persönlichen charismatischen Qualitäten wurden entweder Gegenstand von traditionaler [A 81]Anschulung in geschlossenen Verbänden oder erblicher Tradition. Individuelle Berufe nicht streng charismatischen Charakters schufen zunächst – leiturgisch – die großen Haushaltungen der Fürsten und Grundherren, dann – verkehrswirtschaftlich – die Städte. Daneben aber stets: die im Anschluß an die magische oder rituelle oder klerikale Berufsschulung entstehenden literarischen und als vornehmIn der Korrekturfahne K2 heißt es statt „(,Ansehens-‘)lnteressen“ noch „Prestige-Interessen“. Vgl. Anhang, unten, S. 665 mit textkrit. Anm. e.
62
geltenden ständischen Erziehungsformen. In den Korrekturfahnen K2 statt „vornehm“ noch: „wissenschaftlich“. Vgl. Anhang, unten, S. 665 mit textkrit. Anm. c.
Berufsmäßige Spezialisierung bedeutet nach dem früher Gesagten nicht notwendig: kontinuierliche Leistungen entweder 1. leiturgisch für einen Verband (z. B. einen fürstlichen Haushalt oder eine Fabrik)
63
oder 2. für einen völlig freien „Markt“. Es ist vielmehr möglich und häufig: Gemeint sind vermutlich die zuvor erwähnte russische „Leibeigenenfabrik“ (oben, S. 318) und die in der Literatur auch „Fabriken“ genannten Werkstätten im antiken Griechenland (oben, S. 331). In diesen Fällen hat es auch leiturgische Leistungserbringung gegeben, nicht aber in der modernen Fabrik, die nach Weber „eine Kategorie der kapitalistischen Wirtschaft“ ist. Vgl. oben, S. 331 f.
[342]1. daß besitzlose
64
berufsspezialisierte Arbeiter je nach Bedarf nur als Gelegenheitsarbeitskräfte verwendet werden, von einem relativ gleichbleibenden Kreis [342]Das Adjektiv „besitzlose“ wurde von Max Weber eigenhändig in Korrekturfahne K2 eingefügt. Vgl. Anhang, unten, S. 666.
a) von haushaltsmäßigen
f
Kunden (Konsumenten) oder [342]A: haushaltmäßigen
b) von Arbeitgeberkunden
65
(Erwerbswirtschaften). Als Nachfrager am Arbeitsmarkt sind auch Arbeitgeber „Kunden“. Dies zu betonen, war vermutlich die Absicht von Max Weber, als er in der Korrekturfahne K2 das ursprüngliche „Abnehmer“ eigenhändig erst in „Kunden“ und dann in „Arbeitgeberkunden“ korrigierte. Vgl. Anhang, unten, S. 666.
Zu a) In Haushaltungen: dahin gehört
α. bei Expropriation mindestens: der Rohstoffbeschaffung, also: der Verfügung über das Erzeugnis, vom Arbeiter:
I. Die „Stör“
αα) als reiner Wanderbetrieb,
ββ) als seßhafte, aber in einem örtlichen Kreis von Haushaltungen ambulante Arbeit;
II. das „Lohnwerk“: seßhafte Arbeit, in eigner Werkstatt (bzw. Haushalt) für einen Haushalt arbeitend.
66
Anders als oben, S. 319, „Dritte Möglichkeit“ a), weicht Max Weber hier von Büchers Begrifflichkeit ab. Oben und bei Bücher ist „Lohnwerk“ der Oberbegriff zu „Stör“ und „Heimwerk“. Vgl. auch Bücher, Karl, Gewerbe, in: WbVW3, Band 1, 1911, S. 1066–1082, hier S. 1072.
In allen Fällen liefert der Haushalt den Rohstoff; dagegen pflegen die Werkzeuge dem Arbeiter appropriiert zu sein (Sensen den Schnittern, Nähwerkzeug der Näherin, alle Arten von Werkzeugen den Handwerkern).
Das Verhältnis bedeutet in den Fällen Nr. I den temporären Eintritt in den Haushalt eines Konsumenten.
Dem gegenüber ist von K[arl] Bücher der Fall der vollen Appropriation aller Beschaffungsmittel an den Arbeiter als „Preiswerk“ bezeichnet worden.
67
In der Regel spricht auch Bücher von „Handwerk“. Jedoch hat er, wo es auf die Unterscheidung zu „Lohnwerk“ ankam, das Handwerk auch als „Preiswerk“ bezeichnet. Vgl. oben, S. 324, Hg.-Anm. 17.
Zu b) Gelegenheitsarbeit berufsspezialisierter Arbeiter für Erwerbswirtschaften:
[343]bei Expropriation mindestens der Rohstoffbeschaffung, also: der Verfügung über das Erzeugnis, vom Arbeiter:
I. Wanderarbeit in wechselnden Betrieben von Arbeitgebern,
II. gelegentliche oder Saison-Heimarbeit für einen Arbeitgeber in eigner Haushaltung.
Beispiel zu I: Sachsengänger,
68
[343]Ursprünglich Bezeichnung für aus dem Osten kommende Landarbeiter, die in der preußischen Provinz Sachsen und im Königreich Sachsen regelmäßig im Sommer in der dort intensiv betriebenen Landwirtschaft, vor allem dem Zuckerrübenanbau, Beschäftigung fanden. Um 1900 ist „Sachsengängerei“ ein Ausdruck für alle Art saisonaler Wanderung von Landarbeitern. Über die Probleme der „Sachsengängerei“ vgl. Weber, Die Lage der Landarbeiter, MWG I/3, passim; ders., Landarbeiterfrage, MWG I/4, passim.
zu
g
II: jede gelegentlich ergänzend zur Werkstattarbeit tretende Heimarbeit. [343]A: Zu
2. Das Gleiche bei Wirtschaften mit appropriierten Beschaffungsmitteln:
α. Bei Kapitalrechnung und partieller, insbesondere: auf die Anlagen beschränkter Appropriation der Beschaffungsmittel an Besitzer; Lohnwerkstattbetriebe (Lohnfabriken) und vor allem: verlegte Fabriken – erstere seit langem, letztere neuerdings häufig vorkommend.
69
„Lohnwerkstattbetriebe“ hießen Arbeitsstätten, wie sie insbesondere in der Hausindustrie (Verlagssystem) seit langem vorkamen (vgl. oben, S. 300 f., Hg.-Anm. 42 und 43). „Lohnfabriken“ hießen gewerbliche Großbetriebe, die für wechselnde Auftraggeber die von diesen gelieferten Rohstoffe bearbeiteten, ohne daran Eigentum zu erwerben und das Fertigprodukt selbst auf den Markt zu bringen. Handelte es sich immer um denselben Auftraggeber und übernahm dieser auch weitere kaufmännische Funktionen, so sprach man von „verlegten Fabriken“. Zu den Beziehungen zwischen Handel und Fabrikindustrie und dem neuen Typus des „Fabrikverlegers“ vgl. Hirsch, Julius, Organisation und Formen des Handels und der staatlichen Binnenhandelspolitik, in: GdS, Abt. V, 1. Teil, 1918, S. 39–235 (hinfort: Hirsch, Organisation), hier S. 85 f.
β. Bei voller Appropriation der Beschaffungsmittel an Arbeiter
a) kleinbetrieblich, ohne Kapitalrechnung:
αα) für Haushaltungen: Kundenpreiswerker
ββ) für Erwerbsbetriebe: Hausindustrie ohne Expropriation der Beschaffungsmittel, also formal ungebundene[,] aber tat[344]sächlich an einen monopolistischen Kreis von Abnehmern absetzende Erwerbsbetriebe,
[A 82]b) großbetrieblich mit Kapitalrechnung: Beschaffung für einen festen Abnehmerkreis: – Folge (regelmäßig, aber nicht: nur) von kartellmäßigen Absatzregulierungen.
70
[344]Absatzregulierungen, die sich auf die Verteilung der Produktion von Kartellmitgliedern auf bestimmte Abnehmer bezogen, waren typisches Kennzeichen der sog. Kartelle höherer Ordnung. Bekannteste Beispiele in Deutschland waren das Rheinisch-Westfälische Kohlensyndikat und der Stahlwerksverband. Vgl. Liefmann, Robert, Kartelle und Trusts. – Stuttgart: Ernst Heinrich Moritz 1905; 3. Aufl. unter dem Titel: Kartelle und Trusts und die Weiterbildung der volkswirtschaftlichen Organisation, ebd., 1918.
Es ist schließlich noch festzustellen:
71
daß weder Die Ausführungen bis zum Ende von § 24, unten, S. 345, beruhen auf nachträglichen Einfügungen Max Webers in die Korrekturfahnen K2. Zum ersten Teil (bis unten, Zeile 26) ist ein handschriftliches Zusatzblatt überliefert. Vgl. den Anhang, unten, S. 668.
a) jeder Erwerbsakt Bestandteil eines berufsmäßigen Erwerbens ist, – noch
b) alle noch so häufigen Erwerbsakte begriffsnotwendig irgendeiner kontinuierlichen gleichsinnigen Spezialisierung zugehören.
Zu a: Es gibt Gelegenheitserwerb:
h
[344]A: Gelegenheitserwerb;
α) der Überschüsse des Hausfleißes abtauschenden Hauswirtschaft. Ebenso zahlreiche ihnen entsprechende großhaushaltungsmäßige, namentlich grundherrliche, Gelegenheits-Erwerbsabtausche. Von da führt eine kontinuierliche Reihe von möglichen „Gelegenheitserwerbsakten“ bis:
β) zur Gelegenheitsspekulation eines Rentners, dem Gelegenheitsabdruck eines Artikels, Gedichtes usw. eines Privaten und ähnlichen modernen Vorfällen. – Von da wieder bis zum „Nebenberuf“.
Zu b: Es ist ferner zu erinnern: daß es auch vollkommen wechselnde und in ihrer Art absolut unstete, zwischen allen Arten von Gelegenheitserwerb und zwar eventuell auch zwischen normalen Erwerbsakten und Bettel, Raub, Diebstahl wechselnde Formen der Existenzfristung gibt.
[345]Eine Sonderstellung nehmen ein
a) rein karitativer Erwerb,
b) nicht karitativer Anstaltsunterhalt (insbesondre: strafweiser),
c) geordneter Gewalterwerb,
i
[345]A: Gewalterwerb:
d) ordnungsfremder (krimineller) Erwerb durch Gewalt oder List.
j
Absatz fehlt in A.
Die Rolle von b und d bietet wenig Interesse. Die Rolle von a war für die hierokratischen Verbände
72
(Bettelmönchtum), die Rolle von c für die politischen Verbände (Kriegsbeute) und in beiden Fällen für dies[345]Zum Begriff „hierokratischer Verband“ vgl. Kap. I, oben, S. 212.
k
Wirtschaften oft ganz ungeheuer groß. Die „Wirtschaftsfremdheit“ ist in diesen beiden Fällen das Spezifische. Deshalb ist eine nähere Klassifikation hier nicht am Platz. Die Formen werden anderwärts zu entwickeln sein.Lies: dieses
73
Aus teilweise (aber nur teilweise) ähnlichen Gründen ist der Beamtenerwerb (einschließlich des Offizierserwerbes, der dazu gehört) unten (§ 41Eine kurze Erwähnung der „Wirtschaftsfremdheit“ findet sich bei der Darstellung der charismatischen Herrschaftsformen (Kap. III, § 10, unten, S. 495). Ausführlichere Darlegungen liegen nicht vor.
l
)A: 39
74
nur zwecks „systematischerEine entsprechende kurze Erwähnung der Beamtengehälter findet sich in Kap. II, § 41 (nicht „§ 39“, wie in der Druckfassung angegeben), unten, S. 444.
m
Ortsbezeichnung“ als Unterart des Arbeitserwerbes genannt, ohne vorerst näher kasuistisch erörtert zu sein. Denn dazu gehört die Erörterung der Art der Herrschaftsbeziehung,A: „systematische
75
in welcher diese Kategorien stehen. Kap. III, unten, S. 449–539.
§ 24a.
76
Die Kasuistik der technischen, betriebsmäßigen Appropriations- und Marktbeziehungen ist also nach den von § 15Im Druck von Korrekturfahne K1 fehlt jegliche Paragraphenangabe, hier fügte Weber handschriftlich „§ 24“ ein. Die Korrektur ist übernommen in Korrekturfahne K2 und wurde von Weber nicht neuerlich korrigiert. Vgl. Anhang, unten, S. 669 mit textkrit. Anm.5. Ob die Änderung in „§ 24a“ von Weber selbst in einem weiteren Korrekturdurchgang vorgenommen wurde oder postum erfolgt ist, ließ sich nicht ermitteln.
77
[346]angefangen bis hier entwickelten theoretischen Schemata eine höchst vielseitige. Kap. II, § 15, oben, S. 295.
Tatsächlich spielen von den zahlreichen Möglichkeiten nur einige eine beherrschende Rolle.
78
[346]Unten, S. 353–355, läßt Max Weber der im Folgenden entwickelten komprimierten Typologie ebenso knappe Hinweise auf die Verbreitung der genannten Typen in Zeit und Raum folgen.
1. Auf dem Gebiet des landwirtschaftlichen Bodens:
a) ambulanter, d. h. nach Ausnutzung des Bodens den Standort wechselnder Ackerbau: Hauswirtschaft mit Appropriation des Bodens an den Stamm und – zeitweilig oder dauernd – der Nutzung an Nachbarschaftsverbände mit nur zeitweiser Appropriation der Bodennutzung an Haushaltungen.
Die Größe der Haushaltsverbände ist regelmäßig entweder
- große Hauskommunion,79oderEine Haus- und Familiengemeinschaft (vgl. den Glossar-Eintrag, unten, S. 743). Sie übt ihre wirtschaftliche Tätigkeit im gemeinsamen Haushalt und zu gemeinsamem Nutzen aus. Spuren einer solchen Ordnung in der Familie sind bei vielen Völkern nachzuweisen. Typisch war sie bei den Südslawen. Vgl. Marković, Milan, Die serbische Hauskommunion (zadruga) und ihre Bedeutung in der Vergangenheit und Gegenwart. – Leipzig: Duncker & Humblot 1903. Zum Vorkommen dieses Typs vgl. unten, S. 353.
- organisierte Sippenwirtschaft, oder
- Großfamilienhaushalt, oder
- Kleinfamilienhaushalt.
„Ambulant“ ist der Ackerbau regelmäßig nur in bezug auf den bebauten Boden, weit seltener und in größeren Perioden: für Hofstätten.
[A 83]b) Seßhafter Ackerbau: mark- und dorf-genossenschaftliche Regulierung der Nutzungsrechte an Äckern, Wiesen, Weiden, Holzungen, Wasser mit (normalerweise) Kleinfamilienhaushaltungen. Appropriation von Hofgütern und Gärten an Kleinfamilien; Acker, (meist) Wiesen, Weiden an den Dorfverband; Holzungen an größere Markgemeinschaften. Bodenumteilungen sind dem Recht nach ursprünglich möglich, aber nicht systematisch organisiert und daher meist obsolet. Die Wirtschaft ist meist durch Dorfordnung reguliert (primäre Dorfwirtschaft).
[347]Die Sippengemeinschaft als Wirtschaftsgemeinschaft besteht nur ausnahmsweise (China),
80
und dann in rationalisierter Verbandsform (Sippenvergesellschaftung), fort[347]Vgl. Weber, Konfuzianismus, MWG I/19, S. 273 ff.; Weber, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, MWG III/6, S. 135 f., dort wird die „halbkommunistische Sippenwirtschaft“ in China beschrieben: „Die Sippe besitzt innerhalb des einzelnen Dorfes Schulen und Magazine, hält die Feldbestellung aufrecht, greift in den Erbgang ein und ist dem Gerichte für die Untaten ihrer Mitglieder verantwortlich; die ganze ökonomische Existenz des einzelnen beruht auf seiner Zugehörigkeit zu ihr; Kredit ist normalerweise immer Sippenkredit“.
n
.[347]A: (Sippenvergesellschaftung)
81
Der erst in die Korrekturen eingefügte Begriff „Sippenvergesellschaftung“ kommt bei Max Weber nur hier vor. Durch die handschriftliche Begriffseinfügung in Korrekturfahne K2 ist das ursprüngliche Satzende „, fort“ offenbar übersehen worden. Zu den Überarbeitungen in den Korrekturfahnen in diesem Bereich vgl. den Anhang, unten, S. 670.
c) Grundherrschaft
82
und LeibherrschaftÜber Bedingungen und die Entwicklung der Grundherrschaft ausführlich Weber, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, MWG III/6, S. 150–157, und zum Begriff „Grundherrschaft“ der Glossar-Eintrag, unten, S. 743.
83
mit grundherrlichem Fronhof und gebundenen Naturalgüter- und Arbeits-Leistungen der abhängigen Bauernbetriebe. Gebundene Appropriation: des Bodenbesitzes und der Arbeiter an den Herren, der Bodennutzung und der Rechte auf die Arbeitsstellen an die Bauern (einfacher grundherrlicher Naturalleistungsverband). Vgl. den Glossar-Eintrag „Leibherrschaft“, unten, S. 746.
d) α) Grundherrschaftliches oder β) fiskalisches Bodenmonopol mit Solidarhaft der Bauerngemeindeverbände für fiskalische Lasten. Daher: Feldgemeinschaft und systematisierte regelmäßige Neuverteilung des Bodens:
84
oktroyierte dauernde Appropriation des Bodens als Korrelat der Lasten an den Bauerngemeindeverband, nicht an die Haushaltungen, an diese nur zeitweise und vorbehaltlich der Neuumteilung zur Nutzung. Regulierung der Wirtschaft durch Ordnungen des Grundherrn [348]oder politischen Herrn (grundherrliche oder fiskalische Feldgemeinschaft). Max Weber verwendet den Begriff „Feldgemeinschaft“ hier wie auch an anderen Stellen zunächst im weiten Sinne, für gemeinschaftlichen Besitz der Dorfbewohner an der Ackerfläche mit den daraus folgenden, für die mittelalterliche und frühneuzeitliche Landwirtschaft typischen Nutzungsregeln. Die von ihm als hinzutretend angesprochene systematisierte regelmäßige Neuverteilung des Bodens bildet den Kern eines engeren Begriffs Feldgemeinschaft, für den der russische Mir das bekannteste Beispiel ist. Vgl. Meitzen, August, Feldgemeinschaft, in: HdStW3, Band 4, 1909, S. 56–71.
e) Freie Grundherrschaft mit haushaltsmäßiger Nutzung der abhängigen Bauernstellen als Rentenquelle[.] Also: Appropriation des Bodens an den Grundherren, aber:
- Kolonen, oder
- Teilpacht- oder
- Geldzinsbauern85[348]Der ungewöhnliche Begriff „Geldzinsbauern“ faßt Pächter („Pachtzins-Bauern“) und „Erbzinsbauern“ zusammen. (Zur ursprünglichen Gestalt des Absatzes und Webers Korrekturen in K1 und K2 vgl. den Anhang, unten, S. 671.) In der Fachsprache bezeichnete man als Zinsbauern Bauern mit guten, d. h. erblichen Besitzrechten an dem ihnen überlassenen Boden, wofür sie Abgaben, den (Erb-)Zins, zu zahlen hatten.
als Träger der Wirtschaftsbetriebe.
f) Plantagenwirtschaft:
86
freie Appropriation des Bodens und der Arbeiter (als Kaufsklaven) an den Herren als Erwerbsmittel in einem kapitalistischen Betrieb mit unfreier Arbeit. Max Weber bildet den vom seinerzeitigen Sprachgebrauch abweichenden Begriff Plantagenwirtschaft, der auf Zwangsarbeit abstellt, in Anlehnung an Karl Bücher, Die Aufstände der unfreien Arbeiter 143–129 v. Chr. – Frankfurt a.Μ.: J.C. Sauerländer 1874, S. 13 („Plantagensystem“). Ausführlich zu diesem Typ Weber, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, MWG III/6, S. 161–166.
g) Gutswirtschaft:
87
Appropriation des Bodens Indem Max Weber „Gutswirtschaft“ als landwirtschaftlichen Großbetrieb mit freien Arbeitern definiert, hat er – anders als oben, S. 314 und S. 331 – die Verhältnisse nach der Bauernbefreiung im 19. Jahrhundert im Auge. (In den Korrekturfahnen heißt es hier zwischenzeitlich sogar „Freie Gutswirtschaft“, vgl. Anhang, unten, S. 671.) In der Vorlesung „Abriß der universalen Sozial- und Wirtschaftsgeschichte“ nennt Weber pointiert „Gutswirtschaft“ „einen auf den Absatz eingerichteten kapitalistischen Großbetrieb“ (vgl. Weber, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, MWG III/6, S. 166). In der Agrarverfassungsgeschichte werden auch die mit Unfreien betriebenen Eigenwirtschaften von Guts- und Grundherren als Gutswirtschaft bezeichnet; vgl. Wittich, W[erner], Gutsherrschaft, in: HdStW3, Band 5, 1910, S. 209–216.
α. an Bodenrentenbesitzer, Verleihung an Großpächterwirtschaften. Oder
β. an die Bewirtschafter als Erwerbsmittel. Beidemal mit freien Arbeitern, in
a)
88
eignen oder Bei den Ordnungsbuchstaben a) und b) handelt es sich um die Untergliederungsebene zu „β.“, weshalb hier abweichende Ordnungsbuchstaben erforderlich gewesen wären. Zu den Mehrfachkorrekturen dieser Textpassage vgl. den Anhang, unten, S. 671.
b) vom Herrn gestellten Haushaltungen, in beiden Fällen
[349]α. mit landwirtschaftlicher Erzeugung oder – Grenzfall – β.
o
ohne alle eigne Gütererzeugung. [349]A: β)
h) Fehlen der Grundherrschaft: bäuerliche Wirtschaft mit Appropriation des Bodens an die Bewirtschafter (Bauern). Die Appropriation kann praktisch bedeuten:
α. daß tatsächlich vorwiegend nur erblich erworbener Boden oder
β. umgekehrt, daß Parzellenumsatz besteht,
ersteres bei Einzelhofsiedelung und Großbauernstellen, letzteres bei Dorfsiedelung und Kleinbauernstellen typisch.
Normale Bedingung ist für den Fall e[,] γ ebenso wie für den Fall h, β die Existenz ausreichender lokaler Marktchancen für bäuerliche Bodenprodukte.
2. Auf dem Gebiet des Gewerbes (einschließlich des Bergbaues), Transports
p
und Handels: A: Gewerbes und Transports (einschließlich des Bergbaues)
90
In der Korrekturfahne K1 änderte Weber „des Gewerbes und Transports“ handschriftlich zu: „des Gewerbes (einschließlich des Bergbaues), Transports und Handels“. Durch die etwas mißverständlichen Korrekturzeichen ist daraus der in A (und K2) überlieferte Text geworden. Hier wurde nach K1 emendiert. Vgl. dazu auch den Anhang, unten, S. 672.
a) Hausgewerbe, primär als Mittel des Gelegenheitstausches, sekundär als Erwerbsmittel mit
α. interethnischer Leistungsspezialisierung (Stammesgewerbe). Daraus erwachsen:
[A 84]β. Kastengewerbe.
89
[349]Zur Entstehung der dem indischen Kastenwesen eigentümlichen Berufsspezifizierung, derzufolge die Ausübung eines Gewerbes ausschließlich den Angehörigen einer Kaste oblag, vgl. oben, S. 325, sowie Weber, Hinduismus, MWG I/20, u. a. S. 185 ff.; Weber, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, MWG III/6, S. 195 f. und 389.
In beiden Fällen primär: Appropriation der Rohstoffquellen und also der Rohstofferzeugung; Kauf der Rohstoffe oder Lohngewerbe erst sekundär. Im ersten Fall oft: Fehlen formaler Appropriation. Daneben, und im zweiten Fall stets: erbliche Appropriation der leistungsspezifizierten Erwerbschancen an Sippen- oder Hausverbände.
b) Gebundenes Kundengewerbe: Leistungsspezifikation für einen Konsumenten-Verband:
[350]α. einen herrschaftlichen (oikenmäßig, grundherrlich) –
β. einen genossenschaftlichen (demiurgisch).
Kein Markterwerb. Im Fall α haushaltsmäßige Leistungsverbindung, zuweilen Werkstattarbeit im Ergasterion des Herren. Im Fall β erbliche (zuweilen: veräußerliche) Appropriation der Arbeitsstellen, Leistung für appropriierte (Konsumenten-) Kundschaft – kärgliche Fortentwicklungen:
I. Erster Sonderfall: Appropriierte (formal unfreie) leistungsspezifizierte Träger des Gewerbes
α. als Rentenquelle der Herren, dabei aber als, trotz der formalen Unfreiheit, material freie (meist) Kundenproduzenten (Rentensklaven),
1
[350]„Rentensklave“ ist eine Wortschöpfung, die sich noch nicht in den Korrekturfahnen K1 und K2 findet (vgl. Anhang, unten, S. 674). Zum Sachverhalt vgl. oben, S. 317, sowie Weber, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, MWG III/6, S. 201.
β. als unfreie Hausgewerbetreibende für Erwerbszwecke,
γ. als Werkstatt-Arbeiter in einem Ergasterion des Herren für Erwerbszwecke (unfreie Hausindustrie).
II. Zweiter Sonderfall: leiturgische Leistungsspezifikation für fiskalische Zwecke: Typus dem Kastengewerbe (a, β) gleichartig.
Entsprechend auf dem Gebiet des Bergbaues:
fürstlicher oder grundherrlicher Betrieb mit Unfreien: Sklaven oder Hörigen.
Entsprechend auf dem Gebiet des Binnentransports:
a) grundherrliche Appropriation der Transportanlagen als Rentenquelle: Umlegung demiurgischer Leistungen auf die dafür bestimmten Kleinbauernstellen;
2
Im Mittelalter haben die Grundherren für die Benützung der in ihrem Besitz befindlichen Straßen und Brücken Abgaben erhoben. Die Anlage und der Unterhalt derselben gehörten zu den drückendsten Lasten der zu diesen Arbeiten verpflichteten Bauern.
q
b) genossenschaftlich
q
regulierte Kleinhändlerkarawanen. [350]A: Kleinbauernstellen. Genossenschaftlich Absatz und Ordnungsbuchstabe fehlen in A; sinngemäß ergänzt.
Die Ware war ihnen appropriiert.
Auf dem Gebiet des Seetransports:
a) oikenmäßiger oder grundherrlicher oder patrizischer Schiffsbesitz mit Eigenhandel des Herren;
[351]b) genossenschaftlicher Schiffsbau und Schiffsbesitz, Schiffsführer und Mannschaft als Eigenhändler beteiligt, interlokal reisende Kleinhändler neben ihnen als Befrachter, Risikovergesellschaftung aller Interessenten, streng regulierte Schiffskarawanen. In allen Fällen war dabei „Handel“ mit interlokalem Handel, also Transport, noch identisch.
c)
3
Freies Gewerbe: [351]Der Ordnungsbuchstabe c) bindet nicht an die unmittelbar vorausgehenden a) und b) an, sondern gehört zu der oben, S. 349, beginnenden übergeordneten Gliederung „a) Hausgewerbe, b) Gebundenes Kundengewerbe“.
Freie Kundenproduktion als
a) Stör, oder
b) Lohnwerk
4
Zu Webers von Bücher abweichender Definition von „Lohnwerk“ vgl. oben, S. 342, Hg.-Anm. 66 und 67.
bei Appropriation der Rohstoffe an den Kunden (Konsumenten), der Arbeitswerkzeuge an den Arbeiter, der etwaigen Anlagen an Herren (als Rentenquelle) oder Verbände (zur Reihum-Benutzung), oder
c) „Preiswerk“, mit Appropriation der Rohstoffe und Arbeitswerkzeuge, damit auch: der Leitung, an Arbeiter, etwaiger Anlagen (meist) an einen Arbeiterverband (Zunft).
In allen diesen Fällen typisch: Erwerbsregulierung durch die Zunft.
Im Bergbau: Appropriation des Vorkommens an politische oder Grundherren als Rentenquelle; Appropriation des Abbaurechts an einen Arbeiterverband; zünftige Regelung des Abbaus als Pflicht gegen den Bergherren als Renteninteressenten und gegen die Berggemeinde als jenem solidarisch haftend und am Ertrag interessiert. –
[A 85]Auf dem Gebiet des Binnen-Transports: Schiffer- und Fracht fahrer-Zünfte mit festen Reihefahrten
5
und Regulierung ihrer Erwerbschancen. Bezeichnung für eine bis in das 19. Jahrhundert von Schiffergilden organisierte konkurrenzausschließende Zuteilung von Fracht an jene Schiffer, die „an der Reihe“ waren. Ausführlich hierzu Sombart, Der moderne Kapitalismus II2, S. 350–352.
[352]Auf dem Gebiet der Seeschiffahrt: Schiffspartenbesitz, Schiffskarawanen, reisende Kommendahändler.
r
[352]Durchschuß fehlt in A.
6
[352]In den Korrekturfahnen K1 und K2 hat Max Weber sich an dieser Stelle auch zum Handel (Detail- und Fernhandel) geäußert. Zu den mannigfach überarbeiteten, am Ende aber gestrichenen Passagen vgl. den Anhang, unten, S. 676.
Entwicklung zum Kapitalismus:
α. tatsächliche Monopolisierung der Geldbetriebsmittel durch Unternehmer als Mittel der Bevorschussung der Arbeiter. Damit Leitung der Güterbeschaffung kraft Beschaffungskredits und Verfügung über das Produkt trotz formal fortbestehender Appropriation der Erwerbsmittel an
7
die Arbeiter (so im Gewerbe und Bergbau). Wie auch in der Druckfassung unten in Absatz δ stand in den Korrekturfahnen K1 und K2 zunächst „Appropriation … durch die Arbeiter.“ Max Weber hat dies in K2 eigenhändig in „an“ geändert. Vgl. Anhang, unten, S. 677.
β. Appropriation des Absatzrechtes von Produkten auf Grund vorangegangener tatsächlicher Monopolisierung der Marktkenntnis und damit der Marktchancen und Geldbetriebsmittel kraft oktroyierter monopolistischer (Gilden-)Verbandsordnung
s
oder Privilegs der politischen Gewalt (als Rentenquelle oder gegen Darlehen). A: (Gilden)-Verbandsordnung
γ. Innere Disziplinierung der hausindustriell abhängigen Arbeiter: Lieferung der Rohstoffe und Apparate durch den Unternehmer.
Sonderfall: Rationale monopolistische Organisation von Hausindustrien auf Grund von Privilegien im Finanz- und populationistischen (Erwerbsversorgungs-)Interesse
t
. Oktroyierte Regulierung der Arbeitsbedingungen mit Erwerbskonzessionierung. A: (Erwerbsversorgungs)Interesse
9
Emendation nach Korrekturfahnen K1 und K2, unten, S. 677.
δ. Schaffung von Werkstattbetrieben ohne rationale
8
Arbeitsspezialisierung im Betriebe bei Appropriation sämtlicher sachlicher Beschaffungsmittel durch den Unternehmer. Im Bergbau: Appropriation der Vorkommen, Stollen und Apparate durch [353]Besitzer. Im Transportwesen: Reedereibetrieb durch Großbesitzer. Folge überall: Expropriation der Arbeiter von den Beschaffungsmitteln. In K1 und K2 zunächst „mit rationaler“; von Weber eigenhändig geändert in „ohne rationale“, vgl. Anhang, unten, S. 677.
ε. Als letzter Schritt zur kapitalistischen Umwandlung der Beschaffungsbetriebe: Mechanisierung der Produktion und des Transports. Kapitalrechnung. Alle sachlichen Beschaffungsmittel werden („stehendes“ oder Betriebs-)Kapital
u
.[353]A: („stehendes“ oder Betriebs)-Kapital ; lies: „stehendes“ Kapital oder Betriebs-Kapital
10
Alle Arbeitskräfte: „Hände“. Durch Verwandlung der Unternehmungen in Vergesellschaftungen von Wertpapierbesitzern wird auch der Leiter expropriiert und formal zum „Beamten“,[353]Als „stehendes“ Kapital wurden alle Kapitalgüter bezeichnet, die im Produktionsprozeß wiederholt eingesetzt werden (Anlagen, Maschinen, Werkzeuge); „Betriebskapital“ oder „Umlaufkapital“ hießen Kapitalgüter, die bei einmaliger Verwendung in der Produktion verbraucht werden (Roh- und Hilfsstoffe), vielfach auch Halb- und Fertigerzeugnisse sowie Kassenbestände. Letztere gehen bei Verbrauch mit ihrem vollen Wert in die Kostenrechnung ein, stehendes Kapital nur mit Zinsen und Abschreibungen.
11
der Besitzer material zum Vertrauensmann der Kreditgeber (Banken).§ 622 des Bürgerlichen Gesetzbuchs vom 1. Januar 1900 bezeichnet die „mit festen Bezügen zur Leistung von Diensten höherer Art Angestellten“ in der Privatwirtschaft als „Privatbeamte“. Vgl. auch oben, S. 272, Hg.-Anm. 60.
v
Durchschuß fehlt in A.
Von diesen verschiedenen Typen ist
1. auf dem Gebiet der Landwirtschaft der Typus a
12
überall, aber in der Form α (Hauskommunion und Sippenwirtschaft) in Europa nur stellenweise, dagegen in Ostasien (China) typisch vertreten gewesen, – der Typus b (Dorf- und Markgemeinschaft) in Europa und Indien heimisch gewesen, – der Typus c (gebundene Grundherrschaft) überall heimisch gewesen und im Orient teilweise noch jetzt heimisch, – der Typus d in den Formen α und β (Grundherrschaft und Fiskalherrschaft mit systematischer Feldumteilung der Bauern) in mehr grundherrlicher Form russisch und (in abweichendem Sinn: Bodenrentenumteilung) indisch, in mehr fiskalischer Form ostasiatisch und vorderasiatisch-ägyptisch gewesen. Der Typus e (freie Renten-Grundherrschaft mit Kleinpächtern) ist typisch in Irland, kommt in Italien [354]und Südfrankreich, ebenso in China und im antikhellenistischen Orient vor. Der Typus f (Plantage mit unfreier Arbeit) gehörte der karthagisch-römischen Antike, den Kolonialgebieten und den Südstaaten der amerikanischen Union an, der Typus g (Gutswirtschaft) in der Form α (Trennung von Bodenbesitz und Betrieb) England, in der Form β (Betrieb des Bodenbesitzers) dem östlichen Deutschland, Teilen von Österreich, Polen, Westrußland, der Typus h (bäuerliche Besitzer-Wirtschaft) ist in Frankreich, Süd- und Westdeutschland, Teilen Italiens, Skandinavien, ferner (mit Einschränkungen) in Südwestrußland und besonders im modernen China und Indien (mit Modifikationen) heimisch. Max Weber bezieht sich auf die oben, S. 346, beginnende Kasuistik mit den entsprechenden Gliederungsziffern- und Buchstaben.
Diese starken Verschiedenheiten der (endgültigen) Agrarverfassung sind nur zum Teil auf ökonomische Gründe (Gegensatz der Waldrodungs- und der Be[A 86]wässerungskultur), zum andern auf historische Schicksale, insbesondere die Form der öffentlichen Lasten und der Wehrverfassung, zurückzuführen.
2. Auf dem Gebiet des Gewerbes – die Transport- und Bergverfassung ist noch nicht universell genug geklärt
13
– ist [354]In den Korrekturfahnen K1 und K2 stand zunächst: „Auf dem Gebiet des Gewerbes, Transport- und Bergwesens“. Weber ändert in K2 eigenhändig in die vorliegende Fassung (vgl. Anhang, unten, S. 679) und weist somit auf die Forschungsdefizite bei der Transport- und Bergverfassung hin. – Die nach Gliederungsziffer 2, oben, S. 349, zu erwartenden Beispiele zum Handel fehlen.
a) der Typus a, α (Stammesgewerbe) überall verbreitet gewesen.
b) Der Typus a, β (Kastengewerbe) hat nur in Indien universelle Verbreitung erlangt, sonst nur für deklassierte („unreine“) Gewerbe.
c) Der Typus b, α (oikenmäßige
w
Gewerbe) hat in allen Fürstenhaushalten der Vergangenheit, am stärksten in Ägypten, geherrscht, daneben in den Grundherrschaften der ganzen Welt, in der Form b, β (demiurgische Gewerbe) ist er vereinzelt überall (auch im Okzident), als Typus aber nur in Indien, verbreitet gewesen. Der Sonderfall I (Leibherrschaft als Rentenquelle) herrschte in der Antike, der Sonderfall II (leiturgische Lei[355]stungsspezifikation) in Ägypten, dem Hellenismus, der römischen Spätantike und zeitweise in China und Indien. [354]Klammer fehlt in A.
d) Der Typus c
14
findet seine klassische Stätte als herrschender Typus im okzidentalen Mittelalter und nur dort, obwohl er überall vorkam und insbesondere die Zunft universell (namentlich: in China und Vorderasien) verbreitet war, – freilich gerade in der „klassischen“ Wirtschaft der Antike völlig fehlte. In Indien bestand statt der Zunft die Kaste. [355]Gemeint ist das freie Gewerbe, vgl. oben, S. 351.
e) Die Stadien der kapitalistischen Entwicklung fanden beim Gewerbe außerhalb des Okzidents nur bis zum Typus β
15
universelle Verbreitung. Dieser Unterschied ist nicht ausschließlich durch rein ökonomische Gründe zu erklären.Vgl. oben, S. 352: „Appropriation des Absatzrechtes“.
16
In der Korrekturfahne K1 lautet der Satz noch: „Diese Unterschiede der (endgültigen) Gewerbe-, Bergbau-, Transport- und Handelsverfassung sind nicht durch rein ökonomische Gründe zu erklären, sondern daneben durch gesonderte historische Schicksale, Formen der politischen Verfassung und der höchst verschieden, in starkem Maße aber religiös bedingten Lebensführungs- und Erkenntnisformen, welche die Art der Orientierung der Erwerbschancen bedingten.“ Diese Passage hat Weber in K2 eigenhändig gestrichen. Vgl. Anhang, unten, S. 680.
§ 25. I. Zur Erreichung von rechnungsmäßigen Leistungsoptima der ausführenden Arbeit (im allgemeinsten Sinn) gehört außerhalb des Gebiets der drei typisch kommunistischen Verbände,
17
bei welchen außerökonomische Motive mitspielen:Unten, S. 361, führt Weber drei Arten kommunistischer Leistungsvergemeinschaftung oder -vergesellschaftung auf: Hauskommunismus der Familie, Kameradschaftskommunismus des Heeres, Liebeskommunismus der (religiösen) Gemeinde.
18
Hinweis auf die „außer-ökonomischen Motive“ von Weber erst in Korrekturfahne K2 handschriftlich eingefügt; vgl. Anhang, unten, S. 680.
- Optimum der Angepaßtheit an die Leistung,
- Optimum der Arbeitsübung,
- Optimum der Arbeitsneigung.
Zu 1. Angepaßtheit (gleichviel inwieweit durch Erbgut oder Erziehungs- und Umweltseinflüsse bedingt) kann nur durch Probe festgestellt werden. Sie ist in der Verkehrswirtschaft bei [356]Erwerbsbetrieben in Form der „Anlerne“-Probe
19
üblich. Rational will sie das Taylor-System durchführen. [356]Gemeint ist die Praxis, die Einstellung einer Arbeitskraft, die für die gedachte Tätigkeit noch Fähigkeiten erlernen muß, von der Bewährung in der sog. Anlernzeit abhängig zu machen.
Zu 2. Arbeitsübung ist im Optimum nur durch rationale und kontinuierliche Spezialisierung erreichbar. Sie ist heute nur wesentlich empirisch, unter Kostenersparnis-Gesichtspunkten (im Rentabilitätsinteresse und durch dieses begrenzt) vorgenommene Leistungsspezialisierung. Rationale (physiologische) Spezialisierung liegt in den Anfängen (Taylor-System).
20
In Korrekturfahne K1 lautete der von Weber in K2 verkürzte Satz: „Eine systematische Prüfung der Eignung und rationale (physiologische) Spezialisierung liegt in den Anfängen (in Amerika: Taylor-System) und ist in ihrer Anwendung auf Rentabilitäts-Betriebe begrenzt.“ Vgl. Anhang, unten, S. 680.
Zu 3. Die Bereitwilligkeit zur Arbeit kann ganz ebenso orientiert sein wie jedes andre Handeln (s. Kap. I, § 2).
21
Arbeitswilligkeit (im spezifischen Sinn der Ausführung von eignen Dispositionen oder von solchen anderer Leitender) ist aber stets entweder durch starkes eignes Interesse am Erfolg oder durch unmittelbaren oder mittelbaren Zwang bedingt gewesen; in besonders hohem Maß Arbeit im Sinn der Ausführung der Disposition anderer. Der Zwang kann bestehen entweder Kap. I, § 2, oben, S. 175, wo Max Weber die Typen der Bestimmungsgründe des sozialen Handelns entfaltet.
1. in unmittelbarer Androhung von physischer Gewaltsamkeit oder anderen Nachteilen, oder
2. in der Chance der Erwerbslosigkeit im Falle ungenügender Leistung.
Da die zweite Form, welche der Verkehrswirtschaft wesentlich ist, ungleich stärker an das Eigeninteresse sich wendet und die Freiheit der Auslese nach der Leistung (in Maß und Art) erzwingt (natürlich: unter Rentabilitätsgesichtspunkten), wirkt sie formal rationaler (im Sinn des technischen Optimums) als jeder unmittel[A 87]bare Arbeitszwang. Vorbedingung ist die Expropriation der Arbeiter von den Beschaffungsmitteln und ihre Verweisung auf Bewerbung um Arbeitslohnverdienstchancen, also: gewaltsamer Schutz der Appropriation der Beschaffungsmittel an Besitzer. Gegenüber dem unmittelbaren Arbeitszwang [357]ist damit außer der Sorge für die Reproduktion (Familie) auch ein Teil der Sorge um die Auslese (nach der Art der Eignung) auf die Arbeitsuchenden selbst abgewälzt. Außerdem ist der Kapitalbedarf und das Kapitalrisiko gegenüber der Verwertung unfreier Arbeit beschränkt und kalkulierbar gemacht, endlich – durch massenhaften Geldlohn – der Markt für Massengüter verbreitert. Die positive Arbeitsneigung ist nicht dergestalt obstruiert, wie – unter sonst gleichen Verhältnissen – bei unfreier Arbeit, freilich besonders bei weitgehender technischer Spezialisierung auf einfache (taylorisierte)
22
monotone Verrichtungen auf die rein materiellen Lohnchancen beschränkt. Diese enthalten nur bei Lohn nach der Leistung (Akkordlohn) einen Anreiz zu deren Erhöhung. – Akkordlohnchancen und Kündigungsgefahr bedingen in der kapitalistischen Erwerbsordnung primär die Arbeitswilligkeit. [357]Zu den von Frederick Winslow Taylor (vgl. oben, S. 277) propagierten Empfehlungen an das Management gehört die Zerlegung der Arbeit in kleinste Einheiten, die keine Denkleistung fordern und sich wegen ihres geringen Umfangs rasch wiederholen lassen.
Unter der Bedingung der freien, von den Beschaffungsmitteln getrennten, Arbeit gilt im übrigen folgendes:
1. Die Chancen affektueller Arbeitswilligkeit sind – unter sonst gleichen Umständen – bei Leistungsspezifikation größer als bei Leistungsspezialisierung,
23
weil der individuelle Leistungserfolg dem Arbeitenden sichtbarer vor Augen liegt. Demnächst, naturgemäß, bei allen Qualitätsleistungen. Zu Webers Unterscheidung von Leistungsspezifikation und Leistungsspezialisierung vgl. oben, S. 339.
2. Traditionale Arbeitswilligkeit, wie sie namentlich innerhalb der Landwirtschaft und der Hausindustrie (unter allgemein traditionalen Lebensbedingungen) typisch ist, hat die Eigenart: daß die Arbeiter ihre Leistung entweder: an nach Maß und Art stereotypen Arbeitsergebnissen oder aber: am traditionalen Arbeitslohn orientieren (oder: beides), daher schwer rational verwertbar und in ihrer Leistung durch Leistungsprämien (Akkordlohn) nicht zu steigern sind. Dagegen können traditional patriarchale Beziehungen zum Herren (Besitzer) die affektuelle Arbeitswilligkeit erfahrungsgemäß hoch halten.
[358]3. Wertrationale Arbeitswilligkeit ist in typischer Art entweder religiös bedingt, oder durch spezifisch hohe soziale Wertung der betreffenden spezifischen Arbeit als solcher. Alle andren Anlässe dazu sind, nach aller
x
Erfahrung, Übergangserscheinungen. [358]A: alter
Selbstverständlich enthält die „altruistische“ Fürsorge für die eigne Familie eine typische Pflichtkomponente der Arbeitswilligkeit. –
y
Durchschuß fehlt in A.
II. Die Appropriation von Beschaffungsmitteln und die (sei es noch so formale) Eigenverfügung über den Arbeitshergang bedeutet eine der stärksten Quellen schrankenloser Arbeitsneigung. Dies ist der letzte Grund der außerordentlichen Bedeutung des Klein- und zwar insbesondere: des Parzellenbetriebs in der Landwirtschaft, sowohl als Kleineigentümer, wie als Kleinpächter (mit der Hoffnung künftigen Aufstiegs zum Bodeneigentümer). Das klassische Land dafür ist: China; auf dem Boden des fachgelernten leistungsspezifizierten Gewerbes vor allem: Indien; demnächst alle asiatischen Gebiete, aber auch das Mittelalter des Okzidents, dessen wesentliche Kämpfe um die (formale) Eigenverfügung geführt worden sind. Das sehr starke Arbeits-Mehr, welches der (stets, auch als Gärtner: leistungsspezifizierte, nicht: -spezialisierte) Kleinbauer in den Betrieb steckt[,] und die Einschränkung der Lebenshaltung, die er sich im Interesse der Behauptung seiner formalen Selbständigkeit auferlegt, verbunden mit der in der Landwirtschaft möglichen haushaltsmäßigen Ausnutzung von erwerbsmäßig, also im Großbetrieb, nicht verwertbaren Nebenerzeugnissen und „Abfällen“ aller Art[,] ermöglichen
z
seine Existenz gerade wegen des Fehlens der Kapitalrechnung und der Beibehaltung der Einheit von Haushalt und Betrieb. Der Kapitalrechnungsbetrieb in der Landwirtschaft ist – im Fall des Eigentümerbetriebs – nach allen Ermittlungen (s. meine Rechnungen in den Verh[andlungen] [359][A 88]des D[eutschen] Juristentags XXIV)A: ermöglicht
24
ungleich Konjunkturen empfindlicher[359]Anhand der Statistik von Zwangsvollstreckungen in Preußen führt Max Weber den Nachweis, daß der landwirtschaftliche Großbetrieb als „Conjuncturen-Betrieb“ in stärkerem Maße von Zwangsvollstreckungen betroffen gewesen sei als kleinere Betriebe (vgl. Weber, Heimstättenrecht, in: MWG I/4, S. 645–666; insbes. S. 646 ff., Zitat: S. 649). Es handelte sich um ein Gutachten für den vierundzwanzigsten Deutschen Juristentag 1898.
a
als der Kleinbetrieb. [359]Lies: konjunkturempfindlicher
Auf dem Gebiet des Gewerbes bestand die entsprechende Erscheinung bis in die Zeit mechanisierter und streng spezialisierter arbeitsverbindender Betriebe. Betriebe, wie die des „Jack of Newbury“
25
konnte man noch im 16. Jahrhundert einfach, ohne Katastrophe für die Erwerbschancen der Arbeiter, verbieten (wie es in England geschah).Zu der legendären Wollmanufaktur des „Jack of Newbury“ vgl. oben, S. 332, Hg.-Anm. 47.
26
Denn die Zusammenziehung von, dem Besitzer appropriierten, Webstühlen nebst ihren Arbeitern in einer Werkstatt ohne wesentliche Steigerung der Spezialisierung und Verbindung der Arbeit bedeutete unter den gegebenen Marktverhältnissen keineswegs eine derartige Steigerung der Chancen für den Unternehmer, daß das immerhin größere Risiko und die Werkstattkosten dadurch mit Sicherheit gedeckt worden wären. Vor allem aber ist im Gewerbe ein Betrieb mit hohem Kapital von Anlagen („stehendem“ K[apital]) nicht nur, wie auch in der Landwirtschaft, konjunkturempfindlich, sondern im Höchstmaß empfindlich gegen jede Irrationalität (Unberechenbarkeit) der Verwaltung und Rechtspflege, wie sie, außerhalb des modernen Okzidentes, überall bestand. Die dezentralisierte Heimarbeit hat hier, wie in Konkurrenz mit den russischen „Fabriken“1555 untersagte eine Parlamentsakte, daß Wollweber mehr als zwei Webstühle hielten und Weber zugleich Tücher walkten. Weitere Gesetze ähnlichen Inhalts folgten. Vgl. Ashley, Englische Wirtschaftsgeschichte (wie oben, S. 332, Hg.-Anm. 47), dort S. 244–248; sowie Lohmann, Friedrich, Die staatliche Regelung der englischen Wollindustrie vom XV. bis zum XVIII. Jahrhundert (Staats- und socialwissenschaftliche Forschungen, hg. v. Gustav Schmoller, 18. Band, 1. Heft). – Berlin: Duncker & Humblot 1900.
27
und überall sonst, das Feld behaupten [360]können, bis – noch vor Einfügung der mechanisierten Kraftquellen und Werkzeugmaschinen – das Bedürfnis nach genauer Kostenkalkulation und Standardisierung der Produkte zum Zweck der Ausnutzung der verbreiterten Marktchancen, in Verbindung mit technisch rationalen Apparaten, zur Schaffung von Betrieben mit (Wasser- oder Pferdegöpel und) innerer Spezialisierung führte, in welche dann die mechanischen Motoren und Maschinen eingefügt wurden. Alle vorher, in der ganzen Welt, gelegentlich entstandenen großen Werkstattbetriebe konnten ohne jede nennenswerte Störung der Erwerbschancen aller Beteiligten und ohne daß die Bedarfsdeckung ernstlich gefährdet worden wäre, wieder verschwinden. Erst mit der „Fabrik“ wurde dies anders. Die Arbeitswilligkeit der Fabrikarbeiter aber war primär durch einen mit Abwälzung des Versorgungsrisikos auf sie kombinierten sehr starken indirekten Zwang (englisches Arbeitshaussystem!)Auf die Konkurrenz der russischen „Sklavenfabriken“ mit den in Heimarbeit tätigen Bauern im ausgehenden 18. und beginnenden 19. Jahrhundert geht Weber unten, S. 377 f., näher ein. Zu seiner Quelle vgl. oben, S. 318, Hg.-Anm. 94.
28
bedingt und ist dauernd an der Zwangsgarantie der Eigentumsordnung orientiert geblieben, wie der Verfall dieser Arbeitswilligkeit in der Gegenwart im Gefolge des Zerbrechens der Zwangsgewalt in der Revolution zeigte.[360]Gemäß der Armengesetzgebung erhielten in England seit dem 16. Jahrhundert arbeitsfähige Arme nur als Insassen von Arbeitshäusern Unterstützung. Auch noch nach den 1834 verabschiedeten New Poor Laws stand das Arbeitshaus im Mittelpunkt der Armenfürsorge für jene, die als arbeitsfähig galten. Vgl. Webb, Sidney, und Beatrice Webb, English Poor Law Policy. – London u. a.: Longmans, Green and Co. 1910; 2. Aufl. 1913.
29
In einer Rede auf der Mitgliederversammlung der Deutschen Demokratischen Partei in Heidelberg am 15. Februar 1919 hat Max Weber „das völlige Verschwinden der Arbeitsdisziplin“ als viel schlimmer bezeichnet als „Geldpanik“ und „Lohnpanik“ (vgl. Weber, Die gegenwärtige Lage der Deutschen Demokratischen Partei, in: MWG I/16, S. 475–481, Zitat: S. 480). Noch im September 1919 hat Reichswirtschaftsminister Robert Schmidt (SPD) in einer „Wirtschaftspolitischen Richtlinie“ festgestellt: „Das Kernproblem der deutschen Wirtschaft liegt in der Wiedergewinnung der Arbeitswilligkeit und Arbeitsleistung der handarbeitenden Klassen.“ Vgl. Akten der Reichskanzlei. Weimarer Republik, hg. für die Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften von Karl Dietrich Erdmann, für das Bundesarchiv von Hans Booms: Das Kabinett Bauer. 21. Juni 1919 bis 27. März 1920, bearbeitet v. Anton Golecki. – Boppard am Rhein: Boldt 1980, Nr. 65, S. 261.
§ 26. Kommunistische und dabei rechnungsfremde Leistungsvergemeinschaftung oder -vergesellschaftung gründet sich nicht auf Errechnung von Versorgungsoptima, sondern auf unmittel[361]bar gefühlte Solidarität. Geschichtlich ist sie daher – bis zur Gegenwart – aufgetreten auf der Grundlage von primär außerwirtschaftlich orientierten Gesinnungs-Einstellungen, nämlich:
1. als Hauskommunismus der Familie, – auf traditionaler und affektueller Grundlage,
2. als Kameradschaftskommunismus des Heeres, –
3. als Liebeskommunismus der (religiösen) Gemeinde, in diesen beiden Fällen (2 und 3) primär auf spezifisch emotionaler (charismatischer) Grundlage. Stets aber entweder:
a) im Gegensatz zur traditional oder zweckrational, und dann rechenhaft, leistungsteilig wirtschaftenden Umwelt: entweder selbst arbeitend, oder grade umgekehrt: rein mäzenatisch sustentiert
30
(oder beides); – oder [361]Von lat. sustentare abgeleitet, unterhalten, unterstüzt, ernährt.
b) als Haushaltsverband von Privilegierten, die nicht einbezogenen Haushaltungen beherrschend und mäzenatisch oder leiturgisch durch sie erhalten, – oder
c) als Konsumentenhaushalt, getrennt von dem Erwerbsbetriebe und sein Einkommen von ihm beziehend, also mit ihm vergesellschaftet.
Der Fall a ist typisch für die religiös oder weltanschauungsmäßig kommunistischen Wirtschaften (weltflüchtige oder arbeitende Mönchsgemeinschaften, Sektengemeinschaften, ikarischer Sozialismus).
31
Ikarische Sozialisten bzw. Kommunisten nannten sich die Anhänger von Étienne Cabet (1788–1856), eines französischen revolutionären Publizisten. In seinem 1842 veröffentlichten Werk „Voyage en Icarie, roman philosophique et sociale“ entwarf er ein utopisches Gemeinwesen. Dieses suchten seine Anhänger 1848–1856 in Nordamerika zu realisieren, woran sie scheiterten (vgl. Lux, Heinrich, Etienne Cabet und der Ikarische Kommunismus (Internationale Bibliothek, Band 18). – Stuttgart: J.H.W. Dietz 1894). Max Weber hat den Ikarischen Kommunismus 1895 in seiner Vorlesung „Arbeiterfrage und Arbeiterbewegung“ behandelt; vgl. Weber, Arbeiterfrage, MWG III/4, S. 160 und 283 f.
[A 89]Der Fall b ist typisch für die militaristischen[,] ganz oder teilweise kommunistischen Gemeinschaften
32
(Männerhaus,Die folgenden Beispiele finden sich – in ähnlicher Reihenfolge – ausführlicher behandelt in Weber, Erhaltung des Charisma, MWG I/22-4, S. 551 f.
33
spartiatische Syssiti[362]en,Von dem Ethnologen Heinrich Schurtz geprägter Begriff für die Form des Zusammenlebens von Kriegern in kaum oder einfach strukturierten Gesellschaften. Vgl. Schurtz, Heinrich, Altersklassen und Männerbünde. Eine Darstellung der Grundformen der Gesellschaft. – Berlin: Georg Reimer 1902 (hinfort: Schurtz, Altersklassen), sowie Weber, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, MWG III/6, S. 130 f.
34
liparische[362]Syssition, griech. Essensgemeinschaft. In Sparta war seit Lykurg die Mitgliedschaft in dieser Gemeinschaft Voraussetzung für das volle Bürgerrecht. Die Mitglieder hatten Beiträge an Naturalien zu leisten. Max Weber behandelte Syssitien schon in seiner Vorlesung zur Theoretischen Nationalökonomie als Beispiel des „naturalwirtschaftl[ichen] Stadtfeudalismus“ in Griechenland. Vgl. Weber, Theoretische Nationalökonomie, MWG III/1, S. 417 f.
b
Räubergemeinschaft,[362]A: ligurische
35
Organisation des Khalifen Omar,Die Sizilien vorgelagerten liparischen Inseln waren von ca. 575 bis 252 v. Chr. griechische Kolonie. Mit ihrer Kriegsflotte betrieben die Kolonisten auch die Kaperei. Wegen des gemeinsamen Vermögens, Bodenbesitzes, der gemeinsamen Mahlzeiten und der Teilung aller Erträge aus Landwirtschaft und Kaperei galt die Gemeinschaft zu Webers Zeit als „kommunistisch“. Vgl. das Kapitel „Der Kommunistenstaat auf Lipara“, in: Pöhlmann, Robert von, Geschichte der sozialen Frage und des Sozialismus in der antiken Welt, Band 1, 2. Aufl. – München: C.H. Beck 1912, S. 44–51. – Die im Text überlieferte Verschreibung „ligurische Räubergemeinschaft“ wurde emendiert.
36
Konsum- und – partieller – Requisitionskommunismus von Heereskörpern im Felde in jeder Epoche), daneben für autoritäre religiöse Verbände (Jesuitenstaat in Paraguay,Kalif Omar I. (um 592–644) organisierte die arabisch-muslimischen Truppen, indem er sie in Korps unterteilte und ihnen feste Militärlager zuwies. Entsprechend der Anweisung des Propheten Mohammed wurde die in seinen Feldzügen gemachte Beute zu vier Fünfteln unter den Kriegern verteilt und das weitere Fünftel zur Unterstützung von Armen und Waisen verwendet. Von „Beutekommunismus des Kalifen Omar“ spricht Max Weber bereits in: Der Streit um den Charakter der altgermanischen Sozialverfassung in der deutschen Literatur des letzten Jahrzehnts, MWG I/6, S. 259.
37
indische und andre aus Bettelpfründen lebende Mönchsgemeinschaften). Die vom Jesuitenorden in seiner Provinz Paraguay zum Zwecke der Mission eingerichteten Guarani-Reduktionen bildeten von 1609 bis 1767 einen von Ordensangehörigen geleiteten Verband, der wegen seiner relativen Unabhängigkeit von der spanischen Oberhoheit vielfach als Jesuitenstaat bezeichnet wird. Die Siedlungen waren im wesentlichen landwirtschaftliche Großkommunen unter geistlicher Leitung. Wegen des Fehlens von Geldwirtschaft und Privateigentum an Produktionsmitteln fanden sie besonderes Interesse bei Kritikern des Kapitalismus. Vgl. Gothein, Eberhard, Der christlich-sociale Staat der Jesuiten in Paraguay (Staats- und socialwissenschaftliche Forschungen, hg. v. Gustav Schmoller, Band 4, Heft 4). – Leipzig: Duncker & Humblot 1883.
Der Fall c ist der typische Fall aller familialen Haushaltungen in der Verkehrswirtschaft.
Die Leistungsbereitschaft und der rechnungsfremde Konsum innerhalb dieser Gemeinschaften ist Folge der außerwirtschaftlich orientierten Gesinnung und gründet sich in den Fällen 2 und 3
38
zum erheblichen Teil auf das Pathos des Gegensatzes und Kampfes gegen die Ordnungen der „Welt“. Alle modernen [363]kommunistischen Anläufe sind, sofern sie eine kommunistische Massenorganisation erstreben, für ihre Jüngerschaft auf wertrationale, für ihre Propaganda aber auf zweckrationale Argumentation, in beiden Fällen also: auf spezifisch rationale Erwägungen und – im Gegensatz zu den militaristischen und religiösen außeralltäglichen Vergemeinschaftungen – auf Alltags-Erwägungen angewiesen. Die Chancen für sie liegen daher unter Alltagsverhältnissen auch innerlich wesentlich anders als für jene außeralltäglichen oder primär außerwirtschaftlich orientierten Gemeinschaften. Bezug ist der „Kameradschafts-“ und „Liebeskommunismus“, oben, S. 361.
§ 27. Kapitalgüter treten typisch im Keim zuerst auf als interlokal oder interethnisch getauschte Waren, unter der Voraussetzung (s. § 29),
c
[363]A: Voraussetzung, (s. § 29)
39
daß der „Handel“ von der haushaltsmäßigen Güterbeschaffung getrennt auftritt[.] Denn der Eigenhandel der Hauswirtschaften (Überschuß-Absatz) kann eine gesonderte Kapitalrechnung nicht kennen. Die interethnisch abgesetzten Produkte des Haus-, Sippen-, Stammesgewerbes sind Waren, die Beschaffungsmittel, solange sie Eigenprodukte bleiben, sind Werkzeuge und Rohstoffe, nicht: Kapitalgüter. Ebenso wie die Absatzprodukte und die Beschaffungsmittel des Bauern und Fronherren, solange nicht auf Grund von Kapitalrechnung (sei es auch primitiver Form) gewirtschaftet wird (wofür z. B. bei Cato schon Vorstufen bestehen).[363]Kap. II, § 29, unten, S. 367.
40
Daß alle internen Güterbewegungen im Kreise der Grundherrschaft und des Oikos, auch der Gelegenheits- oder der typische interne Austausch von Erzeugnissen, das Gegenteil von Kapitalrechnungswirtschaft sind, versteht sich von selbst. Auch der Handel des Oikos (z. B. [364]des Pharao) ist, selbst wenn er nicht reiner Eigenbedarfshandel, also: haushaltsmäßiger Tausch, ist, sondern teilweise Erwerbszwecken dient, im Sinn dieser Terminologie so lange nicht kapitalistisch, als er nicht an Kapitalrechnung, insbesondre an vorheriger Abschätzung der Gewinnchancen in Geld orientierbar ist.Der römische Geschichtsschreiber und Staatsmann Cato der Ältere hat in seinem Werk „De agricultura“ aus eigener Erfahrung gewonnene und teilweise auf exakte Geldrechnungen gestützte Ratschläge zur Führung eines landwirtschaftlichen Gutsbetriebs aufgezeichnet (vgl. Gummerus, Römischer Gutsbetrieb). In einer kritischen Bemerkung zu Ausführungen Sombarts über den Rationalismus Catos hebt Weber als charakteristisch für Cato hervor: „daß das Landgut als Objekt einer Vermögens-,Anlage‘ gewertet und beurteilt wird.“ Vgl. Weber, Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus, in: GARS I, S. 39, Fn. 1 (MWG I/18).
41
Dies war bei den reisenden Berufshändlern der Fall, gleichviel ob sie eigne oder kommendierte oder gesellschaftlich zusammengelegte Waren absetzten. Hier, in der Form der Gelegenheitsunternehmung, ist die Quelle der Kapitalrechnung und der Kapitalgüterqualität. Leibherrlich und grundherrlich als Rentenquelle benutzte Menschen (Sklaven, Hörige) oder Anlagen aller Art sind selbstverständlich nur rententragende Vermögensobjekte, nicht Kapitalgüter, ganz ebenso wie heute (für den an der Rentenchance und allenfalls einer Gelegenheitsspekulation orientierten Privatmann – im Gegensatz zur zeitweiligen Anlage von Erwerbsbetriebskapital darin –) Renten[364]In der Korrekturfahne K1 korrigiert Max Weber „orientiert“ in „orientierbar“. Dem entspricht die den Paragraphen abschließende Bemerkung, daß es hier um „die prinzipielle Möglichkeit der materialen Kapitalrechnung“ geht, vgl. unten, S. 365.
42
oder Dividenden tragende Papiere. Waren, die der Grundherr oder Leibherr von seinen Hintersassen kraft seiner Herrengewalt als Pflichtabgaben erhält und auf den Markt bringt, sind für unsre Terminologie: Waren, nicht Kapitalgüter, da die rationale Kapitalrechnung (Kosten!) prinzipiell (nicht nur: faktisch) fehlt. Dagegen sind bei Verwendung von Sklaven als Erwerbsmitteln (zumal: bei Existenz eines Sklavenmarktes und typischer Kaufsklaverei) in einem Betriebe diese: Kapitalgüter. Bei FronbetriebenUmgangssprachlich für sogenannte Rentenpapiere, d. h. festverzinsliche Wertpapiere (Staats- und Kommunalanleihen, Hypothekenpfandbriefe und Industrieobligationen).
43
mit nicht frei käuflichen und verkäuflichen (Erb-)[365]Untertanen wollen wir nicht von kapitalistischen Betrieben, sondern nur von Erwerbsbetrieben mit gebundener Arbeit sprechen (Bindung auchZum Begriff „Fron“ vgl. den Glossar-Eintrag, unten, S. 742. Max Weber bezieht sich terminologisch auf eine in der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Grund- und Gutsherrschaft verbreitete Verpflichtung der Untertanen zu Arbeitsleistungen an den Herrenhöfen und in deren Wirtschaften. Wo Arbeit vornehmlich von Frondienst Leistenden erbracht wurde, wie z. B. auf den Gütern in Ostdeutschland seit dem 16. Jahrhundert, spricht Max Weber von „Fronbetrieb“ als einem speziellen Typ von „Erwerbswirtschaft.“ Vgl. Weber, Feudalismus, MWG I/22-4, S. 437. Wesentlich bleibt das Unterscheidungsmerkmal der Unfreiheit, doch waren die Hörigen keine Sklaven. Sie hatten [365]vielfach erbliche Rechte an ihren (Bauern)Stellen und Anspruch auf die Fürsorge des Herrn.
c
[A 90]des Herren an die Arbeiter ist das Entscheidende!), einerlei ob es sich um landwirtschaftliche Betriebe oder um unfreie Hausindustrie handelt. [365] c(S. 340, ab: γ.)–c Zu dieser Textpassage sind Korrekturfahnen überliefert; vgl. dazu den Anhang, unten, S. 664–688.
Im Gewerbe ist das „Preiswerk“ „kleinkapitalistischer“
d
Betrieb,A: kleinkapitalistischer“
44
die Hausindustrie dezentralisierter, jede Art von wirklich kapitalistischem Werkstattbetrieb zentralisierter kapitalistischer Betrieb. Alle Arten von Stör, Lohnwerk und Heimarbeit sind bloße Arbeitsformen, die beiden ersteren im Haushalts-, die letzte im Erwerbsinteresse des Arbeitgebers. Zu „Preiswerk“ vgl. Büchers Ausführungen, oben, S. 324, Hg.-Anm. 17. „Kleinkapitalistisch“ ist eine Charakterisierung Max Webers. Sie findet sich nicht bei Bücher.
Entscheidend ist also nicht die empirische Tatsache, sondern die prinzipielle Möglichkeit der materialen Kapitalrechnung.
§ 28. Neben allen früher besprochenen
45
Arten von spezialisierten oder spezifizierten Leistungen steht in jeder Verkehrswirtschaft (auch, normalerweise: einer material regulierten): die Vermittlung des AbtauschsMax Weber verweist auf seine Ausführungen in den §§ 16–18, 21 und 24–25, oben, S. 303–314, 333 f. und 339–360.
e
eigner oder des EintauschsA: Eintauschs
46
Anders als hier versehentlich, verwendet Max Weber die Begriffe „Abtausch“ für das Hingeben eines Tauschgutes und „Eintausch“ für die Annahme eines Tauschgutes oben, S. 245 und 254, korrekt.
f
fremder Verfügungsgewalt. A: Abtauschs
Sie kann erfolgen:
1. durch die Mitglieder eines Verwaltungsstabes von Wirtschaftsverbänden, gegen festen oder nach der Leistung abgestuften Natural- oder Geld-Entgelt;
2. durch einen eigens für die Ein- oder Abtauschbedürfnisse der Genossen geschaffenen Verband dieser (genossenschaftlich) oder
[366]3. als Erwerbsberuf gegen Gebühr ohne eignen Erwerb der Verfügungsgewalt (agentenmäßig), in sehr verschiedener rechtlicher Form;
4. als kapitalistischer Erwerbsberuf (Eigenhandel): durch gegenwärtigen Kauf in der Erwartung gewinnbringenden künftigen Wiederverkaufs oder Verkauf auf künftigen Termin in der Erwartung gewinnbringenden vorherigen Einkaufs, entweder
a) ganz frei auf dem Markt, oder
b) material reguliert;
5. durch kontinuierlich geregelte entgeltliche Expropriation von Gütern und deren entgeltlichen – freien oder oktroyierten – Abtausch seitens eines politischen Verbandes (Zwangshandel);
6. durch berufsmäßige Darbietung von Geld oder Beschaffung von Kredit zu erwerbsmäßigen Zahlungen oder Erwerb von Beschaffungsmitteln durch Kreditgewährung an:
a) Erwerbswirtschaften, oder
b) Verbände (insbesondere: politische): Kreditgeschäft. – Der ökonomische Sinn kann sein
α. Zahlungskredit, oder
β. Kredit für Beschaffung von Kapitalgütern.
Die Fälle Nr. 4 und 5, und nur sie, sollen „Handel“ heißen, der Fall 4 „freier“ Handel, der Fall 5 „zwangsmonopolistischer“ Handel.
Fall 1: a) Haushaltswirtschaften: fürstliche, grundherrliche, klösterliche „negotiatores“ und „actores“,
47
– b) Erwerbswirtschaften: „Kommis“. [366]In seiner Vorlesung „Abriß der universalen Sozial- und Wirtschaftsgeschichte“ (MWG III/6, S. 255) bezeichnet Max Weber als negotiator (Pl. negotiatores, (lat.), Kaufmann, Händler), wie hier, denjenigen, der gegen Lehen, Deputat usw. die Erzeugnisse der klösterlichen Herrschaft auf den Markt bringt. Dort erscheint der actor (Pl. actores, (lat.), Verwalter, Vermittler, Besorger) als derjenige, der in der Antike im Namen des Grundherrn Geschäfte abschließt. An gleicher Stelle werden beide als „angestellte Kommis“ charakterisiert.
Fall 2: Ein- und Verkaufs-Genossenschaften (einschließlich der „Konsumvereine“).
Fall 3: Makler, Kommissionäre, Spediteure, Versicherungs- und andere „Agenten“.
Fall 4: a) moderner Handel,
[367]b) heteronom oktroyierte oder autonom paktierte Zuweisung von Einkauf oder Absatz von oder an Kunden, oder Einkauf oder Absatz von Waren bestimmter Art, oder materiale Regulierung der Tauschbedingungen durch Ordnungen eines politischen oder Genossen-Verbandes.
Fall 5: Beispiel: staatliches Getreidehandelsmonopol.
48
[367] Staatliche Getreidehandelsmonopole waren zu Webers Zeit nicht nur Gegenstand historischen Interesses, sondern auch akuter politischer Auseinandersetzungen. Am Ende des 19. Jahrhunderts wurden sie in Deutschland aus konservativ-agrarischer und aus sozialistischer Richtung gefordert, im Weltkrieg als Bewirtschaftungsinstrument gehandhabt. Vgl. Dietze, Constantin von, Getreidemonopol, in: HdStW4, Ergänzungsband, 1929, S. 296–308.
[A 91]§ 29. Freier Eigenhandel (Fall 4)
49
– von dem zunächst allein die Rede sein soll – ist stets „Erwerbsbetrieb“, nie „Haushalt“, und also unter allen normalen Verhältnissen (wenn auch nicht unvermeidlich): Geldtauscherwerb in Form von Kauf- und Verkauf-Verträgen. Aber er kann sein: Siehe oben, S. 366.
a) „Nebenbetrieb“ eines Haushalts,
Beispiel: Abtausch von Hausgewerbe-Überschüssen durch eigens dafür bestimmte Hausgenossen auf deren Rechnung. Der bald von diesen[,] bald von jenen Genossen betriebene Abtausch ist dagegen nicht einmal „Nebenbetrieb“. Wenn die betreffenden Genossen sich auf eigene Rechnung nur dem Abtausch (oder Eintausch) widmen, liegt der Fall Nr. 4 (modifiziert) vor, wenn sie auf Rechnung der Gesamtheit handeln, der Fall Nr. 1.
b) untrennbarer Bestandteil einer Gesamtleistung, welche durch eigene Arbeit (örtliche) Genußreife herstellt.
Beispiel: Die Hausierer und die ihnen entsprechenden mit den Waren reisenden, primär die örtliche Bewegung an den Marktort besorgenden Kleinhändler, die deshalb früher unter „Transport“ miterwähnt sind.
50
Die reisenden „Kommendahändler“ bilden zuweilen den Übergang zu Nr. 3. Wann die Transportleistung „primär“ ist, der „Handelsgewinn“ sekundär und wann umgekehrt, ist ganz flüssig. „Händler“ sind alle diese Kategorien in jedem Fall. Siehe oben, S. 351.
Eigenhandel (Fall 4) wird betrieben stets auf Grundlage der Appropriation der Beschaffungsmittel, mag die Verfügungsgewalt auch durch Kreditnahme beschafft sein. Stets trifft das [368]Kapitalrisiko den Eigenhändler als Eigenrisiko, und stets ist ihm die Gewinnchance, kraft Appropriation der Beschaffungsmittel, appropriiert.
Die Spezifizierung und Spezialisierung innerhalb des freien Eigenhandels (Fall 4) ist unter sehr verschiedenen Gesichtspunkten möglich. Es interessieren ökonomisch vorerst nur die Arten:
a)
51
nach dem Typus der Wirtschaften, von denen und an welche der Händler tauscht. [368]Die auf a) folgenden Unterscheidungen des freien Handels sind ohne Gliederungsbuchstaben geblieben. Zur Erleichterung des Überblicks sind die entsprechenden Buchstaben mit Nachweis (vgl. textkritische Anm. g, h, i) hinzugefügt, nicht aber die weiteren Untergliederungen vereinheitlichend angepaßt worden.
1. Handel zwischen Überschußhaushaltungen und Konsumhaushaltungen.
2. Handel zwischen Erwerbswirtschaften („Produzenten“ oder „Händlern“) und Haushaltungen: „Konsumenten“, mit Einschluß, natürlich, aller Verbände, insbesondere: der politischen.
3. Handel zwischen Erwerbswirtschaften und anderen Erwerbswirtschaften.
Die Fälle 1 und 2 entsprechen dem Begriff „Detailhandel“, der bedeutet: Absatz an Konsumenten (einerlei: woher gekauft), der Fall 3 entspricht dem Begriff „Großhandel“ oder „Kaufmannshandel“.
b)
g
Der Handel kann sich vollziehen [368]Fehlt in A; b) sinngemäß ergänzt.
a) marktmäßig
α. auf dem Markt für Konsumenten, normalerweise in Anwesenheit der Ware (Marktdetailhandel),
β. auf dem Markt für Erwerbswirtschaften,
αα) in Anwesenheit der Ware (Meßhandel),
52
Die Anwesenheit der Ware war Kennzeichen der Messen vom 11. bis 19. Jahrhundert. Seit dem Ausgang des 19. Jahrhunderts setzte sich nach dem Vorbild Leipzigs im internationalen Handel für Halb- und Fertigwaren der Abschluß der Geschäfte nach dem ausgestellten Produktmuster durch (Mustermesse). Vgl. Hirsch, Organisation (wie oben, S. 343, Hg.-Anm. 69), S. 99 f.
Meist, aber nicht begriffsnotwendig, saisonmäßig.
[369]ββ) in Abwesenheit der Ware (Börsenhandel);
Meist, aber nicht begriffsnotwendig, ständig.
b) kundenmäßig, bei Versorgung fester Abnehmer, und zwar entweder
α. Haushaltungen (Kundendetailhandel), oder
[A 92]β. Erwerbswirtschaften, und zwar entweder
- produzierende (Grossist),53oder[369]Abgeleitet aus „en gros“, frz., für Handel im Großen, Großhändler.
- detaillierende (Engrossortimenter)54oder endlichEin an Kleinhändler (Detaillisten) liefernder Großhändler, der durch Einkauf im Großen ein breites Warenangebot aufgebaut hat (Sortiment), aus dem der Kleinhändler das für seinen Absatz Gewünschte auswählt. Vgl. Hirsch, Organisation (wie oben, S. 343, Hg.-Anm.69), S. 89 ff.
- andere grossierende: „erste“, „zweite“ usw. „Hand“ im Großhandel (Engroszwischenhandel).
c)
h
Er kann sein, je[369]Fehlt in A; c) sinngemäß ergänzt.
i
nach dem örtlichen Bezug der am Ort abgesetzten Güter: A: e
a)
55
interlokaler Handel, a) und b) sind Untergliederungen zu c).
b) Platzhandel.
d)
j
Der Handel kann material oktroyieren Fehlt in A; d) sinngemäß ergänzt.
a)
56
seinen Einkauf den an ihn kundenmäßig absetzenden Wirtschaften (Verlagshandel), a) und b) sind Untergliederungen zu d).
b) seinen Verkauf den von ihm kaufenden Wirtschaften (Absatzmonopolhandel).
Der Fall a steht der Verlagsform des Gewerbebetriebs nahe und ist meist mit ihr identisch.
Der Fall b ist material „regulierter“ Handel (Nr. 4 Fall b).
57
Vgl. Webers Schema oben, S. 366.
Der eigne Güterabsatz ist selbstverständlich Bestandteil jedes marktmäßigen Erwerbsbetriebes, auch eines primär „produzierenden“. Dieser Absatz aber ist nicht „Vermittlung“ im Sinne der Definition, solange nicht eigens dafür spezialisiert bestimmte Verwaltungsstabsmitglieder (z. B.: „Kommis“) vorhanden sind, [370]also eine eigene berufsmäßige „händlerische“ Leistung stattfindet. Alle Übergänge sind völlig flüssig.
Die Kalkulation des Handels soll „spekulativ“ in dem Grade heißen, als sie an Chancen sich orientiert, deren Realisierung als „zufällig“ und in diesem Sinn „unberechenbar“ gewertet wird
k
und daher die Übernahme eines „Zufalls-Risikos“[370]A: werden
l
bedeutet. Der Übergang von rationaler zu (in diesem Sinn) spekulativer Kalkulation ist völlig flüssig, da keine auf die Zukunft abgestellte Berechnung vor unerwarteten „Zufällen“ objektiv gesichert ist.A: „Zufalls-Risiko“
58
Der Unterschied bedeutet also nur verschiedene Grade der Rationalität. [370]Frank H. Knight hat 1921, im Jahr des Erscheinens der 1. Lieferung, in die ökonomische Theorie die Unterscheidung zwischen kalkulierbarem, weil mit Wahrscheinlichkeiten versehenem, Risiko und Ungewißheit eingeführt. Vgl. Knight, Frank H., Risk, Uncertainty and Profit. – Cambridge: Houghton Mifflin 1921.
Die technische und ökonomische Leistungs-Spezialisierung und -Spezifikation des Handels bietet keine Sondererscheinungen. Der „Fabrik“ entspricht – durch ausgiebigste Verwendung innerer Leistungsspezialisierung – das „Warenhaus“.
59
In Hinblick auf die Bestrebungen, die Ausbreitung von Warenhäusern gesetzlich zu verhindern, ist seinerzeit die Abgrenzung gegenüber dem „Kaufhaus“ von politischem und wissenschaftlichem Interesse gewesen. Biermer, [Magnus], Warenhäuser und Warenhaussteuer, in: HdStW3, Band 8, 1911, S. 590–615, hier S. 591, nennt Warenhäuser „solche mit großem Kapital, einem riesenhaften Angestelltenapparat betriebenen, durch alle Mittel der neuzeitlichen Reklame und Kulanz in ihrer Leistungsfähigkeit gesteigerten Großmagazine, die den ganzen Detailhandel an sich zu reißen suchen“.
§ 29a.
60
Banken sollen jene Arten von erwerbsmäßigen Händlerbetrieben heißen, welche berufsmäßig Geld Zur Paragraphenbezifferung vgl. den Editorischen Bericht, oben, S. 103.
a) verwalten,
b) beschaffen.
Zu a): Geld verwalten
α. für private Haushaltungen (Haushaltsdepositen, Vermögensdepots),
β. für politische Verbände (bankmäßige Kassenführung für Staaten),
[371]γ. für Erwerbswirtschaften (Depots der Unternehmungen, laufende Rechnungen derselben). –
Zu b): Geld beschaffen
α. für Haushaltungsbedürfnisse:
- Privater (Konsumkredit),
- politischer Verbände (politischer Kredit);
β. für Erwerbswirtschaften:
- zu Zahlungszwecken an Dritte:
- als Bevorschussung von künftig fälligen Zahlungen von Kunden. Hauptfall: die Wechseldiskontierung;
- zu Kapitalkreditzwecken.
Gleichgültig ist formal, ob sie
1. dies Geld aus eigenem Besitz vorstrecken oder vorschießen oder versprechen, [A 93]es auf Erfordern bereit zu stellen („laufende Rechnung“), ebenso ob mit oder ohne Pfand oder andere Sicherheitsleistung des Geldbedürftigen, oder ob sie
2. durch Bürgschaft oder in anderer Art andere veranlassen, es zu kreditieren.
Tatsächlich ist das Erwerbswirtschaften der Banken normalerweise darauf eingestellt: durch Kreditgabe mit Mitteln, welche ihnen selbst kreditiert worden sind, Gewinn zu machen.
Das kreditierte Geld kann die Bank beschaffen entweder:
1. aus pensatorischen Metall- oder aus den Münzvorräten der bestehenden Geldemissionsstätten
m
, die sie auf Kredit erwirbt, oder [371]A: Geldemissionstätten
2. durch eigene Schaffung von
a. Zertifikaten (Banko-Geld)
n
,Öffnende Klammer fehlt in A.
61
oder [371]Der Begriff „Zertifikat“ hat ein weites Spektrum von Bedeutungen. Die hier gemeinte definiert Max Weber oben, S. 238, und unten, S. 401. Bei dem von Girobanken in Europa im 17.–19. Jahrhundert geschaffenen „Banko-Geld“ geschah die Übertragung der Einlagen zunächst vornehmlich durch Umbuchungen auf Konten (Buch- oder Giralgeld), erst später regelmäßig durch Weitergabe der Depotbescheinigungen (Zertifikate) (vgl. Ehrenberg, Richard, Die Banken vom 11. bis zum 17. Jahrhundert, in: HdStW3, Band 2, 1909, S. 360–366, hier S. 363–365). Zertifikate spielten um 1900 im [372]europäischen Zahlungsverkehr keine Rolle mehr, wohl aber als Gold- oder Silberzertifikate in den USA.
ß. Umlaufsmitteln (Banknoten). Oder:
[372]3. aus Depositen anderer ihr von Privaten kreditierten Geldmittel
o
. [372]A: Geldmitteln
In jedem Fall, in welchem die Bank
a) selbst Kredit in Anspruch nimmt, oder
b) Umlaufsmittel schafft,
ist sie bei rationalem Betrieb darauf hingewiesen, durch „Deckung“, d. h. Bereithaltung eines hinlänglich großen Einlösungsgeldbestandes oder entsprechende Bemessung der eigenen Kreditgewährungsfristen[,] für „Liquidität“, d. h. die Fähigkeit, den normalen Zahlungsforderungen gerecht zu werden, Sorge zu tragen.
In aller Regel (nicht: immer) ist für die Innehaltung der Liquiditätsnormen bei solchen Banken, welche Geld schaffen (Notenbanken)[,] durch oktroyierte Regulierungen von Verbänden (Händlergilden oder politischen Verbänden) Sorge getragen.
62
Diese Regulierungen pflegen zugleich orientiert zu sein an dem Zweck: die einmal gewählte Geldordnung eines Geldgebiets gegen Änderungen der materialen Geltung des Geldes tunlichst zu schützen und so die (formal) rationalen wirtschaftlichen Rechnungen der Haushaltungen, vor allem: derjenigen des politischen Verbandes, und ferner: der Erwerbswirtschaften, gegen „Störung“ durch (materiale) Irrationalitäten zu sichern; insbesondere pflegt aber ein tunlichst stabiler Preis der eigenen Geldsorten in den Geldsorten anderer Geldgebiete, mit denen Handels- und Kreditbeziehungen bestehen oder gewünscht werden („fester Kurs“, „Geldpari“),Die Bestimmungen über die Notendeckung dienten vornehmlich der Begrenzung der Geldschöpfungsmacht dieser Banken, nicht der Sicherung ihrer Liquidität. Zu den im Verlauf des 19. Jahrhunderts für nahezu alle Banken mit dem Recht der Notenausgabe formulierten gesetzlichen Regeln der Notenemission vgl. Schanz, Georg von, Noten- oder Zettelbank, in: WbVW3, Band 2, 1911, S. 442–481.
63
angestrebt zu werden. [373]Diese gegen Irrationalitäten des Geldwesens gerichtete Politik soll „lytrische Politik“ (nach G[eorg] F[riedrich] Knapp) heißen.Pari, aus dem ital., al pari, d. h. gleich, abgeleitete umgangssprachliche Bezeichnung für das den jeweiligen Edelmetallgehalten oder anderen gesetzlichen Festlegungen entsprechende Kursverhältnis von Währungen. Die Währungsordnung vor dem Ersten Weltkrieg war durch in der Regel feste Wechselkurse zwischen den verschiedenen Währungen gekennzeichnet. Zu Webers Geldbegriff vgl. oben, S. 236.
64
Sie ist beim reinen „Rechtsstaat“ (laissez-faire-Staat) die wichtigste überhaupt von ihm typisch übernommene wirtschaftspolitische Maßregel.[373]Ableitend aus lytron (griech. Lösegeld, Loskauf, Zahlungsmittel), definiert Knapp: „Die lytrische Politik ist die Politik, welche die Einrichtung der Zahlungsmittel betrifft; sie umfaßt alles, was darüber durch Gesetze, Verordnungen oder Verfügungen angeordnet ist und beschränkt sich keineswegs, wie die Metallisten glauben, auf die Herstellung der Zahlungsmittel.“ Vgl. Knapp, Staatliche Theorie, S. 199.
65
In rationaler Form ist sie dem modernen Staat durchaus eigentümlich. Vgl. hierzu Kap. I, § 14, oben, S. 209. Dort knüpft Max Weber den Begriff eines „theoretisch denkbare[n] reine[n] ,Rechtsstaat[es]‘ des absoluten laissez faire“ an die Voraussetzung der „Überlassung der Regulierung des Geldwesens an die reine Privatwirtschaft.“
Die Maßregeln der chinesischen Kupfermünz- und Papiergeldpolitik und der antik-römischen Münzpolitik werden an gegebenem Ort erwähnt werden.
66
Sie waren keine moderne lytrische Politik. Nur die Bankogeld-Politik der chinesischen Gilden (Muster der Hamburger Mark-Banko-Politik)Das in Aussicht Gestellte hat Weber nicht mehr ausführen können. Vgl. aber zur Münzpolitik Roms Webers Darstellung in „Abriß der universalen Sozial- und Wirtschaftsgeschichte“, MWG III/6, S. 295 f.; über chinesisches Kupfer- und Papiergeld vgl. Weber, Konfuzianismus, MWG I/19, S. 132–147.
67
waren in unserem Sinn rational. In „Konfuzianismus“ bezeichnet Weber in China gegen Metalleinlagen ausgegebene Zertifikate wiederholt als „Banko-Währung“ (vgl. Weber, Konfuzianismus, MWG I/19, S. 123 f. und 145 ff.). Daß die von chinesischen Bankiers-Gilden geschaffenen Einrichtungen und ihr „Banko-Geld“ Vorbild für die europäischen Girobanken gewesen seien, sagt Weber auch in „Abriß der universalen Sozial- und Wirtschaftsgeschichte“, MWG III/6, S. 300. Wahrscheinlich stützt er sich auf Edkins, J[oseph], Banking and Prices in China. – Shanghai: Presbyterian Mission Press 1905, S. 1, und Morse, Hosea Ballou, The Trade and Administration of the Chinese Empire. – Shanghai, Hongkong u. a.: Kelly and Walsh Ltd. 1908, S. 161. In „Konfuzianismus“ (vgl. oben) hat Weber ausführlich aus diesen Werken zitiert. Doch sind deren diesbezüglichen Behauptungen aus europäischen Quellen nicht zu belegen.
Finanzierungsgeschäfte sollen alle jene – einerlei ob von „Banken“ oder von anderen (als Gelegenheits- oder privater Nebenerwerb, oder Bestandteil der Spekulationspolitik eines „Finanzers“) – betriebenen Geschäfte heißen, welche orientiert werden an dem Zweck der gewinnbringenden Verfügung über Unternehmungserwerbschancen:
[374]a) durch Verwandlung von Rechten an appropriierten Erwerbschancen in Wertpapiere („Kommerzialisierung“) und durch Erwerb von solchen, direkt oder durch im Sinn von c
68
„finanzierte“ Unternehmungen, – [374]Gemeint ist c) δ, unten, Zeilen 19–23.
b) durch systematisierte Darbietung (und eventuell: Verweigerung) von Erwerbskredit, –
[A 94]c) (nötigen- oder erwünschtenfalls) durch Erzwingung einer Verbindung zwischen bisher konkurrierenden Unternehmungen
α. im Sinn einer monopolistischen Regulierung von gleichstufigen Unternehmungen (Kartellierung), oder
β. im Sinn einer monopolistischen Vereinigung von bisher konkurrierenden Unternehmungen unter einer Leitung zum Zweck der Ausmerzung der mindest
p
rentablen (Fusionierung), oder [374]Lies: wenigst
γ. im Sinn einer (nicht notwendig monopolistischen) Vereinigung sukzessiv = stufig spezialisierter Unternehmungen in einer „Kombination“,
69
oderIn der Fachsprache der Zeit war „Kombination“ ein Oberbegriff 1. für den Zusammenschluß von Unternehmungen jeglicher Art und 2. für die Angliederung vor- und/ oder nachgelagerter Stufen der Produktion an ein Unternehmen wie das seinerzeit beobachtete Ausgreifen der Eisen- und Stahlindustrie einerseits in den Kohlenbergbau und andererseits in den Maschinenbau und die Werftindustrie. Auf Letzteres bezieht sich Max Weber.
q
A: „Kombination“.
δ. im Sinn einer durch Wertpapieroperationen erstrebten Beherrschung massenhafter Unternehmungen von einer Stelle aus (Vertrustung)
70
und – erwünschtenfalls – der planmäßigen Schaffung von neuen solchen zu Gewinn- oder zu reinen Machtzwecken (Finanzierung i[m] o[bigen] S[inn]).Der aus Amerika übernommene Begriff „Vertrustung“ bezeichnet die Bildung von wirtschaftlichen Einheiten aus formal selbständig bleibenden Unternehmen. Typisch war hierfür die Errichtung einer Gesellschaft, die die Eigentumsanteile anderer Gesellschaften erwarb und auf dieser Grundlage die wirtschaftliche Kontrolle und Leitung über eine unter Umständen große Zahl von Unternehmen ausübte (vgl. Liefmann, Robert, Trust, in: HdStW3, Band 7, 1911, S. 1274–1292). Der Begriff Trust wurde in der deutschen Fachsprache abgelöst durch „Konzern“.
71
Siehe oben, S. 373.
[375]„Finanzierungsgeschäfte“ werden zwar oft von Banken, ganz regelmäßig, oft unvermeidlich, unter deren Mithilfe, gemacht. Aber gerade die Leitung liegt oft bei Börsenhändlern (Harriman),
72
oder bei einzelnen Großunternehmern der Produktion (Carnegie), bei Kartellierung ebenfalls oft bei Großunternehmern (Kirdorf[375]Zu Harriman und den nachfolgend genannten Unternehmern und Industriellen, Carnegie, Kirdorf, Gould, Rockefeller, Stinnes und Rathenau, vgl. die Eintragungen im Personenverzeichnis, unten, S. 725, 722, 726, 724, 732, 735 und 731.
73
usw.), bei „Vertrustung“ von besonderen „Finanzern“ (GouldEmil Kirdorf fällt insofern aus der von Weber zusammengestellten Gruppe heraus, als er zwar Unternehmen geleitet, aber nie besessen hat.
r
, Rockefeller, Stinnes, Rathenau).[375]A: Graed
74
(Näheres später.)Die Leistungen Goulds, Rockefellers und John Pierpont Morgans (1837–1913) bezeichnete Weber in anderem Zusammenhang „nach jeder konsequenten sozialistischen Entwicklungstheorie in eminentem Sinn als ‚Vorfrüchte' des Sozialismus“. Vgl. Weber, „Energetische“ Kulturtheorien, S. 576. Dort auch die Begründung für die Emendation von „Graed“ zu „Gould“.
75
Auf Finanzierungsgeschäfte und damit zusammenhängende Probleme ist Max Weber in diesem Kapitel nicht mehr eingegangen.
§ 30. Das Höchstmaß von formaler Rationalität der Kapitalrechnung von Beschaffungsbetrieben ist erreichbar unter den Voraussetzungen:
1. vollständiger Appropriation aller sachlichen Beschaffungsmittel an Besitzer und vollkommenen Fehlens formaler Appropriation von Erwerbschancen
76
auf dem Markt (Gütermarktfreiheit); Zur Definition appropriierter Chancen als „Rechte“ am Gewerk vgl. oben, S. 198. Zu Marktfreiheit und ihren Beschränkungen vgl. oben, S. 248 f.
2. vollkommener Autonomie der Auslese der Leiter durch die Besitzer, also vollkommenen Fehlens formaler Appropriation der Leitung (Unternehmungsfreiheit);
3. völligen Fehlens der Appropriation sowohl von Arbeitsstellen und Erwerbschancen an Arbeiter wie umgekehrt der Arbeiter an Besitzer (freie Arbeit, Arbeitsmarktfreiheit und Freiheit der Arbeiterauslese);
4. völligen Fehlens von materialen Verbrauchs-, Beschaffungsoder Preisregulierungen oder anderen die freie Vereinbarung [376]der Tauschbedingungen einschränkenden Ordnungen (materiale wirtschaftliche Vertragsfreiheit);
5. völliger Berechenbarkeit der technischen Beschaffungsbedingungen (mechanisch rationale Technik);
6. völliger Berechenbarkeit des Funktionierens der Verwaltungs- und Rechtsordnung und verläßlicher rein formaler Garantie aller Vereinbarungen durch die politische Gewalt (formal rationale Verwaltung und formal rationales Recht);
7. möglichst vollkommener Trennung des Betriebs und seines Schicksals vom Haushalt und dem Schicksal des Vermögens, insbesondere der Kapitalausstattung und des Kapitalzusammenhalts der Betriebe von der Vermögensausstattung und den Erbschicksalen des Vermögens der Besitzer. Dies wäre generell für Großunternehmungen formal optimal der Fall: 1. in den Rohstoffe verarbeitenden und Transportunternehmungen und im Bergbau in der Form der Gesellschaften mit frei veräußerlichen Anteilen und garantiertem Kapital ohne Personalhaftung,
77
2. in der Landwirtschaft in der Form (relativ) langfristiger Großpacht; [376]Die genannten Merkmale trafen im deutschen Recht im Regelfall auf die Aktiengesellschaft zu. Doch konnte auch hier im Gesellschaftsvertrag eine Einschränkung der freien Verfügbarkeit über die Gesellschaftsanteile vorgesehen werden.
8. möglichst formaler rationaler Ordnung des Geldwesens.
Der Erläuterung bedürfen nur wenige (übrigens schon früher berührte)
78
Punkte. Im folgenden (bis S. 378) bezieht sich Weber in Ziffer 1 auf Ausführungen, oben, S. 316 ff., und in Ziffer 2 auf oben, S. 328.
1. Zu Nr. 3. Unfreie Arbeit (insbesondre Vollsklaverei) gewährte eine formal schrankenlosere Verfügung über die Arbeiter
s
als die Miete gegen Lohn.[376]A: Arbeiter,
79
Allein a) war der erforderliche in Menschenbesitz anzulegende Kapitalbedarf für Anschaffung und Fütterung der Sklaven größer als bei Arbeitsmiete, – b) war das Menschenkapital[A 95]risiko spezifisch irrational (durch außerwirtschaftliche Umstände aller Art, insbesondere aber im höchsten Grad durch politische Momente stärker bedingt als bei Arbeitsmiete), – c) war die Bilanzierung des Sklavenkapitals infolge des schwan[377]kenden Sklavenmarkts und der darnach schwankenden Preise irrational, – d) aus dem gleichen Grund auch und vor allem: die Ergänzung und Rekrutierung (politisch bedingt), – e) war die Sklavenverwendung im Falle der Zulassung von Sklaven-Familien belastet mit Unterbringungskosten, vor allem aber mit den Kosten der Fütterung der Frauen und der Aufzucht der Kinder, für welche nicht schon an sich eine ökonomisch rationale Verwertung als Arbeitskräfte gegeben war, – f) war volle Ausnutzung der Sklavenleistung nur bei Familienlosigkeit und rücksichtsloser Disziplin möglich, welche die Tragweite des unter d angegebenen Moments noch wesentlich in ihrer Irrationalität steigerte, – g) war die Verwendung von Sklavenarbeit an Werkzeugen und Apparaten mit hohen Anforderungen an die Eigenverantwortlichkeit und das Eigeninteresse nach allen Erfahrungen nicht möglich, – h) vor allem aber fehlte die Möglichkeit der Auslese: Engagement nach Probe an der Maschine und Entlassung bei Konjunkturschwankungen oder Verbrauchtheit. Im römischen Recht war das vertragliche Arbeitsverhältnis eines Freien Miete, lat. locatio conductio operarum. Vgl. auch oben, S. 231, Hg.-Anm. 37.
Nur bei a) der Möglichkeit sehr billiger Ernährung der Sklaven, – b) regelmäßiger Versorgung des Sklavenmarkts, – c) plantagenartigen landwirtschaftlichen Massenkulturen oder sehr einfachen gewerblichen Manipulationen hat sich der Sklavenbetrieb rentiert. Die karthagischen, römischen, einige koloniale
t
und die nordamerikanischen Plantagen und die russischen „Fabriken“[377]A: kolonialen
80
sind die wichtigsten Beispiele dieser Verwertung. Das Versiegen des Sklavenmarkts (durch Befriedung des Imperium) ließ die antiken Plantagen schrumpfen; in Nordamerika führte der gleiche Umstand zur stetigen Jagd nach billigem Neuland, da neben der Sklaven- nicht noch eine Grundrente möglich war;[377]Zu den russischen „Leibeigenen-Fabriken“ vgl. oben, S. 318 mit Hg.-Anm.94.
81
in Rußland konnten die Sklavenfabriken die Konkurrenz des Kustar (Hausindustrie)Die landwirtschaftliche Grundrente ist Ergebnis der absoluten und relativen Knappheit von bebaubarem Boden. Weil in Nordamerika bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts hinein im Indianerland des Westens eine Vermehrung des Kulturbodens möglich war, schien keine absolute Rente anzufallen. Differentialrenten, die sich aus der relativen Knappheit, nämlich der unterschiedlichen Fruchtbarkeit der Böden und ihrer unterschiedlichen Lage ergeben, beachtet Max Weber hier nicht. Vgl. aber seine Behandlung der Grundrente in Weber, Theoretische Nationalökonomie, MWG III/1, S. 642–644.
82
nur sehr schwer und die Konkurrenz der freien Fabrikarbeit gar nicht aushalten, petitio[378]nierten schon vor der Emanzipation ständig um Erlaubnis zur Freilassung der Arbeiter und verfielen mit Einführung der freien Werkstattarbeit.Kustar (Tl. (russ.): kustar’); ein Bauer, der in Heimarbeit tätig ist. Die Kustar-Industrie war in Rußland von großer Bedeutung, vor allem in der Textil-, Metall- und Holzindustrie. Oftmals schlossen sich die kustari zu freiwilligen Kooperativ-Organisationen (Artjel) zusammen, die einen gewählten Ältesten an der Spitze hatten.
83
[378]Anders als in Westeuropa geriet in der Konkurrenz der Betriebsformen zunächst weniger die Hausindustrie in Schwierigkeiten als der mit Leibeigenen arbeitende Großbetrieb. Deshalb gingen schon vor Aufhebung der Leibeigenschaft durch Zar Alexander II. 1861 zahlreiche Fabrikanten zu freier Lohnarbeit über.
Bei der Lohnarbeitermiete ist a) das Kapitalrisiko und der Kapitalaufwand geringer, – b) die Reproduktion und Kinderaufzucht ganz dem Arbeiter überlassen, dessen Frau und Kinder ihrerseits Arbeit „suchen“ müssen, – c) ermöglicht deshalb die Kündigungsgefahr die Herausholung des Leistungsoptimums, – d) besteht Auslese nach der Leistungsfähigkeit und -willigkeit.
2. Zu Punkt 7. Die Trennung der Pachtbetriebe mit Kapitalrechnung von dem fideikommissarisch gebundenen Grundbesitz in England
84
ist nichts Zufälliges, sondern Ausdruck der dort (wegen des Fehlens des Bauernschutzes:Das Institut des Fideikommisses, bei dem durch Willenserklärung des Stifters der Grundbesitz für eine Familie auf Dauer gebunden, in seiner Gesamtheit unteilbar, unveräußerlich und unverschuldbar sowie einer bestimmten Erbfolge unterworfen ist, war seit dem Mittelalter in England nicht zugelassen. Doch ließ sich durch jeweils zeitbeschränkte, aber wiederholte Stiftungen der jeweils Erbenden (strict family settlement) ein ähnlicher Bindungseffekt erzielen. Vgl. Dietze, Constantin von, Fideikommisse, in: HdStW4, Band 3, 1926, S. 996.
85
Folge der insularen Lage) seit Jahrhunderten sich selbst überlassenen Entwicklung. Jede Verbindung des Bodenbesitzes mit der Bodenbewirtschaftung verwandelt den Boden in ein Kapitalgut der Wirtschaft, steigert dadurch den Kapitalbedarf und das Kapitalrisiko, hemmt die Trennung von Haushalt und Betrieb (Erbabfindungen fallen dem Betrieb als Schulden zur Last), hemmt die Freiheit der Bewegung des Kapitals des Wirtschafters, belastet endlich die Kapitalrechnung mit irrationalen Posten. Formal also entspricht die Trennung von Bodenbesitz und Landwirtschaftsbetrieb der Rationalität der Kapitalrechnungsbetriebe (die materiale Bewertung des Phänomens ist eine Sache für sich und kann je nach dem maßgebenden Bewertungsstandpunkt sehr verschieden ausfallen). Anders als in England hatten die auf grundherrlichem Boden wirtschaftenden Bauern in Kontinentaleuropa vielfach Rechte, die sie davor schützten, vom Grundherren zugunsten der Erweiterung von dessen Eigenbetrieb aus ihrem Besitz vertrieben zu werden. Zudem haben Landesfürsten insbesondere im 17. und 18. Jahrhundert im Interesse der Steuer- und Wehrkraft mit gesetzlichen Maßnahmen die Zahl der Bauernstellen zu halten oder gar auszudehnen versucht. Vgl. Hötzsch, Otto, Der Bauernschutz in den deutschen Territorien vom 16. bis ins 19. Jahrhundert, in: Schmollers Jb., Band 26, Heft 2, 1902, S. 239–272 (1137–1169).
[379]§ 31. Es gibt untereinander artverschiedene typische Richtungen „kapitalistischer“ (d. h. im Rationalitätsfall: kapitalrechnungsmäßiger) Orientierung des Erwerbs:
1. Orientierung a) an Rentabilitätschancen des kontinuierlichen Markterwerbs und -absatzes („Handel“) bei freiem (formal: nicht erzwungenem, material: wenigstens relativ freiwilligem) Ein- und Abtausch, – b) an Chancen der Rentabilität in kontinuierlichen Güter-Beschaffungsbetrieben mit Kapitalrechnung.
2. Orientierung an Erwerbschancen a) durch Handel und Spekulation in Geldsorten, Übernahme von Zahlungsleistungen aller Art und Schaffung von Zahlungsmitteln; b) durch berufsmäßige Kreditgewährung α) für Konsumzwecke, β) für Erwerbszwecke.
3. Orientierung an Chancen des aktuellen Beuteerwerbs von politischen oder politisch orientierten Verbänden oder Personen: Kriegsfinanzierung oder Revolutionsfinanzierung oder Finanzierung von Parteiführern durch Darlehen und Lieferungen.
[A 96]4. Orientierung an Chancen des kontinuierlichen Erwerbs kraft gewaltsamer, durch die politische Gewalt garantierter Herrschaft: a) kolonial (Erwerb durch Plantagen mit Zwangslieferung oder Zwangsarbeit, monopolistischer und Zwangshandel); b) fiskalisch (Erwerb durch Steuerpacht und Amtspacht, einerlei ob in der Heimat oder kolonial).
86
[379]Gegen feste Geldzahlungen (Pacht) erhielten der Steuer- oder der Amtspächter das Recht, die von der Obrigkeit festgesetzten Zwangsabgaben (Steuern) auf eigene Rechnung einzutreiben bzw. die mit der Führung des Amtes verbundenen Einnahmen (Gebühren, Sporteln etc.) für sich zu behalten. Zu den Erscheinungsweisen und Gründen dieser Form erwerbswirtschaftlicher Nutzung von Gewaltverhältnissen hat sich Max Weber wiederholt geäußert, vgl. u. a. Weber, Agrarverhältnisse3, MWG I/6, S. 338 und 352; Weber, Bürokratismus, MWG I/22-4, S. 172 f.; Weber, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, MWG III/6, S. 146, 324, 366 f., sowie Kap. III, unten, S. 480 f. Zur Geschichte der Steuerpacht in Europa vgl. Sombart, Der moderne Kapitalismus I2, S. 628–635.
5. Orientierung an Chancen des Erwerbs durch außeralltägliche Lieferungen politischer Verbände.
87
Der Text läßt verschiedene Deutungen zu. Dafür, daß Lieferungen der Verbände gemeint sind, könnte sprechen, daß Max Weber oben, S. 256 f., von einer „außeralltägliche[n] (vor allem: künstlerische[n]) Verwertung [der] Überschußversorgtheit“, [380]hier allerdings von Großhaushaltungen redet. Der Herausgeber der späteren Auflagen von „Wirtschaft und Gesellschaft“, Johannes Winckelmann, nimmt an, es handle sich um einen Schreib- oder Druckfehler. Er verweist darauf, das Weber häufig von „Staatsaufträgen“, „Staatslieferanten“, „Staatslieferungen“ spricht und korrigiert in: „Lieferungen [an] politische Verbände.“ Vgl. Winckelmann, Johannes, Erläuterungsband zu Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriß der verstehenden Soziologie, 5. Aufl. – Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) 1976, S. 42.
[380]6. Orientierung an Chancen des Erwerbs a) durch rein spekulative Transaktionen in typisierten Waren oder wertpapiermäßig verbrieften Anteilen an Unternehmungen; b) durch Besorgung kontinuierlicher Zahlungsgeschäfte der öffentlichen Verbände; c) durch Finanzierung von Unternehmungsgründungen in Form von Wertpapierabsatz an angeworbene Anleger; d) durch spekulative Finanzierung von kapitalistischen Unternehmungen und Wirtschaftsverbandsbildungen aller Art mit dem Ziel der rentablen Erwerbsregulierung oder: der Macht.
Die Fälle unter Nr. 1 und 6 sind dem Okzident weitgehend eigentümlich. Die übrigen Fälle (Nr. 2–5) haben sich in aller Welt seit Jahrtausenden überall gefunden, wo (für 2) Austauschmöglichkeit und Geldwirtschaft und (für 3–5) Geldfinanzierung stattfand. Sie haben im Okzident nur lokal und zeitweilig (besonders: in Kriegszeiten) eine so hervorragende Bedeutung als Erwerbsmittel gehabt wie in der Antike. Sie sind überall da, wo Befriedung großer Erdteile (Einheitsreich: China, Spätrom) bestand, auch ihrerseits geschrumpft, so daß dann nur Handel und Geldgeschäft (Nr. 2) als Formen kapitalistischen Erwerbs übrig blieben. Denn die kapitalistische Finanzierung der Politik war überall Produkt:
a) der Konkurrenz der Staaten untereinander um die Macht,
b) ihrer dadurch bedingten Konkurrenz um das – zwischen ihnen freizügige – Kapital.
Das endete erst mit den Einheitsreichen.
Dieser Gesichtspunkt ist, soviel ich mich entsinne, bisher am deutlichsten von J[ohann] Plenge (Von der Diskontpolitik zur Herrschaft über den Geldmarkt, Berlin 1913) beachtet.
88
Vgl. vorher nur meine Ausführungen [381]im Artikel „Agrargeschichte, Altertum“ H[and]W[örterbuch] d. St[aats-]W[issenschaften] 3. Aufl. Bd. I.Bei Plenge, Diskontpolitik, S. 28, heißt es: „Keines der großen Reiche der Mitte, die eine ganze Kultur zusammenfaßten, weder China noch das kaiserliche Rom ist zum Kapitalismus fortgeschritten. Der Kapitalismus braucht zu seinem Gedeihen die Konkurrenz eines festgewordenen Staatensystems auf gleichmäßiger und zusammenhän[381]gender Kulturunterlage: Gegensatz in der Gemeinschaft. Wettrüsten auf der Unterlage des Wirtschaftsverkehrs, das war der Sinn des Merkantilismus und durch den Merkantilismus ist der Kapitalismus in seinen zartesten Jahren großgezogen.“ Max Weber hatte das ihm gewidmete Buch von Plenge bereits in den Korrekturfahnen gelesen und in einem Dankbrief die Übereinstimmung mit eigenen, beim Studium der chinesischen Verhältnisse gewonnenen Überzeugungen begrüßt (vgl. die Briefe Max Webers an Johann Plenge vom 22. März 1913 und 11. Aug. 1913, MWG II/8, S. 137–139 und 303–310). Auch in der Überarbeitung der Aufsatzfolge „Konfuzianismus und Taoismus“ hat Max Weber auf Plenges Gedankengänge zum „Zusammenbruch des (politisch orientierten) Kapitalismus“ hingewiesen. Vgl. Weber, Konfuzianismus, MWG I/19, S. 283.
89
Gemeint ist: Weber, Agrarverhältnisse3, MWG I/6, bes. S. 715 f.
Nur der Okzident kennt rationale kapitalistische Betriebe mit stehendem Kapital, freier Arbeit und rationaler Arbeitsspezialisierung und -verbindung und rein verkehrswirtschaftliche Leistungsverteilung auf der Grundlage kapitalistischer Erwerbswirtschaften. Also: die kapitalistische Form der formal rein voluntaristischen Organisation der Arbeit als typische und herrschende Form der Bedarfsdeckung breiter Massen, mit Expropriation der Arbeiter von den Beschaffungsmitteln, Appropriation der Unternehmungen an Wertpapierbesitzer. Nur er kennt öffentlichen Kredit in Form von Rentenpapieremissionen,
90
Kommerzialisierung, Emissions- und Finanzierungsgeschäfte als Gegenstand rationaler Betriebe, den Börsenhandel in Waren und Wertpapieren, den „Geld“- und „Kapitalmarkt“, die monopolistischen Verbände als Form erwerbswirtschaftlich rationaler Organisation der unternehmungsweisen Güterherstellung (nicht nur: des Güterumsatzes). Zu „Rentenpapier“ vgl. oben, S. 364, Hg.-Anm. 42.
Der Unterschied bedarf der Erklärung, die nicht aus ökonomischen Gründen allein gegeben werden kann. Die Fälle 3–5 sollen hier als politisch orientierter Kapitalismus zusammengefaßt werden. Die ganzen späteren Erörterungen gelten vor allem auch diesem Problem. Allgemein ist nur zu sagen:
1. Es ist von vornherein klar: daß jene politisch orientierten Ereignisse, welche diese Erwerbsmöglichkeiten bieten, ökonomisch: – von der Orientierung an Marktchancen (d. h. Konsum[382]bedarf von Wirtschaftshaushaltungen) her gesehen, irrational sind.
2. Ebenso ist offenbar, daß die rein spekulativen Erwerbschancen (2, a und 6, a) und der reine Konsumtivkredit (2, b, α) für die Bedarfsdeckung und für die Güter[A 97]beschaffungswirtschaften irrational, weil durch zufällige Besitz- oder Marktchancen-Konstellationen bedingt[,] sind und daß auch Gründungs- und Finanzierungschancen (6 b, c und d) es unter Umständen sein können, aber allerdings nicht: sein müssen.
Der modernen Wirtschaft eigentümlich ist neben der rationalen kapitalistischen Unternehmung an sich 1. die Art der Ordnung der Geldverfassung[,] 2. die Art der Kommerzialisierung von Unternehmungsanteilen in
a
Wertpapierformen. Beides ist hier noch in seiner Eigenart zu erörtern.[382]A: Notenrechnungsanteilen und
2
Zur Emendation vgl. die kurze Erwähnung, oben, S. 374, Zeile 1 ff.
91
Zunächst: Die Geldverfassung. [382]Die angekündigte Erörterung zu Ziffer 2 hat Max Weber aus nicht erkennbaren Gründen unterlassen.
§ 32.
92
1. Der moderne Staat hat sich zugeeignet In diesem und den folgenden §§ 33–36 entfaltet Max Weber eine weitgehend an Georg Friedrich Knapp angelehnte Systematik des Geld- und Währungswesens, einschließlich der vielfach eigentümlichen Begrifflichkeit Knapps. Weber führt fort, was in § 6, oben, S. 235–244, begonnen worden ist.
a) durchweg: das Monopol der Geldordnung durch Satzungen,
b) in fast ausnahmsloser Regel: das Monopol der Geldschaffung
1
(Geldemission), mindestens für Metallgeld. Wie oben, S. 236, definiert, versteht Max Weber im Anschluß an Knapp unter Geld ein chartales Zahlungsmittel, welches Tauschmittel ist. Das seinerzeit schon in großem Umfang dem Zahlungsverkehr dienende nicht-chartale Buch- oder Giralgeld war im Verständnis Knapps und der meisten Zeitgenossen nicht „Geld“. Es spielt deshalb in den Ausführungen Max Webers über die Geldordnung keine Rolle.
1.
b
Für diese Monopolisierung waren zunächst rein fiskalische Gründe maßgebend (Schlagschatz und andere Münzgewinne). Daher – was hier beiseite bleibt – zuerst das Verbot fremden Geldes. Fehlt in A; 1. sinngemäß ergänzt.
[383]2. Die Monopolisierung der Geldschaffung hat bis in die Gegenwart nicht überall bestanden (in Bremen bis zur Münzreform kursierten als Kurantgeld ausländische Goldmünzen
c
).[383]A: Geldmünzen
3
[383]Der Stadtstaat Bremen war von 1760 bis zu den Münzreformen im Zusammenhang mit der Gründung des Deutschen Reiches 1871/73 der einzige deutsche Staat mit einer gesetzlich verordneten, aber nicht mit eigenen Münzen realisierten Goldwährung. Im Barzahlungsverkehr wurden bis 1873 – wie in anderen Ländern auch – Gold-, Silber- und Scheidemünzen aus deutschen und nichtdeutschen Staaten verwendet. Vgl. Helfferich, Karl, Die Reform des deutschen Geldwesens nach Gründung des Reiches, Band I: Geschichte der deutschen Geldreform. – Leipzig: Duncker & Humblot 1898, S. 192–197.
Ferner:
c) ist er, mit steigender Bedeutung seiner Steuern und Eigenwirtschaftsbetriebe, entweder durch seine eigenen oder durch die für seine Rechnung geführten Kassen
4
(beides zusammen soll: „regiminale Kassen“ Max Weber beachtet hier den Unterschied zwischen den Staatskassen im engeren Sinne und den Kassen von staatlichen Eigenbetrieben wie Reichspost und Telegraphenverwaltungen, Staatseisenbahnen, staatlichen Berg- und Hüttenbetrieben, Staatsforsten etc. Obwohl aus praktischen Gründen gesondert geführt, gehören sie zum „großen Kassenverband für thatsächliche Geldmanipulationen (Einnahmen und Ausgaben).“ Vgl. Wagner, Adolph, Die Ordnung der Finanzwirtschaft und der öffentliche Kredit, in: Handbuch der Politischen Ökonomie, Band 3, 3. Aufl. – Tübingen: H. Laupp’sche Buchhandlung 1891, S. 545.
5
heißen) Max Weber übernimmt das von frz. régime (Ordnung, Staatsform, Verwaltung) abgeleitete Kunstwort „regiminal“ von Knapp. Gemeint sind Behörden und deren Gesetze, Verordnungen, aber auch praktische Maßnahmen. „[…] wir reden daher von regiminalen Vorschriften, um anzudeuten, daß wir nicht den staatsrechtlichen Charakter derselben unterscheiden, sondern nur die faktische Wirksamkeit im Auge haben.“ (Knapp, Staatliche Theorie, S. 85). Max Weber gebraucht im Folgenden „regiminal“ und „tatsächlich“ synonym.
- der größte Zahlungsempfänger,
- der größte Zahlungsleister.
Auch abgesehen von den Punkten a und b ist daher gemäß Punkt c für ein modernes Geldwesen das Verhalten der staatlichen Kassen zum Geld, vor allem die Frage, welches Geld sie tatsächlich („regiminal“)
1. zur Verfügung haben, also hergeben können,
2. dem Publikum, als legales Geld, aufdrängen, –
andererseits die Frage, welches Geld sie tatsächlich (regiminal)
[384]1. nehmen,
2. ganz oder teilweise repudiieren,
von entscheidender Bedeutung für das Geldwesen.
Teilweise repudiiert ist z. B. Papiergeld, wenn Zollzahlung in Gold
d
verlangt wird,[384]A: Geld
6
französischen Revolution, Im ausgehenden 19. Jahrhundert war es nicht selten, daß Behörden, insbesondere Zollämter, das in ihren Staaten gebräuchliche Papiergeld, selbst wenn es gesetzliches Zahlungsmittel war, nicht annahmen, sondern international gültige Valuta, also Gold- oder Silbermünzen verlangten. Bekanntestes Beispiel waren die USA, wo dies bis 1927 ausdrücklich auf der Rückseite der Geldscheine vermerkt war: „This note is legal tender for all debts public and private, except duties on imports and interest on the public debts and is redeemable on payment of all Ioans made to the United States.“
7
voll repudiiert wurden (schließlich) z. B. die Assignaten der das Geld der Sezessionsstaaten[384] frz. assignats: Anweisungen, das Papiergeld der französischen Revolution. Ab 1790 verlor es rasch an Wert und wurde noch vor seiner formalen Außerkraftsetzung (1796) vom Publikum kaum noch angenommen. Vgl. Ehrenberg, Richard, Assignaten, in: HdStW3, Band 2, 1909, S. 217–219.
8
und die Emissionen der chinesischen Regierung in der Taiping-Rebellionszeit.Im amerikanischen Bürgerkrieg (1861–1865) haben beide Kriegsparteien ihren Finanzbedarf zu erheblichen Teilen durch Ausgabe von Papiergeld finanziert. Die von der Union abgefallenen Südstaaten, die Sezessionsstaaten, waren wegen ihres rückständigen Finanzsystems weit mehr als die Nordstaaten auf die Papiergeldschöpfung angewiesen. Ihr Geld wurde praktisch wertlos und verschwand aus dem Verkehr, während sich das Geld der Nordstaaten (nur) um 70 Prozent entwertete.
9
Die 1850 beginnende, zunächst sehr erfolgreiche, erst 1865 endgültig niedergeschlagene politisch-religiöse Rebellion unter der Führung des Sektengründers und selbsternannten Kaisers Hung Hsiu-ch’üan, der ein „Himmlisches Reich“ (T’ai-p’ing) errichten wollte, behandelt Max Weber ausführlich in „Konfuzianismus“ (MWG I/19, S. 438–446). Im Zusammenhang mit einem Überblick über die chinesische Geldgeschichte spricht Weber davon, daß die Emission von Staatsnoten in dieser Zeit „mit assignatenartiger Entwertung und Repudiation“ geendet habe (ebd., S. 146; dort auch Webers Quelle).
Legal kann das Geld nur als „gesetzliches Zahlungsmittel“, welches jedermann – also auch und vor allem die staatlichen Kassen – zu nehmen und zu geben, in bestimmtem Umfang oder unbeschränkt, „verpflichtet“ ist, definiert werden. Regiminal kann das Geld definiert werden als jenes Geld, welches Regierungskassen annehmen und aufdrängen, – legales Zwangsgeld ist insbesondere dasjenige Geld, welches sie aufdrängen.
Das „Aufdrängen“ kann
a) kraft von jeher bestehender legaler Befugnis erfolgen zu währungspolitischen Zwecken (Taler und Fünffrankenstücke [385]nach der Einstellung der Silberprägung, – es
e
erfolgte bekanntlich nicht!).[385]A: sie
10
[385] Bis zur Einführung der Goldwährung im Deutschen Reich hatte jedermann das Recht, bei der Berliner Münze Silber anzuliefern und sich zum festgelegten Kurs Silber-Taler aushändigen zu lassen. Dieses Recht hob die preußische Regierung im Juli 1871 auf. In ähnlicher Weise stellte Frankreich 1876 die bis dahin noch freie Ausprägung von Silbermünzen, insbesondere des Fünffrankenstücks, ein. Die einmal geprägten Münzen verblieben noch einige Jahrzehnte als gesetzliche Zahlungsmittel im Umlauf. In größeren Mengen wurden sie aber von den staatlichen Kassen nicht mehr aufgedrängt. Vgl. Knapp, Staatliche Theorie, S. 313–315 und 327–330.
Oder aber es kann:
b) das Aufdrängen erfolgen kraft Zahlungsunfähigkeit in den andern Zahlmitteln,
11
welche dazu führt, daß entweder In diesem Kapitel spricht Weber mehrheitlich von „Zahlungsmittel“. Doch findet sich, wie gleich im Folgenden wiederholt, auch die Schreibweise „Zahlmittel“. Sie wird, weil weber-typisch, nicht korrigiert.
α. von jener legalen Befugnis jetzt erst regiminal Gebrauch gemacht werden muß oder daß
[A 98]β. ad hoc eine formale (legale) Befugnis der Aufdrängung eines neuen Zahlmittels geschaffen wird (so fast stets bei Übergang zur Papierwährung).
Im letzten Fall (b β) ist der Verlauf regelmäßig der, daß ein bisheriges (legal oder faktisch) einlösliches Umlaufsmittel, mochte es vorher legal aufdrängbar sein, nun effektiv aufgedrängt wird und effektiv uneinlöslich bleibt.
12
Max Weber beschreibt den u. a. bei der Einführung der Assignaten und des Geldes der amerikanischen Südstaaten beobachteten Vorgang.
Legal kann ein Staat beliebige Arten von Objekten als „gesetzliches Zahlungsmittel“ und jedes chartale Objekt als „Geld“ im Sinn von „Zahlungsmittel“ bestimmen. Er kann sie in beliebige Werttarifierungen, bei Verkehrsgeld:
13
Währungsrelationen, setzen. Vgl. Webers Definition oben, S. 237.
Was er auch an formalen Störungen der legalen Geldverfassung nur sehr schwer oder gar nicht herbeiführen kann, ist
a) bei Verwaltungsgeld:
14
die Unterdrückung der dann fast stets sehr rentablen Nachahmung, Vgl. Webers Definition oben, S. 237 f.
b) bei allem Metallgeld
[386]α. die außermonetäre Verwendung des Metalls als Rohstoff, falls die Produkte einen sehr hohen Preis haben; dies insbesondere dann nicht, wenn eine für das betreffende Metall ungünstige Währungsrelation besteht (s. γ);
β. die Ausfuhr in andere Gebiete mit günstigerer Währungsrelation (bei Verkehrsgeld);
γ. die Anbietung von legalem Währungsmetall zum Ausprägen bei einer im Verhältnis zum Marktpreis zu niedrigen Tarifierung des Metallgeldes im Verhältnis zum Kurantgeld (Metallgeld oder Papiergeld).
Bei
f
Papiergeld wird die Tarifierung: ein Nominale Metall gleich dem gleichnamigen Nominale Papier immer dann zu ungünstig für das Metallgeld, wenn die Einlösung des Umlaufmittels eingestellt ist: denn dies geschieht bei Zahlungsunfähigkeit in Metallgeld. [386]A: Zu
Währungsrelationen mehrerer metallener Verkehrsgeldarten können festgestellt werden
1. durch Kassenkurstarifierung im Einzelfall (freie Parallelwährung),
15
[386]Der Begriff „Parallelwährung“ ist um 1900 in verschiedenen Bedeutungen verwendet worden. Zumeist wurde darunter eine Geldordnung verstanden, bei welcher Gold- und Silbermünzen frei ausgeprägt wurden und gleichberechtigt in Umlauf waren, ohne daß zwischen ihnen ein fest tarifiertes Wertverhältnis bestand. Der Tauschkurs mußte beim einzelnen Geschäft vereinbart werden.
2. durch periodische Tarifierung (periodisch tarifierte Parallelwährung),
3. durch legale Tarifierung für die Dauer (Plurametallismus, z. B.: Bimetallismus).
16
Der Begriff „Plurametallismus“ (im Unterschied zu „Monometallismus“, bei dem es nur ein Währungsmetall gibt) ist eine Neuschöpfung Webers. Er hat sich, wohl auch weil mehr als zwei Metalle sehr selten in legal fester Tarifierung verbunden waren, in der Fachsprache nicht durchgesetzt. Zu einem solchen Fall (Kupfer, Silber und Gold) in China vgl. Weber, Konfuzianismus, MWG I/19, S. 132 f.
Bei Nr. 1 und 2 ist durchaus regelmäßig nur ein Metall das regiminale und effektive Währungsmetall (im Mittelalter: Silber), das andre: Handelsmünze (Friedrichsd’or, Dukaten)
17
mit Kassenkurs. Völlige Scheidung der [387]spezifischen Verwertbarkeit von Verkehrsgeld ist im modernen Geldwesen selten, war aber früher (China, Mittelalter) häufig. Friedrichsd’or, von 1740 bis 1855 in Preußen geprägte Münze von 6 gr. Feingold, auf deren Vorderseite der Kopf des Königs zu sehen war. Sie gehörte zur Familie des [387]seit 1640 in Frankreich geprägten Louisd’or. – Golddukaten mit einem Gewicht von etwa 3,5 gr. wurden seit dem 13. Jahrhundert geprägt. Die Reichsmünzordnung von 1559 erklärte den Dukaten zur Hauptgoldmünze des Reiches, doch verlor er im 17. und 18. Jahrhundert im Handelsverkehr an Bedeutung.
2. Die Definition des Geldes als gesetzliches Zahlungsmittel und Geschöpf der „lytrischen“ (Zahlmittel-)Verwaltung ist soziologisch nicht erschöpfend. Sie geht von der „Tatsache aus, daß es Schulden gibt“ (G[eorg] F[riedrich] Knapp),
18
insbesondere Steuerschulden an die Staaten und Zinsschulden der Staaten. Für deren legale Ableistung ist das gleichbleibende Geldnominale (mag auch der Geldstoff inzwischen geändert sein) oder, bei Wechsel des Nominale, die „historische Definition“ Max Weber zitiert aus einer Formulierung von Knapp: „Der Grund dafür, daß die Werteinheit nicht immer technisch, aber ohne alle Ausnahme, bei jeder Verfassung des Zahlungsmittels, auf andere Weise, nämlich historisch definiert ist, liegt in der Tatsache, daß es Schulden gibt.“ Knapp, Staatliche Theorie, S. 9.
19
maßgebend. Und darüber hinaus schätzt der einzelne heute die Geldnominaleinheit als aliquoten Vgl. das Zitat aus Knapp in Hg.-Anm. 18.
20
Teil seines Geldnominaleinkommens, nicht: als chartales metallisches oder notales Stück. Abgeleitet aus lat. aliquot: einige, ein paar; in umgangssprachlicher Bedeutung: anteilsmäßig, ohne Rest teilend.
Der Staat kann durch seine Gesetzgebung und der Verwaltungsstab desselben durch sein tatsächliches (regiminales) Verhalten formal in der Tat die geltende „Währung“ des von ihm beherrschten Geldgebiets ebenfalls beherrschen.
Wenn er mit modernen Verwaltungsmitteln arbeitet. China z. B. konnte es nicht.
21
Weder früher: dazu waren die „apozentrischen“ und „epizentrischen“ Zahlungen Max Weber bezieht sich auf die Ergebnisse der Umstellung der Währung in China 1910, auf die er unten, S. 398 f., zurückkommt. Vgl. dort Hg.-Anm. 61.
22
(Zahlungen „von“ und „an“ Staatskassen) zu unbedeutend im Verhältnis zum Gesamtverkehr. Noch neuerdings: es scheint, daß es Silber nicht zum [A 99]Sperrgeld Zu den von ihm geprägten Begriffen vgl. Knapp, Staatliche Theorie, S. 87 f.
23
mit Goldreserve Geld, das im Zahlungsverkehr unbeschränkt Geltung hatte, jedoch nicht frei ausgeprägt werden durfte. Zum Sperrgeld vgl. unten, S. 397–400.
g
machen konnte, da die Machtmittel gegen die dann ganz sichere Nachprägung nicht ausreichen. [387]A: Geldreserve
[388]Allein es gibt nicht nur (schon bestehende) Schulden, sondern auch aktuell Tausch und Neukontrahierung von Schulden für die Zukunft. Dabei aber erfolgt die Orientierung primär an der Stellung des Geldes als Tauschmittel – und das heißt: an der Chance, daß es von unbestimmt Anderen
h
zu bestimmten oder unbestimmt gedachten Gütern künftig in einer (ungefähr geschätzten) Preisrelation in Abtausch werde genommen werden. [388]A: unbestimmten Arten
27
Zur Emendation vgl. die ähnliche Formulierung oben, S. 172, Zeile 35.
1. Zwar unter Umständen auch primär an der Chance, daß dringliche Schulden an den Staat oder Private mit dem Erlös abgetragen werden könnten. Doch darf dieser Fall hier zurückgestellt werden, denn er setzt „Notlage“ voraus.
2. An diesem Punkte beginnt die Unvollständigkeit der im übrigen völlig „richtigen“ und schlechthin glänzenden, für immer grundlegenden, „Staatlichen Theorie des Geldes“ von G[eorg] F[riedrich] Knapp.
24
[388]Vgl. Webers Charakterisierung des Werkes von Knapp als in Hinblick auf materiale Geldprobleme „unvollständig“, oben, S. 240 mit Hg.-Anm. 71.
Der Staat seinerseits ferner begehrt das Geld, welches er durch Steuern oder andere Maßregeln erwirbt, zwar nicht nur als Tauschmittel, sondern oft sehr stark auch zur Schuldzinsen-Zahlung. Aber seine Gläubiger wollen es dann eben doch als Tauschmittel verwenden und begehren es deshalb. Und fast stets begehrt es der Staat selbst auch, sehr oft aber: nur als Tauschmittel für künftig auf dem Markt (verkehrswirtschaftlich) zu deckende staatliche Nutzleistungsbedürfnisse. Also ist die Zahlmittelqualität, so gewiß sie begrifflich zu sondern ist, doch nicht das Definitivum.
25
Die Tauschchance eines Geldes zu bestimmten anderen Gütern, beruhend auf seiner Schätzung im Verhältnis zu Marktgütern, soll materiale Geltung (gegenüber 1. der formalen, legalen, als Zahlmittel und 2. dem oft bestehenden legalen Zwang zur formalen Verwendung eines Geldes als Tauschmittel) heißen.Weil Knapp davon überzeugt ist, vermeidet dieser konsequent den Begriff „Tauschmittel“.
26
„Materiale“ Schätzung gibt es als feststellbare Einzeltatsache prinzipiell 1. nur im Verhältnis zu [389]bestimmten Arten von Gütern und 2. für jeden einzelnen, als dessen Schätzung auf Grund des Grenznutzens des Geldes (je nach seinem Einkommen) für ihn.Vgl. auch die Definition oben, S. 235.
28
Dieser wird – wiederum für den einzelnen – natürlich durch Vermehrung des ihm verfügbaren Geldbestandes verschoben. Primär sinkt daher der Grenznutzen des Geldes für die Geldemissionsstelle (nicht nur, aber:), vor allem dann, wenn sie Verwaltungsgeld schafft und „apozentrisch“ als Tauschmittel verwendet oder als Zahlungsmittel aufdrängt. Sekundär für diejenigen Tauschpartner des Staats, in deren Händen infolge der ihnen (gemäß der gesunkenen Grenznutzenschätzung der Staatsverwaltung) bewilligten höheren Preise eine Vermehrung des Geldbestandes eintritt. Die so bei ihnen entstehende „Kaufkraft“, – das heißt: der nunmehr bei diesen Geldbesitzern sinkende Genznutzen des Geldes[389]Ohne den Begriff „Geldwert“ oder „Tauschwert“ zu benützen, folgt Max Weber im Ansatz der insbesondere von Friedrich von Wieser formulierten subjektiven Wertlehre der Grenznutzentheoretiker auch hinsichtlich des Geldes. Danach bestimmt der antizipierte Grenznutzen der für das Geld anzuschaffenden Güter den persönlichen (subjektiven) Tauschwert des Geldes und gilt das Gesetz des abnehmenden Grenznutzens. Vgl. Wieser, Friedrich von, Der natürliche Wert. – Wien: Alfred Hölder 1889, S. 46 u. a.; Wieser, Theorie, S. 286–290.
i
–[,] kann alsdann wiederum bei ihren Einkäufen die Bewilligung höherer Preise im Gefolge haben usw. Würde umgekehrt der Staat das bei ihm eingehende Notalgeld teilweise „einziehen“, d. h. nicht wieder verwenden (und: vernichten), so müßte er seine Ausgaben entsprechend der für ihn nunmehr gestiegenen Grenznutzenschätzung seiner gesunkenen Geldvorräte einschränken, seine Preisangebote also entsprechend herabsetzen. Dann würde die genau umgekehrte Folge eintreten. Verkehrswirtschaftlich kann also (nicht nur, aber:) vor allem Verwaltungsgeld in einem einzelnen Geldgebiet preisumgestaltend wirken. [389]A: Geldes,
Auf welche Güter überhaupt und in welchem Tempo, gehört nicht hierher.
3. Universell könnte eine Verbilligung und Vermehrung oder umgekehrt eine Verteuerung und Einschränkung der Währungsmetall-Beschaffung eine ähnliche Folge für alle betreffen[390]den Verkehrsgeld-Länder
29
haben. Monetäre und außermonetäre Verwendung der Metalle stehen nebeneinander. Aber nur bei Kupfer [A 100](China) war die außermonetäre Verwertung zeitweilig maßgebend für die Schätzung.[390]Gemeint sind Länder gleichen, frei ausprägbaren Metallgelds, wie es z. B. bis 1914 die Länder mit Goldwährung waren.
30
Bei GoldDie gewerbliche, künstlerische und militärische Verwendung von Kupfer führte häufig dazu, daß der Marktwert über dem Nominalwert der Münzen lag und diese aus dem Verkehr gezogen wurden. Vgl. Weber, Konfuzianismus, MWG I/19, S. 138–142.
k
ist die äquivalente Bewertung in der nominalen Gold-Geldeinheit abzüglich der Prägekosten so lang selbstverständlich, solange es intervalutarisches Zahlmittel und zugleich: in dem Geldgebiet führender Handelsstaaten Verkehrsgeld ist, wie heute.[390]A: Geld
31
Bei Silber war und wäre es im gleichen Fall noch heute ebenso. Ein Metall, welches nicht intervalutarisches Zahlmittel, aber für einige Geldgebiete Verkehrsgeld ist, wird natürlich nominal gleich mit der dortigen nominalen Geldeinheit geschätzt, – aber diese ihrerseits hat eine je nach den Ergänzungs-Kosten und Quantitäten und je nach der sogenannten „Zahlungsbilanz“Max Weber beschreibt die Verhältnisse bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Nach Aufhebung der Goldeinlösungspflicht verschwanden Goldmünzen in den meisten am Krieg beteiligten und auch in neutralen Staaten aus dem inneren Zahlungsverkehr, blieben aber (gesuchtes) internationales Zahlungsmittel.
32
(„pantopolisch“)„Zahlungsbilanz“ war zu Webers Zeit noch kein eindeutiger Begriff. Vielfach bezog er sich nur auf den vermuteten Saldo von Verpflichtungen und Forderungen eines Landes auf das Ausland, mehr und mehr auf die Abschätzung aller Wertübertragungen zwischen Inland und Ausland. Eine vollständige Zahlungsbilanz wurde für das Deutsche Reich erstmals auf das Jahr 1924 aufgestellt.
l
A: („pentapolisch“)
33
schwankende intervalutarische Relation. Dasjenige Edelmetall schließlich, welches universell zwar für regulierte (also: begrenzte) Verwaltungsgeldprägung verwendet wird, aber nicht Verkehrsgeld (sondern: Sperrgeld„pantopolisch“ (und nicht „pentopolisch“, wie es im überlieferten Text hieß), ist ein von Knapp gebildetes Kunstwort: „Das Wort soll bedeuten, daß es sich [bei den Wechselkursen, Hg.] um eine Preisbildung handelt; die valutarische Geldart des einen Landes erhält an der Börse des anderen Landes einen Preis; dieser aber bestimmt sich durch die Gesamtheit der Zahlungsverpflichtungen und durch die Stimmungen, welche jeder Preisbildung zugrunde liegen.“ Knapp, Staatliche Theorie, S. 209 f.
m
, s. den folgenden Paragraphen)A: Spargeld
34
ist, wird durchaus primär nach der außermonetären Schätzung bewertet. Die Frage ist stets: ob und wieviel des [391]betreffenden Edelmetalls rentabel produziert werden kann. Bei voller Demonetisierung richtet sie sich lediglich nach der Relation der im intervalutarischen Zahlmittel geschätzten Geldkosten zu der außermonetären Verwendbarkeit. Im Fall der Verwendung als universelles Verkehrsgeld und intervalutarisches Zahlmittel natürlich nach der Relation der Kosten primär zu der monetären Verwendbarkeit. Im Fall endlich der Verwendung als partikuläres VerkehrsgeldKap. II, § 33, unten, S. 397.
35
oder als Verwaltungsgeld auf die Dauer nach derjenigen „Nachfrage“, welche die Kosten, in dem intervalutarischen Zahlmittel ausgedrückt, ausgiebiger zu überbieten vermag. Dies wird bei partikulärer Verkehrsgeldverwendung auf die Dauer schwerlich die monetäre Verwendung sein, da die intervalutarische Relation des nur partikulären Verkehrsgeldgebiets sich auf die Dauer für dieses letztere zu senken die Tendenz haben wird und dies nur bei vollständiger Absperrung (China, Japan früher, jetzt: alle gegeneinander noch faktisch kriegsabgesperrten Gebiete)[391]Partikulär ist ein Verkehrsgeld, das nur in einem oder wenigen Ländern gilt.
36
nicht auf die Inlandspreise zurückwirkt. Auch im Fall bloßer Verwertung als reguliertes Verwaltungsgeld würde diese fest begrenzte monetäre Verwertungsgelegenheit nur bei ungemein hoher Ausprägungsrate entscheidend mitspielen, dann aber – aus den gleichen Gründen wie im Fall partikulärer freier Prägung – ähnlich enden. Im Verlauf des Ersten Weltkriegs kam es in zahlreichen Ländern zu Ausfuhrverboten für Edelmetalle sowie zu behördlichen Einschränkungen des Devisenhandels bis hin zur Monopolisierung des Auslands-Zahlungsverkehrs in der Hand des Staates oder der von ihm hierzu befugten Organe. Die Regelungen galten z. T. noch einige Jahre über das Kriegsende hinaus.
Der theoretische Grenzfall der Monopolisierung der gesamten Produktion und – monetären wie nicht-monetären – Verarbeitung des Geldmetalls (in China temporär praktisch geworden)
37
eröffnet bei Konkurrenz mehrerer Geldgebiete und: bei Verwendung von Lohnarbeitern keine so neuen Perspektiven, wie vielleicht geglaubt wird. Denn wenn für alle apozentrischenFür dies und die folgenden, die Verhältnisse in China betreffenden Mitteilungen vgl. Weber, Konfuzianismus, MWG I/19, S. 132–147; dort auch Nachweise von Webers Quellen.
n
Zahlungen das betreffende Metallgeld verwertet würde, so würde bei jedem Versuch, die Ausmünzung einzuschränken oder aber fiskalisch [392]sehr hoch zu verwerten (ein bedeutender Gewinn wäre sehr wohl zu erzielen), das gleiche eintreten, wie es bei den hohen chinesischen Schlagschätzen geschah. Das Geld würde, zunächst, im Verhältnis zum Metall, sehr „teuer“, daher die Bergwerksproduktion (bei Lohnarbeit) weitgehend unrentabel. Mit ihrer zunehmenden Einschränkung würde dann umgekehrt die Wirkung einer „Kontra-Inflation“ („Kontraktion“)[391]A: apozentrische
38
eintreten und dieser Prozeß sich (wie in China, wo er zu zeitweiliger völliger Freigabe der Prägung geführt hat) bis zum Übergang zu Geldsurrogaten und zur Naturalwirtschaft fortsetzen (wie dies in China die Folge war). Bei fortbestehender Verkehrswirtschaft könnte also die lytrische Verwaltung auf die Dauer kaum grundsätzlich anders verfahren, wie wenn „freie Prägung“ legal bestände, – nur daß nicht mehr „Interessenten“betrieb herrschte, über dessen Bedeutung später zu reden ist.[392]Hinsichtlich der Bezeichnung des Gegenteils von Inflation (zum Begriff vgl. unten, S. 410) gab es lange Zeit keine Übereinkunft im Fach. Der Begriff „Deflation“ wurde vielfach abgelehnt: „Von ‚Deflation', als Gegensatz zu Inflation sollte nicht gesprochen werden; das Wort ist unschön und bildwidrig und kann leicht durch das ältere ‚Kontraktion' ersetzt werden […]“. Vgl. Singer, Kurt, Inflation, in: HdStW4, Band 5, 1923, S. 445.
39
Bei Vollsozialisierung andererseits wäre das „Geld“-Problem beseitigt undBei freier Prägung von Münzen erfolgt die Geldschöpfung auf Initiative privater Interessenten. Siehe unten, S. 411.
o
Edelmetalle schwerlich Gegenstände der Produktion. [392]Zu ergänzen wäre: wären
4. Die Stellung der Edelmetalle als normale Währungsmetalle und Geldmaterialien ist zwar rein historisch aus ihrer Funktion als Schmuck und daher typisches Geschenkgut erwachsen, war aber neben ihrer rein technischen Qualität durch ihre Eigenschaft als spezifisch nach Wägung umgesetzte
p
Güter bedingt. Ihre Erhaltung in dieser Funktion ist, da heute im Verkehr bei Zahlungen über etwa [A 101]100 Μ. Vorkriegswährung jedermann normalerweise mit Notalzahlmitteln (Banknoten vor allem) zahlte und Zahlung begehrte,A: umgesetzter
40
nicht selbstverständlich, aber allerdings durch gewichtige Motive veranlaßt.Max Weber beschreibt hier (unter Außerachtlassung von Zahlungen in Giralgeld) die Verhältnisse in der Vorkriegszeit, als Papiergeld tatsächlich nur für Zahlungen großer Beträge verwendet wurde, zumal der geringste Wert einer Note der Reichsbank bis 1906 100 Μ und bis 1913 20 Μ betrug. Entsprechend bestand Ende 1913 die Bargeldmenge im Deutschen Reich zu 56 Prozent aus Münzen (Gold- und Scheidemünzen) und zu 44 Prozent aus Papiergeld, vor allem Banknoten. Als Max Weber an der Druckfassung seines Beitrags arbeitete, war im Zuge der Inflation der Geldwert gegenüber der Vorkriegszeit bereits auf mehr als ein Zehntel gesunken. Es gab prak[393]tisch nur noch Papiergeld. Vgl. Deutsche Bundesbank (Hg.), Deutsches Geld- und Bankwesen in Zahlen. – Frankfurt a. Μ.: Fritz Knapp 1976, S. 14.
41
Welche Gründe Weber bei der Abfassung dieses Textes im Auge hatte, läßt sich nur vermuten. Unten, S. 415–427, speziell S. 418 f., entwickelt Max Weber ausführlich, warum einer Papierwährung die Tendenz zu inflatorischem Mißbrauch innewohne und es gute Gründe gebe, an Edelmetallen als Währungsmetall und Geldmaterial festzuhalten.
[393]5. Auch die notale Geldemission ist in allen modernen Staaten nicht nur legal geordnet, sondern durch den Staat monopolisiert. Entweder in Eigenregie des Staates oder in einer (oder einigen) privilegierten und durch oktroyierte Normen und durch Kontrolle staatlich reglementierten Emissionsstelle (Notenbanken).
6. Regiminales Kurantgeld soll nur das von jenen Kassen faktisch jeweils aufgedrängte Geld heißen, anderes, faktisch nicht von jenen Kassen, dagegen im Verkehr zwischen Privaten kraft des formalen Rechts aufgedrängtes Währungsgeld soll akzessorisches Währungsgeld heißen.
42
Geld, welches nach legaler Ordnung nur bis zu Höchstbeträgen im Privatverkehr aufgedrängt werden darf, soll Scheidegeld heißen. Georg Friedrich Knapp unterscheidet „valutarisches“ und „akzessorisches“ Geld. Valutarisch nennt er eine Geldart, die a) definitiv, d.h. nicht in Währungsmetall einlösbar ist, b) für Zahlungen der öffentlichen Kassen stets bereit gehalten und c) als aufdrängbar behandelt wird. Wenn eine dieser Bedingungen nicht erfüllt ist, nennt er die betrachtete Geldart – sofern es sich um Geld in dem von ihm definierten Sinn handelt – akzessorisch. Vor dem Ersten Weltkrieg entsprachen im Deutschen Reich die Reichskassenscheine den Bedingungen b) und c), nicht aber a); die Silbertaler entsprachen den Bedingungen a) und b), nicht aber c). Vgl. Knapp, Staatliche Theorie, S. 95 und 98.
Die Terminologie lehnt sich an Knappsche Begriffe an. Das Folgende erst recht.
„Definitives“ Kurantgeld soll das regiminale Kurantgeld, „provisorisches“ jedes tatsächlich (gleichviel bei welchen Kassen) jederzeit effektive durch Einlösung oder Umwechslung in solches umwandelbare Geld heißen.
43
„Wenn eine Zahlung in definitivem Geld geleistet wird, so ist dies Geschäft vollkommen erledigt und zwar nach drei Seiten hin: erstens für den Geber, zweitens für den Empfänger und drittens für den Emittenten des Geldes.“ (Knapp, Staatliche Theorie, S. 92). Im Deutschen Reich waren bis 1914 Goldmünzen definitives Geld. – „Ist eine Zahlung in einlösbarem Gelde erfolgt, so hat der Empfänger zwar vom Geber nichts weiter zu fordern; aber dem Empfänger bleibt noch eine Forderung an den Emittenten des Geldes; der Inhaber kann vom Emittenten denselben Betrag in defini[394]tivem Gelde verlangen.“ (Knapp, ebd., S. 93). Im Deutschen Reich waren Banknoten, Reichskassenscheine und Scheidemünzen provisorisches Geld.
[394]7. Regiminales Kurantgeld muß natürlich auf die Dauer das gleiche wie effektives, nicht also das etwa davon abweichende „offizielle“, nur legal geltende, Kurantgeld sein. „Effektives“ Kurantgeld ist aber, wie früher erörtert (§ 6 oben),
44
entweder 1. freies Verkehrsgeld oder 2. unreguliertes oder 3. reguliertes Verwaltungsgeld. Die staatlichen Kassen zahlen nicht etwa nach ganz freien, an irgendeiner ihnen ideal scheinenden Geldordnung orientierten, Entschlüssen, sondern verhalten sich so, wie es ihnen 1. eigene finanzielle, – 2. die Interessen mächtiger Erwerbsklassen oktroyieren.Max Weber entwickelt die Systematik oben, S. 238 f., ohne dort von „effektivem“ Kurantgeld zu sprechen.
q
[394]Durchschuß fehlt in A.
Seiner chartalen Form nach kann effektives Währungsgeld sein:
A.
45
Metallgeld. Nur Metallgeld kann freies Verkehrsgeld sein. Aber Metallgeld muß dies keineswegs sein. Der dem Abschnitt A entsprechende Abschnitt B „Notales Geld“ beginnt in § 34, unten, S. 400.
Es ist:
I. freies Verkehrsgeld dann, wenn die lytrische Verwaltung jedes Metallquantum Währungsmetall ausprägt oder in chartalen Stücken (Münzen) einwechselt: Hylodromie.
46
Je nach der Art feinen Währungsmetalls herrscht dann effektive freie Gold-Mit dem von ihm erfundenen Kunstwort „Hylodromie“ bezeichnet Georg Friedrich Knapp die „bewußte Befestigung des Preises eines hylischen Metalles [durch eine Geldverwaltung, Hg.].“ (Knapp, Staatliche Theorie, S. 70). Zum Begriff vgl. den Glossar-Eintrag, unten, S. 744.
r
, Silber- oder Kupfer-Verkehrsgeldwährung. Ob die lytrische Verwaltung Hylodromien effektiv walten lassen kann, hängt nicht von ihrem freien Entschluß, sondern davon ab, ob Leute am Ausprägen interessiert sind. A: Geld-
a) Die Hylodromie kann also „offiziell“ bestehen, ohne „effektiv“ zu sein. Sie ist nach dem Gesagten trotz offiziellen Bestehens nicht effektiv:
47
Max Weber skizziert im Folgenden Beobachtungen in der Geschichte von Doppelwährungen bzw. des Bimetallismus (vgl. oben, S. 386 f.), wenn das verordnete Wert[395]verhältnis der (Gold-, und Silber-)Münzen nicht dem Verhältnis der Marktwerte ihrer Metalle bzw. ihrem Wertverhältnis in (großen) anderen Ländern entsprach.
[395]aa) wenn für mehrere Metalle tarifiert legale Hylodromie besteht (Plurametallismus), dabei aber eines (oder einige) dieser im Verhältnis zum jeweiligen Marktpreis des Rohmetalls zu niedrig tarifiert ist (sind). Denn dann wird nur das jeweils zu hoch tarifierte Metall von Privaten zur Ausprägung dargeboten und von den Zahlenden zur Zahlung verwendet. Wenn sich die öffentlichen Kassen dem entziehen,
48
so „staut“Gemeint ist: Wenn die öffentlichen Kassen nach wie vor auch in niedrig tarifierter Münze zahlen, aber vom Publikum vornehmlich das zu hoch tarifierte Zahlungsmittel erhalten.
49
sich bei ihnen das zu hochMax Weber übernimmt den Begriff von Knapp, Staatliche Theorie, S. 164 ff.
s
tarifierte Geld so lange an, bis auch ihnen andere Zahlungsmittel nicht bleiben. Bei hinlänglicher Preissperrung[395]A: niedrig
50
können dann die Münzen aus dem zu niedrig tarifierten Metall eingeschmolzen oder nach Gewicht als Ware gegen Münzen des zu hochGemeint ist vermutlich: Wenn das offizielle Wertverhältnis voraussehbar anhaltend nicht dem Wertverhältnis der Metalle entspricht.
t
tarifierten Metalls verkauft werden;A: niedrig
51
Für das, was Weber hier beschreibt, hat sich in der Nationalökonomie der Begriff „Greshamsches Gesetz“ eingebürgert, das Weber oben, S. 157, erwähnt.
bb) wenn die Zahlenden, insbesondere aber notgedrungen (s. aa) die staatlichen Kassen andauernd und massenhaft von dem ihnen formal zustehenden oder usurpierten Recht Gebrauch machen, ein anderes, metallenes oder notales Zahlungsmittel aufzudrängen
u
, welches nicht nur provisorisches Geld ist, sondern entweder 1. akzessorisch [A 102]oder 2. zwar provisorisch gewesen, aber infolge Zahlungsunfähigkeit der Einlösungsstelle nicht mehr einlöslich ist. A: aufdrängen
In dem Fall aa immer, in den Fällen bb Nr. l und namentlich 2 bei starkem und anhaltendem Aufdrängen der akzessorischen bzw. nicht mehr effektiv provisorischen Geldarten hört die frühere Hylodromie auf.
Im Fall aa tritt ausschließlich Hylodromie des übertarifierten Metalls, welches nun allein freies Verkehrsgeld wird, auf, also: eine neue Metall-(Verkehrsgeld-)Währung; in den Fällen bb wird das „akzessorische“ Metall- bzw. das nicht mehr effektiv [396]provisorische Notal-Geld Währungsgeld (im Fall 1: Sperrgeld-, im Fall 2: Papiergeldwährung).
b) Die Hylodromie kann andererseits „effektiv“ sein, ohne „offiziell“, kraft Rechtssatz, zu gelten.
Beispiel: Die rein fiskalisch, durch Schlagschatz-Interessen, bedingte Konkurrenz der Münzherren des Mittelalters[,] nur möglichst mit Münzmetall zu prägen, obwohl eine formelle Hylodromie noch nicht bestand. Die Wirkung war trotzdem wenigstens ähnlich.
Monometallisches (je nachdem: Gold-
v
, Silber- oder Kupfer-)Währungsrecht wollen wir im Anschluß an das Gesagte den Zustand nennen, wo ein Metall legal hylodromisch ist, plurametallisches (je nachdem: bi- oder trimetallisches) Währungsrecht, wo legal mehrere Metalle in fester Währungsrelation hylodromisch sein sollen, Parallelwährungsrecht, wo legal mehrere Metalle ohne feste Währungsrelation hylodromisch sein sollen. Von „Währungsmetall“ und „Metall“- (je nachdem: Gold-, Silber-, Kupfer-, Parallel-)„Währung“ soll nur für dasjenige Metall jeweils geredet werden, welches effektiv hylodromisch, also: effektiv „Verkehrsgeld“ ist (Verkehrsgeldwährung). [396]A: Geld-
„Legal“ bestand Bimetallismus in allen Staaten des lateinischen Münzbundes bis zur Einstellung der freien Silberprägung nach der deutschen Münzreform.
52
Effektives Währungsmetall war in aller Regel – denn die Relationsstabilisierung hat so stark gewirkt, daß man die Änderung sehr oft gar nicht bemerkte und effektiver „Bimetallismus“ herrschte – jeweils aber nur das des, nach den jeweiligen Marktverhältnissen, jeweilig zu hoch tarifierten, daher allein hylodromischen, Metalls. Das Geld aus dem[396] In der 1865 zwischen Frankreich, Belgien, Italien und der Schweiz abgeschlossenen Münzkonvention (frz. Union latine), der 1867 Griechenland beitrat, vereinbarten die beteiligten Staaten eine gleichartige Ausprägung von Gold- und Silbermünzen und die wechselseitige volle Anerkennung derselben im Zahlungsverkehr. Dabei sollte ein Wertverhältnis von 1 : 151/2 gelten, jedoch sollten nur die Fünffrankenstücke in Silber frei ausprägbar sein. Nachdem in Deutschland 1871 die freie Ausprägung der Silbertaler eingestellt worden war und weltweit der Kurs des Silbers sank, wurde 1874 auch in der Lateinischen Münzunion die Ausprägung der Fünffrankenstücke eingeschränkt, später ganz aufgehoben. Vgl. Lexis, Wilhelm, Münzbund (lateinischer), in: HdStW3, Band 6, 1910, S. 812–816.
w
anderen wurde: „akzessorisches Geld“. (In der Sache ganz mit Knapp über[397]einstimmend.)A: den
53
„Bimetallismus“ ist also – mindestens bei Konkurrenz mehrerer autokephaler und autonomer Münzstätten – als effektives Währungssystem stets nur ein transitorischer und im übrigen normalerweise ein rein „legaler“, nicht effektiver Zustand. [397]Max Weber folgt hier zunächst nur den Darlegungen Knapps hinsichtlich der Funktionsweise historischer Doppelwährungen (vgl. Knapp, Staatliche Theorie, S. 58 ff., 103 ff., 150 ff.). Die Doppelwährung bzw. der Bimetallismus hat die für die Geltung der chartalen Theorie Knapps entscheidende Frage aufgeworfen, ob es einen allen Erscheinungen gerecht werdenden einheitlichen Geldbegriff gibt. Die Tatsache, daß im Fall der Doppelwährung nicht der Staat (die regiminale Behörde), sondern der Verkehr entscheidet, was letztlich valutarisch ist, galt als ein fundamentaler Einwand der Kritiker Knapps. Vgl. Palyi, Melchior, Der Streit um die Staatliche Theorie des Geldes. – München und Leipzig: Duncker & Humblot 1922, S. 10–26 (hinfort: Palyi, Streit).
Daß das zu niedrig bewertete Metall nicht zur Prägestätte gebracht wird, ist natürlich kein „regiminaler“ (durch Verwaltungsmaßregeln herbeigeführter) Zustand, sondern Folge der (nehmen wir an: veränderten) Marktlage und der fortbestehenden Relationsbestimmung. Freilich könnte die Geldverwaltung das Geld als „Verwaltungsgeld“ mit Verlust prägen, aber sie könnte es, da die außermonetäre Verwertung des Metalls lohnender ist, nicht im Verkehr halten.
§ 33. II.
54
SperrgeldMax Weber setzt die in § 32 unter Ziffer A I (oben, S. 393) begonnenen Ausführungen zum Metallgeld als chartaler Form effektiven Währungsgeldes fort.
55
soll jedes nicht hylodromisch metallische Geld dann heißen, wenn es Kurantgeld ist. „Sperrgeld“ in dem von Weber definierten Sinn ist keine eigene Kategorie im System von Georg Friedrich Knapp. Doch spricht Knapp, wie andere Theoretiker auch, von „sperren“, wenn es nicht im Belieben Privater steht, bei der Prägeanstalt Edelmetall in unbeschränkter Menge in Münzen zu tauschen. Beispiele nennt Weber unten, S. 398 f.
Sperrgeld läuft um entweder:
α. als „akzessorisches“, d. h. in einem anderen Kurantgeld des gleichen Geldgebiets tarifiertes Geld,
- in einem anderen Sperrgeld,
- in einem Papiergeld,
- in einem Verkehrsgeld.
Oder es läuft um als:
β. „intervalutarisch orientiertes“ Sperrgeld. Dies dann, wenn es zwar als einziges Kurantgeld in seinem Geldgebiet umläuft, aber Vorkehrungen getroffen sind, für Zahlungen in andern Geldgebieten das intervalutarische Zahlmittel (in [A 103]Barren- oder [398]Münzform) verfügbar zu halten (intervalutarischer Reservefonds): intervalutarische Sperrgeldwährung.
a) Partikuläres Sperrgeld soll Sperrgeld dann heißen, wenn es zwar einziges Kurantgeld, aber nicht intervalutarisch orientiert ist.
Das Sperrgeld kann dann entweder ad hoc, beim Ankauf des intervalutarischen Zahlmittels oder der „Devise“,
56
im Einzelfall, oder – für die zulässigen Fälle – generell regiminal in dem intervalutarischen Zahlmittel tarifiert werden. [398]Als „Devisen“ wurden zu Webers Zeit im kaufmännischen Verkehr Wechsel bezeichnet, die auf ausländische Plätze gezogen und dort in fremder Währung zahlbar waren.
(Zu α
x
und β[398]A: a
y
): Valutarisch tarifiertes Sperrgeld waren die TalerA: b
57
und sind die silbernen Fünffrankenstücke,Bis zum Übergang auf die Mark-Währung waren (Silber-)Taler in Norddeutschland valutarisches Geld, d. h. frei ausprägbar. Nachdem Preußen 1871 die freie Ausprägung eingestellt hatte, blieb der Taler trotz des ständig sinkenden Metallwerts von Silber gesetzliches Zahlungsmittel in fester Relation zur Goldmark. Weil er von den öffentlichen Kassen dem Publikum nicht aufgedrängt wurde, war er akzessorisches Geld. Ab 1900 fand eine beschleunigte Einziehung statt; 1907 wurden die noch umlaufenden Taler außer Kurs gesetzt und bis 1908 eingezogen.
58
beide „akzessorisch“. „Intervalutarisch orientiert“ (an Gold) sind die silbernen holländischen Gulden (nachdem sie kurze Zeit nach der Sperrung der Ausprägung „partikulär“ gewesen waren),Die Fünffrankenstücke der Lateinischen Münzunion (vgl. oben, S. 384 f. mit Hg.-Anm. 10) wurden seit 1878 in den beteiligten Staaten nicht mehr frei ausgeprägt, blieben aber bei der festgelegten Wertrelation von 151/2 : 1 zum Gold gesetzliche Zahlungsmittel. Formal waren sie auch nach dem Ersten Weltkrieg noch in Geltung, obgleich sie faktisch Scheidemünzen waren und von einer Gemeinsamkeit des Münzumlaufs nicht mehr die Rede sein konnte. Vgl. Esslen, J. B., Münzbund, in: HdStW4, Band 6, 1925, S. 664–669.
59
jetzt auch die Rupien;1873 haben die Niederlande die unbeschränkte Ausprägung des Silberguldens eingestellt, ohne einen weiteren Schritt der Währungsreform zu tun. Im Sinne der Definition oben unter a) waren die Gulden „partikuläres“ Geld, bis 1877 die Niederlande zur Goldwährung übergingen. Dabei wurde der Kurs des Silberguldens zum Goldgulden gesetzlich festgelegt, ohne daß die Regierung die Verpflichtung übernahm, Silbergulden in Goldgulden einzulösen.
60
„partikulär“ würden nach der [399]Münzordnung vom 24.V.10 die chinesischen „Yuan“ (Dollars) so lange sein, als die im Statut nicht erwähnte Hylodromie wirklich nicht bestehen sollte (eine intervalutarische Orientierung, wie sie die amerikanische Kommission vorschlug, wurde abgelehnt).1893 stellte die indische Regierung die freie Ausprägung der silbernen Rupie ein, um den Nachteilen der anhaltenden Entwertung ihrer Währung gegenüber der Goldwährung im britischen Mutterland zu entgehen. Durch Knapphaltung der behördlich gelenkten Ausprägung gelang es in den folgenden Jahren, den Kurs der Rupie zu heben. Seit 1899 blieb er dank der sich am Wechselkurs zum britischen Pfund orientierenden Emissionspolitik stabil, ohne daß dies gesetzlich festgelegt war. Damit war Indien faktisch auf dem Goldstandard, obgleich das vorherrschende Münzmetall Sil[399]ber war. Vgl. Bothe, M[oritz], Die indische Währungsreform seit 1893 (Münchener volkswirtschaftliche Studien, hg. von Lujo Brentano und Walther Lotz, 67. Stück). – Stuttgart: Cotta 1904; Keynes, John Maynard, Indian Currency and Finance. – London: Macmillan 1913.
61
(Zeitweise waren es die holländischen Gulden, s. oben.) Das Münzstatut vom 24. Mai 1910 bestimmte den Silber-Dollar (yuan) – mit definiertem Silbergehalt – zum Standard des chinesischen Währungssystems und entzog zugleich der Jahrhunderte lang bestehenden Recheneinheit tael die amtliche Anerkennung (vgl. Wei, Wen-Pin, The Currency Problem in China (Studies in History, Economics and Public Law, ed. by the Faculty of Political Sciences of Columbia University, Vol. 59, No. 2). – New York: Columbia University and Longmans, Green & Co. Agents 1914, S. 128 ff.; von Max Weber in der überarbeiteten Fassung von „Konfuzianismus und Taoismus“ herangezogen, vgl. Weber, Konfuzianismus, MWG I/19, S. 133, Fn. 5). Das Statut ist abgedruckt bei Wei (S. 148–154). Von einer „amerikanischen Kommission“ berichtet Wei nicht, wohl aber davon, daß der Präsident der Bank of Java, der als auswärtiger Berater die Reform begleitete, als langfristiges Ziel die Anlehnung an den Goldstandard empfohlen habe.
Bei Sperrgeld wäre die Hylodromie für die Edelmetallbesitzer privatwirtschaftlich sehr lohnend. Trotzdem (und: eben deshalb) ist die Sperrung verfügt, damit nicht, bei Einführung der Hylodromie des bisherigen Sperrgeldmetalls, die Hylodromie des nunmehr in ihnen in zu niedriger Relation tarifierten andren Metalls als unrentabel aufhört und der monetäre Bestand des aus diesem Metall hergestellten, nunmehr obstruierten Sperrgeldes (s. gleich) zu außermonetären, rentableren, Zwecken verwendet werde. Der Grund, weshalb dies zu vermeiden getrachtet wird, ist bei rationaler lytrischer Verwaltung: daß dies andere Metall intervalutarisches Zahlmittel ist.
b) Obstruiertes Verkehrsgeld soll Sperrgeld (also: Kurantgeld) dann heißen, wenn gerade umgekehrt wie bei a die freie Ausprägung zwar legal besteht, privatwirtschaftlich aber unrentabel ist und deshalb tatsächlich unterbleibt. Die Unrentabilität beruht dann auf entweder:
α. einer im Verhältnis zum Marktpreis zu ungünstigen Währungsrelation des Metalls zum Verkehrsgeld, oder
β. zu Papiergeld.
[400]Derartiges Geld ist einmal Verkehrsgeld gewesen, aber entweder
bei α: bei Plurametallismus Änderungen der Marktpreisrelation, – oder
bei β: bei Mono-
z
oder Plurametallismus Finanzkatastrophen, welche die Metallgeldzahlung den staatlichen Kassen unmöglich machten und sie nötigten, notales Geld aufzudrängen und dessen Einlösung zu sistieren, haben die privatwirtschaftliche Möglichkeit effektiver Hylodromie unmöglich gemacht. Das betreffende Geld wird (mindestens rational) nicht mehr im Verkehr verwendet. [400]A: Mone-
c) Außer Sperrkurantgeld (hier allein „Sperrgeld“ genannt) kann es gesperrtes metallenes Scheidegeld geben, d. h. Geld mit einem auf einen „kritischen“ Betrag begrenzten Annahmezwang als Zahlmittel. Nicht notwendig, aber regelmäßig ist es dann im Verhältnis zu den Währungsmünzen absichtlich „unterwertig“ ausgeprägt (um es gegen die Gefahr des Einschmelzens zu bewahren) und dann meist (nicht: immer): provisorisches Geld, d. h. einlösbar bei bestimmten Kassen.
Der Fall gehört der alltäglichen Erfahrung an und bietet kein besonderes Interesse.
Alles Scheidegeld und sehr viele Arten von metallischem Sperrgeld stehen dem rein notalen (heute: Papier-)Geld in ihrer Stellung im Geldwesen nahe und sind von ihm nur durch die immerhin etwas ins Gewicht fallende anderweitige Verwertbarkeit des Geldstoffs verschieden. Sehr nahe steht metallisches Sperrgeld [A 104]den Umlaufsmitteln
62
dann, wenn es „provisorisches Geld“ ist, wenn also hinlängliche Vorkehrungen zur Einlösung in Verkehrsgeld getroffen sind. [400]Zum Begriff „Umlaufsmittel“ vgl. oben, S. 238.
§ 34. B.
63
Notales Geld ist natürlich stets: Verwaltungsgeld. Für eine soziologische Theorie ist stetsMax Weber setzt die in § 32 (oben, S. 393) begonnenen Ausführungen zur chartalen Form des effektiven Währungsgeldes fort, nachdem in den §§ 32 und 33 „A. Me[401]tallgeld“ abgehandelt worden ist. Zu Webers von Knapp abweichender Definition des „notalen“ Geldes vgl. § 5, oben, S. 237, mit Anm. 58.
a
genau die Urkunde bestimm[401]ter chartaler Formen (einschließlich des Aufdrucks bestimmten formalen Sinnes) das „Geld“, nie: die etwaige – keineswegs notwendig – wirklich durch sie repräsentierte „Forderung“A: stets,
64
(die ja bei reinem uneinlöslichen Papiergeld völlig fehlt). Max Weber bezieht sich auf die seinerzeit umstrittene Frage, ob Forderungen auf „Währungsgeld“ ihrerseits zum Geld bzw. zu den Umlaufsmitteln zu rechnen seien. Banknoten stellten bis zur Aufhebung der Einlösungspflicht regelmäßig ein Zahlungsversprechen bzw. eine Forderung dar. Weber folgt mit seiner Festlegung, die Urkunde als solche sei Geld, Knapp, Staatliche Theorie, S. 119 ff. Zur Diskussion vgl. Helfferich, Das Geld2, S. 226 ff.
Es kann formal rechtlich eine, offiziell, einlösliche Inhaberschuldurkunde:
- eines Privaten (z. B. im 17. Jahrhundert in England eines Goldschmieds),65Seit der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts und insbesondere im 18. Jahrhundert gaben reiche Personen in England Teile ihrer Vorräte an Münzen und Edelmetallbarren Goldschmieden zur Aufbewahrung und erhielten dafür Depositenscheine. Weil diese in zunehmend größeren Kreisen als Zahlungsmittel akzeptiert wurden, entwickelte sich die Gewohnheit, die Urkunden in Teilbeträgen auf runde Summen auszustellen, „Goldsmith’s Notes“.
- einer privilegierten Bank66(Banknoten),Außer in Ländern der „Notenbankfreiheit“ (z. B. England und Schottland bis 1844, USA bis 1863) und in Ländern mit Staatsbanken (Schweden, Rußland, Bulgarien) bedurften Banken, die Banknoten in Verkehr brachten, der staatlichen Konzessionierung. Im Deutschen Reich regelte das Bankgesetz von 1875 das Notenbankwesen. Neben einer in spezieller Weise privilegierten Zentralnotenbank, der Reichsbank, behielt eine kleine Zahl bereits bestehender Banken ihr hinsichtlich des Emissionsbetrags kontingentiertes Privileg bis über den Ersten Weltkrieg hinweg. Vgl. Schanz, Georg von, Noten- oder Zettelbank, in: WbVW3, Band 2, 1911, S. 442–481.
- eines politischen Verbandes (Staatsnoten)67Einlösliche Staatsnoten (Staatspapiergeld) waren z. B. die in Preußen seit 1806 ausgegebenen Tresorscheine bzw. Kassenanweisungen und insbesondere die nach dem Gesetz vom 30. April 1874 ausgegebenen Reichskassenscheine. Diese haben in der geldtheoretischen und geldpolitischen Diskussion der Zeit eine große Rolle gespielt. Sie wurden jederzeit bei der Reichshauptkasse gegen Goldgeld eingelöst und von den öffentlichen Kassen zum Nennwert akzeptiert. Vgl. Lexis, Wilhelm, Papiergeld, in: HdStW3, Band 6, 1910, S. 984–1007.
sein. Ist es „effektiv“ einlöslich, also nur Umlaufsmittel, und also „provisorisches Geld“, so kann es sein:
1. voll gedeckt: Zertifikat,
[402]2. nur nach Kassenbedarf gedeckt: Umlaufsmittel.
68
[402]Max Weber gebraucht den Begriff „Umlaufsmittel“, indem er jetzt Zertifikate ausschließt, in einer anderen Bedeutung als am Anfang des Satzes, wo er seiner Definition S. 238 folgt.
Die Deckung kann geordnet sein:
α. durch pensatorisch normierte Metallbestände (Bankowährung),
69
Zu „Bankowährung“ vgl. oben, S. 275 mit Hg.-Anm. 69, und S. 371 mit Hg.-Anm. 61.
β. durch Metallgeld.
Primär emittiert worden ist notales Geld ganz regelmäßig als provisorisches (einlösbares) Geld, und zwar in modernen Zeiten typisch als Umlaufsmittel, fast immer als: Banknote, daher durchweg auf schon vorhandene Nominale von Metallwährungen lautend.
1. Natürlich gilt der erste Teil des letzten Satzes nicht in Fällen, wo eine notale Geldart durch eine neue ersetzt wurde, Staatsnoten durch Banknoten oder umgekehrt. Aber dann ist eben keine primäre Emission vorhanden.
2. Zum Eingangssatz von B: Gewiß kann es Tausch- und Zahlmittel geben, die nicht chartal, also weder Münzen noch Urkunden noch andere sachliche Objekte sind: das ist ganz zweifellos. Aber diese wollen wir dann nicht „Geld“, sondern – je nachdem – „Rechnungseinheit“ oder wie immer ihre Eigenart dies nahe legt, nennen. Dem „Gelde“ ist eben dies charakteristisch: daß es an Quantitäten von chartalen Artefakten gebunden ist, – eine ganz und gar nicht „nebensächliche“ und nur „äußerliche“ Eigenschaft.
Im Fall der faktischen Sistierung der Einlösung von bisher provisorischem Gelde ist zu unterscheiden, ob dieselbe von dem Interessenten eingeschätzt wird: – „gilt“:
- als eine transitorische Maßregel, –
- als für absehbare Zeit definitiv.
Im ersten Fall pflegt sich, da ja Metallgeld oder Metallbarren zu allen intervalutarischen Zahlungen gesucht sind, ein „Disagio“
70
der notalen Zahlmittel gegen die im Nominal gleichen metallischen einzustellen; doch ist dies nicht unbedingt notwen[403]dig, und das Disagio pflegt (aber auch dies wiederum: nicht notwendig, da jener Bedarf ja sehr akut sein kann) mäßig zu sein. „Disagio“ bezeichnet hier den Betrag, um den eine Geldsorte oder ein Wertpapier im Verkehr niedriger bewertet wird, als der Nennwert bzw. der Zwangskurs beträgt.
Im zweiten Fall entwickelt sich nach einiger Zeit definitive („autogenische“)
71
Papiergeldwährung. Von „Disagio“ kann man dann nicht mehr sprechen, sondern (historisch!) von „Entwertung“. [403]Knapp, Staatliche Theorie, S. 29 f., 51–56, unterscheidet zwei Arten von chartalen Zahlungsmitteln (Geld): hylogenische und autogenische. Bei hylogenischen erwächst die Geldqualität aus dem stofflichen Gehalt. Bei autogenischen ist der stoffliche Gehalt der Stücke für die Geltung nicht wesentlich.
Denn es ist dann sogar möglich, daß das Währungsmetall jenes früheren, jetzt des obstruierten Verkehrsgeldes, auf welches die Noten ursprünglich lauteten, aus gleichviel welchen Gründen auf dem Markt sehr stark im Preise gegenüber den intervalutarischen Zahlungsmitteln sinkt, die Papierwährung aber in geringem Grade. Was die Folge haben muß (und in Österreich und Rußland gehabt hat): daß schließlich die frühere Nominalgewichtseinheit (Silber) zu einem „geringeren“ Nominalbetrag in den inzwischen „autogenisch“ gewordenen Noten käuflich war.
72
Das ist völlig verständlich. Wenn also auch das Anfangsstadium der reinen Papierwährung intervalutarisch wohl ausnahmslos eine Niedrigerbewertung der Papiernominale [A 105]gegenüber der gleichnamigen Silbernominale bedeutete, – weil sie stets Folge von aktueller Zahlungsunfähigkeit ist, – so hing z. B. in Österreich und RußlandÖsterreich und Rußland hatten im 19. Jahrhundert, auf Silberwährungen folgend, die sie aus politischen Gründen nicht halten konnten, uneinlösliches Papiergeld. Als am Ende des 19. Jahrhunderts Silber drastisch im Werte sank, ist der Wechselkurs des vom Silber gelösten österreichischen und russischen Papiergeldes gegenüber Goldwährungen stabil geblieben. Für G. F. Knapp war Österreich ein Beweis für die Richtigkeit seiner chartalen Theorie. Im Folgenden schildert Weber in Anlehnung an Knapp die Gründe. Vgl. Knapp, Staatliche Theorie, S. 355 ff.; konzentrierter in: Knapp, Geldtheorie, staatliche, in: HdStW3, Band 4, 1909, S. 613–616.
73
die weitere Entwicklung doch 1. von den intervalutarisch sich entwickelnden sog. „Zahlungsbilanzen“, welche die Nachfrage des Auslands nach einheimischen Zahlmitteln bestimmen, – 2. von dem Maß der Papiergeldemissionen, – 3. von dem Erfolg der Emissionsstelle: intervalutarische Zahlungsmittel zu beschaffen (der sog. „Devisenpolitik“) ab. Diese drei Momente konnten und können sich so gestalten und gestalteten sich in diesem Fall so, daß die Schätzung des betreffenden Papiergelds im „Weltmarktverkehr“, d. h. in seiner Relation zum intervalutarischen Zahlmittel (heute: GoldVgl. dazu Helfferich, Das Geld2, S. 77 ff.
b
) sich im Sinn zunehmend stabiler, [404]zeitweise wieder: steigender Bewertung entwickelte, während das frühere Währungsmetall aus Gründen a) der vermehrten und verbilligten Silberproduktion, – b) der zunehmenden Demonetialisierung[403]A: Geld
74
des Silbers zunehmend im Preise, am Gold gemessen, sank. Eine echte („autogenische“) Papierwährung ist eben eine solche, bei welcher auf eine effektive „Restitution“ der alten Einlösungsrelation in Metall gar nicht mehr gezählt wird. [404]Ungewöhnliche Bezeichnung Webers für die Aufhebung der gesetzlichen Zahlkraft von Münzen, eines bestimmten Metalls bzw. den Ausschluß eines Metalls von der weiteren Verwendung zu Münzzwecken. Unten, S. 417, spricht Max Weber von „Demonetisation“; in der Fachsprache waren auch „Demonetarisierung“ oder „Demonetisierung“ gebräuchlich.
§ 35. Daß die Rechtsordnung und Verwaltung des Staats die formale legale und auch die formale regiminale Geltung einer Geldart als „Währung“ im Gebiet ihrer Zwangsgewalt heute bewerkstelligen kann, falls sie selbst in dieser Geldart überhaupt zahlungsfähig bleibt, ist richtig. Sie bleibt es nicht mehr, sobald sie eine bisher „akzessorische“ Geldart oder „provisorische“ zu freiem Verkehrsgeld (bei Metallgeld) oder zu autogenem Papiergeld (bei Notalgeld) werden läßt, weil dann diese Geldarten sich bei ihr so lange aufstauen, bis sie selbst nur noch über sie verfügt, also sie bei Zahlungen aufdrängen muß.
Von Knapp richtig als das normale Schema der „obstruktionalen“ Währungsänderung dargelegt.
75
Georg Friedrich Knapp unterscheidet zwei Arten des Übergangs eines Landes zu einer neuen Währung: die „exaktorische“ und die „obstruktionelle“. Die exaktorische beruht auf freien Entschlüssen der Obrigkeit hinsichtlich der Durchsetzung eines als zweckmäßig erkannten neuen valutarischen Geldes. Die obstruktionelle ist eine durch die Umstände herbeiführte Änderung der Währung. In diesem Fall hat der Staat akzessorisches Geld für Zahlungen an sich zugelassen, ist aber seinerseits verpflichtet, auf Anforderung in valutarischem, endgültigem Geld zu zahlen. Wenn Zahlungen an den Staat vornehmlich in akzessorischem Geld eingehen, kommt es zu der oben, S. 395, beschriebenen „Stauung“ (Obstruktion, Verstopfung), mit der Folge, daß der Staat seinen Verpflichtungen, in valutarischem Geld zu zahlen, nicht nachkommen kann. Vgl. Knapp, Staatliche Theorie, S. 164–202.
Damit ist aber natürlich über dessen materiale Geltung, d. h. darüber: in welcher Tauschrelation es zu anderen, naturalen Gütern genommen wird, noch nichts gesagt, also auch nicht darüber: ob und wieweit die Geldverwaltung darauf Einfluß gewin[405]nen kann. Daß die politische Gewalt durch Rationierungen des Konsums, Produktionskontrolle und Höchst- (natürlich auch: Mindest-)Preis-Verordnungen weitgehend auch darauf Einfluß nehmen kann, soweit es sich um im Inland schon vorhandene oder im Inland hergestellte Güter (und: Arbeitsleistungen im Inland) handelt, ist ebenso erfahrungsmäßig beweisbar wie: daß dieser Einfluß auch da seine höchst fühlbaren Grenzen hat
76
(worüber anderwärts).[405]Max Weber bezieht sich vermutlich auf Erfahrungen mit der massenhaften Umgehung der staatlichen Preissetzung und den Bewirtschaftungsregeln im Ersten Weltkrieg.
77
Jedenfalls aber sind solche Maßnahmen ersichtlich nicht solche der Geldverwaltung. Entsprechende Ausführungen liegen nicht vor.
Die modernen rationalen Geldverwaltungen stecken sich vielmehr, der Tatsache nach, ein ganz anderes Ziel: die materiale Bewertung der Inlandswährung in ausländischer Währung, den „Valutakurs“ genannten Börsenpreis der fremden Geldsorten also[,] zu beeinflussen, und zwar, in aller Regel, zu „befestigen“, d. h. möglichst stetig (unter Umständen: möglichst hoch) zu halten. Neben Prestige- und politischen Machtinteressen sind dabei Finanzinteressen (bei Absicht künftiger Auslandsanleihen), außerdem die Interessen sehr mächtiger Erwerbsinteressenten: der Importeure, der mit fremden Rohstoffen arbeitenden Inlandsgewerbe, endlich Konsuminteressen der Auslandsprodukte begehrenden Schichten maßgebend. „Lytrische Politik“ ist unstreitig heute,
78
der Tatsache nach, primär intervalutarische Kurspolitik. Diese, sich an eine zentrale These Knapps anlehnende Behauptung (vgl. Knapp, Staatliche Theorie, S. 262 ff.) hatte nur Geltung bis zum Kriegsausbruch 1914. 1919/20 verfolgten die Geldverwaltungen bei flexiblen Wechselkursen primär fiskalische sowie wirtschafts- und sozialpolitische Ziele. Zum Begriff „lytrisch“ vgl. den Glossar-Eintrag, unten, S. 746.
Auch dies und das Folgende durchaus gemäß Knapp. Das Buch ist formell und inhaltlich eines der größten Meisterstücke deutscher schriftstellerischer Kunst und wissenschaftlicher Denkschärfe. Die Augen fast aller Fachkritiker aber waren auf die (relativ wenigen, freilich nicht ganz unwichtigen) beiseite gelassenen Probleme gerichtet.
79
Knapps Werk ist von Anfang an auf heftige Kritik und relativ wenig Zustimmung gestoßen. Die Diskussion ist zusammenfassend dargestellt worden in Palyi, Streit (wie [406]oben, S. 397, Hg.-Anm. 53). Im Vordergrund der Kritik stand, was Friedrich von Wieser wie folgt formulierte: „Der Fortschritt der Knappschen nominalistischen Theorie ist aber damit erkauft, daß sie das Problem der Geldtheorie auf das engste einschränkt.“ Wieser, Theorie, S. 321.
[406]Während England s. Z. noch vielleicht halb widerwillig in die Goldwährung hineingeriet, weil das als Währungsstoff gewünschte Silber in der Währungsrelation [A 106]zu niedrig tarifiert war,
80
sind alle anderen modern organisierten und geordneten Staaten unzweifelhaft deshalb entweder zur reinen Goldwährung oder zur Goldwährung mit akzessorischem Silbersperrgeld, oder zur Sperrgeldsilberwährung oder regulierten Notalwährung mit (in beiden Fällen) einer auf Goldbeschaffung für Auslandszahlungen gerichteten lytrischen Politik übergegangen, um eine möglichst feste intervalutarische Relation zum englischen Goldgeld zu erhalten. Fälle des Übergangs zur reinen Papierwährung sind nur im Gefolge politischer Katastrophen, als eine Form der Abhilfe gegen die eigene Zahlungsunfähigkeit im bisherigen Währungsgeld[,] aufgetreten,Theoretisch wäre eine zu niedrige Tarifierung des Silbers kein Argument dafür gewesen, zur Goldwährung überzugehen. Zu den tatsächlichen Gründen vgl. Helfferich, Das Geld2, S. 64 ff.
81
– so jetzt massenhaft.„Reine Papierwährung“ meint ein System, in dem uneinlösliches Papiergeld gesetzliches Zahlungsmittel ist. In der Regel war Papiergeld zunächst einlöslich, wurde dann aber im Gefolge der Überbeanspruchung der Emission uneinlösliches gesetzliches Zahlungsmittel, wie in den napoleonischen Kriegen in England. Zu Österreich und Rußland vgl. oben, S. 403 mit Hg.-Anm. 72 und 73.
82
Seit 1914, dem Beginn des Ersten Weltkriegs, haben nahezu alle Staaten die ursprünglich vorgesehene Einlösung von Banknoten ausgesetzt, zudem neue Papiergeldarten mit gesetzlicher Zahlkraft eingeführt und den freien internationalen Verkehr mit Edelmetallen unterbunden.
Es scheint nun richtig, daß für jenen intervalutarischen Zweck (fester Kurs[,] heute:
83
gegen Gold) nicht ausschließlich die eigene effektive Gold-Hylodromie (Chrysodromie)Gemeint ist ein etwa zwei Jahrzehnte umfassender Zeitraum vor dem Weltkrieg.
84
das mögliche Mittel ist. Auch das Münzpari chrysodromer chartaler Münzsorten kann aktuell sehr heftig erschüttert werden, – wenn auch die Chance, eventuell durch Versendung und Umprägung [407]von GoldZu „Hylodromie“ vgl. oben, S. 394, sowie den Glossar-Eintrag, unten, S. 744. Den Begriff „Chrysodromie“ (abgeleitet aus chrysos, dem griechischen Wort für Gold, und dromos „Lauf“) prägte Knapp für den Fall, daß die Hylodromie Gold betraf. Vgl. Knapp, Staatliche Theorie, S. 109.
c
intervalutarische Zahlungsmittel für Leistungen vom ausländischen Verkehr zu erlangen, durch eigene Chrysodromie immerhin sehr stark erleichtert wird und, solange diese besteht, nur durch natürliche Verkehrsobstruktion oder durch Goldausfuhrverbot zeitweise stark gestört werden kann. Andererseits kann aber erfahrungsgemäß[407]A: Geld
85
unter normalen Friedensverhältnissen recht wohl auch ein Papierwährungsgebiet mit geordnetem Rechtszustand, günstigen Produktionsbedingungen und planvoll auf Goldbeschaffung[407]Max Weber bezieht sich auf die oben (S. 403) und unten (S. 416) herangezogenen Erfahrungen in Österreich, die von Knapp, Staatliche Theorie, S. 353–394, ausführlich analysiert worden sind.
d
für Auslandszahlungen gerichteter lytrischer Politik einen leidlich stabilen „Devisenkurs“ erreichen, – wenn auch, ceteris paribus, mit merklich höheren Opfern für: die Finanzen,A: Geldbeschaffung
86
oder: die Goldbedürftigen. (Ganz ebenso läge es natürlich, wenn das intervalutarische Zahlungsmittel Silber wäre, also „Argyrodromie“Unten, S. 429, bezeichnet Weber das „Handeln des Verwaltungsstabs als solchem und das von ihm geleitete Handeln“ als „Finanzen“ im weitesten Wortsinn.
87
in den Haupthandelsstaaten der Welt herrschte.) Ableitend aus dem griechischen argyros: Silber, und dem griechischen dromos: Lauf, prägte Knapp für den Fall, daß Silber das hylische Metall war, diesen Begriff. Vgl. Knapp, Staatliche Theorie, S. 108 f.
§ 36. Die typischen elementarsten Mittel der intervalutarischen lytrischen Politik (deren Einzelmaßnahmen sonst hier nicht erörtert werden können) sind:
I. in Gebieten mit Gold-Hylodromie:
1. Deckung der nicht in bar
1
gedeckten Umlaufsmittel prinzipiell durch Waren-Wechsel, d. h. Forderungen über verkaufte Waren, aus welchen „sichere“ Personen (bewährte Unternehmer) haften, unter Beschränkung der auf eigenes Risiko gehenden Geschäfte der Notenbanken tunlichst auf diese und auf Warenpfandgeschäfte, Depositenannahme- und, daran anschlie[408]ßend, Girozahlungsgeschäfte, endlich: Kassenführung für den Staat; – Als Deckung in „bar“ galten vornehmlich Goldbarren und Goldmünzen mit einem bestimmten Feingehalt. Deutsche Notenbanken durften nach dem Bankgesetz von 1875 darüber hinaus auch Reichskassenscheine und Noten anderer deutscher Notenbanken in die Bardeckung einrechnen.
2. „Diskontpolitik“ der Notenbanken, d. h. Erhöhung des Zinsabzugs für angekaufte Wechsel im Fall der Chance, daß die Außenzahlungen einen Bedarf nach Goldgeld ergeben, der den einheimischen Goldbestand, insbesondere den der Notenbank, mit Ausfuhr bedroht, – um dadurch Auslandsgeldbesitzer zur Ausnutzung dieser Zinschance anzuregen und Inlandsinanspruchnahme zu erschweren.
II. in Gebieten mit nicht goldener Sperrgeldwährung
2
oder mit Papierwährung: [408]Gemeint sind Länder mit Silberwährung, in denen die Ausprägung des Silbers und damit die Bestimmung der Menge des im Umlauf befindlichen Währungsgeldes ausschließlich in der Hand der Geldbehörden liegt, wie seit 1893 in Britisch-Indien (vgl. oben, S. 398 mit Hg.-Anm. 60).
1. Diskontpolitik wie bei Nr. I, 2, um zu starke Kreditinanspruchnahme zu hemmen; außerdem:
2. Goldprämienpolitik, – ein Mittel, welches auch in Goldwährungsgebieten mit akzessorischem Silbersperrgeld häufig ist,
3
– Goldprämienpolitik ist vor dem Weltkrieg vornehmlich von Frankreich, einem Goldwährungsland mit akzessorischem Sperrgeld in Gestalt der Fünffrankenstücke, betrieben worden. Um eine Goldausfuhr zu behindern, wurden von der französischen Zentralbank ihre Noten oder die Fünffrankenstücke nicht ohne weiteres in die Goldmünzen des betreffenden Staates, sondern nur in Barren oder unter Umständen in abgenützten Münzen fremder Staaten eingelöst und dabei indirekt ein Preiszuschlag erhoben. Doch hat es auch direkte Zuschläge auf den an sich gesetzlich festgelegten Goldpreis gegeben. Vgl. Mises, Theorie des Geldes, S. 449–458.
3. planvolle Goldankaufspolitik und planvolle Beeinflussung der „Devisenkurse“ durch eigene Käufe oder Verkäufe von Auslandswechseln.
Diese zunächst rein „lytrisch“ orientierte Politik kann aber in eine materiale Wirtschaftsregulierung umschlagen.
Die Notenbanken können, durch ihre große Machtstellung innerhalb der Kredit gebenden Banken, welche in sehr vielen Fällen ihrerseits auf den Kredit der Notenbank angewiesen sind, dazu beitragen, die Banken zu veranlassen: den „Geldmarkt“, d. h. die Bedingungen kurzfristigen (Zahlungs- und Betriebs-)Kredits einheitlich zu regulieren und von da aus zu einer planmäßigen Regulierung des Er[A 107]werbskredits, dadurch aber: der [409]Richtung der Gütererzeugung, fortzuschreiten:
4
die bisher am stärksten einer „Planwirtschaft“ sich annähernde Stufe[409] Das von Max Weber Gemeinte ist ausführlich in dem Max Weber gewidmeten Werk von Plenge, Diskontpolitik, behandelt worden.
5
kapitalistischer, formal voluntaristischer Die Zeitangabe „bisher“ läßt vermuten, daß der Text noch vor den Erfahrungen mit der Planwirtschaft im Weltkrieg verfaßt worden ist.
e
,[409]A: valutaristischer
6
materialer Ordnung des Wirtschaftens innerhalb des Gebiets des betreffenden politischen Verbandes. „Voluntaristisch“ nennt Weber oben, S. 248, eine durch Interessenlage herbeigeführte materiale Marktregulierung bei formaler Marktfreiheit. „Valutarisch“ in der überlieferten Druckfassung wurde emendiert.
Diese vor dem Kriege typischen Maßregeln bewegten sich alle auf dem Boden einer Geldpolitik, die primär von dem Streben nach „Befestigung“, also Stabilisierung, wenn aber eine Änderung gewünscht wurde
f
(bei Ländern mit Sperrgeld- oder Papierwährung)[,] am ehesten: langsame HebungA: wurde –
g
, des intervalutarischen Kurses ausging, also letztlich an dem hylodromischen Geld des größten HandelsgebietsLies: nach langsamer Hebung
7
orientiert war. Aber es treten an die Geldbeschaffungsstellen auch mächtige Interessenten heran, welche durchaus entgegengesetzte Absichten verfolgen. Sie wünschen eine lytrische Politik, welche Gemeint ist das britische Pfund, in dem der größte Teil des internationalen Handels abgerechnet wurde.
1. den intervalutarischen Kurs des eigenen Geldes senkt
h
, um Exportchancen für Unternehmer zu schaffen, und welche A: senkte
2. durch Vermehrung der Geldemissionen, also: Argyrodromie neben (und das hätte bedeutet: statt) Chrysodromie und eventuell: planvolle Papiergeldemissionen[,] die Austauschrelation des Geldes gegen Inlandsgüter senkt, was dasselbe ist: den Geld-(Nominal-)Preis der Inlandsgüter steigert. Der Zweck war: Gewinnchancen für die erwerbsmäßige Herstellung solcher Güter, deren Preishebung, berechnet in Inlandnominalen, als wahrscheinlich schnellste Folge der Vermehrung des Inlandgeldes und damit seiner Preissenkung in der intervalutarischen [410]Relation angesehen wurde. Der beabsichtigte Vorgang wird als „Inflation“ bezeichnet.
8
[410]Der Begriff „Inflation“, in den 1860er Jahren in den USA geprägt, ist in Deutschland erst im Verlauf des Krieges in Wissenschaft und Umgangssprache gebräuchlich geworden. Gemeint war meist eine politisch gewollte Geldvermehrung, noch nicht ein Ansteigen der Güterpreise bzw. Sinken des Wechselkurses der Währung. Diese wurden als Wirkung von Inflation (im Sinne der bewußten Geldvermehrung) verstanden. Zur Begriffsgeschichte und zum Stand der Diskussion bei Kriegsende vgl. Eulenburg, Franz, Inflation. (Zur Theorie der Kriegswirtschaft. II), in: AfSSp, Band 45, Heft 3, 1919, S. 477–526 (hinfort: Eulenburg, Inflation); Singer, Kurt, Inflation, in: HdStW4, Band 5, 1923, S. 444–446.
Es ist nun einerseits:
1. zwar (der Tragweite nach) nicht ganz unbestritten, aber sehr wahrscheinlich: daß auch bei (jeder Art von) Hylodromie im Fall sehr starker Verbilligung und Vermehrung der Edelmetallproduktion (oder des billigen Beuteerwerbs von solchen) eine fühlbare Tendenz zu einer Preishebung wenigstens für viele, vielleicht: in verschiedenem Maß für alle, Produkte in den Gebieten mit Edelmetallwährung entstand.
9
Andererseits steht als unbezweifelte Tatsache fest: Max Weber bezieht sich auf die anhaltende Fachdiskussion über die Ursachen der seit dem 16. Jahrhundert wiederholt beobachteten Phasen auffälliger allgemeiner Preissteigerungen. Diese schienen mit der Erschließung neuer Edelmetallvorkommen zusammenzufallen, im 19. Jahrhundert insbesondere 1850 bis 1873 nach der Entdeckung der reichen Goldlager in Kalifornien und Australien und 1895 bis 1914 nach den Funden in Südafrika. Vgl. u. a. Lexis, Wilhelm, Gold und Goldwährung, in: HdStW3, Band 5, 1910, S. 32–44; Helfferich, Das Geld2, S. 88–116.
2. daß lytrische Verwaltungen in Gebieten mit (autogenischem) Papiergeld, in Zeiten schwerer finanzieller Not (insbesondere: Krieg) in aller Regel ihre Geldemissionen lediglich an ihren finanziellen Kriegsbedürfnissen orientieren. Ebenso steht freilich fest, daß Länder mit Hylodromie oder mit metallischem Sperrgeld in solchen Zeiten nicht nur – was nicht notwendig zu einer dauernden Währungsänderung führte – die Einlösung ihrer notalen Umlaufsmittel sistierten
i
, sondern ferner auch durch rein finanziell (wiederum: kriegsfinanziell) orientierte Papiergeldemissionen zur definitiven reinen Papierwährung übergingen und dann das akzessorisch gewordene Metallgeld [411]infolge der Ignorierung seines Agio[410]A: zu sistieren
10
bei der Tarifierung im Verhältnis zum Papiernominale lediglich außermonetär verwertet werden konnte und also monetär verschwand.[411]Agio (ital.), Aufgeld, Betrag, um den eine Geldsorte oder ein Wertpapier höher bezahlt wird, als dem Nennwert entspricht.
11
Endlich steht fest: daß in Fällen eines solchen Wechsels zur reinen Papierwährung und hemmungslosen Papiergeldemission der Zustand der Inflation mit allen Folgen tatsächlich in kolossalem Umfang eintrat.Weber faßt die bereits oben in verschiedenen Zusammenhängen angedeuteten Erfahrungen mit der Finanzierung von Kriegen in Preußen, Österreich, Großbritannien, Rußland, China und den USA zusammen.
12
Neben der französischen Assignatenwirtschaft und der Papiergeldwirtschaft im amerikanischen Bürgerkrieg (vgl. oben, S. 348, Hg.-Anm. 7 und 8) sind vermutlich die im Weltkrieg beginnenden und sich in Rußland, Deutschland und den Nachfolgestaaten Österreich-Ungarns nach Friedensschluß beschleunigenden Inflationen gemeint. Bis März/April 1920 (Termin für die Ablieferung der korrigierten Druckfahnen) war der Index der Großhandelspreise im Deutschen Reich auf das 17-Fache der Preise zu Kriegsbeginn gestiegen. Vgl. Zahlen zur Geldentwertung in Deutschland 1914 bis 1923. Bearbeitet im Statistischen Reichsamt (Sonderhefte zu Wirtschaft und Statistik, 5. Jg., Sonderheft 1). – Berlin: Reimar Hobbing 1925 (hinfort: Zahlen zur Geldentwertung), S. 5 und 16.
Beim Vergleich aller dieser Vorgänge (1 und 2) zeigt sich:
A. Solange freies Metall-Verkehrsgeld besteht, ist die Möglichkeit der „Inflation“ eng begrenzt:
1. „mechanisch“ dadurch: daß das jeweilig für monetäre Zwecke erlangbare Quantum des betreffenden Edelmetalls, wenn auch in elastischer Art, so doch letztlich fest begrenzt ist, –
2. ökonomisch (normalerweise) dadurch: daß die Geldschaffung lediglich auf Initiative von privaten Interessenten erfolgt, also das Ausprägungsbegehren an Zahlungsbedürfnissen der marktorientierten Wirtschaft orientiert ist.
3. Inflation ist dann nur durch Verwandlung bisherigen Metall-Sperrgeldes (z. B. heute: Silbers in den Goldwährungsländern) in freies Verkehrsgeld [A 108]möglich, in dieser Form allerdings bei stark verbilligter und gesteigerter Produktion des Sperrgeldmetalls sehr weitgehend.
4. Inflation mit Umlaufsmitteln ist nur als sehr langfristige, allmähliche Steigerung des Umlaufs durch Kreditstundung [412]denkbar, und zwar elastisch, aber letztlich doch fest durch die Rücksicht auf die Solvenz der Notenbank begrenzt.
13
Akute Inflationschance liegt hier nur bei Insolvenzgefahr der Bank vor, also normalerweise wiederum: bei kriegsbedingter Papiergeldwährung. [412] Das von Weber mit „Kreditstundung“ (bei Emission von Banknoten) Gemeinte ist nicht mit Sicherheit zu erschließen. Ludwig v. Mises nennt als ausschlaggebenden Grund für die Regel, nur Wechsel (Kredite kurzer Frist) zur kreditären Deckung von Banknoten zuzulassen, daß damit eine gewisse Begrenzung der Höhe der Emission gewährleistet sei. „Wären Hypotheken und Staatsrenten ohne weiteres als geeignete Grundlage für die Ausgabe von Umlaufsmitteln anerkannt, dann würde die Ausgabe der Umlaufsmittel ins Schrankenlose gehen.“ Vgl. Mises, Theorie des Geldes, S. 390.
Sonderfälle, wie die durch Kriegsexporte bedingte „Inflation“ Schwedens mit Gold sind so besonders gelagert, daß sie hier beiseite gelassen werden.
14
Schweden hatte während des Weltkriegs einen Exportüberschuß, der zunächst zu erheblichen Teilen in Gold ausgeglichen wurde. Doch war der Anstieg der Großhandelspreise auf das Dreifache nur zum geringen Teil auf die Goldzufuhr zurückzuführen. Vgl. Neustätter, Hanna, Schwedische Währung während des Weltkrieges. – München: Drei Masken Verlag 1920; Cassel, Gustav, Das Geldwesen nach 1914 (Schriften des Weltwirtschafts-Instituts der Handels-Hochschule Leipzig, Bandl). – Leipzig: G.A. Gloeckner 1925 (hinfort: Cassel, Geldwesen), S. 63–74.
B. Wo einmal autogenische Papierwährung besteht, ist die Chance vielleicht nicht immer der Inflation selbst, – denn im Krieg gehen fast alle Länder bald zur Papierwährung über, – wohl aber meist der Entfaltung der Folgen der Inflation immerhin merklich größer. Der Druck finanzieller Schwierigkeiten und der
k
infolge der Inflationspreise gestiegenen Gehalt- und Lohnforderungen und sonstigen Kosten begünstigt recht fühlbar die Tendenz der Finanzverwaltung, auch ohne absoluten Zwang der Not und trotz der Möglichkeit, sich durch starke Opfer ihnen zu entziehen, die Inflation weiter fortzusetzen. Der Unterschied ist – wie die Verhältnisse der Entente[412]A: die
15
einerseits, Deutschlands zweitens, Österreichs und Rußlands drittens zei[413]gen Im engeren Sinn das 1904 geschlossene Abkommen zwischen Großbritannien und Frankreich (Entente cordiale) bzw. das 1907 durch Einbeziehung Rußlands in die Triple Entente verwandelte Militärbündnis, dem im Verlauf des Krieges weitere Gegner der Mittelmächte beitraten; schließlich umgangssprachlich alle Kriegsgegner der Mittelmächte, auch wenn sie der Entente nicht förmlich angehörten.
l
– gewiß nur ein quantitativer, aber immerhin doch fühlbar.[413]A: zeigen,
16
[413] In den USA und England setzte sich der dort relativ milde Inflationsprozeß bis 1920 fort. Frankreich und Italien erleichterten sich die finanzielle Liquidation des Krieges, indem sie ihre Währungen erst 1926 bzw. 1927 (auf dem Niveau von 20 bis 25 Prozent des Vorkriegswertes) stabilisierten. Österreich, Ungarn, Polen und die Sowjetunion befanden sich 1920 bereits im Stadium der Hyperinflation, während sich in Deutschland das Inflationstempo nach Kriegsschluß zwar erhöht hatte, die Hyperinflation mit völliger Entwertung der Mark aber erst 1922 einsetzte. Vgl. Cassel, Geldwesen (wie oben, S. 412, Hg.-Anm. 14); Nurkse, Ragnar, The Course and Control of Inflation. A Review of Monetary Expérience in Europe after World War I. (League of Nations. Economie, Financial and Transit Department). – o.O.: League of Nations 1946, S. 87 ff.
Lytrische Politik kann also, insbesondere bei akzessorischem Metallsperrgeld oder bei Papierwährung[,] auch Inflationspolitik (sei es plurametallistische oder sei es „papieroplatische“)
17
sein. Sie ist es in einem am intervalutarischen Kurs relativ so wenig interessierten Lande, wie Amerika, eine Zeitlang in ganz normalen Zeiten ohne alles und jedes Finanzmotiv wirklich gewesen. Georg Friedrich Knapp unterscheidet „metalloplatisches“ und „papiroplatisches“ Geld. „Platisch“ bezieht sich auf die Gestalt aller chartalen Zahlungsmittel, deren Wertzeichen sich nach Knapp auf „Platten“ – aus Metall oder Papier – befinden. Knapp gibt den ausdrücklichen Hinweis: „lies papyroplatisches Geld“ (Knapp, Staatliche Theorie, S. 396). Ob Max Weber absichtlich „papieroplatisch“ schrieb oder es sich um einen Druckfehler handelt, läßt sich nicht mehr feststellen.
18
Sie ist es heute unter dem Druck der Not in nicht wenigen Ländern, welche die Kriegszahlmittelinflation über sich ergehen ließen, nach dem Krieg geblieben. Die Theorie der Inflation ist hier nicht zu entwickeln. Stets bedeutet sie zunächst eine besondere Art der Schaffung von Kaufkraft bestimmter Interessenten. Es soll nur festgestellt werden: daß die material planwirtschaftliche rationale Leitung der lytrischen Politik, die scheinbar bei Verwaltungsgeld, vor allem Papiergeld, weit leichter zu entwickeln wäre, doch gerade besonders leicht (vom Standpunkt der Kursstabilisierung aus) irrationalen Interessen dient. Zu den wirtschaftlichen Zielen der von den „Inflationisten“ in den USA gewünschten Vermehrung von Papiergeld bzw. Wiedereinführung der freien Ausprägung von Silber vgl. Prager, Max, Die Währungsfrage in den Vereinigten Staaten von Nordamerika. Eine wirtschaftsgeschichtliche Studie (Münchener Volkswirtschaftliche Studien, hg. von Lujo Brentano und Walther Lotz, Band 23). – Stuttgart: Cotta 1897; Mises, Theorie des Geldes, S. 262–279.
[414]Denn formale verkehrswirtschaftliche Rationalität der lytrischen Politik und damit: des Geldwesens könnte, entsprechend dem bisher durchgehend festgehaltenen Sinn, nur bedeuten: die Ausschaltung von solchen Interessen, welche entweder 1. nicht marktorientiert sind, – wie die finanziellen
m
, – oder 2. nicht an tunlichster Erhaltung stabiler intervalutarischer Relationen als optimale Grundlage rationaler Kalkulation interessiert sind, – sondern im Gegenteil an jener bestimmten Art der Schaffung von „Kaufkraft“ jener Kategorien von Interessenten durch das Mittel der Inflation und ihrer Erhaltung auch ohne Zwang der Finanzen. Ob dieser letzte Vorgang zu begrüßen oder zu tadeln ist, ist natürlich keine empirisch zu beantwortende Frage. Aber sein empirisches Vorkommen steht fest. Und darüber hinaus: eine an materialen sozialen Idealen orientierte Anschauung kann sehr wohl gerade die Tatsache: daß die Geld- und Umlaufsmittelschaffung in der Verkehrswirtschaft Angelegenheit des nur nach „Rentabilität“ fragenden Interessentenbetriebs ist, nicht aber orientiert ist an der Frage nach dem „richtigen“ Geldquantum und der „richtigen“ Geldart, zum Anlaß der Kritik nehmen. Nur das Verwaltungsgeld kann man, würde sie mit Recht argumentieren, „beherrschen“, nicht: das Verkehrsgeld. Also ist ersteres, vor allem aber: das billig in beliebigen Mengen und Arten zu schaffende Papiergeld, das spezifische Mittel, überhaupt Geld unter – gleichviel welchen – material rationalen Gesichts[A 109]punkten zu schaffen. Die Argumentation[414]Lies: staatsfinanziellen
n
– deren Wert gegenüber der Tatsache: daß „Interessen“ der einzelnen, nicht „Ideen“ einer Wirtschaftsverwaltung, künftig wie heut die Welt beherrschen werden, natürlich seineA: Argumentation,
o
Schranken hat –A: ihre
p
ist doch formal logisch schlüssig. Damit aber ist der mögliche Widerstreit der (im hier festgehaltenen Sinn) formalen und der (gerade für eine von jeder hylodromischen Rücksicht auf das Metall völlig gelöste lytrischeA: hat,
q
Verwaltung theoretisch konstruierbaren) materialen Rationalität auch an diesem Punkt gegeben; und darauf allein kam es an. A: gelösten lytrischen
[415]Ersichtlich sind diese gesamten Auseinandersetzungen eine freilich nur in diesem Rahmen gehaltene und auch innerhalb seiner höchst summarische
r
, alle Feinheiten ganz beiseite lassende[415]A: summarischen
s
Diskussion mit G[eorg] F[riedrich] Knapps prachtvollem Buch: „Staatliche Theorie des Geldes“ (1. Aufl. 1905, inzwischen 2. Aufl.).A: lassenden
19
Das Werk ist sofort, entgegen seiner Absicht, aber vielleicht nicht ganz ohne seine Schuld, für Wertungen ausgeschlachtet und natürlich besonders von der „papieroplatischen“[415]Knapp, Staatliche Theorie2, war 1918 erschienen. Der Text der ersten Auflage blieb nahezu unverändert. Nachträge betreffen die österreichischen Zollzahlungen, Änderungen im österreichischen und deutschen Geldwesen bis 1914 sowie ergänzende Begründungen, warum die „Staatliche Theorie“ den Begriff Geldwert nicht braucht. In einem Anhang führt Knapp die ihm bekannt gewordene Literatur über die „Staatliche Theorie“, einschließlich kritischer Besprechungen auf.
20
lytrischen Verwaltung Österreichs stürmisch begrüßt worden.Zu Begriff und Schreibweise vgl. oben, S. 413, Hg.-Anm. 17.
21
Die Ereignisse haben der Knappschen Theorie in keinem Punkte „Unrecht“ gegeben, wohl aber gezeigt, was ohnehin feststand: daß sie allerdings nach der Seite der materialen Geldgeltung unvollständig ist. Dies soll nachfolgend etwas näher begründet werden. Max Weber bezieht sich vermutlich auf eine Bemerkung Knapps im oben (Hg.-Anm. 19) erwähnten Anhang in der 2. Auflage: „Die früheste lebhafte Zustimmung rührt von Dr. L. Calligaris her, der als Beamter in der Österreich-ungarischen Bank in Wien tätig war und über das österreichische Geldwesen geschrieben hat.“ (Knapp, Staatliche Theorie2, S. 446). Vgl. Calligaris, Ludwig, Staatliche Theorie des Geldes. Ein wissenschaftliches Urteil über die Währungsreform, in: Österreichische Rundschau, Band 7, Heft 80 vom 10. Mai 1906, S. 43–50; ders., Helfferich über Knapp, in: Bank-Archiv, 5. Jg., 1911, S. 268–270. Zur österreichischen Papiergeldwährung vgl. oben, S. 403, Hg.-Anm. 73.
Exkurs über die staatliche Theorie des Geldes.aa-a(S. 447, bis: (A II, 3).) Zu dieser Textpassage sind Korrekturfahnen überliefert; vgl. dazu den Anhang, unten, S. 689–709.
a-a(S. 447, bis: (A II, 3).) Zu dieser Textpassage sind Korrekturfahnen überliefert; vgl. dazu den Anhang, unten, S. 689–709.
Knapp weist siegreich nach:
22
daß jede sowohl unmittelbar staatliche als staatlich regulierte „lytrische“ (Zahlmittel-)Politik der letzten Zeit beim Bestreben zum Übergang zur Goldwährung oder einer ihr möglichst nahestehenden, indirekt chrysodromischen, Währung „exodromisch“:Daß sich die Gedanken des Buches von Knapp „siegreich durchsetzen“ werden, schrieb Max Weber dem Autor bereits nach der Lektüre der Erstauflage. Vgl. Brief Max Webers an Georg Friedrich Knapp vom 22. Juli 1906, MWG II/5, S. 117.
23
durch Rücksicht auf den Valutakurs der eignen in fremder, vor allem: englischer, [416]Währung, bestimmt war.„Exodromisch bedeutet, daß es sich um die Bewegung des Kurses zwischen dem Inlande und dem Auslande handelt.“ (Knapp, Staatliche Theorie, S. 231). Unten, S. 418, definiert Max Weber: am intervalutarischen Kurs orientiert.
24
Wegen des „Münzparis“ mit dem größten Handelsgebiet und dem universellsten Zahlungsvermittler im Weltverkehr, dem Goldwährungslande England[,] demonetisierte zuerst Deutschland das Silber, verwandelten dann Frankreich, die Schweiz und die anderen Länder des „Münzbundes“, ebenso Holland, schließlich Indien, ihr bis dahin als freies Verkehrsgeld behandeltes Silber in Sperrgeld und trafen weiterhin indirekt chrysodromische Einrichtungen für Außenzahlungen, taten Österreich und Rußland das gleiche, trafen die „lytrischen“ Verwaltungen dieser Geldgebiete mit „autogenischem“ (nicht einlöslichem[416]Vgl. Knapp, Staatliche Theorie, S. 266: „Nicht die Goldwährung als solche breitete sich seit 1871 aus, sondern die englische Geldverfassung tat es – und sie war sozusagen zufällig Goldwährung.“
b
, also selbst als Währung fungierendem[416]A: einlöslichen
c
Papiergeld ebenfalls indirekt chrysodromische Maßregeln, um wenigstens ins Ausland tunlichst jederzeit in Gold zahlen zu können.A: fungierenden
25
Auf den (tunlichst) festen intervalutarischen Kurs allein also kam es ihnen in der Tat an. Deshalb meint Knapp: nur diese Bedeutung habe die Frage des Währungsstoffs und der Hylodromie überhaupt. Diesem „exodromischen“ Zweck aber genügten, schließt er, jene anderen indirekt chrysodromischen Maßregeln (der Papierwährungsverwaltungen) ebenso wie die direkt hylodromischen Maßregeln (siehe Österreich und Rußland!). Das ist zwar – ceteris paribus – für die Hylodromien keineswegs unbedingt wörtlich richtig. Denn solange keine gegenseitigen Münzausfuhrverbote zwischen zwei gleichsinnig hylodromischen (entweder beide chryso- oder beide argyrodromischen) Währungsgebieten bestehen, erleichtert dieser Tatbestand der gleichsinnigen Hylodromie die Kursbefestigung doch unzweifelhaft ganz erheblich. Aber soweit es wahr ist – und es ist unter normalen Verhältnissen in der Tat weitgehend wahr –, beweist es doch noch nicht: daß bei der Wahl derMax Weber faßt den Inhalt von Knapps Ausführungen zu den Änderungen der Währungsordnungen der genannten Länder in Hinblick auf den Anschluß an das Goldwährungsland England zusammen. Vgl. Knapp, Staatliche Theorie, S. 203–287, sowie die Detailschilderungen zu Frankreich (S. 305 ff.), Deutschland (S. 324 ff.) und Österreich (S. 353 ff.). Die Maßnahmen sind zum Teil von Weber oben in den §§ 32 ff., S. 382 ff., angesprochen worden. Zum Münzbund vgl. oben, S. 396 mit Hg.-Anm. 52.
d
„Hyle“ (Stoff)A: des
26
des Geldes, heute also vor allem der Wahl einerseits zwischen metallischem (heute vor allem: goldenem oder silbernem Geld) und andererseits notalem Gelde (die Spezialitäten des Bimetallismus und des Sperrgeldes, die [417]früher besprochen sind,Zu Knapps Begriff „Hylodromie“ vgl. oben, S. 394, Hg.-Anm. 46, sowie den Glossar-Eintrag, unten, S. 744. Max Weber verwendet den Begriff „Hyle“ hier anders, bezogen auf jeglichen Geldstoff, also auch Papier. Doch räumt er sogleich ein, daß Papier nicht hylodromisch sein könne.
27
lassen wir jetzt füglich einmal beiseite)[,] nur jener Gesichtspunkt in Betracht kommen könne. Das hieße: daß Papierwährung im übrigen der metallischen Währung gleichartig fungiere. Schon formell ist der Unterschied bedeutend: Papiergeld ist stets das, was Metallgeld nur sein kann, nicht: sein muß, „Verwaltungsgeld“; Papiergeld kann (sinnvollerweise!) nicht hylodromisch sein. Der Unterschied zwischen „entwerteten“ Assignaten und künftig vielleicht, bei universeller Démonétisation, einmal ganz zum industriellen Rohstoff „entwerteten“ Silber ist nicht gleich Null (wie übrigens auch Knapp gelegentlich zugibt).[417]Siehe oben, S. 396–400.
28
Papier war und ist gerade jetzt (1920) so gewiß wenig wie ein Edelmetall ein „beliebig“ jederzeit vorrätiges Gut.Ein entsprechendes Zitat konnte nicht nachgewiesen werden. In ähnlichem Zusammenhang sagt Weber unten, S. 423: „Daß gar kein Unterschied zwischen der ‚Entwertung' des Silbers und der ‚Entwertung' von Assignaten stattfinde, wird gerade Knapp nicht behaupten.“
29
Aber der Unterschied 1. der objektiven Beschaffungsmöglichkeit und 2. der Kosten der Beschaffung im Verhältnis zum in Betracht kommenden Bedarf ist dennoch so kolossal, die [A 110]Metalle sind an die gegebenen Bergvorkommnisse immerhin relativ so stark gebunden, daß er den Satz gestattet: Eine „lytrische“ Verwaltung konnte (vor dem Kriege!) papierenes Verwaltungsgeld (verglichen sogar mit kupfernem – China –, vollends: mit silbernem, erst recht: mit goldenem) unter allen normalen Verhältnissen wirklich jederzeit, wenn sie den Entschluß faßte, in (relativ) „beliebig“ großen Stück-Quantitäten herstellen. Und mit (relativ) winzigen „Kosten“. Vor allem: in rein nach Ermessen bestimmter nominaler Stückelung, also: in beliebigen, mit dem Papierquantum außer Zusammenhang stehenden Nominalbeträgen. Das letztere war offenbar bei metallischem Gelde überhaupt nur in Scheidegeldform, also nicht entfernt in gleichem Maß und Sinn der Fall. Bei Währungsmetall nicht. Für dieses war die Quantität der Währungsmetalle eine elastische, aber doch schlechthin „unendlich“ viel festere Größe als die der Papierherstellungsmöglichkeit. Also schuf sie Schranken. Gewiß: wenn sich die lytrische Verwaltung ausschließlich exodromisch, am Ziel des (möglichst) festen Kurses orientierte, dann hatte sie gerade bei der Schaffung notalen Geldes wenn auch keine „technischen“, so doch normativ fest gegebene Schranken: das würde Knapp wohl einwenden.Die im Krieg einsetzende Verknappung von Papier beeinflußte auch den Druck der 1. Lieferung des GdS; vgl. den Editorischen Bericht, oben, S. 80.
30
Und darin hätte er formal [418]– aber eben nur formal – recht. Wie stand es mit „autogenischem“ Papiergeld? Auch da, würde Knapp sagen, die gleiche Lage (siehe Österreich und Rußland): „Nur“ die technisch-„mechanischen“ Schranken der Metallknappheit fehlten. War das bedeutungslos? Knapp ignoriert die Frage.So hat es Knapp vielfach behauptet, ohne für eine Papierwährung zu werben. „Wir schlagen es [uneinlösliches Papiergeld, Hg.] durchaus nicht vor, sondern behaupten nur, daß man sich’s denken kann – und daß alsdann der intervalutarische Kurs fest wäre, so lange man diese Einrichtung beibehielte.“ (Knapp, Staatliche Theorie, S. 280). „Aber kehren wir auf den festen Boden der Wirklichkeit zurück. Nicht alles, [418]was möglich oder denkbar ist, kann empfohlen werden. Die Theorie muß auch zeigen, was unter dem Möglichen das Zweckmäßige ist. Und dies wird leicht zu sagen sein. Es ist durchaus das Beste, beim hylogenischen Gelde zu bleiben, so lange es geht.“ Ebd., S. 282.
31
Er würde wohl sagen, daß „gegen den Tod“ (einer Währung) „kein Kraut gewachsen ist“. Nun aber gab und gibt es (denn wir wollen von der momentanen absoluten Papierherstellungsobstruktion hier einmal absehen) unstreitig sowohl 1. eigne Interessen der Leiter der politischen Verwaltung – die auch Knapp als Inhaber oder Auftraggeber der „lytrischen“ Verwaltung voraussetzt –, wie 2. auch private Interessen, welche beide keineswegs primär an der Erhaltung des „festen Kurses“ interessiert, oft sogar – pro tempore wenigstens – geradezu dagegen interessiert sind. Auch sie können – im eigenen Schoß der politisch-lytrischen Verwaltung oder durch einen starken Druck von Interessenten auf sie –Knapp spricht das Thema indirekt an. Der seiner Meinung nach einzig haltbare Grund an einer Metallwährung festzuhalten, sei, daß bei ihr der Glaube aller Beteiligten an die Einhaltung eines bestimmten Wechselkurses ein festerer ist. Und sei es aus den falschen, von den „Metallisten“ behaupteten Gründen. „Wenn es aber klar ist, daß wir die Geldsysteme aus exodromischen Gründen wählen, dann sind zwar alle Methoden zur Befestigung des intervalutarischen Kurses zulässig, aber diejenige Methode verdient einen Vorzug, welche am leichtesten von allen Seiten gebilligt wird – und politisch ist es gleichgültig, ob dabei auch Vorurteile mitspielen.“ Knapp, Staatliche Theorie, S. 283.
e
wirksam auf den Plan treten und „Inflationen“ – das würde für Knapp (der den Ausdruck streng vermeidet)[418]A: sie,
32
nur heißen dürfen: anders als „exodromisch“ (am intervalutarischen Kurs) orientierteKnapp war kein Sonderfall. Auch Helfferich, Das Geld2, Mises, Theorie des Geldes und Wieser, Theorie, sprechen nicht von „Inflation“, allenfalls – in polemischer Absicht – von „Inflationismus“. Mises äußert noch 1925 erhebliche Bedenken gegen den Begriff (vgl. Mises, Ludwig von, Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel, 2. neubearb. Aufl. – München und Leipzig: Duncker & Humblot 1924, S. 224 f.). Zur Verwendung des Begriffs „Inflation“ vor dem Weltkrieg vgl. oben, S. 410, Hg.-Anm. 8.
f
und darnach „zulässige“ notale Emissionen –A: orientierten
g
vornehmen. Gedankenstrich fehlt in A; sinngemäß ergänzt.
Zunächst finanzielle Versuchungen: eine durchschnittliche „Entwertung“ der deutschen Mark durch Inflation auf im 1/20 Verhältnis zu den wichtigsten naturalen Inlandsvermögensstücken würde, wenn erst einmal die „Anpassung“ der Gewinne und Löhne an diese Preisbedingungen hergestellt, also alle Inlandskonsumgüter und alle Arbeit 20 mal so hoch bewertet würden (nehmen wir hier an!), für alle diejenigen, die in dieser [419]glücklichen Lage wären, ja eine Abbürdung der Kriegsschulden
33
in Höhe von 19/20[419]Gemeint sind die in allen kriegführenden Staaten aufgenommenen Schulden zur Finanzierung der Ausgaben – noch ohne die Reparationsschulden der Kriegsverlierer. Die deutsche Reichsregierung schätzte im März 1919, daß die Reichsschuld von Ende 1913 bis Ende 1918 von 5 Mrd. Mark auf ca. 150 Mrd. Mark gestiegen sei. Vgl. Denkschrift des Reichsministers der Finanzen Schiffer über „Die Finanzen des deutschen Reiches in den Rechnungsjahren von 1914 bis 1918.“ Vom 12. März 1919. Drucksachen der Verfassunggebenden Nationalversammlung Nr. 158; abgedruckt in: Finanz-Archiv, Jg. 36, Heft 2, 1919, S. 233–257, bes. S. 248.
h
sein. Der Staat aber, der nun von den gestiegenen (Nominal-)Einkommen entsprechend gestiegene (Nominal-)Steuern erhöbe, würde wenigstens eine recht starke Rückwirkung davon spüren. Wäre dies nicht verlockend? Daß „jemand“ die „Kosten“ zahlen würde[,] ist klar. Aber nicht: der Staat oder jene beiden Kategorien.[419]A: 1/20
34
Und wie verlockend wäre es gar, eine alte Außenschuld den Ausländern in einem Zahlmittel, das man beliebig höchst billig fabriziert, zahlen zu können! Bedenken stehen – außer wegen möglicher politischer Interventionen – bei einer reinen Außenanleihe freilich wegen Gefährdung künftiger Kredite im Wege, – aber das Hemd ist ja doch recht oft dem Staat näher als der Rock. Und nun gibt es Interessenten unter den Unternehmern, denen eine Preissteigerung ihrer Verkaufsprodukte durch Inflation auf das Zwanzigfache nur recht wäre, falls dabei – was sehr leicht möglich ist – die Arbeiter, aus Machtlosigkeit oder weil sie die Lage nicht übersehen oder warum immer, „nur“ 5- oder „nur“ 10 „mal so hohe“ (Nominal-)Löhne erhalten. Derartige rein finanzmäßig bedingte akute „Inflationen“ pflegen von den Wirtschaftspolitikern stark perhorresziert zu werden. In der Tat: mit exodromischer Politik Knappscher Art sind sie nicht vereinbar. Während im Gegensatz dazu eine planmäßige ganz allmähliche Vermehrung der Umlaufsmittel, wie sie unter Umständen die Kreditbanken durch Erleichterung des Kredits vornehmen, gern angesehen wird als im Interesse vermehrter „Anregung“ des spekulativen Geistes – der erhofften Profitchancen, heißt das –: damit der Unternehmungslust und also der kapitalistischen Güterbeschaffung durch Anreiz zur „Dividenden-Kapitalanlage“ statt der „Rentenanlage“ von freien Geldmitteln.Auf welche „beiden Kategorien“ sich Max Weber bezieht, ist nicht mit Sicherheit zu erschließen. Vermutlich meint er die zuvor erwähnten Gewinne aus dem Verkauf von Inlandskonsumgütern und die Löhne – unter der oben erwähnten Bedingung, daß die Anpassung an die Preiserhöhungen gelingt. Daß damit in der Realität kaum zu rechnen war, wird im Folgenden ausgeführt.
35
Wie steht es aber bei ihr mit der [420]exodromischen Orientiertheit? Ihre eigene Wirkung aber: jene „Anregung der Unternehmungslust“ mit ihren Folgen vermag die sogenannte „Zahlungsbilanz“ („pantopolisch“)In ähnlichem Sinne vgl. Eulenburg, Inflation (wie oben, S. 410, Hg.-Anm.8), S. 511 ff. Der Engländer Thomas Attwood (1783–1856) gilt als der erste, der sich für eine flexibel gesteuerte Papiergeldemission zum Zwecke der Belebung der Wirtschaftsaktivität eingesetzt hat. Seine Ideen galten bis in die Zeit nach dem Ersten [420]Weltkrieg, als die Diskussion neuerlich aufgenommen wurde, als abwegig. Vgl. Mises, Theorie des Geldes, S. 265 ff.
i
im Sinn der Steigerung oder doch der Hinderung der Senkung des Kurses der eigenen Währung zu beeinflussen. Wie oft? wie stark? ist eine andere Frage. Ob eine finanzmäßig bedingte, nicht akute Steigerung des Währungsgeldes [A 111]ähnlich wirken kann, sei hier nicht erörtert. Die „Lasten“ dieser exodromisch unschädlichen Anreicherungen des Währungsgeldvorrats zahlt in langsamem Tempo die gleiche Schicht, welche im Fall der akuten Finanzinflation material „konfiskatorisch“ betroffen wird: alle diejenigen, die ein nominal gleichgebliebenes Einkommen oder ein Nominal-Wertpapiervermögen haben (vor allem: der feste Rentner[,] dann: der „fest“ – d. h. nur durch langes Lamentieren erhöhbar –[420]A: („pentopolisch“)
k
besoldete Beamte, aber auch: der „fest“ – d. h. nur durch schweren Kampf beweglich – entlohnte Arbeiter). – Man wird also Knapp jedenfalls nicht dahin verstehen dürfen: daß für die Papierwährungspolitik immer nur der exodromische Gesichtspunkt: „fester Kurs“ maßgebend sein könne (das behauptet er nicht) und nicht für wahrscheinlich halten, daß – wie er glaubt – eine große Chance sei, daß nur er es sein werde.Gedankenstrich fehlt in A; sinngemäß ergänzt.
36
Daß erEine Bemerkung, aus der zu entnehmen ist, daß Knapp an eine „große Chance“ für die alleinige Orientierung am Wechselkurs glaube, findet sich nicht im Werk Knapps. Dieser betont den theoretischen Charakter seiner Vorstellungen in folgendem Sinn: „[…] es soll ja gar nicht zu einer solchen Neuerung [Einführung der allgemeinen Papiergeldwährung, Hg.] geschritten werden. Es soll nur zu künftiger Erinnerung hier stehen, daß Geldverfassungen möglich sind, die sogar feste Kurse zwischen verschiedenen Ländern gewähren, ohne daß hylogenische Einrichtungen beibehalten werden. Man muß es dem Theoretiker gestatten, diese letzte Folgerung zu ziehen, damit man die Tragweite der Theorie danach ermißt.“ Knapp, Staatliche Theorie, S. 282. Vgl. auch oben, S. 417, Hg.-Anm. 30.
l
es bei einer völlig in seinem Sinn rational, d. h. aber (ohne daß er dies ausspricht): im Sinn der möglichsten Ausschaltung von „Störungen“ der Preisrelationen durch Geldschaffungsvorgänge, orientierten lytrischen Politik sein würde, ist nicht zu leugnen. Keineswegs aber wäre zuzugestehen – Knapp sagt auch das nicht –, daß die praktische Wichtigkeit der Art der Währungspolitik sich auf den „festen Kurs“ beschränke. Wir haben hier von „Inflation“ als einer Quelle von Preisrevolutionen oder Preisevolutionen geredet, auch davon: daß sie durch das Streben nach solchen bedingt sein kann. Preisrevolutionäre (notale) Inflationen pflegen natürlich auch den festen [421]Kurs zu erschüttern (preisevolutionäre Geldvermehrungen, sahen wir,Fehlt in A; er sinngemäß ergänzt.
37
nicht notwendig). Knapp wird das zugeben. Er nimmt offenbar, und mit Recht, an, daß in seiner Theorie kein Platz für eine valutarisch bestimmte Warenpreispolitik sei (revolutionäre[,] evolutionäre oder konservative). Warum nicht? Vermutlich aus folgendem formalen Grund: Das Valutapreisverhältnis zwischen zwei oder mehreren Ländern äußert sich täglich in einer sehr kleinen Zahl (formal) eindeutiger und einheitlicher Börsenpreise, an denen man eine „lytrische Politik“ rational orientieren kann. Es läßt sich ferner auch für eine „lytrische“, insbesondere eine Umlaufsmittelverwaltung schätzen, – aber nur (an der Hand vorhandener, durch periodischen Begehr darnach sich äußernder, Tatbestände) schätzen: – welche Schwankungen eines gegebenen Zahlungsmittelvorrats (zu reinen Zahlungszwecken), für eine bestimmte verkehrswirtschaftlich verbundene Menschengruppe in absehbarer Zukunft, bei annähernd gleichbleibenden Verhältnissen, „erforderlich“ sein werden. Hingegen welches Maß von preisrevolutionären oder preisevolutionären oder (umgekehrt) preiskonservativen Wirkungen eine Inflation oder (umgekehrt) eine Einziehung von Geld in einer gegebenen Zukunft haben werde, läßt sich nicht im gleichen Sinn berechnen. Dazu müßte man bei Erwägung einer Inflation (die wir hier allein in Betracht ziehen wollen) kennen[421]Vermutlich bezieht sich Max Weber auf das oben, S. 419, Zeile 20 f., zu einer „planmäßige[n] ganz allmähliche[n] Vermehrung der Umlaufsmittel“ Gesagte.
m
: 1. die gegenwärtige Einkommensverteilung. – Daran anschließend 2. die gegenwärtig darauf aufgebauten Erwägungen der einzelnen Wirtschaftenden,– 3. die „Wege“ der Inflation, d. h.: den primären und weiteren Verbleib der Neuemissionen. Dies wiederum hieße aber: die Reihenfolge und das Maß der Erhöhung von Nominaleinkommen durch die Inflation. Dann 4. die Art der Verwendung (Verzehr, Vermögensanlage, Kapitalanlage) der dadurch wiederum verursachten Güternachfrage nach Maß und vor allem: Art (Genußgüter oder Beschaffungsmittel in all ihren Arten). Endlich 5. die Richtung, in welcher dadurch die Preisverschiebung und durch diese wiederum die Einkommensverschiebung fortschreitet, – und die zahllosen nun weiter anschließenden Erscheinungen von „Kaufkraft“-Verschiebung, auch das Maß der (möglichen) „Anregung“ der naturalen Gütermehrbeschaffung. Alles das wären Dinge, die ganz und gar durch künftige Erwägungen einzelner Wirtschaftender[421]A: kommen
n
gegenüber der neu geschaffenen Lage bestimmt wären und ihrerseits wieder auf Preisschätzungen von anderen solchen Einzelnen zurückwirken würden: diese erst würden dann im Interessenkampf die künftigen „Preise“ ergeben. Hier kann in der Tat von „Berechnung“: (etwa: 1 Milliarde Mehr-Emission voraussichtlich gleich Eisenpreis [422]von + x, Getreidepreis von + y usw.) gar keine Rede sein. Um so weniger, als zwar temporär für reine Binnenprodukte wirksame Preisregulierungen möglich sind, aber nur als Höchst-, nicht als Mindestpreise und mit bestimmt begrenzter Wirkung. – Mit der (empirisch unmöglichen) Berechnung der „Preise“ an sich wäre überdies noch nichts gewonnen. Denn sie würde allenfalls die als reines Zahlmittel erforderte Geldmenge bestimmen. Aber daneben und weit darüber hinaus würde Geld als Mittel der Kapitalgüterbeschaffung, in Kreditformen, neu und anderweit beansprucht werden. Hier würde es sich aber um mögliche Folgen der beabsichtigten Inflation handeln, die sich jeglicher näheren „Berechnung“ überhaupt entzögen. Es ist also, alles in allem (denn nur dies sollten diese höchst groben Ausführungen illustrieren) verständlich, daß Knapp für moderne Verkehrswirtschaften die Möglichkeit einer planvollen, rationalen, auf einer der „Devisenpolitik“ an Rechenhaftigkeit irgendwie [A 112]ähnlichen Grundlage ruhenden Preispolitik durch Inflation ganz außer Betracht ließ. Aber sie ist historische Realität. Inflation und Kontra-Inflation sind – in recht plumper Form freilich – in China unter wesentlich primitiveren Verhältnissen der Geldwirtschaft wiederholt, aber mit erheblichen Mißerfolgen, in der Kupferwährung versucht worden.A: Wirtschaftenden
38
Und sie ist in Amerika empfohlen worden.[422]Auf die z. T. heftigen, auch mit fiskalischen Interessen verbundenen Veränderungen der Geldmenge (Kupfer- und Papiergeld) geht Max Weber ein in Weber, Konfuzianismus, MWG I/19, S. 138–142. Zu seinen Quellen vgl. die dortigen Hg.-Anmerkungen.
39
Knapp begnügt sich aber in seinem offenbar nur mit, in seinem Sinn, „beweisbaren“ Annahmen operierenden Buch mit dem Rat: der Staat solle „vorsichtig“ bei der Emission autogenen Papiergelds sein.In den USA ist nach dem Bürgerkrieg die Forderung der „Inflationisten“, sei es durch Schaffung zusätzlichen Papiergeldes, sei es durch Erweiterung der Silberausprägung, die Geldmenge zu erhöhen, Gegenstand heftiger parteipolitischer Auseinandersetzungen gewesen. Vgl. oben, S. 413, Hg.-Anm. 18, und das Folgende.
40
Und da er sich ganz und gar am „festen Kurs“ orientiert, scheint dies auch leidlich eindeutig: Inflationsentwertung und intervalutarische Entwertung hängen meist sehr eng zusammen. Nur sind sie nicht identisch und ist vor allem nicht etwa jede Inflationsentwertung primär intervalutarisch bedingt. Daß tatsächlich preispolitisch orientierte inflationistische lytrische Verwaltung gefordert worden ist, und zwar nicht nur von den Silberbergwerksbesitzern bei der Silberkampagne, von den Farmern für Greenbacks,Ein wörtliches Zitat kann in Knapp, Staatliche Theorie, nicht nachgewiesen werden.
41
gibt Knapp [423]nicht ausdrücklich zu, bestreitet es aber auch nicht.In den USA haben sich seit 1875 bis in die neunziger Jahre insbesondere auch – aber nicht nur – die Eigentümer von Silberbergwerken, die unter dem starken Fall des Weltmarktpreises für Silber litten, für die Wiedereinführung von Silber als gesetzliches Zahlungsmittel und die Ausdehnung seines Umlaufs eingesetzt. Nahezu gleichzeitig kämpfte eine Farmer-Lobby, die sich vorübergehend auch als „Greenback-Party“ or[423]ganisierte, für eine erhebliche Ausdehnung der Papiergeldemission. Damit sollte dem anhaltenden Druck auf die Agrarpreise begegnet werden. Vgl. oben, S. 413, Hg.- Anm. 18, und oben, S. 422, Hg.-Anm. 39. „Greenback“ war zunächst der Spottname des von den Nordstaaten im Bürgerkrieg 1861 erstmals ausgegebenen grünfarbigen Papiergeldes, er hat sich für die inzwischen von der Federal Reserve Bank emittierten Noten bis in die Gegenwart erhalten.
42
Sie ist – das beruhigte ihn wohl – jedenfalls nie dauernd geglückt. – Aber so einfach liegen die Dinge vielleicht doch nicht. Einerlei ob als Preismaßregel beabsichtigt, haben Inflationen (im obigen Sinn)Georg Friedrich Knapp geht in der „Staatlichen Theorie“ nicht auf Probleme der Geldordnung in den USA ein. Das von Max Weber Gemeinte kann sich nur auf die Hauptaussage, nicht auf das Beispiel beziehen.
43
jedenfalls oft tatsächlich stattgefunden, und Assignatenkatastrophen sind in Ostasien wie in Europa nicht unbekannt geblieben.Oben, S. 410 mit Hg.-Anm. 8.
44
Damit muß sich die materiale Geldtheorie doch befassen. Daß gar kein Unterschied zwischen der „Entwertung“ des Silbers und der „Entwertung“ von Assignaten stattfinde, wird gerade Knapp nicht behaupten. Schon formal nicht: entwertet ist das nicht in Münzform gebrachte, sondern umgekehrt das für industriale Zwecke angebotene, rohe, Silber, nicht notwendig die (gesperrte) chartale Silbermünze (oft im Gegenteil!). Entwertet wird dagegen nicht das für industriale Zwecke angebotene rohe „Papier“, sondern (natürlich) gerade die chartale Assignate. Endgültig, auf Null oder den „Sammler“- und „Museums“-Wert, allerdings (wie Knapp mit Recht sagen würde) erst: wenn sie von den Staatskassen repudiiert wird: also sei auch dies immerhin „staatlich“, durch regiminale Verfügung, bedingt. Das trifft zu. Aber auf winzige Prozente ihrer einstigen materialen Geltung (ihrer Preisrelation zu beliebigen Gütern) trotz nominaler „epizentrischer“ Weitergeltung oft schon lange vorher. Zu den Assignaten der französischen Revolution vgl. oben, S. 384, Hg.-Anm. 7. Von „assignatenartig[er]“ Entwertung des chinesischen Papiergeldes, gar „Assignatenbankerott“ spricht Weber, Konfuzianismus, MWG I/19, S. 143 f. Vgl. hierzu oben, S. 417 mit Hg.-Anm. 28.
Aber von diesen Katastrophen ganz abgesehen, gab es sonst der Inflationen und andererseits (in China) der „Währungsklemmen“ durch außermonetäre Verwertung des Währungsmetalls genug in der Geschichte.
45
Und da nehmen wir nicht nur davon Notiz: daß dann unter Umständen (gar nicht immer) eben gewisse Geldarten „akzessorisch“ werden, die es nicht waren, sich in den Staatskassen „stauen“ und „obstruktionale“ Währungsänderungen erzwingen. Sondern die materiale Geldlehre müßte natürlich auch die Frage nach der Art der Beeinflussung der Preise und [424]Einkommen und dadurch der Wirtschaft in solchen Fällen wenigstens stellen, zweifelhaft aus den früher erwähnten Gründen vielleicht –: wieweit sie theoretisch zu beantworten wäre.Zur außermonetären Verwendung des Währungsmetalls Kupfer in China vgl. oben, S. 390, Hg.-Anm. 30.
46
Und ebenso wollen wir, wenn infolge Sinkens des Gold- oder Silberpreises (im anderen Metall ausgedrückt) im formal bimetallistischen Frankreich material bald Gold allein, bald Silber allein effektiv valutarisches Geld, das andere Metall „akzessorisch“ wird, nicht nur darauf verweisen, daß jene Preisverschiebungen eben „pantopolisch“[424]Max Weber skizziert oben, S. 421 f., die Fragen, die im einzelnen konkret beantwortet werden müßten, wollte man das Maß der Wirkungen einer politisch gezielten Geldvermehrung im voraus berechnen. Daraus ergeben sich gleichsam von selbst die Gründe, weshalb er solche Berechnungen für empirisch unmöglich hielt.
o
bedingt seien.[424]A: „pentopolisch“
47
Ebenso nicht in sonstigen Fällen von Geldstoffänderungen. Sondern wir wollen auch fragen: Liegt in Fällen der Vermehrung eines Edelmetalls Beutegewinn (Cortez, Pizarro)Gemäß seiner Definition valutarischen Geldes entschieden bei Knapp streng genommen nicht die Marktverhältnisse (pantopolisch) über die Frage, welches Metall im bimetallistischen System Frankreichs valutarisch war, sondern die regiminalen Kassen, je nachdem, welches Geld sie annahmen bzw. aufdrängten. Vgl. Knapp, Staatliche Theorie, S. 106–109 und 307.
48
oder Anreicherung durch Handel (China im Anfang unserer Ära und seit 16. Jahrhundert)Der Eroberer Mexikos Fernando Cortez und der Entdecker und Eroberer Perus Francisco Pizarro erbeuteten in ihren Herrschaftsgebieten große Mengen Goldes und Silbers. Die Schätzungen über den Umfang des Gewonnenen gingen weit auseinander. Vgl. Lexis, Wilhelm, Gold und Goldwährung, in: HdStW3, Band 5, 1910, S. 34 f.; ders., Silber und Silberwährung, in: HdStW3, Band 7, 1911, S. 516 und 529.
49
oder Mehrproduktion vor? Wenn letzteres, hat sich die Produktion nur vermehrt oder auch (oder nur) verbilligt und warum? Welche Verschiebungen in der Art der nicht monetären Verwendung haben etwa mitgewirkt? Ist etwa ein für dies Wirtschaftsgebiet (z. B. das antik mittelländische)So auch Weber, Konfuzianismus, MWG I/19, S. 135 f.; zu den Quellen ebd.
50
definitiver Export in ein ganz fremdes (China, Indien) eingetreten (wie in den ersten Jahrhunderten nach Chr.)?In Anlehnung an die alte Bezeichnung „mare mediterraneum“ von Weber wiederholt gebrauchte Bezeichnung für die nördlichen Anrainerstaaten des Mittelmeers.
51
Oder liegen die Gründe nur (oder auch) auf Seiten einer „pantopolisch“Das römische Reich bezog in der Kaiserzeit insbesondere Luxusgüter aus China und Indien. Deren Wert überstieg den der Exporte in diese Länder. Zum Ausgleich erhielten diese Edelmetall in gemünzter und ungemünzter Form. Plinius d. Ä. (23–79) klagte, „daß jährlich 50 Millionen Sesterzen in bar nach Indien flößen.“ Lexis, Wilhelm, Handel, in: Handbuch der Politischen Ökonomie, hg. von Gustav v. Schönberg, 3. Aufl., Band 2. – Tübingen: Laupp 1891, S. 816.
p
bedingten Verschiebung der monetären Nachfrage (Art des Kleinverkehrsbedarfs)?A: „pentopolisch“
q
Mindestens diese und [425]andere verschiedene Möglichkeiten müssen in der Art, wie sie zu wirken pflegen, erörtert werden. A: Kleinverkehrsbedarfs?).
Schließlich noch ein Blick auf die verkehrswirtschaftliche Regulierung des „Bedarfs“ an „Geld“ und das, was dieser Begriff in ihr bedeutet. Das ist klar: Aktueller Zahlmittel-„Bedarf“ von Markt-Interessenten bestimmt die Schaffung „freien Verkehrsgelds“ („freie Prägung“). Und: aktueller Zahlmittel- und vor allem Kreditbedarf von Markt-Interessenten in Verbindung mit Beachtung der eigenen Solvenz und der zu diesem Zweck oktroyierten Normen sind es, welche die Umlaufsmittel-Politik der modernen Notenbanken bestimmen. Immer also herrscht heute primär Interessentenbetrieb, – dem allgemeinen Typus unserer Wirtschaftsordnung entsprechend. [A 113]Nur das kann also in unserer (formal legalen) Wirtschaftsordnung „Geldbedarf“ überhaupt heißen. Gegen „materiale“ Anforderungen verhält sich auch dieser Begriff – wie der der „Nachfrage“ (des „kaufkräftigen Bedarfs“) nach „Gütern“ – also ganz indifferent. In der Verkehrswirtschaft gibt es eine zwingende Schranke der Geldschaffung nur für Edelmetallgeld. Die Existenz dieser
r
Schranke aber bedingt eben, nach dem Gesagten, gerade die Bedeutung der Edelmetalle für das Geldwesen. Bei Beschränkung auf „hylisches“ Geld aus einem (praktisch) nicht „beliebig“ vermehrbaren Stoff, insbesondere aus Edelmetall, und daneben: auf gedeckte Umlaufsmittel ist jeder Geldschaffung eine – gewiß: elastische, evolutionäre Bankinflation[425]A: diese
52
nicht gänzlich ausschließende, aber: immerhin innerlich recht feste – Grenze gesetzt. Bei Geldschaffung aus einem im Vergleich dazu (praktisch) „beliebig“ vermehrbaren[425]Gemeint ist: „Banknoteninflation“.
s
Stoff, wie: Papier, gibt es eine solche mechanische Grenze nicht. Hier ist dann wirklich der „freie Entschluß“ einer politischen Verbandsleitung, das heißt aber: es sind dann, wie angedeutet, deren Auffassungen von den Finanz-Interessen des Herren, unter Umständen sogar (Gebrauch der Notenpresse durch die roten Horden!)A: vermehrbarem
53
ganz persönliche Interessen ihres Verwaltungsstabes die von jenen mechanischen Hemmungen gelösten Regulatoren der Geldquantität. In der Ausschaltung, richtiger: da der Staat ja von ihnen zur Aufgabe der Metall- und zum Übergang zur Papierwährung gedrängt werden kann – in einer gewissen Hemmung dieser Interessen also besteht heute noch die Bedeutung der Metallwährungen: der Chryso- und Argyrodromie, welche – trotz des höchst mechanischen Charakters dieses Sachverhalts – immer[426]hin ein höheres Maß formaler, weil nur an reinen Tauschchancen orientierter, Verkehrswirtschaftlicher Rationalität bedeuten. Denn die finanzmäßig bedingte lytrische Politik von Geldverwaltungen bei reiner Papierwährung ist zwar, wie oben zugegeben: – Österreich und Rußland haben es bewiesenBereits vor der Oktoberrevolution 1917 ist in Rußland kriegsbedingt ein Inflationsprozeß in Gang gekommen. Nach Wegfall nahezu aller Steuereinnahmen war die Papiergeldschöpfung im Bürgerkrieg Hauptfinanzierungsquelle für die Ausgaben der Sowjets. Vgl. Malle, Silvana, The Economie Organization of War Communism. 1918–1921. – Cambridge: University Press 1985, S. 153–201.
54
– nicht notwendig rein an persönlichen Interessen des Herrn oder Verwaltungsstabs oder an rein aktuellen Finanzinteressen und also an der möglichst kostenlosen Schaffung von soviel Zahlmitteln wie möglich, einerlei was aus der „Gattung“ als Tauschmittel wird, orientiert. Aber die Chance, daß diese Orientierung eintritt, ist unbestreitbar chronisch vorhanden, während sie bei Hylodromie („freiem Verkehrsgeld“) in diesem Sinn nicht besteht. Diese Chance ist das – vom Standpunkt der formalen Ordnung der Verkehrswirtschaft aus gesehen – (also ebenfalls formal) „Irrationale“ der nicht „hylodromischen“ Währungen, so sehr zuzugeben ist, daß sie selbst durch jene „mechanische“ Bindung[426]Zur Papierwährung in Österreich und Rußland in der Vorkriegszeit vgl. oben, S. 403, Hg.-Anm. 72 und 73.
t
nur eine relative formale Rationalität besitzen. Dies Zugeständnis könnte – und sollte – G[eorg] F[riedrich] Knapp machen.[426]A: Bindung,
55
Zu entsprechenden Erklärungen Knapps vgl. oben, S. 417 f., Hg.-Anm. 30 und 31.
Denn so unsäglich plump die alten „Quantitätstheorien“
u
waren,A: Quantitätstheorien“
56
so sicher ist die „Entwertungsgefahr“ bei jeder „Inflation“ mit rein finanzmäßig orientierten Notalgeldemissionen, wie ja doch niemand, auch Knapp nicht, leugnet. Sein „Trost“ dem gegenüber ist durchaus abzulehnen. Die „amphitropische“ Stellung „aller“ (!) einzelnen aber, die bedeutet: – jeder sei ja sowohl Gläubiger wie Schuldner,Unter dem Oberbegriff „Quantitätstheorie“ wird eine Vielzahl von im einzelnen unterschiedlichen Theorien hinsichtlich der Wirkung von Änderungen der Geldmenge verstanden. Max Weber bezieht sich vermutlich auf im 18. und frühen 19. Jahrhundert gelegentlich vertretene mechanistische Formen. Danach führt jede Vermehrung der Geldmenge zu einer proportionalen Erhöhung der Preise. Vgl. Altmann, Sally P., Quantitätstheorie, in: HdStW3, Band 6, 1910, S. 1257–1265.
57
– die Knapp allen Ernstes zum Nachweis der absoluten Indifferenz jeder „Entwertung“ vorführt,Vgl. Knapp, Staatliche Theorie, S. 40: „Jede Person aber hat im Verkehr eine amphitropische Stellung, das heißt, sie ist nach vielen Richtungen Schuldner und zugleich nach vielen Richtungen Gläubiger.“ Das von Knapp geprägte Kunstwort setzt sich aus den griechischen Wortelementen „amphi“ (beid(seitig), doppel(seitig)) und „trope“ (Wendung) zusammen und bedeutet „sich nach beiden Seiten wendend“.
58
ist, wir [427]alle erleben es jetzt: Phantom. Wo ist sie nicht nur beim Rentner, sondern auch beim Festbesoldeten, dessen Einnahmen nominal gleichbleiben (oder in ihrer Erhöhung auf vielleicht das Doppelte von der finanziellen Konstellation und: von der Laune der Verwaltungen abhängen), dessen Ausgaben aber nominal sich vielleicht (wie jetzt) verzwanzigfachen?Knapps „Staatliche Theorie“ vermeidet konsequent die Anerkennung eines Geldwertproblems, somit auch die Vorstellung einer „Entwertung“ des Geldes. Doch könnte Weber sich auf Knapps Behauptung beziehen, daß der Übergang von einer Währung zu einer anderen für den Einzelnen wegen seiner amphitropischen Stellung (vgl. Hg.-Anm. 57) immer unschädlich sei: „Ist die Änderung absteigend, so wird der [427]scheinbare Verlust beim Nehmen ausgeglichen durch den entsprechenden Gewinn beim Geben. Ist die Änderung aufsteigend, so wird der scheinbare Gewinn beim Nehmen wieder ausgeglichen durch den entsprechenden Verlust beim Geben.“ Knapp, Staatliche Theorie, S. 198.
59
Wo bei jedem langfristigen Gläubiger? Derartige starke Umgestaltungen der (materialen) Geltung des Geldes bedeuten heute: chronische Tendenz zur sozialen Revolution, mögen auch viele Unternehmer intervalutarische Gewinne zu machen in der Lage sein und manche (wenige!) Arbeiter die Macht haben, sich nominale Mehrlöhne zu sichern. Diesen sozialrevolutionären Effekt und damit die ungeheure Störung der Verkehrswirtschaft mag man je nach dem Standpunkt nun für sehr „erfreulich“ halten. Das ist „wissenschaftlich“ unwiderlegbar. Denn es kann (mit Recht oder Unrecht) jemand davon die Evolution aus der „Verkehrswirtschaft“ zum Sozialismus erwarten. Oder den Nachweis: daß nur die regulierte Wirtschaft mit Kleinbetrieben material rational sei, einerlei, wieviel „Opfer“ auf der Strecke bleiben. Aber die demgegenüber neutrale Wissenschaft hat jenen Effekt zunächst jedenfalls so nüchtern als möglich zu konstatieren, – und das verhüllt die in ihrer Allgemeinheit ganz falsche „Amphitropie“-Behauptung Knapps.Preisindices der Lebenshaltung sind seinerzeit auf sehr unsicherer Datenbasis erhoben worden. Für Februar/März 1920 errechnete das Statistische Reichsamt aus dem vorhandenen Material einen Anstieg der Preise für Nahrungsmittel, Heizung, Beleuchtung, Bekleidung und Wohnung in Deutschland gegenüber 1913/14 auf das Neun- bis Zehnfache. Darunter waren aber zahlreiche Güter mit staatlich regulierten Höchstpreisen. Ein Index der (freieren) Großhandelspreise wies für März 1920 einen Anstieg auf das 17-Fache aus. Vgl. Zahlen zur Geldentwertung (wie oben, S. 411, Hg.-Anm. 12), S. 16 f., 33.
60
Neben Einzel-Irrtümern scheint mir in dem vorstehend Gesagten die wesentlichste Unvollständigkeit seiner Theorie zu liegen, – diejenige, welche ihr auch Gelehrte zu „prinzipiellen“ Gegnern gemacht hat, welche dies durchaus nicht sein müßten.Zum Begriff vgl. oben, Hg.-Anm. 57.
61
Zur Kritik an Knapp vgl. oben, S. 405, Hg.-Anm. 79.
[A 114]§ 37. Abgesehen von der Geldverfassung liegt die Bedeutung der Tatsache, daß selbständige politische Verbände existieren, für die Wirtschaft, primär in folgenden Umständen:
[428]1. darin, daß sie für den Eigenbedarf an Nutzleistungen die eignen Angehörigen unter annähernd gleichen Umständen als Lieferanten zu bevorzugen pflegen. Die Bedeutung dieses Umstandes ist um so größer, je mehr die Wirtschaft dieser Verbände Monopolcharakter oder haushaltsmäßigen Bedarfsdeckungscharakter annimmt, steigt also derzeit dauernd;
62
– [428]Der von Max Weber angesprochene langfristige Anstieg ist erstmals 1863 von Adolph Wagner behauptet und später in unterschiedlichen begrifflichen Fassungen zum „Gesetz“ erhoben worden. Zum „Gesetz der wachsenden Ausdehnung der öffentlichen, besonders der Staatstätigkeiten“ vgl. Wagner, Adolph, Grundlagen der Volkswirtschaft (Lehr- und Handbuch der politischen Ökonomie), 1. Theil, 2. Halbband, 3. Aufl. – Leipzig: C. F. Winter’sche Buchhandlung 1893, S. 892–908, sowie ders., Staat (in nationalökonomischer Hinsicht), in: HdStW3, Band 7, 1911, S. 734–736.
2. in der Möglichkeit, den Austauschverkehr über die Grenzen hinweg nach materialen Gesichtspunkten planmäßig zu begünstigen oder zu hemmen oder zu regulieren („Handelspolitik“); –
3. in der Möglichkeit und den Unterschieden der formalen und materialen Wirtschaftsregulierung durch diese Verbände nach Maß und Art; –
4. in den Rückwirkungen der sehr starken Verschiedenheiten der Herrschaftsstruktur, der damit zusammenhängenden verwaltungsmäßigen und ständischen Gliederung der für die Art der Gebarung maßgebenden Schichten und der daraus folgenden Haltung zum Erwerbe; –
5. in der Tatsache der Konkurrenz der Leitungen dieser Verbände um eigne Macht und um Versorgung der von ihnen
v
beherrschten Verbandsangehörigen rein als solchen[428]A: ihr
w
mit Konsum- und Erwerbsmitteln, und den daraus für dieseA: solcher
x
folgenden Erwerbschancen, A: diesen
6. aus der Art der eignen Bedarfsdeckung dieser Verbände: siehe den folgenden Paragraphen.
§ 38. Am unmittelbarsten ist die Beziehung zwischen Wirtschaft und (primär) außerwirtschaftlich orientierten Verbänden bei der Art der Beschaffung der Nutzleistungen für das Verbands[429]handeln: das Handeln des Verwaltungsstabs als solchem und das von ihm geleitete Handeln (Kap. I § 12),
63
selbst („Finanzen“ im[429]Kap. I, § 12, oben, S. 204 f.
a
weitesten, auch die Naturalbeschaffung einbeziehenden Wortsinn). [429]A: in
Die „Finanzierung“, d. h. die Ausstattung mit bewirtschafteten Nutzleistungen, eines Verbandshandelns, kann – in einer Übersicht der einfachsten Typen – geordnet sein
I. unstet, und zwar:
a) auf Grundlage rein freiwilliger Leistungen, und dies
α. mäzenatisch: durch Großgeschenke und Stiftungen: für karitative, wissenschaftliche und andre nicht primär ökonomische oder politische Zwecke typisch;
b
A: typisch.
β. durch Bettel: für bestimmte Arten asketischer Gemeinschaften typisch;
c
A: typisch.
Doch finden sich in Indien auch profane Bettlerkasten, anderwärts besonders in China Bettlerverbände.
64
Indische Bettlerkasten erwähnt Max Weber, Hinduismus, MWG I/20, S. 187, und Bettlerverbände („Kung kun“) in China in Weber, Konfuzianismus, MWG I/19, S. 270 f., sowie Bettelsprengel, ebd., S. 489.
Der Bettel kann dabei weitgehend (sprengelhaft) und monopolistisch systematisiert werden und, infolge der Pflichtmäßigkeit oder Verdienstlichkeit für die Angebettelten, material aus dem unsteten in den Abgabencharakter übergehen.
γ. durch formal freiwillige Geschenke an politisch oder sozial als übergeordnet Geltende: Geschenke an Häuptlinge, Fürsten, Patrone, Leib- und Grundherren, die durch Konventionalität material dem Charakter von Abgaben nahestehen können, regelmäßig aber nicht zweckrational, sondern durch Gelegenheiten (bestimmte Ehrentage, Familienereignisse, politische Ereignisse) bestimmt sind.
Die Unstetheit kann ferner bestehen:
b) auf Grundlage erpreßter Leistungen.
[430]Typus: die Camorra in Süditalien, die Mafia in Sizilien
d
[430]A: Sizilien,
65
und ähnliche Verbände in Indien: die rituell besonderten sog. „Diebs-“[430]Camorra und Mafia waren, die einen in Neapel und Umgebung, die anderen im ländlichen Raum Siziliens, angesichts der anhaltenden Schwäche der staatlichen Organe im 18. und frühen 19. Jahrhundert zu erheblicher Wirksamkeit gelangte politische Geheimbünde mit anerkannten Ordnungsfunktionen. Zu Webers Zeit waren es sich vornehmlich aus den unteren Schichten rekrutierende, straff organisierte Verbände, die Einkünfte aus (Schutzgeld-)Erpressungen, Diebstahl und Schmuggel bezogen.
e
und „Räuberkasten“,A: „Diebs“-
66
in ChinaVgl. dazu Weber, Hinduismus, MWG I/20, S. 144, Fn. 61.
f
Sekten und Geheimverbände mit ähnlicher ökonomischer Versorgung.A: China,
67
Die Leistungen sind [A 115]nur primär, weil formal „unrechtlich“: unstet; praktisch nehmen sie oft den Charakter von „Abonnements“ an, gegen deren Entrichtung bestimmte Gegenleistungen, namentlich: Sicherheitsgarantie, geboten werden (Äußerung eines Neapolitaner Fabrikanten vor ca. 20 Jahren zu mir,Die Organisation der Bettler und Besitzlosen in China verglich Weber, Konfuzianismus, MWG I/19, S. 271, Fn. 26, bereits explizit mit Camorra und Mafia.
68
auf Bedenken wegen der Wirksamkeit der Camorra auf Betriebe: „Signore, la Camorra mi prende X lire nel mese, ma garantisce la sicurezza, – lo Stato me ne prende 10 x X e garantisce – niente“).Max und Marianne Weber haben im April/Mai 1901 von Rom aus eine Reise durch Süditalien unternommen und sich dabei auch in Neapel aufgehalten (vgl. Weber, Marianne, Lebensbild, S. 262 f.). Der Name des Fabrikanten konnte nicht ermittelt werden.
69
DieDeutsch: „Mein Herr, die Camorra nimmt von mir x Lire im Monat, aber garantiert die Sicherheit, – der Staat nimmt mir 10 mal x, und garantiert – nichts.“
g
namentlich in Afrika typischen Geheimklubs (Rudimente des einstigen „Männerhauses“)A: niente. (Die
70
fungieren ähnlich (Vehme-artig)Zu Geheimklubs in Westafrika, die Schutz der persönlichen Sicherheit und Ordnung gewährleisten, vgl. Weber, Politische Gemeinschaften, MWG I/22-1, S. 209 ff. Zum „Männerhaus“ vgl. oben, S. 361, Hg.-Anm. 33.
71
und garantieren so die Sicherheit. Vehme-(Fem-) oder Freigerichte waren im späten Mittelalter über das Reich verbreitete, in der Regel geheime Gerichte. Bei verweigerter Rechtshilfe durch die ordentliche Gerichtsbarkeit fällten und vollstreckten Vehmegerichte Urteile bei todeswürdigen Verbrechen. War ein Beschuldigter nicht greifbar, konnte er „verfemt“, d. h. geächtet, und bei späterer Ergreifung hingerichtet werden.
Politische Verbände können (wie der liparische
h
Räuberstaat)A: ligurische
72
primär (nie dauernd ausschließlich) auf reinem Beutegewinn ruhen. Zum „liparischen Räuberstaat“ bzw. zur „Räubergemeinschaft“ vgl. oben, S. 362, Hg.-Anm. 35. Die im Text überlieferte Verschreibung „der ligurische Räuberstaat“ wurde emendiert.
Die Finanzierung kann geordnet sein
II. stetig, und zwar:
[431]A. ohne wirtschaftlichen Eigenbetrieb:
a) durch Abgabe in Sachgütern:
α. rein geldwirtschaftlich: Erwerb der Mittel durch Geldabgaben und Versorgung durch Geldeinkauf der benötigten Nutzleistungen (reine Geldabgaben-Verbandswirtschaft). Alle Gehälter des Verwaltungsstabs sind Geldgehälter.
β. Rein naturalwirtschaftlich (s. § 12
i
:[431]A: 37
73
Umlagen mit Naturallieferungsspezifikation (reine Naturalleistungsverbandswirtschaft[431]Kap. II, § 12 (nicht: § 37, wie im überlieferten Text angegeben), oben, S. 237 ff.
j
). Möglichkeiten: A: Naturalleistungsverbandwirtschaft
αα) Die Ausstattung des Verwaltungsstabs erfolgt durch Naturalpräbenden,
74
und die Deckung des Bedarfs erfolgt in naturaIm strengen Sinne bezeichnet „Präbende“ das Recht geistlicher Würdenträger, aus dem Kirchenvermögen feste und regelmäßige Einnahmen zu erhalten, sei es in Form von Erträgen einer landwirtschaftlichen Nutzfläche, sei es aus Abgaben. Weber benutzt den Begriff hier und an anderen Stellen synonym zu „Pfründe“. Vgl. auch Kapitel III, § 8, unten, S. 481.
k
. Oder A: Natura
ββ) die in Naturalien erhobenen Abgaben werden ganz oder teilweise durch Verkauf zu Geld gemacht, und die Bedarfsdekkung erfolgt insoweit geldwirtschaftlich.
Die Abgaben selbst, sowohl in Geld wie in Naturalien, können in allen Fällen in ihren ökonomisch elementarsten Typen sein
α. Steuern, d. h. Abgaben von
αα) allem Besitz oder, geldwirtschaftlich, Vermögen,
ββ) allen Einkünften oder, geldwirtschaftlich, Einkommen,
75
Zu Max Webers Unterscheidung von Besitz und Vermögen bzw. Einkünften und Einkommen vgl. oben, S. 253 f.
γγ) nur vom Beschaffungsmittelbesitz oder von Erwerbsbetrieben bestimmter Art (sogenannte „Ertragsabgaben“).
76
– Oder sie können sein: Im Unterschied zu den unter αα und ββ genannten Abgaben, die in der zeitgenössischen Finanzwissenschaft unter dem Begriff „Subjektsteuern“ zusammengefaßt wurden, wird bei den auch „Objektsteuern“ genannten Ertragsabgaben der Ertrag eines der Einnahmeerzielung dienenden Objekts (z. B. landwirtschaftlicher und städtischer Boden, Gebäude, Gewerbebetrieb) zur Besteuerung herangezogen. Dabei spielen [432]die persönlichen Verhältnisse des Eigentümers keine Rolle. Vgl. Schanz, Georg, Ertragssteuern, in: HdStW3, Band 3, 1909, S. 1102–1106.
[432]β. Gebühren, d. h. Leistungen aus Anlaß der Benutzung oder Inanspruchnahme von Verbandseinrichtungen, Verbandsbesitz oder Verbandsleistungen. – Oder:
γ. Auflagen auf:
αα) Ge- und Verbrauchshandlungen spezifizierter Art,
ββ) Verkehrsakte spezifizierter Art. Vor allem:
1. Gütertransportbewegungen (Zölle),
2. Güterumsatzbewegungen (Akzisen und Umsatzabgaben).
Alle Abgaben können ferner:
1. in Eigenregie erhoben, oder
2. verpachtet oder
3. verliehen oder verpfändet werden.
Die Verpachtung (gegen Geldpauschale) kann fiskalisch rational, weil allein die Möglichkeit der Budgetierung bietend,
77
wirken. Steuerverpachtungen sind vor allem in Staaten der Antike und in Frankreich im 17. und 18. Jahrhundert verbreitet gewesen. Im Vergleich zu den aus vielen Gründen unsicheren Nettoeinnahmen aus Besteuerung stellte die vereinbarte Pachtsumme eine kalkulierbare Geldquelle des Verbandshaushalts dar. Zu Vorkommen und Bedeutung vgl. Webers Erläuterungen unten, S. 437 und S. 439; sowie Weber, Bürokratismus, MWG I/22-4, S. 172 f.; Weber, Feudalismus, MWG I/22-4, S. 392 f. und die dort vom Herausgeber zitierte Literatur.
Verleihung und Verpfändung sind fiskalisch meist irrational bedingt, und zwar durch
α. finanzielle Notlage, oder
β. Usurpationen des Verwaltungsstabes: Folge des Fehlens eines verläßlichen Verwaltungsstabes.
Dauernde Appropriation von Abgabenchancen durch Staatsgläubiger, private Garanten der Militär- und Steuerleistung, unbezahlte Kondottiere und Soldaten, „endlich“ Amtsanwärter soll „Verpfründung“
78
heißen. Sie kann die Form annehmen Zum Institut der Pfründe und zur Verpfründung vgl. u. a. Kap. III, § 8, unten, S. 483 ff.; § 12c, unten, S. 520–525, sowie Weber, Patrimonialismus, MWG I/22-4, S. 296–312.
1. der individuellen Appropriation, oder
[433][A 116]2. der kollektiven Appropriation (mit freier Neubesetzung aus dem Kreise der kollektiv Appropriierenden
l
). [433]A: Appropriierten
Die Finanzierung ohne wirtschaftlichen Eigenbetrieb (II A)
79
kann ferner erfolgen: [433]Max Weber verweist auf den Beginn des Abschnitts, oben, S. 431.
b) durch Auflage persönlicher Leistungen: unmittelbare persönliche Naturaldienste mit Naturalleistungsspezifikation. – Die stetige Finanzierung kann des weiteren, im Gegensatz zu den Fällen II A:
II.B. durch
m
wirtschaftlichen Eigenbetrieb: A: Durch
α. haushaltsmäßig (Oikos, Domänen),
β. erwerbswirtschaftlich
αα) frei, also in Konkurrenz mit andren Erwerbswirtschaften und
ββ) monopolistisch erfolgen.
Wiederum kann die Nutzung im Eigenbetrieb oder durch Verpachtung, Verleihung und Verpfändung erfolgen. – Sie kann endlich, anders als in den Fällen sowohl II A wie II B, erfolgen:
II.C. leiturgisch durch privilegierende Belastung:
80
Die leiturgische Belastung von Personen ergibt sich aus der leiturgischen Bedarfsdeckung eines Verbandshaushalts, die Weber oben, S. 312, definiert.
α. positiv privilegierend: durch Lastenfreiheit spezifizierter Menschengruppen von bestimmten Leistungen, oder (damit eventuell identisch):
β. negativ privilegierend: durch Vorbelastung spezifizierter Menschengruppen – insbesondre bestimmter
αα) Stände, oder
ββ) Vermögensklassen – mit bestimmten Leistungen, – oder:
γ. korrelativ: durch Verknüpfung spezifizierter Monopole mit der Vorbelastung durch spezifizierte Leistungen oder Lieferungen. Dies kann geschehen:
αα) ständisch: durch Zwangsgliederung der Verbandsgenossen in (oft) erblich geschlossenen leiturgischen Besitz- und Berufsverbänden mit Verleihung ständischer Privilegien,
[434]ββ) kapitalistisch: durch Schaffung geschlossener Gilden oder Kartelle mit Monopolrechten und mit Vorbelastung durch Geldkontributionen.
Zu II:
1
Das Folgende bezieht sich auf § 38, Abschnitt II, beginnend oben, S. 430.
Die (ganz rohe) Kasuistik gilt für Verbände aller Art. Hier wird nur an den politischen Verbänden exemplifiziert.
Zu A, a, α: Die moderne staatliche Steuerordnung auch nur in Umrissen zu analysieren, liegt an dieser Stelle natürlich ganz fern. Es wird vielmehr erst weiterhin der „soziologische Ort“, d. h. jener Typus von Herrschaftsverhältnis, der bestimmten Abgabenarten (z. B. den Gebühren, Akzisen, Steuern) typisch zur Entstehung verhalf, zu erörtern sein.
2
Systematische Ausführungen Max Webers hierzu liegen nicht vor und waren womöglich der nicht überlieferten „Staatssoziologie“ vorbehalten. Vgl. dazu auch die Einleitung, oben, S. 69. Gelegentliche Hinweise finden sich in Kap. III, unten, S. 449 ff.
Die Naturalabgabe, auch bei Gebühren, Zöllen, Akzisen, Umsatzabgaben ist noch im ganzen Mittelalter häufig gewesen, ihr geldwirtschaftlicher Ersatz relativ modern.
Zu a, β. Naturallieferungen: Typisch in Form von Tributen und Umlagen von Erzeugnissen auf abhängige Wirtschaften. Die Naturalversendung ist nur bei kleinen Verbänden oder sehr günstigen Verkehrsbedingungen möglich (Nil, Kaiserkanal).
3
Sonst müssen die Abgaben in Geld verwandelt werden, um an den letzten Empfänger zu gelangen (so vielfach in der Antike), oder sie müssen je nach der Entfernung in Objekten verschiedenen spezifischen Preises umgelegt werden (so angeblich im alten China).Der „Kaiserkanal“, auch: „Großer Kanal“, war ein System von Wasserwegen, das der Nord-Süd-Verbindung im chinesischen Reich diente. Begonnen im 5. Jahrhundert v. Chr., wurde die Verbindung vom Huang ho (Gelben Fluß) bis nach Peking 1292 fertiggestellt. Max Weber erwähnt den Kanal im Zusammenhang mit der Versendung von (naturalen) Tributleistungen mehrfach; vgl. Weber, Konfuzianismus, MWG I/19, u. a. S. 153, 211, 224.
4
Vgl. hierzu Weber, Konfuzianismus, MWG I/19, S. 214.
Zu A, b. Beispiele: Heeresdienst-, Gerichtsdienst-, Geschworenen-, Wege- und Brückenbau-, Deich-, Bergarbeits-Pflicht und alle Arten von Robott für Verbandspflichten bei Verbänden aller Art. Typus der Fronstaaten: Altägypten (neues Reich), zeitweise China, in geringerem Maß Indien und in noch geringerem das spätrömische Reich und zahlreiche Verbände des frühen Mittelalters. –
[435]Typus der Verpfründung:
5
1. an die Amtsanwärterschaft kollektiv: China,[435] Die Verpfründung hat Max Weber in der Systematik A, a) zugeordnet, vgl. oben, S. 431.
6
– 2. an private Garanten der Militär- und Steuerleistungen: Indien, Vgl. hierzu Weber, Konfuzianismus, MWG I/19, u. a. S. 224.
7
– 3. an unbezahlte Kondottiere und Soldaten: das späte Khalifat und die Mamelukenherrschaft, Vgl. hierzu Weber, Hinduismus, MWG I/20, S. 137 f.
8
– 4. an Staatsgläubiger: der überall verbreitete Ämterkauf. Zur Rolle und zu den Einnahmequellen der Kaufsklavenarmeen, insbesondere den (ursprünglich türkischen) Mameluken im abassidischen Kalifat (750–1258) und in der anschließenden Mamelukenherrschaft vgl. Weber, Patrimonialismus, MWG I/22-4, S. 265 ff., mit den Hg.-Anm. 41 und 42 zu dem Gemeinten und zu Webers Quellen. Die hier als „Kondottiere“ Bezeichneten nennt Weber (ebd., S. 266) „Offiziere“ oder (S. 341) „Sklavengenerale“.
9
Mit „Ämterkauf“ wird in der Wissenschaftssprache nicht nur ein „Kauf“ im strengen Sinne des Wortes bezeichnet. Bis in der Neuzeit tatsächlich Kauf die vorherrschende Form des Erwerbs solcher Ämter war, lagen ihm häufig Pacht oder Pfandbesitz von Gläubigern an den Einkünften aus Ämtern zugrunde. Entsprechend hat Max Weber an anderer Stelle „Ämterkauf“ weit definiert als „die Auslese der Beamten nach dem Geldbesitz“; vgl. Weber, Konfuzianismus, MWG I/19, S. 184.
Zu B, α. Beispiele: Domänenbewirtschaftung für den Haushalt in eigner Regie, Benutzung der Robottpflicht der Untertanen zur Schaffung von Bedarfsdeckungs[A 117]betrieben (Ägypten)
10
für Hofhalts- und politische Zwecke, modern etwa: Korps-Bekleidungsämter Zu Oiken bzw. Domänen, die in Ägypten für den Hofhalts- und Staatsbedarf produzieren, vgl. Weber, Agrarverhältnisse, MWG I/6, S. 152 ff. (1. und 2. Fass.), 415 f., 419, 423 f. (3. Fass.). Dort auch Nachweise zu Webers Quellen.
11
und staatliche Munitionsfabriken. Seit 1890 im Deutschen Reich Dienststellen eines Armeekorps zur Beschaffung von Tuch, Leder und Wäsche sowie zur Verwaltung der Vorräte. In eigenen Werkstätten wurden Bekleidung und Schuhe für die Truppe hergestellt und repariert.
Zu B, β. Für den Fall αα nur Einzelbeispiele (Seehandlung
12
usw.). Für den Fall ββ zahlreiche Beispiele in allen Epochen der Geschichte, Höhepunkt im Okzident: 16. bis 18. Jahrhundert. Die 1772 ursprünglich zum Zwecke der Förderung des preußischen Überseehandels gegründete „Societé de Commerce Maritime“ war später unter dem Namen „Generaldirection der Seehandlungssocietät“ ein Institut des Staates, das eine bedeutende Rolle in der preußischen Industriepolitik gespielt hat. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts beschränkte es sich auf das Bankgeschäft, ohne daß der Begriff „Seehandlung“ aus dem – mehrfach wechselnden – Firmennamen verschwand. Vgl. Lexis, Wilhelm, Seehandlung, in: HdStW3, Band 2, 1911, S. 751–753.
13
Im 16.–18. Jahrhundert, dem Zeitalter des Merkantilismus, ist in Westeuropa eine Vielzahl fürstlicher bzw. staatlicher Produktionsbetriebe (Manufakturen) und Handelsgesellschaften errichtet worden. Das Ziel, nennenswerte Einnahmen für den Staatshaushalt zu erwirtschaften, haben sie zumeist verfehlt. Vgl. u. a. Sombart, Der moderne Kapitalismus I2, S. 375–381; dass. Il2, S. 175–181; 847–851.
[436]Zu C. Für α: Beispiele: Die Entlastung der Literaten von den Fronden in China,
14
privilegierter Stände von den sordida munera[436]Vgl. hierzu Weber, Konfuzianismus, MWG I/19, S. 315.
15
in aller Welt, der Bildungsqualifizierten vom Militärdienst in zahlreichen Ländern.Im spätrömischen Reich „schmutzige, unreine“ Dienste bzw. Leistungen, von denen höhergestellte Personengruppen befreit waren (Codex Theodosianus XI, 16.18). Max Weber erwähnt „sordida munera“ u. a. in: Weber, Agrarverhältnisse3, MWG I/6, S. 721.
16
Im Deutschen Reich verkürzte sich in Friedenszeiten die Dienstzeit Wehrpflichtiger im Heer auf ein Jahr (gegenüber sonst zwei Jahren), wenn sie den erfolgreichen Abschluß der 5. Jahrgangsstufe der höheren Schule nachweisen konnten und sich verpflichteten, für Unterkunft, Verpflegung und Ausrüstung selbst aufzukommen. Max Weber war „Einjährig-Freiwilliger“ (vgl. Weber, Marianne, Lebensbild, S. 75–83). Ähnliche Regelungen gab es in anderen europäischen Ländern.
Für β: einerseits Vorbelastung der Vermögen mit Leiturgien in der antiken Demokratie; andererseits: der von den Lasten in den Beispielen unter α nicht entlasteten Gruppen.
Für γ: Der Fall αα ist die wichtigste Form systematischer Deckung der öffentlichen Bedürfnisse auf anderer Grundlage als der des „Steuerstaates“.
17
China sowohl wie Indien und Ägypten, also die Länder ältester (Wasserbau-)Bureaukratie[,] haben die leiturgische Organisation als Naturallasten-Leiturgie gekannt, und von da ist sie (teilweise) im Hellenismus und im spätrömischen Reich verwertet worden, freilich dort in wesentlichen Teilen als geldwirtschaftliche Steuer–, nicht als Naturallasten-Leiturgie. Stets bedeutet sie berufsständische Gliederung. In dieser Form kann sie auch heute wiederkehren, wenn die steuerstaatliche öffentliche Bedarfsdeckung versagen und die kapitalistische private Bedarfsdeckung staatlich reguliert werden sollte. Bisher ist bei Finanzklemmen der modernen Art der öffentlichen Bedarfsdeckung der Fall ββ adäquat gewesen: Erwerbsmonopole gegen Lizenzen und Kontribution (einfachstes Beispiel: Zwangskontrollierung von Pulverfabriken mit Monopolschutz gegen Neugründungen und hoher laufender Kontribution an die Staatskasse in Spanien).Der Begriff „Steuerstaat“ ist bis 1917, abgesehen von beiläufigen Erwähnungen, u. a. bei Lorenz von Stein, selten und nur zur Bezeichnung der Tatsache verwendet worden, daß der moderne Staat auf Steuereinnahmen angewiesen ist. 1917–19 war er Gegenstand einer lebhaften Auseinandersetzung zwischen Rudolf Goldscheid und Joseph Schumpeter. In diesem Zusammenhang nannte Schumpeter den Begriff ein Kind der „Auffassung des Staates, seines Wesens, seiner Formen, seiner Schicksale von der finanziellen Seite her“. Vgl. Schumpeter, Joseph, Die Krise des Steuerstaates (Zeitfragen aus dem Gebiete der Soziologie, Heft 4). – Graz und Leipzig: Leuschner & Lubensky 1918, Zitat: S. 8; Goldscheid, Rudolf, Staatssozialismus oder Staatskapitalismus. Ein finanzsoziologischer Beitrag zur Lösung des Staatsschulden-Problems. – Wien, Leipzig: Anzengruber Verlag Gebrüder Suschitzky 1917.
18
Es liegt der Gedanke sehr nahe, die „Sozialisierung“ der einzelnen Branchen von [437]Erwerbsbetrieben, von der Kohle angefangen, in dieser Art: durch Verwendung von Zwangskartellen oder Zwangsvertrustungen als Steuerträgern, fiskalisch nutzbar zu machen, da so die (formal) rationale preisorientierte Güterbeschaffung bestehen bleibt.Der Sachverhalt konnte nicht aufgeklärt werden.
19
Es ist zu vermuten, daß Max Weber die Beispiele aus dem Kali- und Kohlenbergbau Preußens vor Augen gestanden haben. Der preußische Fiskus war Gründer und Mitglied des seit den 1880er Jahren bestehenden Kalisyndikats, an dessen Stelle 1910 durch Reichsgesetz ein Zwangssyndikat errichtet wurde. Speziell im Interesse der Gewinne der staatlichen Werke sind seinerzeit die vom Kartell gesetzten Preise weit über den Kosten gehalten worden. Der Versuch des preußischen Staates 1904/05, durch Erwerb der Aktienmehrheit an der Bergwerksgesellschaft Hibernia, was einer Verstaatlichung („Sozialisierung“) gleich gekommen wäre, auch Einfluß auf das Rheinisch-Westfälische Kohlensyndikat zu gewinnen, gelangte erst 1915/17 an sein Ziel. Vgl. Gothein, Eberhard, Bergbau, in: GdS, Abt. VI, 1914, S. 308 f.; Liefmann, Robert, Kaliindustrie, in: HdStW4, Band 5, 1923, S. 563–567.
§ 39. Die Art der Deckung des Verbandsbedarfs der politischen (und hierokratischen) Verbände wirkt sehr stark auf die Gestaltung der Privatwirtschaften zurück. Der reine Geldabgabenstaat mit Eigenregie bei der Abgabeneinhebung (und nur bei ihr) und mit Heranziehung naturaler persönlicher Dienste nur: zu politischen und Rechtspflegezwecken, gibt dem rationalen, marktorientierten Kapitalismus optimale Chancen.
n
Der Geldabgabenstaat mit Verpachtung begünstigt den politisch orientierten Kapitalismus, dagegen die marktorientierte Erwerbswirtschaft nicht. Die Verleihung und Verpfründung von Abgaben hemmt normalerweise die Entstehung des Kapitalismus durch Schaffung von Interessen an der Erhaltung bestehender Sportel- und Abgabequellen und dadurch: Stereotypierung und Traditionalisierung der Wirtschaft. [437]In A folgt eine verderbte Textpassage: Der Geldabgabenstaat mit Verpachtung begünstigt den politisch orientierten Kapitalismus nicht, dagegen die marktorientierte Erwerbswirtschaft. Die Verleihung und Verpfründung von Abgaben Dienstleistungen nur zu politischen und Rechtspflegezwecken gibt – soweit dafür die Verbandsbedarfsdeckung in Betracht kommt – dem rationalen, marktorientierten Kapitalismus optimale Chancen.
20
Aus den Korrekturfahnen vom 27. Mai 1920 geht hervor, daß hier ein Textverderbnis (vermutlich durch eine fehlerhafte Einfügung von Korrekturen Max Webers) entstanden und nicht mehr abgeglichen worden ist. Vgl. Anhang, unten, S. 702.
Der reine Naturallieferungsverband befördert den Kapitalismus nicht und hindert ihn im Umfang der dadurch erfolgenden [438]tatsächlichen – erwerbswirtschaftlich irrationalen – Bindungen der Beschaffungsrichtung der Wirtschaften.
Der reine Naturaldienstverband hindert den marktorientierten Kapitalismus durch Beschlagnahme der Arbeitskräfte und Hemmung der Entstehung eines freien Arbeitsmarktes, den politisch orientierten Kapitalismus durch Abschneidung der typischen Chancen seiner Entstehung.
Die monopolistisch erwerbswirtschaftliche Finanzierung, die Naturalabgabenleistung mit Verwandlung der Abgabegüter in Geld und die leiturgisch den Besitz vorbelastende Bedarfsdeckung haben gemeinsam, daß sie den autonom marktorientierten Kapitalismus nicht fördern, sondern durch fiskalische, also marktirrationale Maßregeln: Privilegierungen und Schaffung marktirrationaler Gelderwerbschancen, [A 118]die Markterwerbschancen zurückschieben. Sie begünstigen dagegen – unter Umständen – den politisch orientierten Kapitalismus.
Der Erwerbsbetrieb mit stehendem Kapital und exakter Kapitalrechnung setzt formal vor allem Berechenbarkeit der Abgaben, material aber eine solche Gestaltung derselben voraus, daß keine stark negative Privilegierung der Kapitalverwertung, und das heißt vor allem: der Marktumsätze eintritt. Spekulativer Handelskapitalismus ist dagegen mit jeder nicht direkt, durch leiturgische Bindung, die händlerische Verwertung von Gütern als Waren hindernden Verfassung der öffentlichen Bedarfsdeckung vereinbar.
Eine eindeutige Entwicklungsrichtung aber begründet auch die Art der öffentlichen Lastenverfassung, so ungeheuer wichtig sie ist, für die Art der Orientierung des Wirtschaftens nicht. Trotz (scheinbaren) Fehlens aller typischen Hemmungen von dieser Seite hat sich in großen Gebieten und Epochen der rationale (marktorientierte) Kapitalismus nicht entwickelt; trotz (scheinbar) oft sehr starker Hemmungen von seiten der öffentlichen Lastenverfassung hat er sich anderwärts durchgesetzt. Neben dem materialen Inhalt der Wirtschaftspolitik, die sehr stark auch an Zielen außerwirtschaftlicher Art orientiert sein kann[,] und neben Entwicklungen geistiger (wissenschaftlicher und technologischer) Art haben auch Obstruktionen gesinnungsmäßiger [439](ethischer, religiöser) Natur für die lokale Begrenzung der autochthonen kapitalistischen Entwicklung moderner Art eine erhebliche Rolle gespielt. Auch darf nie vergessen werden: daß Betriebs- und Unternehmungsformen ebenso wie technische Erzeugnisse „erfunden“ werden müssen, und daß dafür sich historisch nur „negative“, die betreffende Gedankenrichtung erschwerende oder geradezu obstruierende, oder „positive“, sie begünstigende, Umstände, nicht aber ein schlechthin zwingendes Kausalverhältnis angeben läßt, sowenig wie für streng individuelle Geschehnisse irgendwelcher Natur überhaupt.
1. Zum Schlußsatz: Auch individuelle reine Naturgeschehnisse lassen sich nur unter sehr besonderen Bedingungen exakt auf individuelle Kausalkomponenten zurückführen: darin besteht ein prinzipieller Unterschied gegen das Handeln nicht.
2. Zum ganzen Absatz:
Die grundlegend wichtigen Zusammenhänge zwischen der Art der Ordnung und Verwaltung der politischen Verbände und der Wirtschaft können hier nur provisorisch angedeutet werden.
1. Der historisch wichtigste Fall der Obstruktion marktorientierter kapitalistischer Entwicklung durch Abgaben-Verpfründung ist China, durch Abgaben-Verleihung (damit vielfach identisch): Vorderasien seit dem Khalifenreich
21
(darüber an seinem Ort).[439]Zu Gebühren- und Steuerverpfründungen in China vgl. Weber, Konfuzianismus, MWG I/19, S. 222, 257 f., 282 f. Hinsichtlich der Entwicklung in Vorderasien dürfte sich Weber auf den Aufsatz von Becker, Carl Heinrich, Steuerpacht und Lehnswesen, in: Der Islam. Zeitschrift für Geschichte und Kultur des islamischen Orients, Band 5, 1914, S. 81–92, stützen. Vgl. dazu Weber, Feudalismus, MWG I/22-4, S. 392–394.
22
Abgaben-Verpachtung findet sich in Indien, Vorderasien, dem Okzident in Antike und Mittelalter, ist aber für die okzidentale Antike besonders weitgehend für die Art der Orientierung des kapitalistischen Erwerbs (römischer Ritterstand)Max Weber verweist auf einen noch zu verfassenden Text. Unten, S. 440, Zeilen 11 ff., wird angekündigt, daß Weber „auf die Entwicklungsstufen und Entwicklungsbedingungen der Wirtschaft“ zurückkommen werde. Vgl. dazu die Einleitung, oben, S. 70.
23
maßgebend gewesen, während sie in Indien und Vorderasien mehr die Entstehung von Vermögen (Grundherrschaften) beherrscht hat.Zur Förderung des kapitalistischen Erwerbs der römischen Ritterschaft durch das Institut der Steuerpacht im 2. und 1. vorchristlichen Jahrhundert vgl. Weber, Agrarverhältnisse3, MWG I/6, S. 672.
24
Zu Vorkommen und Wirkung der Abgaben- und Steuerverpachtung in Indien, Vorderasien sowie dem Okzident in Antike und Mittelalter äußert sich Max Weber vielfach. [440]Zu den Verhältnissen in Indien vgl. Weber, Hinduismus, MWG I/20, S. 138–144 u. a.; in Vorderasien vgl. Weber, Agrarverhältnisse3, MWG I/6, S. 352, 355 f., 398, 564 f.
[440]2. Der historisch wichtigste Fall der Obstruktion der kapitalistischen Entwicklung überhaupt durch leiturgische Bedarfsdeckung ist die Spätantike, vielleicht auch Indien in nachbuddhistischer Zeit und, zeitweise, China. Auch davon an seinem Ort.
25
Vgl. dazu oben, S. 439, Hg.-Anm. 22.
3. Der historisch wichtigste Fall der monopolistischen Ablenkung des Kapitalismus ist, nach hellenistischen (ptolemäischen) Vorläufern, die Epoche des fürstlichen Monopol- und Monopolkonzessionserwerbs im Beginn der Neuzeit (Vorspiel: gewisse Maßregeln Friedrichs II. in Sizilien, vielleicht nach byzantinischem Muster,
26
prinzipieller Schlußkampf: unter den Stuarts),Friedrich II. (1194–1250), König von Sizilien und römisch-deutscher Kaiser, errichtete im Königreich Sizilien ein Staatswesen, in dem vielfach moderne Züge erkannt worden sind. Zu seiner an fiskalischen Interessen orientierten Handelspolitik und (Produktions-)Monopolpolitik vgl. Maschke, Erich, Die Wirtschaftspolitik Kaiser Friedrichs II. im Königreich Sizilien, in: VSWG, Band 53, 1966, S. 289–328.
27
wovon an seinem Ort zu reden sein wird.Über den Kampf der 1603–1648 und 1660–1688 in England regierenden Könige aus dem Hause Stuart mit dem Parlament, in dem die Monopole einen Hauptstreitpunkt bildeten und der mit dem Zusammenbruch der autokratisch geförderten Monopolindustrie endete, handelt Max Weber an verschiedenen Stellen seines Werks und stützt sich dabei auf Levy, Hermann, Die Grundlagen des ökonomischen Liberalismus in der Geschichte der englischen Volkswirtschaft. – Jena: Gustav Fischer 1912. Vgl. dazu u. a. Weber, Feudalismus, MWG I/22-4, S. 433, und die überarbeitete Fassung von „Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus“, in: GARS I, S. 73 u. 291 f. (MWG I/18).
28
Vgl. dazu oben, S. 439, Hg.-Anm. 22.
Die ganze Erörterung ist hier, in dieser abstrakten Form, nur zur einigermaßen korrekten Problemstellung vorgenommen. Ehe auf die Entwicklungsstufen und Entwicklungsbedingungen der Wirtschaft zurückgekommen wird,
29
muß erst die rein soziologische Erörterung der außerwirtschaftlichen Komponenten vorgenommen werden. Zum Konzept „ökonomischer Entwicklungsstufen“ vgl. oben, S. 302. Entsprechende Ausführungen liegen nicht vor. Vgl. dazu die Einleitung, oben, S. 70.
§ 40. Für jede Verbandsbildung hat ferner die Wirtschaft dann eine ganz allgemeine soziologische Konsequenz, wenn die Leitung und der Verwaltungs[A 119]stab, wie in aller Regel, entgolten werden. Dann ist ein überwältigend starkes ökonomisches Interesse mit dem Fortbestand des Verbandes verknüpft, einerlei ob seine [441]vielleicht primär ideologischen Grundlagen inzwischen gegenstandslos geworden sind.
Es ist eine Alltagserscheinung, daß, nach der eigenen Ansicht der Beteiligten „sinnlos“ gewordene, Verbände aller Art nur deshalb weiterbestehen, weil ein „Verbandssekretär“ oder anderer Beamter „sein Leben (materiell) daraus macht“
30
und sonst subsistenzlos würde. [441]Von Max Weber wiederholt zitierte Redeweise. Gemeint ist, daß eine Person in solchen Tätigkeiten ein zur Lebensführung hinreichendes Einkommen erzielt; vgl. auch Kap. III, § 12, unten, S. 503, und Weber, Politik als Beruf, MWG I/17, S. 168.
Jede appropriierte, aber unter Umständen auch eine formal nicht appropriierte Chance kann die Wirkung haben, bestehende Formen sozialen Handelns zu stereotypieren. Innerhalb des Umkreises der (friedlichen und auf Alltagsgüterversorgung gerichteten) wirtschaftlichen Erwerbschancen sind im allgemeinen nur die Gewinnchancen von Erwerbsunternehmern autochthone, rational revolutionierende Mächte. Selbst diese aber nicht immer.
Z. B. haben die Courtage-Interessen der Bankiers lange Zeit die Zulassung des Indossements obstruiert,
31
und ähnliche Obstruktionen formal rationaler Institutionen auch durch kapitalistische Gewinninteressen werden uns oft begegnen,Indossament, auch in der zu Webers Zeit noch gebräuchlichen Form Indossement, ist ein Vermerk, in der Regel auf der Rückseite (ital. in dosso) eines Wertpapiers, das zugunsten einer namentlich genannten Person ausgestellt ist. Mit dem Vermerk werden die Rechte an dem Papier, speziell das Eigentum, auf einen anderen als den ursprünglich Berechtigten übertragen. Beim Wechsel widersprach die Tatsache, daß durch wiederholtes Indossieren Zahlungen geleistet werden konnten, ohne daß man neuerlich die Dienste eines Bankiers in Anspruch nehmen mußte, deren Interessen an der bei der Ausstellung und Einlösung von Wechseln üblichen Provision bzw. Courtage (von Courtier, frz. Makler). Nicht zuletzt auf ihr Drängen ist vom 16. bis 18. Jahrhundert in Italien und Deutschland vielfach das Indossieren verboten worden. Vgl. Schaps, Georg, Zur Geschichte des Wechselindossaments. – Stuttgart: Ferdinand Enke 1892, u. a. S. 89, 149. Max Weber hat das Werk 1893 in der „Zeitschrift für das Gesammte Handelsrecht“ besprochen; vgl. Weber, [Rezension von] Georg Schaps, Zur Geschichte des Wechselindossaments, MWG I/1, S. 468–474.
32
wenn sie auch sehr wesentlich seltener sind als namentlich die präbendalen, ständischen und die ökonomisch irrationalen Obstruktionen. Entsprechende Ausführungen liegen nicht vor.
[442]§ 41. Alles Wirtschaften wird in der Verkehrswirtschaft von den einzelnen Wirtschaftenden zur Deckung eigner, ideeller oder materieller, Interessen unternommen und durchgeführt. Auch dann natürlich, wenn es sich an den Ordnungen von wirtschaftenden, Wirtschafts- oder wirtschaftsregulierenden Verbänden orientiert, – was merkwürdigerweise oft verkannt wird.
In einer sozialistisch organisierten Wirtschaft
33
wäre dies nicht prinzipiell anders. Das Disponieren freilich würde in den Händen der Verbandsleitung liegen, die Einzelnen innerhalb der Güterbeschaffung auf lediglich „technische“ Leistungen: „Arbeit“ in diesem Sinn des Worts (oben § 15)[442]Wie dem folgenden Absatz, unten, S. 443, zu entnehmen ist, bezieht sich Max Weber hier auf eine „vollsozialistische (,Plan'-)Wirtschaft.“ „Vollsozialisierung“ ist oben, S. 291, definiert als rein haushaltsmäßige Planwirtschaft.
34
beschränkt sein. Dann und solange nämlich, als sie „diktatorisch“, also autokratisch verwaltet würden, ohne gefragt zu werden. Jedes Recht der Mitbestimmung würde sofort auch formell die Austragung von Interessenkonflikten ermöglichen, die sich auf die Art des Disponierens, vor allem aber: auf das Maß des „Sparens“ (Rücklagen) erstrecken würden. Aber das ist nicht das Entscheidende. Entscheidend ist: daß der einzelne auch dann primär fragen würde: ob ihm die Art der zugewiesenen Rationen und der zugewiesenen Arbeit, verglichen mit anderem, seinen Interessen entsprechend erscheine. Darnach würde er sein Verhalten einrichten, und gewaltsame Machtkämpfe um Änderung oder Erhaltung der einmal zugewiesenen Rationen (z. B. Schwerarbeiterzulagen), Appropriation oder Expropriation beliebter, durch die Entgeltrationierung oder durch angenehme Arbeitsbedingungen beliebter Arbeitsstellen, Sperrung der Arbeit (Streik oder Exmission aus den Arbeitsstellen), Einschränkung der Güterbeschaffung zur Erzwingung von Änderungen der Arbeitsbedingungen bestimmter Branchen, Boykott und gewaltsame Vertreibung unbeliebter Arbeitsleiter, – kurz: Appropriationsvorgänge aller Art und Interessenkämpfe wären auch dann das Normale. Daß sie meist verbandsweise ausgefochten werden, daß dabei die mit besonders „lebenswichtigen“ Arbeiten [443]Befaßten und die rein körperlich Kräftigsten bevorzugt wären, entspräche dem bestehenden Zustand[.] Immer aber stände dies Interesse des einzelnen – eventuell: die gleichartigen[,] aber gegen andere antagonistischen Interessen vieler einzelner –Kap. II, § 15, oben, S. 296.
o
hinter allem Handeln. Die Interessenkonstellationen wären abgeändert, die Mittel der Interessenwahrnehmung andre, aber jenes Moment würde ganz ebenso zutreffen. So sicher es ist, daß rein ideologisch an fremden Interessen orientiertes wirtschaftliches Handeln [A 120] vorkommt, so sicher ist auch: daß die Masse der Menschen nicht so handelt und nach aller Erfahrung nicht so handeln kann und also: wird. [443]Gedankenstrich fehlt in A; sinngemäß ergänzt.
In einer vollsozialistischen („Plan“-)Wirtschaft wäre Raum nur für:
a) eine Verteilung von Naturalgütern nach einem rationierten Bedarfsplan, –
b) eine Herstellung dieser Naturalgüter nach einem Produktionsplan. Die geldwirtschaftliche Kategorie des „Einkommens“ müßte notwendig fehlen. Rationierte Einkünfte wären möglich.
35
[443]Zu Max Webers Unterscheidung zwischen Einkünften und (in Geld geschätztem) Einkommen vgl. oben, S. 253 f.
In einer Verkehrswirtschaft ist das Streben nach Einkommen die unvermeidliche letzte Triebfeder alles wirtschaftlichen Handelns. Denn jede Disposition setzt, soweit sie Güter oder Nutzleistungen, die dem Wirtschaftenden nicht vollverwendungsbereit zur Verfügung stehen, in Anspruch nimmt, Erwerbung und Disposition über künftiges Einkommen, und fast jede bestehende Verfügungsgewalt setzt früheres Einkommen voraus. Alle erwerbswirtschaftlichen Betriebs-Gewinne verwandeln sich auf irgendeiner Stufe in irgendeiner Form in Einkommen von Wirtschaftenden. In einer regulierten Wirtschaft ist die Sorge der Regulierungsordnung[,] normalerweise, die Art der Verteilung des Einkommens. (In Naturalwirtschaften ist hier nach der festgestellten Terminologie kein „Einkommen“, sondern sind Ein[444]künfte in Naturalgütern und -leistungen da, welche nicht in einem
p
Einheitstauschmittel abschätzbar sind). [444]A: ein
Einkommen und Einkünfte können – soziologisch angesehen – folgende Hauptformen annehmen und aus folgenden typischen Hauptquellen fließen:
36
[444]Max Weber lehnt sich im Folgenden an die Ordnung der Einkommensarten bei Robert Liefmann an. Dieser trifft zwei Unterscheidungen: 1. zwischen Leistungs- (oder Arbeits-)Einkommen und Besitz- (oder Kapital-)Einkommen, 2. zwischen „bedungenen“, d. h. der Höhe nach vereinbarten, und „nicht bedungenen“ Einkommen. Hinsichtlich der Begrifflichkeit im einzelnen weicht Weber wiederholt von Liefmann ab. Liefmann spricht z. B. nicht von „Renten“, weder im nationalökonomisch-theoretischen noch (wie Weber) im umgangssprachlichen Sinn. Vgl. Liefmann, Grundsätze II, S. 444–453 und passim. Vgl. auch Webers Urteil über Liefmanns Einkommenslehre, unten, S. 448 mit Hg.-Anm. 51.
A. Leistungs-Einkommen und -Einkünfte (geknüpft an spezifizierte oder spezialisierte Leistungen)
q
. Schließende Klammer fehlt in A.
I. Löhne:
37
In seinen Vorlesungen zur „Allgemeinen (‚theoretischen‘) Nationalökonomie“ hat Max Weber für die im Folgenden genannten Einkommensarten den im Fachschrifttum üblichen Oberbegriff „Arbeitseinkommen“ verwendet. Arbeitslohn nannte er (nur) jene Einkommensform, „wo continuierliche Zahlung für Verfügung über die Arbeitskraft“ vorliegt. Vgl. Weber, Theoretische Nationalökonomie, MWG III/1, S. 649.
1. frei bedungene feste Lohn-Einkommen und -Einkünfte (nach Arbeitsperioden berechnet);
2. skalierte feste Einkommen und Einkünfte (Gehälter, Deputate von Beamten
38
); Zum zeitgenössischen Sprachgebrauch des Begriffs „Beamter“ vgl. oben, S. 272, Hg.-Anm. 60, und Webers Definition unten, S. 457 f.
3. bedungene Akkordarbeitserträge angestellter Arbeiter;
39
In der Formulierung setzt sich Max Weber nur scheinbar über den seinerzeit schon bedeutsamen Unterschied zwischen „Arbeitern“ und „Angestellten“ hinweg. Umgangssprachlich war (und ist) es möglich, von der „Anstellung“ von Arbeitern zu sprechen.
4. ganz freie Arbeitserträge.
40
Gemeint sind – bedungene, der Höhe nach vereinbarte – Einkommen (Reinerträge) aus selbständiger bzw. freiberuflicher Tätigkeit.
II. Gewinne:
1. freie Tauschgewinne durch unternehmungsweise Beschaffung von Sachgütern oder Arbeitsleistungen;
2. regulierte Tauschgewinne ebenso.
[445]In diesen Fällen (1 und 2): Abzug der „Kosten“: „Reinerträge“.
41
[445]Mit „Ertrag“ wurde in der Volkswirtschaftslehre üblicherweise das Ergebnis der Produktion einer gegebenen Wirtschaftsperiode bezeichnet. Dabei konnte Verschiedenes gemeint sein: 1. Eine Menge von Gütern (in naturalen Einheiten), 2. Eine Geldsumme der mit Preisen bewerteten erzeugten Produkte. In seiner Vorlesung „Allgemeine (‚theoretische‘) Nationalökonomie“ spricht Max Weber in Hinblick auf den erst im Tausch, d. h. durch die Preisbildung realisierten Geldwert der Produkte, in origineller Weise von „Tauschertrag“, vgl. Weber, Theoretische Nationalökonomie, MWG III/1, S. 641. Entsprechend wird hier in Ziff. 1 und 2 der Gewinn, ermittelt als Differenz zwischen (Tausch-)Ertrag und Kosten, als „Tauschgewinn“ und zugleich als „Reinertrag“ bezeichnet.
3. Beutegewinne;
4. Herrschafts-, Amtssportel-, Bestechungs-, Steuerpacht- und ähnliche Gewinne aus der Appropriation von Gewaltrechten.
Kostenabzug in den Fällen 3 und 4 bei dauerndem betriebsmäßigem Erwerb dieser Art, sonst nicht immer.
B. Besitzeinkommen und -Einkünfte (geknüpft an die Verwertung von Verfügungsgewalt über wichtige Beschaffungsmittel).
I. Normalerweise „Reinrenten“ nach Kostenabzug:
42
Max Weber knüpft hinsichtlich des Begriffs „Rente“ nicht ausschließlich an den in der Nationalökonomie insbesondere für Einkommen aus der Nutzung des Produktionsfaktors Boden entwickelten wissenschaftlichen Rentenbegriff (Grundrente) an. Er verwendet einen in der Umgangssprache seiner Zeit für eine Vielzahl von Einkommen aus Besitz unterschiedlicher Art eingeführten Rentenbegriff. In den unter I aufgeführten Fällen sieht Weber sich veranlaßt, den ungewöhnlichen, in Analogie zu „Reinertrag“ gebildeten Begriff „Reinrente“ einzuführen. Erst nach Abzug der im Zusammenhang mit dem Erwerb der (Brutto-)„Renten“ entstehenden Kosten ergeben sich die Einkünfte bzw. Einkommen.
1. Menschenbesitzrenten (von Sklaven oder Hörigen oder Freigelassenen), in natura
r
oder Geld, fest oder in Erwerbsanteilen (Abzug der Unterhaltskosten); [445]A: Natura
2. appropriierte Herrschaftsrenten (Abzug der Verwaltungskosten), ebenso:
3. Grundbesitzrenten (Teilpacht, feste Zeitpacht, in natura
s
oder Geld, grundherrliche Renteneinkünfte – Abzug der Grundsteuerkosten und Erhaltungskosten), ebenso A: Natura
4. Hausrenten (Abzug der Unterhaltungskosten), ebenso
[446]5. Renten aus appropriierten Monopolen (Bannrechten,
43
Patenten – Abzug der Gebühren), ebenso [446]Befugnisse eines Gewerbetreibenden, an einem Ort jedermann die Anschaffung eines Gutes oder die Annahme einer Leistung von anderen als ihm selbst zu untersagen, z. B. Mühlenzwang, Brauereigerechtsame, Schornsteinfegergerechtigkeit.
II. normalerweise ohne Kostenabzug:
6. Anlagerenten (aus Hingabe der Nutzung von „Anlagen“ (oben § 17
t
)[446]A: 11
44
gegen sogenannten „Zins“In Kap. II, § 17 (und nicht: § 11, wie im überlieferten Text angegeben), oben, S. 307, und § 20, oben, S. 329, beschreibt Max Weber Anlagen (Kraftanlagen, Mühlen aller Art, Werkstätten mit stehenden Apparaten) als Beschaffungsmittel besonderer Art. Zur Verleihung als Quelle von Renteneinkommen vgl. oben, S. 326.
45
an Haushaltungen oder Erwerbswirtschaften). Gemeint ist: Mietzins.
[A 121]7. Viehrenten,
46
ebenso Eine tarifierte und geregelte Viehleihe in Mesopotamien erwähnt Max Weber in: Agrarverhältnisse3, MWG I/6, S. 392 und 394. Er bezieht sich auf Hainisch, Michael, Die Entstehung des Kapitalzinses, in: Festgabe für Adolph Wagner zur siebenzigsten Wiederkehr seines Geburtstages. – Leipzig: C. F. Winter 1905, S. 293–331. Vgl. auch Weber, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, S. 141 f. und 315.
8. Naturaldarlehens-„Zinsen“ und bedungene Deputatrenten, in natura
u
, A: Natura
9. Gelddarlehens-„Zinsen“,
10. Hypothekenrenten, in Geld,
11. Wertpapierrenten, in Geld und zwar:
a) feste (sog. „Zinsen“),
b) nach einem Rentabilitätsertrag schwankende (Typus: sog. Dividenden).
12. Andre Gewinnanteile (s. A. II, 1):
1. Gelegenheitsgewinnanteile und rationale Spekulationsgewinnanteile,
2. rationale Dauer-Rentabilitätsgewinnanteile an Unternehmen aller Art.
Alle „Gewinne“ und die „Renten“ aus Wertpapieren sind nicht bedungene bzw. nur in den Voraussetzungen (Tauschpreisen, Akkordsätzen) bedungene Einkommen.
47
Feste Zinsen und [447]Löhne, Grundbesitzpachten, Mieten sind bedungene Einkommen, die Herrschafts-, Menschenbesitz-, Grundherrschafts- und Beutegewinne gewaltsam appropriierte Einkommen oder Einkünfte. Besitzeinkommen kann berufloses Einkommen sein, falls der Beziehende den Besitz durch andere verwerten läßt. Löhne, Gehälter, Arbeitsgewinne, Unternehmergewinne sind Berufseinkommen; die anderen Arten von Renten und Gewinnen können sowohl das eine wie das andere sein (eine Kasuistik ist hier noch nicht beabsichtigt).Warum Max Weber die oben unter B. II. Ziffer 11. aufgeführten zwei Arten von „Wertpapierrenten“ unterschiedslos zu den „nicht bedungenen“ zählt, ist unklar. [447]Schon im folgenden Satz werden „feste Zinsen“ zu den bedungenen Einkommen gerechnet.
48
Entsprechende Ausführungen liegen nicht vor.
Eminent dynamischen – wirtschaftsrevolutionierenden – Charakters
49
sind von allen diesen Einkommensarten die aus Unternehmergewinn (A II, 1) und bedungenen oder freien Arbeitserträgen (A I, 3 und 4) abgeleiteten, demnächst die freien Tausch- und, in anderer Art, unter Umständen: die Beutegewinne (A II, 3).Zu einer ähnlichen, den Begriff „dynamisch“ definierenden Formulierung vgl. Kap. IV, unten, S. 594.
a
[447]a(S. 415, ab: Exkurs über […])–a Zu dieser Textpassage sind Korrekturfahnen überliefert; vgl. dazu den Anhang, unten, S. 689–709.
Eminent statisch – wirtschaftskonservativ – sind skalierte Einkommen (Gehälter), Zeitlöhne, Amtsgewaltgewinne, (normalerweise) alle Arten von Renten.
Ökonomische Quelle von Einkommen (in der Tauschwirtschaft) ist in der Masse der Fälle die Tauschkonstellation auf dem Markt für Sachgüter und Arbeit, also letztlich: Konsumentenschätzungen, in Verbindung mit mehr oder minder starker natürlicher oder gesatzter monopolistischer Lage des Erwerbenden.
Ökonomische Quelle von Einkünften (in der Naturalwirtschaft) ist regelmäßig monopolistische Appropriation von Chancen: Besitz oder Leistungen gegen Entgelt zu verwerten.
Hinter allen diesen Einkommen steht nur die Eventualität der Gewaltsamkeit des Schutzes der appropriierten Chancen (s. [448]oben dies Kap. § 1 Nr. 2).
50
Die Beute- und die ihnen verwandten Erwerbsarten sind Ertrag aktueller Gewaltsamkeit. Alle Kasuistik mußte bei dieser ganz rohen Skizze vorerst noch ausgeschaltet werden. [448]In Kap. II, § 1, bezieht sich Weber in dem mit Nr. 2 bezifferten Absatz auf die „Gewaltsamkeit“ (oben, S. 218). Inhaltlich zutreffender sind aber die Aussagen in Absatz Nr. 3, ebd.
Ich halte von R[obert] Liefmanns Arbeiten bei vielen Abweichungen der Einzelansichten die Partien über „Einkommen“ für mit am
v
wertvollsten.[448]A: eine der
51
Hier soll auf das ökonomische Problem gar nicht näher eingegangen werden. Die Zusammenhänge der ökonomischen Dynamik mit der Gesellschaftsordnung werden s. Z. stets erneut erörtert werden.Vgl. vor allem Liefmann, Ertrag und Einkommen; Liefmann, Grundsätze II, S. 369– 528. Max Weber hat den 1919 erschienenen Band nachweislich gelesen und darüber mit Liefmann korrespondiert, vgl. oben, S. 217, Hg.-Anm. 5, und S. 218, Hg.-Anm. 8.
52
Bereits zu Beginn des Kapitels (oben, S. 216) erklärt Max Weber, jegliche „Dynamik“ vorerst beiseite lassen zu wollen. Entsprechende Ausführungen liegen – außer einer speziellen Erwähnung in Kap. IV, unten, S. 594 – nicht vor. Joseph Schumpeter schreibt im „Grundriß der Sozialökonomik“, John St. Mill habe den Begriff in die Ökonomie eingeführt, diesen aber bereits von Auguste Comte übernommen. Vgl. Schumpeter, Joseph, Epochen der Dogmen- und Methodengeschichte, in: GdS, Abt. I, 1914, S. 19–124, hier S. 67.
[449][A 122]Kapitel III. Die Typen der Herrschaft.
1. Die Legitimitätsgeltung.
§ 1. „Herrschaft“ soll, definitionsgemäß (Kap. I, § 16)
1
[,] die Chance heißen, für spezifische (oder: für alle) Befehle bei einer angebbaren Gruppe von Menschen Gehorsam zu finden. Nicht also jede Art von Chance, „Macht“ und „Einfluß“ auf andere Menschen auszuüben. Herrschaft („Autorität“) in diesem Sinn kann im Einzelfall auf den verschiedensten Motiven der Fügsamkeit: von dumpfer Gewöhnung angefangen bis zu rein zweckrationalen Erwägungen, beruhen. Ein bestimmtes Minimum an Gehorchenwollen, also: Interesse (äußerem oder innerem) am Gehorchen, gehört zu jedem echten Herrschaftsverhältnis. [449]Kap. I, § 16, oben, S. 210 f.
Nicht jede Herrschaft bedient sich wirtschaftlicher Mittel. Noch weit weniger hat jede Herrschaft wirtschaftliche Zwecke. Aber jede Herrschaft über eine Vielzahl von Menschen bedarf normalerweise (nicht: absolut immer) eines Stabes von Menschen (Verwaltungsstab, s. Kap. I, § 12),
2
d. h. der (normalerweise) verläßlichen Chance eines eigens auf Durchführung ihrer generellen Anordnungen und konkreten Befehle eingestellten Handelns angebbarer zuverlässig gehorchender Menschen. Dieser Verwaltungsstab kann an den Gehorsam gegenüber dem (oder: den) Herren rein durch Sitte oder rein affektuell oder durch materielle Interessenlage oder ideelle Motive (wertrational) gebunden sein. Die Art dieser Motive bestimmt weitgehend den Typus der Herrschaft. Rein materielle und zweckrationale Motive der Verbundenheit zwischen Herrn und Verwaltungsstab bedeuten hier wie sonst einen relativ labilen Bestand dieser. Regelmäßig kommen andere – affektuelle oder wertrationale – hinzu. In außeralltäglichen Fällen können diese allein [450]ausschlaggebend sein. Im Alltag beherrscht Sitte und daneben: materielles, zweckrationales, Interesse diese wie andere Beziehungen. Aber Sitte oder Interessenlage so wenig wie rein affektuelle oder rein wertrationale Motive der Verbundenheit könnten verläßliche Grundlagen einer Herrschaft darstellen. Zu ihnen tritt normalerweise ein weiteres Moment: der Legitimitätsglaube. Kap. I, § 12, oben, S. 204 ff.
Keine Herrschaft begnügt sich, nach aller Erfahrung, freiwillig mit den nur materiellen oder nur affektuellen oder nur wertrationalen Motiven als Chancen ihres Fortbestandes. Jede sucht vielmehr den Glauben an ihre „Legitimität“ zu erwecken und zu pflegen. Je nach der Art der beanspruchten Legitimität aber sind
a
auch der Typus des Gehorchens, des zu dessen Garantie bestimmten Verwaltungsstabes und der Charakter der Ausübung der Herrschaft grundverschieden. Damit aber auch ihre Wirkung. Mithin ist es zweckmäßig, die Arten der Herrschaft je nach dem ihnen typischen Legitimitätsanspruch zu unterscheiden. Dabei wird zweckmäßigerweise von modernen und also bekannten Verhältnissen ausgegangen. [450]A: ist
[A 123]1. Daß dieser und nicht irgendein anderer Ausgangspunkt der Unterscheidung gewählt wird, kann nur der Erfolg rechtfertigen. Daß gewisse andre typische Unterscheidungsmerkmale dabei vorläufig zurücktreten und erst später eingefügt werden können, dürfte kein entscheidender Mißstand sein. Die „Legitimität“ einer Herrschaft hat – schon weil sie zur Legitimität des Besitzes sehr bestimmte Beziehungen besitzt –
b
eine durchaus nicht nur „ideelle“ Tragweite. A: besitzt,
2. Nicht jeder konventional oder rechtlich gesicherte „Anspruch“ soll ein Herrschaftsverhältnis heißen. Sonst wäre der Arbeiter im Umfang seines Lohnanspruchs „Herr“ des Arbeitgebers, weil ihm auf Verlangen der Gerichtsvollzieher zur Verfügung gestellt werden muß. In Wahrheit ist er formal ein zum Empfang von Leistungen „berechtigter“ Tauschpartner desselben. Dagegen soll es den Begriff eines Herrschaftsverhältnisses natürlich nicht ausschließen, daß es durch formal freien Kontrakt entstanden ist: so die in den Arbeitsordnungen und -anweisungen sich kundgebende Herrschaft des Arbeitgebers über den Arbeiter, des Lehensherrn über den frei in die Lehensbeziehung tretenden Vasallen. Daß der Gehorsam kraft militärischer Disziplin formal „unfreiwillig“, der kraft Werkstattdiszi[451]plin formal „freiwillig“ ist, ändert an der Tatsache, daß auch Werkstattdisziplin Unterwerfung unter eine Herrschaft ist, nichts. Auch die Beamtenstellung wird durch Kontrakt übernommen und ist kündbar, und selbst die „Untertanen“-Beziehung kann freiwillig übernommen und (in gewissen Schranken) gelöst werden. Die absolute Unfreiwilligkeit besteht erst beim Sklaven. Allerdings aber soll andrerseits eine durch monopolistische Lage bedingte ökonomische „Macht“, d. h. in diesem Fall: Möglichkeit, den Tauschpartnern die Tauschbedingungen zu „diktieren“, allein und für sich ebensowenig schon „Herrschaft“ heißen, wie irgendein anderer: etwa durch erotische oder sportliche oder diskussionsmäßige oder andere Überlegenheit bedingter „Einfluß“. Wenn eine große Bank in der Lage ist, andren Banken ein „Konditionenkartell“
3
aufzuzwingen, so soll dies so lange nicht „Herrschaft“ heißen, als nicht ein unmittelbares Obödienzverhältnis derart hergestellt ist: daß Anweisungen der Leitung jener Bank mit dem Anspruch und der Chance, rein als solche Nachachtung zu finden, erfolgen und in ihrer Durchführung kontrolliert werden. Natürlich ist auch hier, wie überall, der Übergang flüssig: von Schuldverpflichtung zur Schuldverknechtung finden sich alle Zwischenstufen. Und die Stellung eines „Salons“ kann bis hart an die Grenze einer autoritären Machtstellung gehen, ohne doch notwendig „Herrschaft“ zu sein. Scharfe Scheidung ist in der Realität oft nicht möglich, klare Begriffe sind aber dann deshalb nur umso nötiger. [451]Als Konditionenkartelle werden unter Wettbewerbern abgeschlossene Verträge zur Regelung der von den Beteiligten im Verkehr mit den Kunden anzuwendenden allgemeinen Geschäfts-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen bezeichnet. Sie schränken den Wettbewerb in Industrie und Handel zumeist wenig ein und gelten deshalb als Kartelle niederer Ordnung. Anders im Bankwesen, wo Zinsen und Provisionen zwar begrifflich zu den Konditionen zählen, aber ökonomisch Preise der angebotenen Bankleistungen und damit die entscheidenden Aktionsparameter im Wettbewerb sind.
3. Die „Legitimität“ einer Herrschaft darf natürlich auch nur als Chance, dafür in einem relevanten Maße gehalten und praktisch behandelt zu wer den, angesehen werden. Es ist bei weitem nicht an dem: daß jede Fügsamkeit gegenüber einer Herrschaft primär (oder auch nur: überhaupt immer) sich an diesem Glauben orientierte. Fügsamkeit kann vom einzelnen oder von ganzen Gruppen rein aus Opportunitätsgründen geheuchelt, aus materiellem Eigeninteresse praktisch geübt, aus individueller Schwäche und Hilflosigkeit als unvermeidlich hingenommen werden. Das ist aber nicht maßgebend für die Klassifizierung einer Herrschaft. Sondern: daß ihr eigner Legitimitätsanspruch der Art nach in einem relevanten Maß „gilt“, ihren Bestand festigt und die Art der gewählten Herrschaftsmittel mit bestimmt. Eine Herrschaft kann ferner – und das ist ein praktisch häufiger Fall – so absolut durch augenfällige Interessengemeinschaft des Herrn und [452]seines Verwaltungsstabs (Leibwache, Prätorianer, „rote“ oder „weiße“ Garden)
4
gegenüber den Beherrschten und durch deren Wehrlosigkeit gesichert sein, daß sie selbst den Anspruch auf „Legitimität“ zu verschmähen vermag. Dann ist noch immer die Art der Legitimitätsbeziehung zwischen Herm und Verwaltungsstab je nach der Art der zwischen ihnen bestehenden Autoritätsgrundlage sehr verschieden geartet und in hohem Grade maßgebend für die Struktur der Herrschaft, wie sich zeigen wird. [452]Während der revolutionären Umbrüche im und nach dem Ersten Weltkrieg standen sich in bürgerkriegsartigen Auseinandersetzungen bewaffnete Milizen gegenüber. „Rote Garden“ bezeichneten die Anhänger der sozialistischen und kommunistischen Revolution, die „Weißen“ die regierungstreuen und gegenrevolutionären Truppen. Während der Februarrevolution 1917 waren zuerst in St. Petersburg Rote Garden entstanden. Sie dienten den neuen Machthabern als Kampfeinheiten und Sicherheitsmilizen. In Deutschland kamen sie kurzzeitig und lokal begrenzt vor, z. B. während der bayerischen Räterepublik im April 1919.
4. „Gehorsam“ soll bedeuten: daß das Handeln des Gehorchenden im wesentlichen so abläuft, als ob er den Inhalt des Befehls um dessen selbst willen zur Maxime seines Verhaltens gemacht habe, und zwar lediglich um des formalen Gehorsamsverhältnisses halber, ohne Rücksicht auf die eigene Ansicht über den Wert oder Unwert des Befehls als solchen.
5. Rein psychologisch kann die Kausalkette verschieden aussehen, insbesondre: „Eingebung“ oder „Einfühlung“
5
sein. Diese Unterscheidung ist aber hier für die Typenbildung der Herrschaft nicht brauchbar. „Eingebung“ und „Einfühlung“ sowie die hier nicht genannte „Einredung“ wurden von dem Psychologen Willy Hellpach als „Kategorien von Möglichkeiten seelischer Übermittlung“ eingeführt und unter dem Aspekt massenpathologischer Auswirkungen beschrieben. Vgl. Hellpach, Willy, Die geistigen Epidemien (Die Gesellschaft. Sammlung sozialpsychologischer Monographien, hg. von Martin Buber, Band 11). – Frankfurt a.Μ.: Rütten & Loening 1906, S. 46, Handexemplar, Max Weber-Arbeitsstelle, BAdW München, sowie die Parallelerwähnungen in Weber, Recht, MWG I/22-3, S. 215 f. (mit explizitem Bezug auf Hellpach) und Weber, Herrschaft, MWG I/22-4, S. 136 (mit allen drei Übermittlungsformen).
6. Der Bereich der herrschaftsmäßigen Beeinflussung der sozialen Beziehungen und Kulturerscheinungen ist wesentlich breiter, als es auf den ersten Blick scheint. Beispielsweise ist es diejenige Herrschaft, welche in der Schule geübt wird, welche die als orthodox geltende Sprach- und Schreibform prägt. Die als Kanzlei[A 124]sprachen der politisch autokephalen Verbände, also ihrer Herrscher, fungierenden Dialekte sind zu diesen orthodoxen Sprach- und Schreibformen geworden und haben die „nationalen“ Trennungen (z. B. Hollands von Deutschland)
6
herbeigeführt. [453]Elternherrschaft und Schulherrschaft reichen aber weit über die Beeinflussung jener (übrigens nur scheinbar:) formalen Kulturgüter hinaus in der Prägung der Jugend und damit der Menschen. Im ausgehenden 16. Jahrhundert forcierte die Unabhängigkeitsbewegung der niederländischen Generalstände die Eigenständigkeit der niederländischen Sprache. Damit wurde eine Entwicklung besiegelt, die das Niederländische als eine Mischung aus dem Niederfränkischen und anderen germanischen Dialekten von der Entwicklung zum Neuhochdeutschen im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation ab[453]grenzte. Die politische Trennung wurde 1648 durch den Westfälischen Frieden besiegelt. Vgl. dazu auch Weber, Herrschaft, MWG I/22-4, S. 126.
7. Daß Leiter und Verwaltungsstab eines Verbandes der Form nach als „Diener“ der Beherrschten auftreten, beweist gegen den Charakter als „Herrschaft“ natürlich noch gar nichts. Es wird von den materialen Tatbeständen der sogenannten „Demokratie“ später gesondert zu reden sein.
7
Irgendein Minimum von maßgeblicher Befehlsgewalt, insoweit also: von „Herrschaft“, muß ihnen aber fast in jedem denkbaren Falle eingeräumt werden. Mit „sogenannter Demokratie“ meint Weber alle Formen demokratischer Herrschaftsausübung, die jenseits der unmittelbar demokratischen Verwaltung liegen (vgl. Weber, Herrschaft, MWG I/22-4, S. 144, und Weber, Staatssoziologie, MWG III/7, S. 115). Von den materialen Tatbeständen der Demokratie wird das Wahlbeamtentum unten, S. 534 f., behandelt, eine umfassende Behandlung wäre aber in der projektierten „Staatssoziologie“ zu erwarten gewesen.
§ 2. Es gibt drei reine Typen legitimer Herrschaft. Ihre Legitimitätsgeltung kann nämlich primär sein:
1. rationalen Charakters: auf dem Glauben an die Legalität gesatzter Ordnungen und des Anweisungsrechts der durch sie zur Ausübung der Herrschaft Berufenen ruhen (legale Herrschaft) – oder
2. traditionalen Charakters: – auf dem Alltagsglauben an die Heiligkeit von jeher geltender Traditionen und die Legitimität der durch sie zur Autorität Berufenen ruhen (traditionale Herrschaft), – oder endlich
3. charismatischen Charakters: auf der außeralltäglichen Hingabe an die Heiligkeit oder die Heldenkraft oder die Vorbildlichkeit einer Person und der durch sie offenbarten oder geschaffenen Ordnungen (charismatische Herrschaft).
Im Fall der satzungsmäßigen Herrschaft wird der legal gesatzten sachlichen unpersönlichen Ordnung und dem durch sie bestimmten Vorgesetzten kraft formaler Legalität seiner Anordnungen und in deren Umkreis gehorcht. Im Fall der traditionalen Herrschaft wird der Person des durch Tradition berufenen und an die Tradition (in deren Bereich) gebundenen Herrn kraft [454]Pietät im Umkreis des Gewohnten gehorcht. Im Fall der charismatischen Herrschaft wird dem charismatisch qualifizierten Führer als solchem kraft persönlichen Vertrauens in Offenbarung, Heldentum oder Vorbildlichkeit im Umkreis der Geltung des Glaubens an dieses sein Charisma gehorcht.
1. Die Zweckmäßigkeit dieser Einteilung kann nur der dadurch erzielte Ertrag an Systematik erweisen. Der Begriff des „Charisma“ („Gnadengabe“) ist altchristlicher Terminologie entnommen
8
. Für die christliche Hierokratie hat zuerst Rudolf Sohms Kirchenrecht[454]„Charisma“ als „Geistes-“ oder „Gnadengabe“ wurde in den einschlägigen theologischen Lexika der Zeit – neben einer Stelle bei Philon von Alexandrien und dem 1. Petrusbrief (4,10) – ausschließlich dem „paulinischen Sprachgebrauch“ zugewiesen. Vgl. Cremer, Hermann, Art. Geistesgaben, Charismata, in: Realencyclopädie für protestantische Theologie und Kirche, Band 6, 3. Aufl. – Leipzig: J. C. Hinrichs 1899, S.460–463; mit anderer Akzentuierung Seisenberger, Art. Charismen, in: Wetzer und Welte’s Kirchenlexikon oder Encyklopädie der katholischen Theologie und ihrer Hülfswissenschaften, Band 3, 2. Aufl. – Freiburg i. Br.: Herder 1884, Sp. 81–89.
9
der Sache, wenn auch nicht der Terminologie nach den Begriff, andre (z. B. Holl in „Enthusiasmus und Bußgewalt“)Gegen die herrschende Lehre vertrat Rudolph Sohm 1892 im ersten Band seines nicht vollendeten Werks „Kirchenrecht“ die These, daß die Organisation der frühen Kirche bis zum 2. und 3. Jahrhundert „nicht rechtliche, sondern charismatische Organisation“ gewesen sei (Sohm, Kirchenrecht, S. 26). Durch die „Verteilung der Gnadengaben (Charismen)“ seien einzelne Christen zu „leitender, führender, verwaltender Tätigkeit“ in der Christenheit berufen gewesen (ebd., S. 26 f.). Mit dem Aufkommen des Episkopats und einer regulierten Aufgaben- und Ämterzuweisung habe die Verrechtlichung der Kirche eingesetzt. Obwohl Sohm den charismatischen Charakter der frühen Kirchenorganisation in seiner späteren Schrift, Wesen und Ursprung des Katholizismus. – Leipzig, Berlin: Teubner (1. Aufl.) 1909, (2. Aufl.) 1912, präziser faßte, bezieht sich Max Weber hier explizit auf die Erstdarstellung von 1892.
10
gewisse wichtige Konsequenzen davon verdeutlicht. Er ist also nicht Neues. Karl Holl zeigt in seiner Habilitationsschrift „Enthusiasmus und Bußgewalt beim griechischen Mönchtum“ 1898 ausgehend von den Schriften des Mönchs Symeon (ca. 963–1041/42), wie sich das griechische Mönchtum als einen mit besondertem Charisma versehenen Stand betrachtete und daraus die Legitimation zur alleinigen Ausübung der Bußgewalt ableitete. Bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts nahm es die Binde- und Lösegewalt wahr, die danach ausschließlich dem Priesteramt vorbehalten wurde. Nach Holl leitete sich die Sonderstellung des Mönchs daraus ab, daß sein Charisma als „echtes Charisma im alten Sinn“ galt und von den Gläubigen als solches anerkannt wurde (Holl, Enthusiasmus und Bußgewalt, S. 153; dort mit Anstreichungen in dem von Max Weber intensiv bearbeiteten Exemplar, Universitätsbibliothek Heidelberg). Das griechische Mönchtum konnte sich somit als genuin „charismatische Gottesgefolgschaft“ sehr lange gegen die Ansprüche der Hierokratie behaupten – dies im Gegensatz zum abendländischen Mönchtum (Zitat aus: Weber, Staat und Hierokratie, MWG I/22-4, S. 594).
[455]2. Daß keiner der drei, im folgenden zunächst zu erörternden, Idealtypen historisch wirklich „rein“ vorzukommen pflegt, darf natürlich hier sowenig wie sonst die begriffliche Fixierung in möglichst reiner Ausprägung hindern. Weiterhin (§§
c
11 ff.)[455]A: (§
11
wird die Abwandlung des reinen Charisma durch Veralltäglichung erörtert und dadurch der Anschluß an die empirischen Herrschaftsformen wesentlich gesteigert werden. Aber auch dann gilt für jede empirische historische Erscheinung der Herrschaft: daß sie „kein ausgeklügelt Buch“[455] Kap. III, § 11, unten, S. 497–513.
12
zu sein pflegt. Und die soziologische Typologie bietet der empirisch historischen Arbeit lediglich den immerhin oft nicht zu unterschätzenden Vorteil: daß sie im Einzelfall an einer Herrschaftsform angeben kann: was „charismatisch“, „erbcharismatisch“ (§§ Zitat aus: Meyer, Conrad Ferdinand, Huttens letzte Tage. Eine Dichtung. – Leipzig: H. Haessel 1887, S. IX.
d
10, 11),A: (§
13
„amtscharismatisch“, „patriarchal“ (§ 7), In Kap. III, § 10, unten, S. 492 f., findet sich nur eine kurze Erwähnung, die eigentlichen Ausführungen zum „Erbcharisma“ dagegen in Kap. III, § 11 e), unten, S. 501 f.
14
„bureaukratisch“ (§ 4), Die Ausführungen finden sich erst in Kap. III, § 7a, unten S. 475–481.
15
„ständisch“ usw. ist oder sich diesem Typus nähert, und daß sie dabei mit leidlich eindeutigen Begriffen arbeitet. Zu glauben: die historische Gesamtrealität lasse sich in das nachstehend entwickelte Begriffsschema „einfangen“, liegt hier so fern wie möglich. Kap. III, § 4, unten, S. 459–463.
2. Die legale Herrschaft mit bureaukratischem Verwaltungsstab.
Vorbemerkung: Es wird hier absichtlich von der spezifisch modernen Form der Verwaltung ausgegangen, um nachher die andern mit ihr kontrastieren zu können.
[A 125]§ 3. Die legale Herrschaft beruht auf der Geltung der folgenden untereinander zusammenhängenden Vorstellungen,
1. daß beliebiges Recht durch Paktierung oder Oktroyierung rational, zweckrational oder wertrational orientiert (oder: beides)[,] gesatzt werden könne mit dem Anspruch auf Nachachtung mindestens durch die Genossen des Verbandes, regelmäßig aber auch: durch Personen, die innerhalb des Machtbereichs des [456]Verbandes (bei Gebietsverbänden: des Gebiets) in bestimmte von der Verbandsordnung für relevant erklärte soziale Beziehungen geraten oder sozial handeln; –
2. daß jedes Recht seinem Wesen nach ein Kosmos abstrakter, normalerweise: absichtsvoll gesatzter Regeln sei, die Rechtspflege die Anwendung dieser Regeln auf den Einzelfall, die Verwaltung die rationale Pflege von, durch Verbandsordnungen vorgesehenen, Interessen, innerhalb der Schranken von Rechtsregeln, und: nach allgemein angebbaren Prinzipien, welche Billigung oder mindestens keine Mißbilligung in den Verbandsordnungen finden; –
3. daß also der typische legale Herr: der „Vorgesetzte“, indem er anordnet und mithin befiehlt, seinerseits der unpersönlichen Ordnung gehorcht, an welcher er seine Anordnungen orientiert, –
Dies gilt auch für denjenigen legalen Herrn, der nicht „Beamter“ ist, z. B. einen gewählten Staatspräsidenten.
4. daß – wie man dies meist ausdrückt
16
– der Gehorchende nur als Genosse und nur „dem Recht“ gehorcht. [456]Weber spielt hier auf die Genossenschaftstheorie an, die durch Otto Gierke geprägt worden ist. Vgl. Gierke, Otto, Das deutsche Genossenschaftsrecht, Band 2. – Berlin: Weidmann 1873, S. 865 ff. zum Genossenschaftsbegriff; dort auch zu der Konstruktion, wie der Einzelne durch einen freien Willensakt Teil der genossenschaftlichen Korporation wird und sich als Genosse an deren Ordnungen bindet.
Als Vereinsgenosse, Gemeindegenosse, Kirchenmitglied, im Staat: Bürger.
5. gilt in Gemäßheit von Nr. 3 die Vorstellung, daß die Verbandsgenossen, indem sie dem Herren gehorchen, nicht seiner Person, sondern jenen unpersönlichen Ordnungen gehorchen und daher zum Gehorsam nur innerhalb der ihm durch diese zugewiesenen rational abgegrenzten sachlichen Zuständigkeit verpflichtet sind.
Die Grundkategorien der rationalen Herrschaft sind also
1. ein kontinuierlicher regelgebundener Betrieb von Amtsgeschäften, innerhalb:
2. einer Kompetenz (Zuständigkeit), welche bedeutet:
[457]a) einen kraft Leistungsverteilung sachlich abgegrenzten Bereich von Leistungspflichten, –
b) mit Zuordnung der etwa dafür erforderlichen Befehlsgewalten und
c) mit fester Abgrenzung der eventuell zulässigen Zwangsmittel und der Voraussetzungen ihrer Anwendung.
Ein derart geordneter Betrieb soll „Behörde“ heißen.
„Behörden“ in diesem Sinn gibt es in großen Privatbetrieben, Parteien, Armeen natürlich genau wie in „Staat“ und „Kirche“. Eine „Behörde“ im Sinne dieser Terminologie ist auch der gewählte Staatspräsident (oder das Kollegium der Minister oder gewählten „Volksbeauftragten“).
17
Diese Kategorien interessieren aber jetzt noch nicht. Nicht jede Behörde hat in gleichem Sinne „Befehlsgewalten“; aber diese Scheidung interessiert hier nicht. [457]„Volksbeauftragte“ hießen die Inhaber von Regierungsgewalt im revolutionären Rußland (1917), Ungarn (1919) und Deutschland (1918/19), teilweise auch in den deutschen Einzelstaaten, wie z. B. den Freistaaten Bayern, Braunschweig und Sachsen. Ihre Legitimation leiteten die Volksbeauftragten von der Wahl, Akklamation oder Bestätigung durch die Arbeiter- und Soldatenräte ab. Der „Rat der Volksbeauftragten“, die deutsche, provisorische Regierung nach der Novemberrevolution, trat am 9. November 1918 zusammen und ließ sich einen Tag später auf einer Großversammlung der Berliner Arbeiter- und Soldatenräte bestätigen. In Bayern wurden nach Ausrufung der Räterepublik in der Nacht vom 6. auf den 7. April 1919 Volksbeauftragte (anstatt der vormaligen Minister) gewählt.
Dazu tritt
3. das Prinzip der Amtshierarchie, d. h. die Ordnung fester Kontroll- und Aufsichtsbehörden für jede Behörde mit dem Recht der Berufung oder Beschwerde von den nachgeordneten an die Vorgesetzten. Verschieden ist dabei die Frage geregelt, ob und wann die Beschwerdeinstanz
e
die abzuändernde Anordnung selbst durch eine „richtige“ ersetzt oder dies dem ihr untergeordneten Amt, über welches Beschwerde geführt wird, aufträgt. [457]A: Beschwerdedistanz
[A 126]4. Die „Regeln“, nach denen verfahren wird, können
a) technische Regeln, –
b) Normen sein.
Für deren Anwendung ist in beiden Fällen, zur vollen Rationalität, Fachschulung nötig. Normalerweise ist also zur Teil[458]nahme am Verwaltungsstab eines Verbandes nur der nachweislich erfolgreich Fachgeschulte qualifiziert und darf nur ein solcher als Beamter angestellt werden. „Beamte“ bilden den typischen Verwaltungsstab rationaler Verbände, seien dies politische, hierokratische
f
, wirtschaftliche (insbesondre: kapitalistische) oder sonstige. [458]A: hierokratische“
5. Es gilt (im Rationalitätsfall) das Prinzip der vollen Trennung des Verwaltungsstabs von den Verwaltungs- und Beschaffungsmitteln. Die Beamten, Angestellten, Arbeiter des Verwaltungsstabs sind nicht im Eigenbesitz der sachlichen Verwaltungs- und Beschaffungsmittel, sondern erhalten diese in Natural- oder Geldform geliefert und sind rechnungspflichtig. Es besteht das Prinzip der vollen Trennung des Amts- (Betriebs-)Vermögens (bzw. Kapitals) vom Privatvermögen (Haushalt) und der Amtsbetriebsstätte (Bureau) von der Wohnstätte.
6. Es fehlt im vollen Rationalitätsfall jede Appropriation der Amtsstelle an den Inhaber. Wo ein „Recht“ am „Amt“ konstituiert ist (wie z. B. bei Richtern und neuerdings zunehmenden Teilen der Beamten- und selbst der Arbeiterschaft),
18
dient sie normalerweise nicht dem Zweck einer Appropriation an den Beamten, sondern der Sicherung der rein sachlichen („unabhängigen“), nur normgebundenen Arbeit in seinem Amt. [458]Ein „Recht am Amt“ stand in Deutschland den Richtern insoweit zu, als sie unabsetzbar und unversetzbar waren, was der „Unabhängigkeit“ der Rechtsprechung dienen sollte. Ein solcher rechtlicher Anspruch auf Ausübung einer einmal übernommenen Tätigkeit stand den anderen Beamten nicht zu. Im Zuge der politischen Umwälzungen im November 1918 forderte der Vorsitzende des neu gegründeten Deutschen Beamtenbundes von der Reichsregierung eine Garantie der Rechte der Beamten, insbesondere die lebenslängliche Anstellung. Durch die Festlegung in Art. 129, Abs. 1, Satz 3 der Weimarer Reichsverfassung: „Die wohl erworbenen Rechte der Beamten sind unverletzlich“, galt das „Recht am Amt“ den meisten Juristen als unbestreitbar (vgl. Triepel, Heinrich, Das preußische Gesetz über die Einführung einer Altersgrenze, in: Archiv für Öffentliches Recht, 40. Jg., 1921, S. 349–377, bes. S. 368, gegen die ältere Ansicht, vor allem bei Jellinek, Georg, System der subjektiven öffentlichen Rechte, 2. Aufl. – Tübingen: J.C. B. Mohr (Paul Siebeck) 1905, S. 177 ff.). Zu den „Vorstufen“ eines gesetzlichen Kündigungsschutzes für Angestellte und Arbeiter durch das Betriebsrätegesetz vom 4. Februar 1920 vgl. oben, S. 201 mit Hg.-Anm. 86.
7. Es gilt das Prinzip der Aktenmäßigkeit der Verwaltung, auch da, wo mündliche Erörterung tatsächlich Regel oder gera[459]dezu Vorschrift ist: mindestens die Vorerörterungen und Anträge und die abschließenden Entscheidungen, Verfügungen und Anordnungen aller Art sind schriftlich fixiert. Akten und kontinuierlicher Betrieb durch Beamte zusammen ergeben: das Bureau, als den Kernpunkt jedes modernen Verbandshandelns.
8. Die legale Herrschaft kann sehr verschiedene Formen annehmen, von denen später gesondert zu reden ist.
19
Im folgenden wird zunächst absichtlich nur die am meisten rein herrschaftliche Struktur des Verwaltungsstabes: des „Beamtentums“, der „Bureaukratie“, idealtypisch analysiert. [459]Der Verweis könnte sich auf die rational geregelten Formen der Kollegialität und der Repräsentation (unten, S. 573–575 und S. 581 f.) beziehen. Wegen der Formulierung „später gesondert“ vermutlich Hinweis auf die angekündigte „Staatssoziologie“.
Daß die typische Art des Leiters beiseite gelassen wird, erklärt sich aus Umständen, die erst später ganz verständlich werden.
20
Sehr wichtige Typen rationaler Herrschaft sind formal in ihrem Leiter andern Typen angehörig (erbcharismatisch: Erbmonarchie, charismatisch: plebiszitärer Präsident), andere wieder sind material in wichtigen Teilen rational, aber in einer zwischen Bureaukratie und Charismatismus in der Mitte liegenden Art konstruiert (Kabinettsregierung), noch andre sind durch die (charismatischen oder bureaukratischen) Leiter anderer Verbände („Parteien“) geleitet (Parteiministerien). Der Typus des rationalen legalen Verwaltungsstabs ist universaler Anwendung fähig, und er ist das im Alltag Wichtige. Denn Herrschaft ist im Alltag primär: Verwaltung. Weber dürfte hier an die systematische Behandlung der charismatisch legitimierten Leiter denken, vgl. unten, S. 490–497.
§ 4. Der reinste Typus der legalen Herrschaft ist diejenige mittelst bureaukratischen Verwaltungsstabs. Nur der Leiter des Verbandes besitzt seine Herrenstellung entweder kraft Appropriation oder kraft einer Wahl oder Nachfolgerdesignation. Aber auch seine Herrenbefugnisse sind legale „Kompetenzen“. Die Gesamtheit des Verwaltungsstabes besteht im reinsten Typus aus Einzelbeamten (Monokratie, im Gegensatz zur „Kollegialität“, von der später zu reden ist),
21
welche Kap. III, § 15. „Kollegialität und Gewaltenteilung“, unten, S. 542–562.
1. persönlich frei nur sachlichen Amtspflichten gehorchen,
[460]2. in fester Amtshierarchie,
3. mit festen Amtskompetenzen,
4. kraft Kontrakts, also (prinzipiell) auf Grund freier Auslese nach
[A 127]5. Fachqualifikation
g
– im rationalsten Fall: durch Prüfung ermittelter, durch Diplom beglaubigter Fachqualifikation – angestellt (nicht: gewählt) sind, – [460]A: Fachqualifikation,
6. entgolten sind mit festen Gehältern in Geld, meist mit Pensionsberechtigung, unter Umständen allerdings (besonders in Privatbetrieben) kündbar auch von seiten des Herrn, stets aber kündbar von seiten des Beamten; dies Gehalt ist abgestuft primär nach dem hierarchischen Rang, daneben nach der Verantwortlichkeit der Stellung, im übrigen nach dem Prinzip der „Standesgemäßheit“ (Kap. IV),
22
[460]In Kap. IV, unten, S. 598–600, behandelt Weber die „ständische Lage“ und die mit ihr verbundene Art der Lebensführung.
7. ihr Amt als einzigen oder Haupt-Beruf behandeln,
8. eine Laufbahn: „Aufrücken“ je nach Amtsalter oder Leistungen oder beiden, abhängig vom Urteil der Vorgesetzten, vor sich sehen,
9. in völliger „Trennung von den Verwaltungsmitteln“ und ohne Appropriation der Amtsstelle arbeiten,
10. einer strengen einheitlichen Amtsdisziplin und Kontrolle unterliegen.
Diese Ordnung ist im Prinzip in erwerbswirtschaftlichen oder karitativen oder beliebigen anderen private ideelle oder materielle Zwecke verfolgenden Betrieben und in politischen oder hierokratischen Verbänden gleich anwendbar und auch historisch (in mehr oder minder starker Annäherung an den reinen Typus) nachweisbar.
1. Z. B. ist die Bureaukratie in Privatkliniken ebenso wie in Stiftungs- oder Ordenskrankenhäusern im Prinzip die gleiche. Die moderne sogen. „Kaplanokratie“:
23
die Enteignung der alten weitgehend appropriierten [461]Kirchenpfründen, aber auch der Universalepiskopat (als formale universale „Kompetenz“)„Kaplanokratie“ war ein Kampfbegriff gegen das konservative Bündnis von Junkertum und Priestern (vgl. Mommsen, Theodor, Was uns noch retten kann, in: Die Nation, 20. Jg., 1902/03, Nr. 11 vom 13. Dez. 1902, S. 163). Weber faßt darunter den bürokratisch-zentralistischen Aufbau der katholischen Kirche, die seit dem Ersten [461]Vatikanum (1869/70) die Bischöfe und Priester zu dienstbaren Hilfsbeamten (Kaplänen) der „kurialen Zentralgewalt“ gemacht habe und in Deutschland mit diesem Apparat die Zentrumspartei unterstütze (vgl. Weber, Parlament und Regierung, MWG I/15, S. 451 (Zitat) und S. 459, sowie Weber, Bürokratismus, MWG I/22-4, S. 205 f.).
24
und die Infallibilität (als materiale universale „Kompetenz“, nur „ex cathedra“, im Amt, fungierend, also unter der typischen Scheidung von „Amt“ und ,,Privat“-Tätigkeit)„Universalepiskopat“ bedeutete zunächst, daß jeder Bischof ein Nachfolger Petri und insofern Bischof der ganzen Kirche sei. Mit dem Ersten Vatikanum fixierte die katholische Kirche den Primat des Papstes in diesem Gesamtvertretungsanspruch endgültig; das galt auch für alle Verwaltungs- und Rechtsfragen der Kirche. Vgl. Sohm, Kirchenrecht, S. 249 f.
25
sind typisch bureaukratische Erscheinungen. Ganz ebenso der großkapitalistische Betrieb, je größer desto mehr, und nicht minder der Parteibetrieb (von dem gesondert zu reden sein wird)Die „Infallibilität“ wurde in der „Constitutio de ecclesia Christi“ vom Ersten Vatikanum am 18. Juli 1870 zum Dogma erhoben. Es besagt, daß die Äußerungen des Papstes in Fragen der Glaubens- und Sittenlehre unfehlbar sind, wenn er „ex cathedra“, d. h. in seiner amtlichen Eigenschaft als Lehrer der Christenheit und in „Vollgewalt seiner apostolischen Autorität“, spricht. Das bedeutet nicht, daß er als Privatperson und in anderen Dingen unfehlbar ist.
26
oder das durch, „Offiziere“ genannte, militärische Beamte besonderer Art geführte moderne bureaukratische Heer. „Parteien“ werden zwar in Kap. III, § 18, unten, S. 566–573, behandelt, aber auch dort (S. 571 mit Hg.-Anm. 17) wird auf eine gesonderte Abhandlung über die Organisationsformen der Parteien verwiesen, die nicht überliefert ist.
2. Die bureaukratische Herrschaft ist da am reinsten durchgeführt, wo das Prinzip der Ernennung der Beamten am reinsten herrscht. Eine Wahlbeamten-Hierarchie gibt es im gleichen Sinne wie die Hierarchie der ernannten Beamten nicht: schon die Disziplin vermag ja natürlich niemals auch nur annähernd die gleiche Strenge zu erreichen, wo der unterstellte Beamte auf Wahl ebenso zu pochen vermag wie der übergeordnete und nicht von dessen Urteil seine Chancen abhängen. (S[iehe] über die Wahlbeamten unten § 14.)
27
Kap. III, § 14, unten, S. 534 f. und 539 f.
3. Kontrakts-Anstellung, also freie Auslese, ist der modernen Bureaukratie wesentlich. Wo unfreie Beamte (Sklaven, Ministeriale) in hierarchischer Gliederung mit sachlichen Kompetenzen, also in formal bureaukratischer Art, fungieren, wollen wir von „Patrimonialbureaukratie“ sprechen.
4. Das Ausmaß der Fachqualifikation ist in der Bureaukratie in stetem Wachsen. Auch der Partei- und Gewerkschaftsbeamte bedarf des fachmäßigen (empirisch erworbenen) Wissens. Daß die modernen „Minister“ und „Staatspräsidenten“ die einzigen „Beamten“ sind, für die keine Fachqualifikation verlangt wird, beweist: daß sie Beamte nur im formalen, nicht im [462]materialen Sinne sind, ganz ebenso wie der „Generaldirektor“ eines großen Privataktienbetriebs. Vollends der kapitalistische Unternehmer ist ebenso appropriiert wie der „Monarch“. Die bureaukratische Herrschaft hat also an der Spitze unvermeidlich ein mindestens nicht rein bureaukratisches Element. Sie ist nur eine Kategorie der Herrschaft durch einen besonderen Verwaltungsstab.
5. Das feste Gehalt ist das Normale. (Appropriierte Sporteleinnahmen wollen wir als „Pfründen“ bezeichnen: über den Begriff s. § 7).
28
Ebenso das Geldgehalt. Es ist durchaus nicht begriffswesentlich, entspricht aber doch am reinsten dem Typus. (Naturaldeputate haben „Pfründen“-Charakter. Pfründe ist normalerweise eine Kategorie der Appropriation von Erwerbschancen und Stellen.) Aber die Übergänge sind hier völlig flüssig, wie gerade solche Beispiele zeigen. Die Appropriationen kraft Amtspacht, Amtskauf, Amtspfand gehören einer andern Kategorie als der reinen Bureaukratie an (§ 7, 1).[462]Der Begriff „Pfründe“ wird erst in Kap III, § 8, unten, S. 481–483, erläutert.
29
Diese Formen der Appropriation behandelt Weber erst in Kap. III, § 7a, unten, S. 477–481.
6. „Ämter“ im „Nebenberuf“ und vollends „Ehrenämter“ gehören in später (§ 14 unten)
30
zu erörternde Kategorien. Der typische „bureaukratische“ Beamte ist Hauptberufsbeamter. Dazu äußert sich Weber erst in Kap. III, §§ 19 und 20, S. 573–578.
[A 128]7. Die Trennung von den Verwaltungsmitteln ist in der öffentlichen und der Privatbureaukratie (z. B. im großkapitalistischen Unternehmen) genau im gleichen Sinn durchgeführt.
8. Kollegiale „Behörden“ werden weiter unten (§ 15) gesondert betrachtet werden.
31
Sie sind in schneller Abnahme zugunsten der faktisch und meist auch formal monokratischen Leitung begriffen (z. B. waren die kollegialen „Regierungen“ in Preußen längst dem monokratischen Regierungspräsidenten gewichen).Kap. III, § 15, unten, S. 542–562.
32
Das Interesse an schneller, eindeutiger, daher von Meinungskompromissen und Meinungsumschlägen der Mehrheit freier Verwaltung ist dafür entscheidend. Im Zuge der Stein-Hardenbergschen Reformen wurden die kollegialischen Kriegs- und Domänenkammern als Träger der preußischen Provinzialverwaltung 1808 durch die Behörde des Regierungspräsidenten abgelöst. Der Regierungspräsident fungierte als leitender Beamter eines Regierungsbezirks und war dem Innenministerium in Berlin direkt unterstellt.
9. Selbstverständlich sind moderne Offiziere eine mit ständischen Sondermerkmalen, von denen andern Orts (Kap. IV) zu reden ist,
33
ausgestattete Kategorie von ernannten Beamten, ganz im Gegenteil zu Wahl[463]führernIm unvollendeten Kap. IV liegen entsprechende Ausführungen nicht vor.
h
einerseits, charismatischen (§ 10)[463]Zu erwarten wäre: Jagdführern
34
Kondottieren andererseits, kapitalistischen Unternehmeroffizieren (Soldheer) drittens, Offizierstellen-Käufern (§ 8)[463]In Kap. III, § 10, unten, S. 490–497, allerdings ohne jeden Bezug auf Kondottiere, dagegen auf Jagdführer und Kriegshelden (S. 490, Z. 22). – Der Ausdruck „Wahlführer“ kommt im Gesamtwerk Max Webers sonst nicht vor. Gemeint ist der gewählte Führer eines Heeres oder Heereskontingents. Dies war in früher Zeit der „Jagdführer“; vgl. dazu auch die textkritische Anm. h.
35
viertens. Die Übergänge können flüssig sein. Die patrimonialen „Diener“, getrennt von den Verwaltungsmitteln[,] und die kapitalistischen Heeresunternehmer sind ebenso wie, oft, die kapitalistischen PrivatunternehmerDer Sachverhalt wird in Kap. III, § 7a, unten, S. 481, Z. 1 f., kurz erwähnt.
i
Vorläufer der modernen Bureaukratie gewesen. Davon später im einzelnen.A: Privatunternehmer,
36
Zur Bürokratisierung der Heeresverwaltung findet sich lediglich ein Exkurs in der älteren Fassung von „Wirtschaft und Gesellschaft“, Weber, Bürokratismus, MWG I/22-4, S. 198–200. Neuere Ausführungen sind nicht überliefert.
§ 5. Die rein bureaukratische, also: die bureaukratisch-monokratische aktenmäßige Verwaltung ist nach allen Erfahrungen die an Präzision, Stetigkeit, Disziplin, Straffheit und Verläßlichkeit, also: Berechenbarkeit für den Herren wie für die Interessenten, Intensität und Extensität der Leistung, formal universeller Anwendbarkeit auf alle Aufgaben, rein technisch zum Höchstmaß der Leistung vervollkommenbare, in all diesen Bedeutungen: formal rationalste, Form der Herrschaftsausübung. Die Entwicklung „moderner“ Verbandsformen auf allen Gebieten (Staat, Kirche, Heer, Partei, Wirtschaftsbetrieb, Interessentenverband, Verein, Stiftung und was immer es sei) ist schlechthin identisch mit Entwicklung und stetiger Zunahme der bureaukratischen Verwaltung: ihre Entstehung ist z. B. die Keimzelle des modernen okzidentalen Staats. Man darf sich durch alle scheinbaren Gegeninstanzen, seien es kollegiale Interessentenvertretungen oder Parlamentsausschüsse oder „Räte-Diktaturen“
37
oder Ehrenbeamte oder Laienrichter oder was immer (und voll[464]ends durch das Schelten über den „hl. Bureaukratius“)Während der revolutionären Umbruchphase stützten sich in Deutschland (im Gegensatz zur Sowjetrepublik) die meisten der durch die Räte legitimierten Regierungen auf den alten Verwaltungsapparat. Vgl. dazu die Ausführungen Max Webers, unten, S. 531 f. mit Hg.-Anm. 53 und 57 zu Rußland.
38
nicht einen Augenblick darüber täuschen lassen, daß alle kontinuierliche Arbeit durch Beamte in Bureaus erfolgt. Unser gesamtes Alltagsleben ist in diesen Rahmen eingespannt. Denn wenn die bureaukratische Verwaltung überall die – ceteris paribus! – formal-technisch rationalste ist, so ist sie für die Bedürfnisse der Massenverwaltung (personalen oder sachlichen) heute schlechthin unentrinnbar. Man hat nur die Wahl zwischen „Bureaukratisierung“ und „Dilettantisierung“ der Verwaltung, und das große Mittel der Überlegenheit der bureaukratischen Verwaltung ist: Fachwissen, dessen völlige Unentbehrlichkeit durch die moderne Technik und Ökonomik der Güterbeschaffung bedingt wird, höchst einerlei[,] ob diese kapitalistisch oder – was, wenn die gleiche technische Leistung erzielt werden sollte, nur eine ungeheure Steigerung der Bedeutung der Fachbureaukratie bedeuten würde – sozialistisch organisiert ist[464]Zitat aus der 1900 erstmals gespielten Komödie „Flachsmann als Erzieher“ von Otto Ernst (Ps. für O. E. Schmidt) und 1912 als „geflügeltes Wort“ aufgenommen bei: Büchmann, Georg, Gefügelte Worte. Zitatenschatz des deutschen Volkes, 25. Aufl., bearb. von Bogdan Krieger. – Berlin: Haude & Spener 1912, S. 266.
k
. Wie die Beherrschten sich einer bestehenden bureaukratischen Herrschaft normalerweise nur erwehren können durch Schaffung einer eigenen, ebenso der Bureaukratisierung ausgesetzten Gegenorganisation, so ist auch der bureaukratische Apparat selbst durch zwingende Interessen materieller und rein sachlicher, also: ideeller Art an sein eigenes Weiterfunktionieren gebunden: Ohne ihn würde in einer Gesellschaft mit Trennung des Beamten, Angestellten, Arbeiters[464]A: sind
l
von den Verwaltungsmitteln und Unentbehrlichkeit der Disziplin und Geschultheit die moderne Existenzmöglichkeit für alle außer die noch im Besitz der Versorgungsmittel befindlichen (die Bauern) aufhören. Er funktioniert für die zur Gewalt gelangte Revolution und für den okkupierenden Feind normalerweise einfach weiter wie für die bisher legale Regierung. Stets ist die Frage: wer beherrscht den bestehenden bureaukratischen Apparat? Und stets ist seine Beherrschung dem Nicht-[A 129]Fachmann nur begrenzt möglich: der Fach-Geheimrat ist dem Nichtfach[465]mann als Minister auf die Dauer meist überlegen in der Durchsetzung seines Willens. Der Bedarf nach stetiger, straffer, intensiver und kalkulierbarer Verwaltung, wie ihn der Kapitalismus – nicht: nur er, aber allerdings und unleugbar: er vor allem – historisch geschaffen hat (er kann ohne sie nicht bestehen) und jeder rationale SozialismusA: Arbeiters,
39
einfach übernehmen müßte und steigern würde, bedingt diese Schicksalhaftigkeit der Bureaukratie als des Kerns jeder Massenverwaltung. Nur der (politische, hierokratische, vereinliche, wirtschaftliche) Kleinbetrieb könnte ihrer weitgehend entraten. Wie der Kapitalismus in seinem heutigen Entwicklungsstadium die Bureaukratie fordert – obwohl er und sie aus verschiedenen geschichtlichen Wurzeln gewachsen sind –, so ist er auch die rationalste, weil fiskalisch die nötigen Geldmittel zur Verfügung stellende, wirtschaftliche Grundlage, auf der sie[465]Zum Begriff „rationaler Sozialismus“ bzw. „rationalsozialistisch“ vgl. Kap. II, oben, S. 292 mit Hg.-Anm. 12.
m
in rationalster Form bestehen kann. [465]A: er
Neben den fiskalischen Voraussetzungen bestehen für die bureaukratische Verwaltung wesentlich verkehrstechnische Bedingungen. Ihre Präzision fordert Eisenbahn, Telegramm, Telephon und ist zunehmend an sie gebunden. Daran könnte eine sozialistische Ordnung nichts ändern. Die Frage wäre (s. Kap. II, § 12),
40
ob sie in der Lage wäre, ähnliche Bedingungen für eine rationale, und das hieße gerade für sie: straff bureaukratische Verwaltung zu noch festeren formalen Regeln zu schaffen, wie die kapitalistische Ordnung. Wenn nicht, – so läge hier wiederum eine jener großen Irrationalitäten: Antinomie der formalen und materialen Rationalität, vor, deren die Soziologie so viele zu konstatieren hat. Mit dem Verweis auf Kap. II, § 12, oben, S. 273–285, dürfte Weber insbes. die Auseinandersetzung mit den Sozialisierungsthesen von Otto Neurath (oben, S. 280–285) meinen. Fortgesetzt wird die Problemstellung Verkehrs- versus Plan- bzw. Verwaltungswirtschaft in Kap. II, §§ 13 und 14, oben, S. 285–295.
Die bureaukratische Verwaltung bedeutet: Herrschaft kraft Wissen: dies ist ihr spezifisch rationaler Grundcharakter. Über die durch das Fachwissen bedingte gewaltige Machtstellung hinaus hat die Bureaukratie (oder der Herr, der sich ihrer bedient), [466]die Tendenz, ihre Macht noch weiter zu steigern durch das Dienstwissen: die durch Dienstverkehr erworbenen oder „aktenkundigen“ Tatsachenkenntnisse. Der nicht nur, aber allerdings spezifisch bureaukratische Begriff des „Amtsgeheimnisses“
41
– in seiner Beziehung zum Fachwissen etwa den kommerziellen Betriebsgeheimnissen gegenüber den technischen vergleichbar – entstammt diesem Machtstreben. [466]Der Begriff des „Amtsgeheimnisses“ stammt aus der Zeit des Absolutismus, aber auch die modernen Staaten verpflichten die Beamten zur Amtsverschwiegenheit, so z. B. im Deutschen Kaiserreich durch § 11 des Reichsbeamtengesetzes von 1873, der auch in der Weimarer Republik (Gesetz vom 21. Juli 1922) Gültigkeit behielt. Die Verletzung der Schweigepflicht kann dienst-, arbeits- und ggf. auch strafrechtlich geahndet werden.
Überlegen ist der Bureaukratie an Wissen: Fachwissen und Tatsachenkenntnis, innerhalb seines Interessenbereichs, regelmäßig nur: der private Erwerbsinteressent. Also: der kapitalistische Unternehmer. Er ist die einzige wirklich gegen die Unentrinnbarkeit der bureaukratischen rationalen Wissens-Herrschaft (mindestens: relativ) immune Instanz. Alle anderen sind in Massenverbänden der bureaukratischen Beherrschung unentrinnbar verfallen, genau wie der Herrschaft der sachlichen Präzisionsmaschine in der Massengüterbeschaffung.
Die bureaukratische Herrschaft bedeutet sozial im allgemeinen:
1. die Tendenz zur Nivellierung im Interesse der universellen Rekrutierbarkeit aus den fachlich Qualifiziertesten,
2. die Tendenz zur Plutokratisierung im Interesse der möglichst lang (oft bis fast zum Ende des dritten Lebensjahrzehnts) dauernden Facheinschulung,
42
Gemeint ist die Alimentierung der Ausbildungszeit durch das Privatvermögen.
3. die Herrschaft der formalistischen Unpersönlichkeit: sine ira et studio,
43
ohne Haß und Leidenschaft, daher ohne „Liebe“ und „Enthusiasmus“, unter dem Druck schlichter Pflichtbegriffe; „ohne Ansehen der Person“,Der Ausdruck findet sich zuerst bei Tacitus, Annales 1,1, der beanspruchte, die Geschichte Roms „ohne Zorn und Eifer“ darzustellen.
44
formal gleich für „jeder[467]mann“, d. h. jeden in gleicher faktischer Lage befindlichen Interessenten, waltet der ideale Beamte seines Amtes. Dem Neuen Testament entnommener Ausdruck: „ohne Ansehen der Person richtet [Gott] nach eines jeglichen Werk“ (1. Brief des Petrus 1,17).
Wie aber die Bureaukratisierung ständische Nivellierung (der normalen, historisch auch als normal erweislichen Tendenz nach) schafft, so fördert umgekehrt jede soziale Nivellierung, indem sie den ständischen, kraft Appropriation der Verwaltungsmittel und der Verwaltungsgewalt, Herrschenden und[,] im Interesse der „Gleichheit“, den kraft Besitz zu „ehrenamtlicher“ oder „nebenamtlicher“ [A 130]Verwaltung befähigten Amtsinhaber beseitigt, die Bureaukratisierung, die überall der unentrinnbare Schatten der vorschreitenden „Massendemokratie“ ist, – wovon eingehender in anderem Zusammenhang.
45
[467]In der älteren Fassung der Herrschaftssoziologie, Weber, Bürokratismus, MWG I/22-4, S. 201 f., angesprochen. Neuere Ausführungen sind nicht überliefert, vgl. dazu die Übersicht zum Editorischen Bericht, oben, S. 111 und 114–117.
Der normale „Geist“ der rationalen Bureaukratie ist, allgemein gesprochen:
1. Formalismus, gefordert von allen an Sicherung persönlicher Lebenschancen gleichviel welcher Art Interessierten, – weil sonst Willkür die Folge wäre, und der Formalismus die Linie des kleinsten Kraftmaßes ist. Scheinbar und zum Teil wirklich im Widerspruch mit dieser Tendenz dieser Art von Interessen steht
2. die Neigung der Beamten zu material-utilitarisch gerichteter Behandlung ihrer Verwaltungsaufgaben im Dienst der zu beglückenden Beherrschten. Nur pflegt sich dieser materiale Utilitarismus in der Richtung der Forderung entsprechender – ihrerseits wiederum: formaler und in der Masse der Fälle formalistisch behandelter – Reglements zu äußern. (Darüber in der Rechtssoziologie.)
46
Unterstützung findet diese Tendenz zur materialen Rationalität von seiten aller derjenigen Beherrschten, welche nicht zu der unter Nr. 1In der älteren Fassung der Rechtssoziologie wird das Reglement vor dem Hintergrund der Scheidung in öffentliches und privates Recht behandelt, Weber, Recht, MWG I/22-3, S. 275 f., 280–282. Hier als Hinweis auf eine neue Fassung der „Rechtssoziologie“ zu lesen.
47
bezeichneten Schicht der [468]an „Sicherung“ besessener Chancen InteressiertenOben, Zeile 15 ff.
n
gehören. Die daher rührende Problematik gehört in die Theorie der „Demokratie“. [468]A: Interessierten gegen besessene Chancen
3. Traditionale Herrschaft.
§ 6. Traditional soll eine Herrschaft heißen, wenn ihre Legitimität sich stützt und geglaubt wird auf Grund der Heiligkeit altüberkommener („von jeher bestehender“) Ordnungen und Herrengewalten. Der Herr (oder: die mehreren Herren) sind kraft traditional überkommener Regel bestimmt. Gehorcht wird ihnen kraft der durch die Tradition ihnen zugewiesenen Eigenwürde. Der Herrschaftsverband ist, im einfachsten Fall, primär ein durch Erziehungsgemeinsamkeit bestimmter Pietätsverband. Der Herrschende ist nicht „Vorgesetzter“, sondern persönlicher Herr, sein Verwaltungsstab sind
o
primär nicht „Beamte“, sondern persönliche „Diener“, die Beherrschten nicht „Mitglieder“ des Verbandes, sondern entweder: 1. „traditionale Genossen“ (§ 7)Fehlt in A; sind sinngemäß ergänzt.
48
oder 2. „Untertanen“. Nicht sachliche Amtspflicht, sondern persönliche Dienertreue bestimmten die Beziehungen des Verwaltungsstabes zum Herrn. [468]Der Sachverhalt wird erst in Kap. III, § 7a, unten, S. 475, angesprochen.
Gehorcht wird nicht Satzungen, sondern der durch Tradition oder durch den traditional bestimmten Herrscher dafür berufenen Person, deren Befehle legitim sind in zweierlei Art:
a) teilweise kraft eindeutig den Inhalt der Anordnungen bestimmender Tradition und in deren geglaubtem Sinn und Ausmaß, welches durch Überschreitung der traditionalen Grenzen zu erschüttern für die eigene traditionale Stellung des Herrn gefährlich werden könnte,
b) teilweise kraft der freien Willkür des Herren, welcher die Tradition den betreffenden Spielraum zuweist.
Diese traditionale Willkür beruht primär auf der prinzipiellen Schrankenlosigkeit von pietätspflichtmäßiger Obedienz.
Es existiert also das Doppelreich
[469]a) des material traditionsgebundenen Herrenhandelns,
b) des material traditionsfreien Herrenhandelns.
Innerhalb des letzteren kann der Herr nach freier Gnade und Ungnade, persönlicher Zu- und Abneigung, und rein persönlicher, insbesondere auch durch Geschenke – die Quellen der „Gebühren“ – zu erkaufender Willkür „Gunst“ erweisen. Soweit er da nach Prinzipien verfährt, sind dies solche der materialen ethischen Billigkeit, Gerechtigkeit oder der utilitarischen Zweckmäßigkeit, nicht aber
p
– wie bei der legalen Herrschaft: – formale Prinzipien. Die tatsächliche Art der Herrschaftsausübung richtet sich darnach: was üblicherweise der Herr (und sein Verwaltungsstab) sich gegenüber der traditionalen Fügsamkeit der Unter[A 131]tanen gestatten dürfen, ohne sie zum Widerstand zu reizen. Dieser Widerstand richtet sich, wenn er entsteht, gegen die Person des Herren (oder: Dieners), der die traditionalen Schranken der Gewalt mißachtete, nicht aber: gegen das System als solches („traditionalistische Revolution“).[469]A: aber,
49
[469]Der Begriff wird trotz Ankündigung (unten, S. 471 mit Hg.-Anm. 54) nicht erläutert. In einer Nachschrift zu Webers Vorlesung Staatssoziologie 1920 heißt es zu traditionalistischen Revolutionen: „An die Stelle des alten Herrn, der die Tradition übertritt, wird ein neuer, aber ebenso traditionaler Beamter gesetzt, der die Tradition anerkennt! China, Großwezir“ (Weber, Staatssoziologie, MWG III/7, S. 84).
Recht oder Verwaltungsprinzipien durch Satzung absichtsvoll neu zu „schaffen“, ist bei reinem Typus der traditionalen Herrschaft unmöglich. Tatsächliche Neuschöpfungen können sich also nur als von jeher geltend und nur durch „Weistum“ erkannt legitimieren. Als Orientierungsmittel für die Rechtsfindung kommen nur Dokumente der Tradition: „Präzedenzien und Präjudizien“ in Frage.
§ 7. Der Herr herrscht entweder 1. ohne oder 2. mit Verwaltungsstab. Über den ersten Fall s. § 6 Nr. 1.
50
Zur Herrschaft ohne persönlichen Verwaltungsstab siehe Kap. III, § 7a, Nr. 1, unten, S. 475 f.
Der typische Verwaltungsstab kann rekrutiert sein aus:
[470]a) traditional, durch Pietätsbande, mit dem Herren Verbundenen („patrimonial rekrutiert“):
α. Sippenangehörigen,
ß. Sklaven,
γ. haushörigen Hausbeamten
q
, insbesondere: „Ministerialen“, [470]A: haushörige Hausbeamte
δ. Klienten,
ε. Kolonen,
ζ.
r
Freigelassenen; A: ξ.
b) („extrapatrimonial rekrutiert“ aus:)
α. persönlichen Vertrauensbeziehungen (freie „Günstlinge“ aller Art) oder
ß. Treubund mit dem zum Herrn Legitimierten (Vasallen), endlich
s
A: (Vasallen) endlich.
γ. freien, in das Pietätsverhältnis zu ihm eintretenden Beamten
t
. A: freie, in das … eintretende Beamte
Zu a α) Es ist ein sehr oft sich findendes Verwaltungsprinzip traditionalistischer Herrschaften, die wichtigsten Stellungen mit Angehörigen der Herrensippe zu besetzen.
Zu a ß): Sklaven und (a ζ) Freigelassene finden sich in patrimonialen Herrschaften oft bis in die höchsten Stellungen (frühere Sklaven als Großveziere waren nicht selten).
51
[470]Von den Großwesiren im Osmanischen Reich waren Sklaven bzw. Freigekaufte beispielsweise Ibrahim Pascha, Großwesir unter Süleyman dem Prächtigen 1523–1536, der die Verhandlungen mit den Habsburgern wegen der Belagerung Wiens führte, oder noch im 19. Jahrhundert Ibrahim Edhem Pascha aus Chios unter Sultan Abdülhamid II. (1877/78) oder Khereddin Pascha, tscherkessischer Herkunft und vom Sultan zur Reform des Staats- und Finanzwesens berufen (1878/79).
Zu a γ) Die typischen Hausbeamten: Seneschall (Großknecht), Marschall (Pferdeknecht), Kämmerer, Truchseß, Hausmeier (Vorsteher des Gesindes und eventuell der Vasallen) finden sich in Europa überall. Im Orient treten als besonders wichtig der Großeunuch (Haremswächter), bei den Negerfürsten oft der Henker, außerdem überall oft der Leibarzt, Leibastrologe und ähnliche Chargen hinzu.
Zu a δ) Die Königsklientel ist in China wie in Ägypten die Quelle des patrimonialen Beamtentums gewesen.
[471]Zu a ε) Kolonenheere hat der ganze Orient, aber auch die Herrschaft der römischen Nobilität gekannt.
52
(Noch der islamische Orient der Neuzeit kannte Sklavenheere.)[471]Kolonenaufgebote der römischen Großgrundbesitzer hat es – wie Weber, Die Stadt, MWG I/22-5, S. 278 mit Hg.-Anm. 223, erwähnt – noch in der Bürgerkriegszeit gegeben.
53
Als Sklavenheer können die Janitscharen, die als Elitetruppe im Osmanischen Reich vom 14. Jahrhundert bis 1826 existierten, bezeichnet werden. Die Truppe beruhte auf Zwangsrekrutierung und -bekehrung von christlichen Knaben, wodurch sie zu Sklaven des Sultans wurden. Vgl. dazu auch Weber, Patrimonialismus, MWG I/22-4, S. 268 f.
Zu b α) Die „Günstlings“-Wirtschaft ist jedem Patrimonialismus spezifisch und oft Anlaß „traditionalistischer Revolutionen“ (Begriff s. am Schluß des §).
54
Der Begriff wird weder am Ende des § 7 noch an anderer Stelle in Kap. III erläutert.
Zu b ß) Über die „Vasallen“ ist gesondert zu sprechen.
55
Dazu in Kap. III, § 12 b „Feudalismus“, unten, S. 513–520. Aus der Verweisformulierung geht hervor, daß Ausführungen über das Lehnswesen zunächst offenbar nicht als Teil von Kap. III geplant waren.
Zu b γ) Die „Bureaukratie“ ist in Patrimonialstaaten zuerst entstanden, als Beamtentum mit extrapatrimonialer Rekrutierung. Aber diese Beamten waren, wie bald zu erwähnen,
56
zunächst persönliche Diener des Herren. Zum Hinweis auf die Pfründner als extrapatrimonial rekrutierte Beamte unten, S. 473 f., unter „Zu c)“.
Es fehlt dem Verwaltungsstab der traditionalen Herrschaft im reinen Typus:
a) die feste „Kompetenz“ nach sachlicher Regel,
b) die feste rationale Hierarchie,
c) die geregelte Anstellung durch freien Kontrakt und das geregelte Aufrücken,
d) die Fachgeschultheit (als Norm),
e) (oft) der feste und (noch öfter) der in Geld gezahlte Gehalt.
Zu a) An Stelle der festen sachlichen Kompetenz steht die Konkurrenz der vom Herren zunächst nach freier Willkür gegebenen jeweiligen, dann dauernd werdenden, schließlich oft traditional stereotypierten Aufträge und Vollmachten unter[A 132]einander, die insbesondre durch die Konkurrenz um die ebenso den Beauftragten wie dem Herren selbst bei Inanspruchnahme ihrer Bemühungen zustehenden Sportelchancen geschaffen wird: durch solche Interessen werden oft erstmalig die sachli[472]chen Zuständigkeiten und damit die Existenz einer „Behörde“ konstituiert.
Alle mit Dauerzuständigkeit versehenen Beauftragten sind zunächst Hausbeamte des Herren, ihre nicht hausgebundene („extrapatrimoniale) Zuständigkeit ist eine an ihren Hausdienst nach oft ziemlich äußerlichen sachlichen Verwandtschaften des Tätigkeitsgebiets angelehnte oder nach zunächst ganz freiem Belieben des Herren, welches später traditional stereotypiert wird, ihnen zugewiesene Zuständigkeit. Neben den Hausbeamten gab es primär nur Beauftragte ad hoc.
Der fehlende „Kompetenz“-Begriff ergibt sich leicht bei Durchmusterung etwa der Liste der Bezeichnungen altorientalischer Beamter.
57
Es ist – mit seltenen Ausnahmen – unmöglich, eine rational abgegrenzte sachliche Tätigkeitssphäre nach Art unserer „Kompetenz“ als dauernd feststehend zu ermitteln. [472]Eine solche Liste mit ca. 200 Beamtentiteln ist aus neuassyrischer Zeit überliefert. Die sog. „große Beamtenliste“ galt in der zeitgenössischen Forschung als die „einzige zusammenfassende Aufzählung von Berufs- und Beamtennamen aus assyrischer Zeit“ (vgl. Klauber, Ernst, Assyrisches Beamtentum nach Briefen aus der Sargonidenzeit. – Leipzig: J. C. Hinrichs’sche Buchhandlung 1910, S. 2 f.). Feste Amtskompetenzen gab es nicht, wie Klauber betont (ebd., S. 37), so daß beispielsweise der Mundschenk auch mit besonderen Missionen und Feldzügen betraut werden konnte (ebd., S. 73 f.). Vgl. dazu auch Weber, Patrimonialismus, MWG I/22-4, S. 293 mit Hg.-Anm. 17.
Die Tatsache der Abgrenzung faktischer Dauerzuständigkeiten durch Konkurrenz und Kompromiß von Sportelinteressen ist insbesondere im Mittelalter zu beobachten. Die Wirkung dieses Umstandes ist eine sehr weitreichende gewesen. Sportelinteressen der mächtigen Königsgerichte und des mächtigen nationalen Anwaltsstandes haben in England die Herrschaft des römischen und kanonischen Rechts teils vereitelt, teils begrenzt.
58
Die irrationale Abgrenzung zahlreicher Amtsbefugnisse aller Epochen war [473]durch die einmal gegebene Abgrenzung der Sportelinteressensphären stereotypiert. Die großen Gerichtshöfe (Common Pleas, King’s Bench, Court of Exchequer und Chancery) folgten dem Gewohnheitsrecht (Common law) oder der Billigkeitsgerichtsbarkeit (Equity). Den Widerstand der Richter und Anwälte gegen den Fremdeinfluß des römischen und kanonischen Rechtes erklärt Julius Hatschek auch durch den „Brodneid der Juristen des Common law“ (vgl. Hatschek, Julius, Englisches Staatsrecht mit Berücksichtigung der für Schottland und Irland geltenden Sonderheiten, 2 Bde. – Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) 1905/06, Band 1, S. 11; hinfort: Hatschek, Englisches Staatsrecht l–ll). Im Gegensatz zu dem nach römischem Recht verfahrenden Admiralitätshof, dem nur ein Richter vorsaß, waren die o.g. Gerichtshöfe mit bis zu neun Richtern besetzt (ebd., Band 2, S. 160). Die Ausbildung der Anwälte erfolgte nicht an Universitäten, sondern durch die Anwaltsinnungen.
Zu b) Die Bestimmung, ob und an welche
u
Beauftragten oder ob von dem Herren selbst die Entscheidung eines Gegenstandes oder einer Beschwerde dagegen erledigt werden soll, ist entweder [473]Zu erwarten wäre: von welchen
α. traditional, zuweilen unter Berücksichtigung der Provenienz bestimmter von außen her übernommener Rechtsnormen oder Präzedenzien (Oberhof-System)
59
geregelt, oder [473]Der Oberhof, ein von Schöffen oder Ratsleuten besetztes Gericht, erteilte auf Anfrage Rechtsweisungen und entwickelte sich zu einer Art Berufungsgericht für andernorts gefällte Urteile. Durch Gewohnheit oder landesherrliche Zuweisung entstanden somit im Spätmittelalter Rechtskreise oder sog. ,Stadtrechtsfamilien‘, wie das Lübische oder das Magdeburgische Recht. Man kann von einem eigenen Rechtsverfahren sprechen, das vor allem mit der Entwicklung des Städtewesens zusammenhing.
ß. völlig dem jeweiligen Belieben des Herrn anheimgestellt, dem, wo immer er persönlich erscheint, alle Beauftragten weichen.
Neben dem traditionalistischen Oberhof-System steht das aus der Sphäre der Herrenmacht stammende deutschrechtliche Prinzip: daß dem anwesenden Herm alle Gerichtsbarkeit ledig wird,
60
das aus der gleichen Quelle und der freien Herrengnade stammendeDer Ausdruck, daß einem etwas ledig wird, stammt aus dem Lehnsrecht und bedeutet, daß dem Lehnsherrn ein Lehen wieder zufällt. Bei persönlicher Anwesenheit des Herrn fiel die Gerichtsgewalt an ihn zurück und er hatte über alle noch anhängigen Streitigkeiten zu entscheiden.
v
jus evocandiA: stehende
61
und sein moderner Ableger: die „Kabinettsjustiz“.Im Heiligen Römischen Reich (deutscher Nation) besaß der König das Recht, jedes Verfahren, das an einem lokalen Gericht anhängig war, an seinen Gerichtshof (Reichsgerichtshof) oder an ein anderes Reichsgericht zu ziehen („ius evocandi“).
62
Der „Oberhof“ ist im Mittelalter besonders oft die Rechtsweisungsbehörde, von welcher aus das Recht eines Orts importiert ist. Bezeichnung für die unmittelbare Einmischung des Herrschers oder seines Kabinetts in die allgemeine Rechtspflege, speziell in anhängige Rechtsstreitigkeiten vor Gericht.
Zu c) Die Hausbeamten und Günstlinge sind sehr oft rein patrimonial rekrutiert: Sklaven oder Hörige (Ministerialen) des Herren. Oder sie sind, wenn extrapatrimonial rekrutiert, Pfründ[474]ner (s. u.),
63
die er nach formal freiem Ermessen versetzt. Erst der Eintritt freier Vasallen und die Verleihung der Ämter kraft Lehenskontrakts ändert dies grundsätzlich, schafft aber, – da die Lehen keineswegs durch sachliche Gesichtspunkte in Art und Ausmaß bestimmt werden, – in den Punkten a und b keine Änderung. Ein Aufrücken gibt es, außer unter Umständen bei präbendaler Struktur des Verwaltungsstabes (s. § 8),[474]Unten, Kap. III, § 8, S. 481.
64
nur nach Willkür und Gnade des Herren. Unten, Kap. III, § 8, S. 481–483.
Zu d) Rationale Fachgeschultheit als prinzipielle Qualifikation fehlt primär allen Hausbeamten und Günstlingen des Herren. Der Beginn der Fachschulung der Angestellten (gleichviel welcher Art) macht überall Epoche in der Art der Verwaltung.
Ein gewisses Maß empirischer Schulung ist für manche Ämter schon sehr früh erforderlich gewesen. Indessen vor allem die Kunst zu lesen und zu schreiben, ursprünglich wirklich noch eine „Kunst“ von hohem Seltenheitswert, hat oft – wichtigstes Beispiel: China – durch die Art der Lebensführung der Literaten die ganze Kulturentwicklung entscheidend beeinflußt und die intrapatrimo[A 133]niale Rekrutierung der Beamten beseitigt, dadurch also die Macht des Herren „ständisch“ (s. Nr. 3)
65
beschränkt. Kap. III, § 7a, Nr. 3, unten, S. 477–479.
Zu e) Die Hausbeamten und Günstlinge werden primär am Tisch des Herrn und aus seiner Kammer verpflegt und equipiert. Ihre Abschichtung vom Herrentisch bedeutet in aller Regel Schaffung von (zunächst: Natural-)Pfründen, deren Art und Ausmaß sich leicht stereotypiert. Daneben (oder statt ihrer) stehen den außerhaushaltsmäßig beauftragten Organen des Herren regelmäßig ebenso wie ihm selbst „Gebühren“ zu (oft ohne jede Tarifierung von Fall zu Fall mit den um eine „Gunst“ sich Bewerbenden vereinbart).
Über den Begriff der „Pfründe“ s. gleich.
66
Kap. III, § 8, unten, S. 481.
[475]§ 7a. 1. Die primären Typen der traditionalen Herrschaft sind die Fälle des Fehlens eines persönlichen Verwaltungsstabs des Herrn:
a) Gerontokratie und
b) primärer Patriarchalismus.
Gerontokratie heißt der Zustand, daß, soweit überhaupt Herrschaft im Verband geübt wird, die (ursprünglich im wörtlichen Sinn: an Jahren) Ältesten, als beste Kenner der heiligen Tradition, sie ausüben. Sie besteht oft für nicht primär ökonomische oder familiale Verbände. Patriarchalismus heißt der Zustand, daß innerhalb eines, meist, primär ökonomischen und familialen (Haus-)Verbandes ein (normalerweise) nach fester Erbregel bestimmter einzelner die Herrschaft ausübt. Gerontokratie und Patriarchalismus stehen nicht selten nebeneinander. Entscheidend ist dabei: daß die Gewalt der Gerontokraten sowohl wie des Patriarchen im reinen Typus an der Vorstellung der Beherrschten („Genossen“) orientiert ist: daß diese Herrschaft zwar traditionales Eigenrecht des Herren sei, aber material als präeminentes Genossenrecht, daher in ihrem, der Genossen, Interesse ausgeübt werden müsse, ihm also nicht frei appropriiert sei. Das, bei diesen Typen, völlige Fehlen eines rein persönlichen („patrimonialen“) Verwaltungsstabs des Herren ist dafür bestimmend. Der Herr ist daher von dem Gehorchenwollen
a
der Genossen noch weitgehend abhängig, da er keinen „Stab“ hat. Die Genossen sind daher noch „Genossen“, und noch nicht: „Untertanen“. Aber sie sind „Genossen“ kraft Tradition, nicht: „Mitglieder“ kraft Satzung. Sie schulden die Obödienz dem Herren, nicht der gesatzten Regel. Aber dem Herren allerdings nur: gemäß Tradition. Der Herr seinerseits ist streng traditionsgebunden. [475]A: Gehorchen wollen
Über die Arten der Gerontokratie s. später.
67
Primärer Patriarchalismus ist ihr insofern verwandt, als die Herrschaft nur innerhalb des Hauses obli[476]gat, im übrigen aber – wie bei den arabischen Schechs[475]Der Bezug ist unklar; Ältestenräte werden beispielsweise in Kap. III, § 15, unter h), unten, S. 546 f., genannt.
b
[476]Nebenform von: Scheichs
68
– nur exemplarisch, also nach Art der charismatischen durch Beispiel, oder aber: durch Rat und Einflußmittel wirkt. [476]Der Schech (oder: Scheich; „Ältester“, „Greis“) war bei den arabischen Beduinen das Stammesoberhaupt, im Gegensatz zum Muchtâr, dem Familienoberhaupt. Wie Weber, Das antike Judentum, MWG I/21, S. 252, schreibt, hing seine Vorrangstellung im Stamm von besonderer kriegerischer Leistung oder ,,schiedsrichterliche[r] Weisheit“ ab.
2. Mit dem Entstehen eines rein persönlichen Verwaltungs- (und: Militär-)Stabes des Herren neigt jede traditionale Herrschaft zum Patrimonialismus und im Höchstmaß der Herrengewalt: zum Sultanismus:
die „Genossen“ werden nun erst zu „Untertanen“, das bis dahin als präeminentes Genossenrecht gedeutete Recht des Herren zu seinem Eigenrecht, ihm in (prinzipiell) gleicher Art appropriiert wie irgendein Besitzobjekt beliebigen Charakters, verwertbar (verkäuflich, verpfändbar, erbteilbar) prinzipiell wie irgendeine wirtschaftliche Chance. Äußerlich stützt sich die patrimoniale Herrengewalt auf (oft: gebrandmarkte) Sklaven- oder Kolonen- oder gepreßte Untertanen-
c
oder – um die Interessengemeinschaft gegenüber den letzteren möglichst unlöslich zu machen – Sold-Leibwachen und -Heere (patrimoniale Heere). Kraft dieser Gewalt erweitert der Herr das Ausmaß der traditionsfreien Willkür, Gunst und Gnade auf Kosten der [A 134]patriarchalen und gerontokratischen Traditionsgebundenheit. Patrimoniale Herrschaft soll jede primär traditional orientierte, aber kraft vollen Eigenrechts ausgeübte, sultanistische eine in der Art ihrer Verwaltung sich primär in der Sphäre freier traditionsungebundener Willkür bewegende Patrimonialherrschaft heißen. Der Unterschied ist durchaus fließend. Vom primären Patriarchalismus scheidet beide, auch den Sultanismus, die Existenz des persönlichen Verwaltungsstabs. A: Untertanen
Die sultanistische Form des Patrimonialismus ist zuweilen, dem äußeren Anscheine nach, – in Wahrheit: nie wirklich – völlig traditionsungebunden. Sie ist aber nicht sachlich rationalisiert, sondern es ist in ihr nur die Sphäre [477]der freien Willkür und Gnade ins Extrem entwickelt. Dadurch unterscheidet sie sich von jeder Form rationaler Herrschaft.
3. Ständische Herrschaft soll diejenige Form patrimonialer Herrschaft heißen, bei welcher dem Verwaltungsstab bestimmte Herrengewalten und die entsprechenden ökonomischen Chancen appropriiert sind. Die Appropriation kann – wie in allen ähnlichen Fällen (Kap. Π, § 19):
69
[477]Kap. II, § 19, oben, S. 314–323.
a) einem Verbande oder einer durch Merkmale ausgezeichneten Kategorie von Personen
d
, oder [477]Zu erwarten wäre: an einen Verband oder eine durch Merkmale ausgezeichnete Kategorie von Personen
b) individuell und zwar: nur lebenslänglich oder auch erblich oder als freies Eigentum erfolgen.
Ständische Herrschaft bedeutet also
a) stets Begrenzung der freien Auslese des Verwaltungsstabes durch den Herren, durch die Appropriation der Stellen oder Herrengewalten:
α. an einen Verband,
ß. an eine ständisch (Kap. IV)
70
qualifizierte Schicht, – oder Kap. IV, § 3, unten, S. 598–600.
b) oft – und dies soll hier als „Typus“ gelten – ferner:
α. Appropriation der Stellen, also (eventuell) der durch ihre Innehabung geschaffenen Erwerbschancen und
ß. Appropriation der sachlichen Verwaltungsmittel,
γ. Appropriation der Befehlsgewalten:
an die einzelnen Mitglieder des Verwaltungsstabs.
Die Appropriierten können dabei historisch sowohl 1. aus dem vorher nicht ständischen Verwaltungsstab hervorgegangen sein, wie 2. vor der Appropriation nicht dazu gehört haben.
Der appropriierte ständische Inhaber von Herrengewalten bestreitet die Kosten der Verwaltung aus eignen und ungeschieden ihm appropriierten Verwaltungsmitteln. Inhaber von militärischen Herrengewalten oder ständische Heeresangehörige equipieren sich selbst und eventuell die von ihnen zu stellenden patrimonial oder wiederum ständisch rekrutierten Kontingente [478](ständisches Heer). Oder aber: die Beschaffung der Verwaltungsmittel und des Verwaltungsstabs wird geradezu als Gegenstand einer Erwerbsunternehmung gegen Pauschalleistungen aus dem Magazin oder der Kasse des Herren appropriiert, wie namentlich (aber nicht nur) beim Soldheer des 16. und 17. Jahrhunderts in Europa (kapitalistisches Heer). Die Gesamtgewalt ist in den Fällen voller ständischer Appropriation zwischen dem Herren und den appropriierten Gliedern des Verwaltungsstabs kraft deren Eigenrechts regelmäßig geteilt, oder aber es bestehen durch besondere Ordnungen des Herren oder besondere Kompromisse mit den Appropriierten regulierte Eigengewalten.
Fall 1 z. B. Hofämter eines Herren, welche als Lehen appropriiert werden. Fall 2 z. B. Grundherren, welche kraft Herren-Privileg oder durch Usurpation (meist ist das erste die Legalisierung des letzteren) Herrenrechte appropriierten.
[A 135]Die Appropriation an die einzelnen kann beruhen auf:
1. Verpachtung,
2. Verpfändung,
3. Verkauf,
4. persönlichem oder erblichem oder frei appropriiertem, unbedingtem oder durch Leistungen bedingtem Privileg, gegeben:
a) als Entgelt für Dienste oder um Willfährigkeit zu erkaufen oder
b) in Anerkennung der tatsächlichen Usurpation von Herrengewalten.
5. Appropriation an einen Verband oder eine ständisch qualifizierte Schicht, regelmäßig Folge eines Kompromisses von Herren und Verwaltungsstab oder
e
einer vergesellschafteten ständischen Schicht; es kann [478]A: oder,
α. dem Herren volle oder relative Freiheit der Auswahl im Einzelfall lassen, oder
ß. für die persönliche Innehabung der Stelle feste Regeln satzen, –
[479]6. auf Lehen
f
, worüber besonders zu reden sein wird.[479]A: Lehre
71
[479]Kap. III, § 12 b, unten, S. 513–520.
1. Die Verwaltungsmittel sind – der dabei herrschenden, allerdings meist ungeklärten Vorstellung nach – bei Gerontokratie und reinem Patriarchalismus dem verwalteten Verband oder dessen einzelnen an der Verwaltung beteiligten Haushaltungen appropriiert: „für“ den Verband wird die Verwaltung geführt. Die Appropriation an den Herren als solchen gehört erst der Vorstellungswelt des Patrimonialismus an und kann sehr verschieden voll – bis zu vollem Bodenregal
72
und voller Herrensklaverei der Untertanen („Verkaufsrecht“ des Herren) – durchgeführt sein. Die ständische Appropriation bedeutet Appropriation mindestens eines Teils der Verwaltungsmittel an die Mitglieder des Verwaltungsstabes. Während also beim reinen Patrimonialismus volle Trennung der Verwalter von den Verwaltungsmitteln stattfindet, ist dies beim ständischen Patrimonialismus gerade umgekehrt: der Verwaltende ist im Besitz der Verwaltungsmittel, aller oder mindestens eines wesentlichen Teils. So war der Lehensmann, der sich selbst equipierte, der belehnte Graf, der die Gerichts- und andern Gebühren und Auflagen für sich vereinnahmte und aus eigenen Mitteln (zu denen auch die appropriierten gehörten) dem Lehensherrn seine Pflicht bestritt, der indische jagirdar, der aus seiner Steuerpfründe sein Heereskontingent stellte,Königliches, später auch landesherrliches Vorrecht, über (herrenlosen) Grund und Boden zu verfügen. Zum Regal vgl. auch die Erläuterung oben, S. 328, Anm. 33.
73
im Vollbesitz der Verwaltungsmittel, dagegen der Oberst, der ein Söldnerregiment in eigner Entreprise aufstellte und dafür bestimmte Zahlungen aus der fürstlichen Kasse erhielt und sich für das Defizit durch Minderleistung und aus der Beute oder durch Requisitionen bezahlt machte, im teilweisen (und: regulierten) Besitz der Verwaltungsmittel. Während der Pharao, der Sklaven- oder Kolonen-Heere aufstellte und durch Königsklienten führen ließ, sie aus seinen Magazinen kleidete, ernährte, bewaffnete, als Patrimonialherr im vollen Eigenbesitz der Verwaltungsmittel war. Dabei ist die formale Regelung nicht immer das Ausschlaggebende: die Mameluken waren formal Sklaven, rekrutierten sich [480]formal durch „Kauf“ des Herren,Der jagirdar war zunächst ein einfacher Militärpfründner, der „die Gestellung eines bestimmten Kontingents übernahm und dafür mit den entsprechenden Eingängen für Sold, Rationen und sonstige Gebührnisse“ beliehen wurde, später dann auch mit jagir (steuerfreiem Apanagenland oder Ödland). Das sog. jagirdar-System entwickelte sich unter der Herrschaft der muslimischen Mogul-Dynastie (16.–19. Jahrhundert) und diente der Landverwaltung zu militärischen Zwecken. Vgl. Weber, Hinduismus, MWG I/20, S. 137.
74
– tatsächlich aber monopolisierten sie die Herrengewalten so vollkommen, wie nur irgendein Ministerialenverband die Dienstlehen. Die Appropriation von Dienstland an einen geschlossenen Verband, aber ohne individuelle Appropriation, kommt vor, sowohl mit innerhalb des Verbands freier Besetzung durch den Herrn, (Fall a, α des Textes),[480]Die Mameluken waren ursprünglich Sklaven, meist türkischer und tscherkessischer Herkunft, die durch einen hohen Beamten des Sultans, den „Käufer der Mamlûken“, eingekauft und zu Leibgardisten ausgebildet wurden. In Ägypten entwickelten sie sich zur militärischen Oberschicht und eigneten sich unter der Herrschaft der Aijubiden (1171–1250) die Macht an. Vgl. Becker, Carl Heinrich, Egypten, in: Enzyklopädie des Islam, Band 2. – Leiden: E. J. Brill, Leipzig: Otto Harrassowitz 1927, S. 4–24, bes. S. 9 f., und Kramers, Johannes Hendrik, Mamlûken, ebd., Band 3, 1936, S. 235–241, Zitat: S. 236.
75
wie mit Regulierung der Qualifikation zur Übernahme (Fall a, β des Texts),Der Bezug ist 3. a) α, oben, S. 477, Z. 16.
76
z. B. durch Verlangen militärischer oder anderer (ritueller) Qualifikation des Anwärters und andrerseits (bei deren Vorliegen) Vorzugsrecht der nächsten Blutsverwandten. Ebenso bei hofrechtlichen oder zünftigen Handwerker- oder Bauernstellen, deren Leistungen militärischen oder Verwaltungsbedürfnissen zu dienen bestimmt sind. Der Bezug ist 3. a) β, oben, S. 477, Z. 17.
2. Appropriation durch Verpachtung (Steuerpacht insbesondere), Verpfändung oder Verkauf waren dem Okzident, aber auch dem Orient und Indien bekannt; in der Antike war Vergebung durch Auktion bei Priesterstellen nicht selten.
77
Der Zweck war bei der Verpachtung teils ein rein aktuell finanzpolitischer (Notlage besonders infolge von Kriegskosten), teils ein finanztechnischer (Sicherung einer festen, haushaltsmäßig verwendbaren Geldeinnahme), bei Verpfändung und Verkauf durchweg der erstgenannte, im Kirchenstaat auch: Schaffung von Nepoten-Renten.Nachgewiesen ist der Verkauf von Priesterstellen in hellenistischer Zeit insbesondere für die griechischen Kolonien auf den ionischen Inseln und an der kleinasiatischen Küste. Max Weber erklärt die Besetzung von Priesterstellen durch Versteigerung andernorts als „Endresultat“ einer Entwicklung, in der die Stadtstaaten „im hellenischen Mutterlande und vollends in den Kolonien […] Herr über das Göttervermögen und die Priesterpfründen“ geworden seien (vgl. Weber, Die Stadt, MWG I/22-5, S. 184 f. mit Hg.-Anm. 144).
78
Die Appropriation durch Verpfändung hat noch im 18. Jahrhundert bei der Stellung der Juristen (Parlamente) in Frankreich eine erhebliche Rolle [481]gespielt,Gemeint ist die Versorgung von Angehörigen der Kurie durch die „massenhafte Schaffung von Sportelpfründen als Sinekuren“, d. h. von Amtseinnahmen ohne Amtsverpflichtung, die insbesondere vom 15. bis zum 17. Jahrhundert ihren Höhepunkt fand. Vgl. Weber, Patrimonialismus, MWG I/22-4, S. 298 f.
79
die Appropriation durch (regulierten) Kauf von Offizierstellen im englischen Heer noch bis in das 19. Jahrhundert.[481]Gemeint ist die Sicherung einer Stelle in den höchsten Gerichtshöfen (parlements) – besonders für den Erben – durch die jährliche Zahlung einer Pachtgebühr, die den sechzigsten Teil des Amtskaufpreises betrug. Die sog. Paulette wurde von 1604 bis 1789 für Beamte und Parlementsmitglieder erhoben. Vgl. Holtzmann, Robert, Französische Verfassungsgeschichte von der Mitte des neunten Jahrhunderts bis zur Revolution. – München, Berlin: R. Oldenbourg 1910 (hinfort: Holtzmann, Französische Verfassungsgeschichte), S. 343–345, und ausführlicher in Weber, Patrimonialismus, MWG I/22-4, S. 299 f.
80
Dem Mittelalter war das Privileg, als Sanktion von Usurpation oder als Lohn oder Werbemittel für politische Dienste, im Okzident ebenso wie anderwärts geläufig. Im Jahr 1871 wurde durch königliche Prärogative und gegen den Widerstand des Oberhauses der Kauf von Offizierspatenten in der englischen Armee abgeschafft. Vgl. Low, Sidney, Die Regierung Englands. Übersetzt von Johannes Hoops. Mit einer Einleitung von Georg Jellinek. – Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) 1908, S. 246 (hinfort: Low, Regierung Englands).
[A 136]§ 8. Der patrimoniale Diener kann seinen Unterhalt beziehen
a) durch Versorgung am Tisch des Herren, –
b) durch (vorwiegend Natural-)Deputate aus Güter- und Geld-Vorräten des Herren, –
c) durch Dienstland, –
d) durch appropriierte Renten-, Gebühren- oder Steuer-Einkunftschancen, –
e) durch Lehen.
Die Unterhaltsformen b bis d sollen, wenn sie in einem nach Umfang (b und c) oder Sprengel (d) traditionalen Ausmaß stets neu vergeben und individuell, aber nicht erblich appropriiert sind, „Pfründen“ heißen, die Existenz einer Ausstattung des Verwaltungsstabes prinzipiell in dieser Form: Präbendalismus. Dabei kann ein Aufrücken nach Alter oder bestimmten objektiv bemeßbaren Leistungen bestehen, und es kann die ständische Qualifikation und also: Standesehre gefordert werden (s. über den Begriff des „Standes“ Kap. IV).
81
Kap. IV, § 3, unten, S. 599.
Lehen sollen appropriierte Herrengewalten heißen, wenn sie kraft Kontrakts an individuell Qualifizierte primär vergeben werden und die gegenseitigen Rechte und Pflichten primär an konventionalen ständischen, und zwar: militaristischen Ehrbe[482]griffen orientiert werden. Das Bestehen eines primär mit Lehen ausgestatteten Verwaltungsstabes soll Lehensfeudalismus heißen.
Lehen und Militär-Pfründe gehen oft bis zur Ununterscheidbarkeit ineinander über. (Darüber die Erörterung des „Standes“ Kap. IV).
82
[482]In dem unvollendeten Kapitel IV finden sich keine entsprechenden Ausführungen.
In den Fällen d und e, zuweilen auch im Fall c, bestreitet der appropriierte Inhaber der Herrengewalten die Kosten der Verwaltung, eventuell: Equipierung, in der schon angegebenen Art, aus den Mitteln der Pfründe bzw. des Lehens. Seine eigne Herrschaftsbeziehung zu den Untertanen kann dann patrimonialen Charakter annehmen (also: vererblich, veräußerlich, erbteilbar werden).
1. Die Versorgung am Tisch des Herren oder nach dessen freiem Ermessen aus seinen Vorräten war sowohl bei fürstlichen Dienern wie Hausbeamten, Priestern und allen Arten von patrimonialen (z. B. grundherrlichen) Bediensteten das Primäre. Das „Männerhaus“, die älteste Form der militärischen Berufsorganisation (wovon später gesondert zu reden sein wird)[,]
83
hatte sehr oft den Charakter des herrschaftlichen Konsumhaushalts-Kommunismus. Abschichtung vom Herren-Eine kurze Erwähnung des „Männerhauses“ als militaristische Organisationsform findet sich in Kap. II, oben, S. 361 mit Hg.-Anm. 33. Neuere Ausführungen sind nicht überliefert. Denkbar ist, daß Weber das Thema im geplanten Kap. V behandelt hätte, vgl. dazu die Übersicht zum Editorischen Bericht, oben, S. 109.
g
(oder: Tempel- und Kathedral-)Tisch und Ersatz dieser unmittelbaren Versorgung durch Deputate oder Dienstland ist keineswegs stets als erstrebenswert angesehen worden, war aber bei eigener Familiengründung die Regel. Naturaldeputate der abgeschichteten Tempelpriester und Beamten waren im ganzen vorderasiatischen Orient die ursprüngliche Form der Beamtenversorgung und bestanden ebenso in China, Indien und vielfach im Okzident. Dienstland findet sich gegen Leistung von Militärdiensten im ganzen Orient seit der frühen Antike, ebenso im deutschen Mittelalter als Versorgung der ministerialen und hofrechtlichen Haus- und anderer Beamten. Die Einkünfte der türkischen Sipahi ebenso wie der japanischen Samurai und zahlreicher ähnlicher orientalischer Ministerialen und Ritter sind – in unserer Terminologie – „Pfründen“, nicht Lehen, wie später zu erörtern sein wird.[482]A: Herren
84
Sie können [483]sowohl auf bestimmte Landrenten, wie auf Steuereinkünfte von Bezirken angewiesen sein. Im letzteren Fall sind sie nicht notwendig, wohl aber der allgemeinen Tendenz nach, mit Appropriation von Herrengewalten in diesen Bezirken verbunden oder ziehen diese nach sich. Der Begriff des „Lehens“ kann erst im Zusammenhang mit dem Begriff des „Staats“ näher erörtert werden.Kap. III, § 12 c, unten, S. 520–527; dort (S. 524 mit Hg.-Anm. 35) verweist Weber allerdings noch auf weitere Erörterungen.
85
Sein Gegenstand kann sowohl grundherrliches Land (also eine Patrimonialherrschaft), wie die verschiedensten Arten von Renten- und Gebühren-Chancen sein. [483]Zum „Lehen“ Kap. III, § 12 b, unten, S. 513–520; jedoch ohne vorherige Erläuterung des „Staats“. Zur geplanten Staatssoziologie vgl. die Übersicht zum Editorischen Bericht, oben, S. 109, 114–117.
2. Appropriierte Renten-, Gebühren- und Steuer-Einkunftschancen finden sich als Pfründen und Lehen aller Art weit verbreitet, als selbständige Form und in hoch entwickelter Weise besonders in Indien:
86
Vergebung von Einkünften gegen Gestellung von Heereskontingenten und Zahlung der Verwaltungskosten. Besonders unter der Mogul-Herrschaft (1526–40 und 1555–1857) entwickelte sich in Indien ein Verwaltungssystem, das durch die Vergabe von Land- und Steuerpfründen an Jagirdar, Talukdar und Zamindar getragen wurde. Vgl. dazu Weber, Hinduismus, MWG I/20, bes. S. 137–139, sowie oben, S. 479 mit Hg.-Anm. 73 und unten, S. 523 mit Hg.-Anm. 30.
§ 9. Die patrimoniale und insbesondere die ständisch-patrimoniale Herrschaft behandelt, im Fall des reinen Typus, alle Herrengewalten und ökonomischen Herren[A 137]rechte nach Art privater appropriierter ökonomischer Chancen. Das schließt nicht aus, daß sie sie qualitativ unterscheidet. Insbesondre indem sie einzelne von ihnen als präeminent in besonders regulierter Form appropriiert. Namentlich aber, indem sie die Appropriation von gerichts- oder militärherrlichen Gewalten als Rechtsgrund ständisch bevorzugter Stellung des Appropriierten gegenüber der Appropriation rein ökonomischer (domanialer
87
oder steuerlicher oder Sportel-)Chancen behandelt und innerhalb der letzteren wieder die primär patrimonialen von den primär extrapatrimonialen (fiskalischen) in der Art der Appropriation scheidet. Für unsere Terminologie soll die Tatsache der prinzipiellen Behandlung von Herrenrechten und der mit ihnen ver[484]knüpften Chancen jeden Inhalts nach Art privater Chancen maßgebend sein. Als „domanial“ bezeichnet Weber hier die Abgaben und Dienste (servitia), die allgemein einem Grundherrn (nicht speziell dem König) von den von ihm abhängigen Hufenbauern und Höfen zu leisten waren.
Durchaus mit Recht betont z. B. v. Below (der deutsche Staat des Mittelalters) scharf, daß namentlich die Appropriation der Gerichtsherrlichkeit gesondert behandelt wurde und Quelle ständischer Sonderstellungen war, daß überhaupt ein rein patrimonialer oder rein feudaler Charakter des mittelalterlichen politischen Verbandes sich nicht feststellen lasse.
88
Indessen: soweit die Gerichtsherrlichkeit und andere Rechte rein politischen Ursprungs nach Art privater Berechtigungen behandelt wurden, scheint es für unsre Zwecke terminologisch richtig, von „patrimonialer“ Herrschaft zu sprechen. Der Begriff selbst stammt bekanntlich (in konsequenter Fassung) aus Haller’s Restauration der Staatswissenschaften.[484]„Gerichtsbesitz adelt“, schreibt v. Below, Staat des Mittelalters, S. 247. Damit meint er, daß mit dem Erwerb eines öffentlichen Gerichtsbezirks „eine Standeserhöhung“ einhergegangen sei. Im letzten Teil seines Buches wägt v. Below die patrimonialen und feudalen Elemente der Reichsverfassung gegeneinander ab und bilanziert, daß das mittelalterliche Reich weder als Patrimonial- noch als Lehnsstaat, sondern als „Feudalstaat“ im eingeschränkten Sinne zu bezeichnen sei (ebd., S. 312–322).
89
Einen absolut idealtypisch reinen „Patrimonial“staat hat es historisch nicht gegeben. Gemeint ist v. Haller, Restauration der Staatswissenschaft. In dem 5-bändigen Werk, das 1816 ff. zuerst erschienen war, beschreibt v. Haller den Patrimonialstaat als diejenige Staatsform, die dem „Verhältniß eines begüterten Haus- und Grundherren zu seinen Kindern, Dienern und andern Hörigen“ gleiche (ebd., Band II, S. 12 f.). v. Below kritisierte v. Hallers Theorie des Patrimonialstaates wegen des rein privatrechtlichen Charakters der Herrschaftsbeziehungen, der weder mit dem öffentlich-rechtlichen Aspekt des Staatsbegriffs noch mit der Realität der mittelalterlichen Verfassung vereinbar sei (vgl. v. Below, Staat des Mittelalters, S. 6–8). Weber bezieht die Kritikpunkte v. Belows ein, hält aber am „Begriff des ,Patrimonialismus‘“ fest, wie er dies schon v. Below brieflich am 21. Juni 1914 mitteilte (vgl. MWG II/8, S. 725).
4. Ständische Gewaltenteilung soll der Zustand heißen, bei dem Verbände von ständisch, durch appropriierte Herrengewalten Privilegierten durch Kompromiß mit dem Herren von Fall zu Fall politische oder Verwaltungssatzungen (oder: beides) oder konkrete Verwaltungsanordnungen oder Verwaltungskontrollmaßregeln schaffen und eventuell selbst, zuweilen durch eigne Verwaltungsstäbe mit, unter Umständen, eignen Befehlsgewalten, ausüben.
1. Daß auch nicht ständisch privilegierte Schichten (Bauern) unter Umständen zugezogen werden, soll am Begriff nichts ändern. Denn das Eigenrecht der Privilegierten ist das typisch Entscheidende. Das Fehlen [485]aller ständisch privilegierten Schichten würde ja offensichtlich sofort einen anderen Typus ergeben.
2. Der Typus ist voll nur im Okzident entwickelt. Über seine nähere Eigenart und den Grund seiner Entstehung dort ist später gesondert zu sprechen.
90
[485]Entsprechende Ausführungen sind nicht überliefert.
3. Eigner ständischer Verwaltungsstab war nicht die Regel, vollends mit eigner Befehlsgewalt die Ausnahme.
§ 9a. Auf die Art des Wirtschaftens wirkt eine traditionale Herrschaft in aller Regel zunächst und ganz allgemein durch eine gewisse Stärkung der traditionalen Gesinnung, am stärksten die gerontokratische und rein patriarchale Herrschaft, welche ganz und gar auf die durch keinen im Gegensatz zu den Genossen des Verbandes stehenden Sonderstab des Herren gestützt, also in ihrer eigenen Legitimitätsgeltung am stärksten auf Wahrung der Tradition in jeder Hinsicht hingewiesen sind
h
. [485]Satzkonstruktion in A defekt.
Im übrigen richtet sich die Wirkung auf die Wirtschaft
1. nach der typischen Finanzierungsart des Herrschaftsverbandes (Kap. II, § 36).
1
Gemeint ist Kap. II, § 38 (nicht: § 36), oben, S. 428–437. Zur Erweiterung von Kapitel II vgl. den Editorischen Bericht, oben, S. 89 f.
Patrimonialismus kann in dieser Hinsicht höchst Verschiedenes bedeuten. Typisch aber ist namentlich:
a) Oikos des Herren mit ganz oder vorwiegend natural-leiturgischer Bedarfsdeckung (Naturalabgaben und Fronden). In diesem Fall sind die Wirtschaftsbeziehungen streng traditionsgebunden, die Marktentwicklung gehemmt, der Geldgebrauch ein wesentlich naturaler und Konsum-orientierter, Entstehung von Kapitalismus unmöglich. In diesen Wirkungen steht diesem Fall nahe der ihm verwandte:
b) mit
i
ständisch privilegierender Bedarfsdeckung. Die Marktentwicklung ist auch hier, wenn auch nicht notwendig in gleichem Maße, begrenzt durch dieLies: Oikos des Herrn mit
k
die [A 138]„Kaufkraft“ beeinträchtigende naturale Inanspruchnahme des Güterbesitzes und der [486]Leistungsfähigkeit der Einzelwirtschaften für Zwecke des Herrschaftsverbandes. A: die,
Oder der Patrimonialismus kann sein:
c) monopolistisch mit teils erwerbswirtschaftlicher, teils gebührenmäßiger, teils steuerlicher Bedarfsdeckung. In diesem Fall ist die Marktentwicklung je nach der Art der Monopole stärker oder schwächer irrational eingeschränkt, die großen Erwerbschancen in der Hand des Herren und seines Verwaltungsstabes, der Kapitalismus in seiner Entwicklung daher entweder
α. bei voller Eigenregie der Verwaltung unmittelbar gehemmt oder aber
ß. im Fall, daß
l
Steuerpacht, Amtspacht oder -Kauf und kapitalistische Heeres- oder Verwaltungs-Beschaffung als Finanzmaßregeln bestehen, auf das Gebiet des politisch orientierten Kapitalismus (Kap. II, § 31)[486]A: Fall ; , daß sinngemäß ergänzt.
2
abgelenkt. [486]Kap. II, § 31, oben, S. 379–382.
Die Finanzwirtschaft des Patrimonialismus, und vollends des Sultanismus, wirkt, auch wo sie geldwirtschaftlich ist, irrational:
1. durch das Nebeneinander von
α. Traditionsgebundenheit in Maß und Art der Inanspruchnahme direkter Steuerquellen, und
ß. völliger Freiheit, und daher: Willkür in Maß und Art der 1. Gebühren- und 2. Auflagenbemessung und 3. Gestaltung der Monopole. All dies besteht jedenfalls dem Anspruch nach; effektiv ist es historisch am meisten bei 1 (dem Prinzip der „bittweisen Tätigkeit“
3
des Herren und des Stabes gemäß), weit weniger bei 2, verschieden stark bei 3. „bittweise“ (lat. precarius), auf dem Gnadenwege, aber ohne rechtsgültigen Kontrakt. Max Weber verwendete den Ausdruck in Bezug auf die spätrömische Verwaltung: „Die steuerliche Autonomie der stipendiären Gemeinden hatte immer nur precario bestanden, auch wo ihnen die Aufbringung ihres Steuersolls überlassen worden war.“ Vgl. Weber, Römische Agrargeschichte, MWG I/2, S. 283.
2. Es fehlt aber überhaupt für die Rationalisierung der Wirtschaft die sichere Kalkulierbarkeit der Belastung nicht nur, sondern auch des Maßes privater Erwerbsfreiheit.
[487]3. Im Einzelfall kann allerdings der patrimoniale Fiskalismus durch planvolle Pflege der Steuerfähigkeit und rationale Monopolschaffung rationalisierend wirken. Doch ist dies ein durch historische Sonderbedingungen, die teilweise im Okzident bestanden, bedingter „Zufall“.
Die Finanzpolitik bei ständischer Gewaltenteilung hat die typische Eigenschaft: durch Kompromiß fixierte, also: kalkulierbare Lasten aufzuerlegen, die Willkürlichkeit des Herren in der Schaffung von Auflagen, vor allem aber auch von Monopolen, zu beseitigen oder mindestens stark zu beschränken. Inwieweit die materiale Finanzpolitik dabei die rationale Wirtschaft fördert oder hemmt, hängt von der Art der in der Machtstellung vorwaltenden Schicht ab, vor allem: ob
a) feudale, oder
b) patrizische.
Das Vorwalten der ersteren pflegt kraft der normalerweise überwiegend patrimonialen Struktur der verlehnten Herrschaftsrechte die Erwerbsfreiheit und Marktentwicklung fest zu begrenzen oder geradezu absichtsvoll, machtpolitisch, zu unterbinden, das Vorwalten
m
der letzteren kann entgegengesetzt wirken. [487]A: Verwalten
1. Das Gesagte muß hier genügen, da darauf in den verschiedensten Zusammenhängen eingehender zurückgekommen wird.
4
[487] Auf den Zusammenhang von Wirtschaftsordnung und traditionalen Herrschaftsformen kommt Weber in den sich anschließenden Passagen der sog. Ersten Lieferung nicht mehr zu sprechen. Ausführlich hatte er das Thema mit Bezug auf die Entwicklung des modernen Kapitalismus in der älteren Fassung der Herrschaftssoziologie behandelt, vgl. Weber, Patrimoniale und feudale Strukturformen der Herrschaft in ihrem Verhältnis zur Wirtschaft, MWG I/22-4, S. 418–453.
2.Beispiele für
a)
5
(Oikos): Altägypten und Indien. Bezug sind die Ausführungen unter 1. a), oben, S. 485, Z. 21 ff.
n
A: Indien,
Für b) erhebliche Gebiete des Hellenismus, das spätrömische Reich, China, Indien, teilweise Rußland und die islamischen Staaten.
Für c) das Ptolemäerreich, Byzanz (teilweise), in anderer Art die Herrschaft der Stuarts.
[488]Für d)
6
die okzidentalen Patrimonialstaaten in der Zeit des „aufgeklärten Despotismus“ (insbesondere des Colbertismus).[488]Bezug sind die Ausführungen unter „3.“, oben, S. 487, Z. 1 ff.
7
Französische, besondere Form des Merkantilismus, die nach dem Staatsmann Jean-Baptiste Colbert (1619–1683) benannt ist.
2. Der normale Patrimonialismus bereitet nicht nur durch seine Finanzpolitik der rationalen Wirtschaft Hemmungen, sondern vor allem durch die allgemeine Eigenart seiner Verwaltung. Nämlich:
[A 139]a) durch die Schwierigkeit, die der Traditionalismus formal rationalen und in ihrer Dauer verläßlichen, daher in ihrer wirtschaftlichen Tragweite und Ausnutzbarkeit kalkulierbaren Satzungen bereitet, –
b) durch das typische Fehlen des formal fachgeschulten Beamtenstabs,
Die Entstehung eines solchen innerhalb des okzidentalen Patrimonialismus ist, wie sich zeigen wird,
8
durch einzigartige Bedingungen herbeigeführt, die nur hier bestanden, und war primär gänzlich anderen Quellen entwachsen. Es ist anzunehmen, daß Max Weber die spezifischen Entwicklungsbedingungen des modernen fachgeschulten Beamtentums in der angekündigten „Staatssoziologie“ dargestellt hätte. Vgl. dazu die konzeptionellen Stichworte in Weber, Vorbemerkung, in: GARS I, S. 3 (MWG I/18), sowie in Weber, Bürokratismus, MWG I/22-4, S. 191 f., und Weber, Recht § 4, MWG I/22-3, S. 484 f.
c) durch den weiten Bereich materialer Willkür und rein persönlicher Beliebungen des Herren und des Verwaltungsstabes, – wobei die eventuelle Bestechlichkeit, die ja lediglich die Entartung des unreglementierten Gebühren-Rechts ist, noch die relativ geringste, weil praktisch kalkulierbare, Bedeutung hätte, wenn sie eine konstante Größe und nicht vielmehr einen mit der Person des Beamten stets wechselnden Faktor darstellen würde. Herrscht Amtspacht, so ist der Beamte auf die Herauswirtschaftung seines Anlagekapitals durch beliebige, noch so irrational wirkende, Mittel der Erpressung ganz unmittelbar angewiesen;
d) durch die allem Patriarchalismus und Patrimonialismus innewohnende, aus der Art der Legitimitätsgeltung und dem Interesse an der Zufriedenheit der Beherrschten folgende Ten[489]denz zur material – an utilitarischen oder sozialethischen oder materialen „Kultur“-Idealen – orientierten Regulierung der Wirtschaft, also: Durchbrechung ihrer formalen, an Juristenrecht orientierten, Rationalität. Im Höchstmaß ist diese Wirkung bei hierokratisch orientiertem Patrimonialismus entscheidend, während der reine Sultanismus mehr durch seine fiskalische Willkür wirkt.
Aus allen diesen Gründen ist unter der Herrschaft normaler patrimonialer Gewalten zwar
a) Händler-Kapitalismus, –
b) Steuerpacht-, Amtspacht-, Amtskauf-Kapitalismus, –
c) Staatslieferanten- und Kriegsfinanzierungs-Kapitalismus, –
d) unter Umständen: Plantagen- und Kolonial-Kapitalismus bodenständig und oft in üppigster Blüte, dagegen nicht die gegen Irrationalitäten der Rechtspflege, Verwaltung und Besteuerung, welche die Kalkulierbarkeit stören, höchstempfindliche, an Marktlagen der privaten Konsumenten orientierte Erwerbsunternehmung mit stehendem Kapital und rationaler Organisation freier Arbeit.
Grundsätzlich anders steht es nur da, wo der Patrimonialherr im eigenen Macht- und Finanzinteresse zu rationaler Verwaltung mit Fachbeamtentum greift. Dazu ist 1. die Existenz von Fachschulung, – 2. ein hinlänglich starkes Motiv in aller Regel: scharfe Konkurrenz mehrerer patrimonialer Teilgewalten innerhalb des gleichen Kulturkreises, – 3. ein sehr besondersartiges Moment: die Einbeziehung städtischer Gemeindeverbände als Stütze der Finanzmacht in die konkurrierenden Patrimonialgewalten erforderlich.
1. Der moderne, spezifisch okzidentale Kapitalismus
o
ist vorbereitet worden in den (relativ) rational verwalteten spezifisch okzidentalen städtischen Verbänden (von deren Eigenart später gesondert zu reden sein wird);[489]A: Kapitalismus,
9
er entwickelte sich vom 16.–18. Jahrhundert innerhalb der[489]Vermutlich Hinweis auf die angekündigte „Staatssoziologie“. Überliefert ist nur die Vorkriegsfassung, vgl. Weber, Die Stadt, MWG I/22-5. Zur Bedeutung der Stadt für die okzidentale Entwicklung vgl. die kurzen Ausführungen in Weber, Probleme der Staatssoziologie, MWG I/22-4, S. 755 f.
p
ständi[490]schen holländischen und englischen, durch Vorwalten der bürgerlichen Macht-A: des
q
und Erwerbsinteressen ausgezeichneten politischen Verbände primär, während die fiskalisch und utilitarisch bedingten sekundären Nachahmungen in den rein patrimonialen oder feudal-ständisch beeinflußten Staaten des Kontinents ganz ebenso wie die Stuartschen Monopolindustrien[490]A: Macht
10
nicht in realer Kontinuität mit der später einsetzenden autonomen kapitalistischen Entwicklung standen, obwohl einzelne (agrar- und gewerbepolitische) Maßregeln, soweit und dadurch daß sie an englischen, holländischen oder, später, französischen Vorbildern orientiert waren, sehr wichtige Entwicklungsbedingungen für sein Entstehen schufen (auch darüber gesondert).[490]Zur Monopolpolitik der Stuarts vgl. die Erläuterung oben, S. 440, Anm. 27.
11
Ausführungen zur Genese des modernen Kapitalismus in Zusammenhang mit den Herrschaftsformen finden sich nur in der älteren Fassung der „Herrschaftssoziologie“; vgl. insbes. Weber, Patrimoniale und feudale Strukturformen der Herrschaft in ihrem Verhältnis zur Wirtschaft, MWG I/22-4, S. 418–453. Neuere Ausführungen sind nicht überliefert.
[A 140]2. Die Patrimonialstaaten des Mittelalters unterschieden sich durch die formal rationale Art eines Teils ihres Verwaltungsstabes (vor allem: Juristen, weltliche und kanonische) prinzipiell von allen andern Verwaltungsstäben aller politischen Verbände der Erde. Auf die Quelle dieser Entwicklung und ihre Bedeutung wird näher gesondert einzugehen sein.
12
Hier mußten die am Schluß des Textes gemachten allgemeinen Bemerkungen vorläufig genügen. Entsprechende Ausführungen sind nicht überliefert.
4. Charismatische Herrschaft.
§ 10. „Charisma“ soll eine als außeralltäglich (ursprünglich, sowohl bei Propheten wie bei therapeutischen wie bei Rechts-Weisen wie bei Jagdführern wie bei Kriegshelden: als magisch bedingt) geltende Qualität einer Persönlichkeit heißen, um derentwillen sie als mit übernatürlichen oder übermenschlichen oder mindestens spezifisch außeralltäglichen, nicht jedem andern zugänglichen Kräften oder Eigenschaften begabt
r
oder als gottgesendet oder als vorbildlich und deshalb als „Führer“ gewertet wird. Wie die betreffende Qualität von irgendeinem ethischen, ästhetischen oder sonstigen Standpunkt aus „objektiv“ richtig [491]zu bewerten sein würde, ist natürlich dabei begrifflich völlig gleichgültig: darauf allein, wie sie tatsächlich von den charismatisch Beherrschten, den „Anhängern“, bewertet wird, kommt es an. Fehlt in A; begabt sinngemäß ergänzt.
Das Charisma eines „Berserkers“ (dessen manische Anfälle man, anscheinend mit Unrecht, der Benutzung bestimmter Gifte zugeschrieben hat:
13
man hielt sich in Byzanz im Mittelalter eine Anzahl dieser mit dem Charisma der Kriegs-Tobsucht Begabten als eine Art von Kriegswerkzeugen),[491] Der Indogermanist Hermann Güntert war der weitverbreiteten Ansicht entgegengetreten, daß die Berserkerwut durch „den Genuß berauschender Getränke, Wurzeln oder Pilze“, insbesondere durch Vergiftung mit Fliegenschwamm künstlich ausgelöst worden sei. Güntert vermutete eher eine psychische Erkrankung – wie bei den Amokläufern – als Ursache. Vgl. Güntert, Hermann, Über altisländische Berserker-Geschichten (Beilage zum Jahresbericht des Heidelberger Gymnasiums 1912). – Heidelberg: J. Hörning 1912, S. 24.
14
eines „Schamanen“ (Magiers, für dessen Ekstasen im reinen Typus die Möglichkeit epileptoider Anfälle als eine Vorbedingung gilt Weber könnte hier die Warägergarde der byzantinischen Kaiser meinen; die nordischen Kämpfer, die mit einer Axt bewaffnet waren, bildeten zwischen 988 und 1204 den Kern der Leibgarde. An parallelen Stellen sprach Weber von „nordischen Wilden“ oder „blonden Bestien“. Vgl. Weber, Das antike Judentum, MWG I/21, S. 375, Fn. 104, und Weber, Charismatismus, MWG I/22-4, S. 460 f.
s
),[491]A: gelten
15
oder etwa des (vielleicht, aber nicht ganz sicher, wirklich einen raffinierten Schwindlertyp darstellenden) Mormonenstifters, Die These, daß die schamanische Ekstase von einer „konstitutionellen Epilepsie“ abhängig gewesen und schon ihr erstes Auftreten einer Berufung zum Schamanen gleichgekommen sei, findet sich in: Chantepie de la Saussaye, Pierre Daniël, unter Mitwirkung von Thomas Achelis, Die sogenannten Naturvölker, in: Lehrbuch der Religionsgeschichte, hg. von Pierre Daniël Chantepie de la Saussaye, Band 1, 3. Aufl. – Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) 1905, S. 17–56, Zitat: S. 54.
16
oder eines den eigenen demagogischen Erfolgen preisgegebenen Literaten wie Kurt Eisner Im Jahr 1830 gründete der Landarbeiter Joseph Smith jun. (1805–1844) in Lafayette (N. Y.) die Sekte der Mormonen („Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage“). Nach eigenen Angaben beruhte sein „Book of Mormon“ (1830) auf einer Offenbarung. Nachdem Smith die Polygamie ebenfalls als göttliche Offenbarung verkündet hatte, wurde er inhaftiert und im Gefängnis ermordet. Vgl. Meyer, Eduard, Ursprung und Geschichte der Mormonen. Mit Exkursen über die Anfänge des Islâms und des Christentums. – Halle a.S.: Max Niemeyer 1912, S. 14 ff.
17
wird Kurt Eisner trat in der Umbruchphase 1918/19 als politischer Redner der USPD bei Massenkundgebungen auf. Als Ministerpräsident des Freistaates Bayern veröffentlichte er am 23. November 1918 Dokumente zum Kriegsausbruch, mit denen die Kriegsschuld Deutschlands belegt werden sollte. Weber verurteilte dieses Verhalten auf das Schärfste. Vgl. bes. Weber, Zum Thema der „Kriegsschuld“, MWG I/16, S. 177–190, mit der Zurückweisung „dies Literatenvolk ist nicht Deutschland“ (ebd., [492]S. 180); sowie Weber, Das neue Deutschland, ebd., S. 376–395, bes. S. 381; oder auch die private Äußerung: „Er [Eisner] ist ein Demagoge ohne alles politische Gewissen.“ (Brief an Else Jaffé vom 18. Februar 1919, MWG II/10, S. 465).
t
[492]von der wertfreien Soziologie mit dem Charisma der nach der üblichen Wertung „größten“ Helden, Propheten, Heilande durchaus gleichartig behandelt. A: werden
1. Über die Geltung des Charisma entscheidet die durch Bewährung – ursprünglich stets: durch Wunder – gesicherte freie, aus Hingabe an Offenbarung, Heldenverehrung, Vertrauen zum Führer geborene, Anerkennung durch die Beherrschten. Aber diese ist (bei genuinem Charisma) nicht der Legitimitätsgrund, sondern sie ist Pflicht der kraft Berufung und Bewährung zur Anerkennung dieser Qualität Aufgerufenen. Diese „Anerkennung“ ist psychologisch eine aus Begeisterung oder Not und Hoffnung geborene gläubige ganz persönliche Hingabe.
Kein Prophet hat seine Qualität als abhängig von der Meinung der Menge über ihn angesehen, kein gekorener König oder charismatischer Herzog die Widerstrebenden oder abseits Bleibenden anders denn als Pflichtwidrige behandelt: die Nicht-Teilnahme an dem formal voluntaristisch rekrutierten Kriegszug eines Führers wurde in aller Welt mit Spott entgolten.
2. Bleibt die Bewährung dauernd aus, zeigt sich der charismatische Begnadete von seinem Gott oder seiner magischen oder Heldenkraft verlassen, bleibt ihm der Erfolg dauernd versagt, vor allem: bringt seine Führung kein Wohlergehen für die Beherrschten, so hat seine charismatische Autorität die Chance, zu schwinden. Dies ist der genuine charismatische Sinn des „Gottesgnadentums“.
Selbst für altgermanische Könige kommt ein „Verschmäher“ vor.
18
Ebenso massenhaft bei sog. primitiven Völkern. Für China war die (erb[493]charismatisch unmodifizierte s. § 11)Als einschlägig gilt die Aussage des spätrömischen Geschichtsschreibers Ammianus Marcellinus 28, 5, 14 über die Burgunden: „Er [der König] muß nach alter Sitte sein Amt niederlegen, wenn das Kriegsglück sich gegen ihn erklärt hat, oder der Boden eine reichliche Ernte verweigert hat“ (vgl. Auszüge aus Ammianus Marcellinus, übersetzt von D. Coste (Die Geschichtsschreiber der deutschen Vorzeit in deutscher Bearbeitung unter dem Schutze Sr. Majestät des Königs Friedrich Wilhelm IV. von Preußen hg. von G. H. Pertz [u. a.]). – Leipzig: Franz Duncker 1879, S. 68). In Burgund gab es aber kein institutionalisiertes Absetzungsverfahren mit einem Gesetzsprecher wie in den nordischen Ländern, weshalb es im Text besser „ein ,Verschmähen‘“ heißen [493]müßte (vgl. dazu Brunner, Heinrich, Deutsche Rechtsgeschichte, Band 1, 2.Aufl. – Leipzig: Duncker & Humblot 1906, S. 170).
19
charismatische Qualifikation des Monarchen so absolut festgehalten worden, daß jegliches, gleichviel wie geartete, Mißgeschick: nicht nur Kriegsunglück, sondern ebenso: Dürre, Überschwemmungen, unheilvolle astronomische Vorgänge usw. ihn zu öffentlicher Buße, eventuell zur Abdankung zwangen. Er hatte dann das [A 141]Charisma der vom Himmelsgeist verlangten (klassisch determinierten) „Tugend“ nicht und war also nicht legitimer „Sohn des Himmels“.Kap. III, § 11, dort speziell unter e), unten, S. 501 f.
20
Die charismatische Stellung des chinesischen Kaisers erklärt Max Weber in seiner Konfuzianismus-Studie (MWG I/19, S. 176 f.) aus den ins Ethische gewendeten magisch-religiösen Wurzeln seiner ursprünglichen Rolle als „Regenmacher“. Die Vertreter der konfuzianischen Orthodoxie (insbes. an der Han-lin-Akademie) wachten über die Tugenden des Kaisers. Beispiele für öffentliche Schuldbekenntnisse finden sich in der Feudalzeit bis zum ausgehenden 19. Jahrhundert.
3. Der Herrschaftsverband Gemeinde: ist eine emotionale Vergemeinschaftung. Der Verwaltungsstab des charismatischen Herren ist kein „Beamtentum“[,] am wenigsten ein fachmäßig eingeschultes. Er ist weder nach ständischen noch nach Gesichtspunkten der Haus- oder persönlichen Abhängigkeit ausgelesen. Sondern er ist seinerseits nach charismatischen Qualitäten ausgelesen: dem „Propheten“ entsprechen die „Jünger“, dem „Kriegsfürsten“ die „Gefolgschaft“, dem „Führer“ überhaupt: „Vertrauensmänner“. Es gibt keine „Anstellung“ oder „Absetzung“, keine „Laufbahn“ und kein „Aufrücken“. Sondern nur Berufung nach Eingebung des Führers auf Grund der charismatischen Qualifikation des Berufenen. Es gibt keine „Hierarchie“, sondern nur Eingreifen des Führers bei genereller oder im Einzelfall sich ergebender charismatischer Unzulänglichkeit des Verwaltungsstabes für eine Aufgabe, eventuell auf Anrufen. Es gibt keine „Amtssprengel“ und „Kompetenzen“, aber auch keine Appropriation von Amtsgewalten durch „Privileg“. Sondern nur (möglicherweise) örtliche oder sachliche Grenzen des Charisma und der „Sendung“. Es gibt keinen „Gehalt“ und keine „Pfründe“. Sondern die Jünger oder Gefolgen leben (primär) mit dem Herren in Liebes- bzw. Kameradschaftskommunismus aus den mäzenatisch beschafften Mitteln. Es gibt keine feststehenden „Behörden“, sondern nur charismatisch, im Umfang des Auftrags des [494]Herren und: des eigenen Charisma, beauftragte Sendboten. Es gibt kein Reglement, keine abstrakten Rechtssätze, keine an ihnen orientierte rationale Rechtsfindung, keine an traditionalen Präzedenzien orientierten
u
Weistümer und Rechtssprüche. Sondern formal sind aktuelle Rechtsschöpfungen von Fall zu Fall, ursprünglich nur Gottesurteile und Offenbarungen maßgebend. Material aber gilt für alle genuin charismatische Herrschaft der Satz: „es steht geschrieben, – ich aber sage euch“;[494]A: orientierte
21
der genuine Prophet sowohl wie der genuine Kriegsfürst wie jeder genuine Führer überhaupt verkündet, schafft, fordert neue Gebote, – im ursprünglichen Sinn des Charisma: kraft Offenbarung, Orakel, Eingebung oder: kraft konkretem Gestaltungswillen, der von der Glaubens-, Wehr-, Partei- oder anderer Gemeinschaft um seiner Herkunft willen anerkannt wird. Die Anerkennung ist pflichtmäßig. Sofern der Weisung[494]Bei Matthäus 5, 21–22 heißt es: „Ihr habt gehört, daß zu den Alten gesagt ist […]. Ich aber sage euch […].“
v
eine konkurrierende Weisung eines andern mit dem Anspruch auf charismatische Geltung entgegentritt, liegt ein letztlich nur durch magische Mittel oder (pflichtmäßige) Anerkennung der Gemeinschaft entscheidbarer Führerkampf vor, bei dem notwendig auf der einen Seite nur Recht, auf der andren nur sühnepflichtiges Unrecht im Spiel sein kann. In A folgt: nicht
Die charismatische Herrschaft ist, als das Außeralltägliche, sowohl der rationalen, insbesondere der bureaukratischen, als der traditionalen, insbesondre der patriarchalen und patrimonialen oder ständischen, schroff entgegengesetzt. Beide sind spezifische Alltags-Formen der Herrschaft, – die (genuin) charismatische ist spezifisch das Gegenteil. Die bureaukratische Herrschaft ist spezifisch rational im Sinn der Bindung an diskursiv analysierbare Regeln, die charismatische spezifisch irrational im Sinn der Regelfremdheit. Die traditionale Herrschaft ist gebunden an die Präzedenzien der Vergangenheit und insoweit ebenfalls regelhaft orientiert, die charismatische stürzt (innerhalb ihres Bereichs) die Vergangenheit um und ist in diesem Sinn spezifisch [495]revolutionär. Sie kennt keine Appropriation der Herrengewalt nach Art eines Güterbesitzes, weder an den Herren noch an ständische Gewalten. Sondern legitim ist sie nur soweit und solange, als das persönliche Charisma kraft Bewährung „gilt“, das heißt: Anerkennung findet und „brauchbar“ ist für
x
Vertrauensmänner, Jünger, Gefolge, nur auf die Dauer seiner charismatischen BewährtheitA: der ; ist für sinngemäß ergänzt.
w
. [495]Satzkonstruktion in A defekt.
Das Gesagte dürfte kaum einer Erläuterung benötigen. Es gilt für den rein „plebiszitären“ charismatischen Herrscher (Napoleons „Herrschaft des Genies“,
22
[A 142]welche Plebejer zu Königen und Generälen machte)[495] Der Ausdruck findet sich bei Friedrich von Wieser als Anspruch des Genies auf Führerschaft gegenüber den Massen, allerdings ohne direkten Bezug auf Napoleon I. (v. Wieser, Friedrich, Über die gesellschaftlichen Gewalten. Rectoratsrede in der Aula der k.k. deutschen Carl-Ferdinands-Universität in Prag am 6. November 1901. – Prag: Selbstverlag der k.k. deutschen Carl-Ferdinands-Universität 1901, S. 27). Napoleon I. ist als militärisches Genie, auch als Genie in der Auswahl seiner Vertrauten bezeichnet worden. Eine legitimatorische Theorie der „Herrschaft des Genies“ entwickelte Napoleon III. Vgl. dazu Weber, Bürokratismus, MWG I/22-4, S. 165 f. mit Hg.-Anm. 15.
23
ganz ebenso wie für den Propheten oder Kriegshelden. Von den Generälen, die Napoleon I. auszeichnete, stammten einige aus sehr einfachen Verhältnissen. André Masséna stieg vom Schiffsjungen zum Herzog von Rivoli und Fürsten von Eßling auf. Er galt als „Heldenlump“ unter den in den Marschallsrang erhobenen Generälen. Ebenso zu nennen sind: Joachim Murat (Sohn eines Gastwirts, Schwager Napoleons und von diesem zum König von Neapel ernannt), Michel Ney (Sohn eines Böttchers, zum Herzog von Elchingen und Fürst von der Moskwa ernannt) sowie Charles-François-Pierre Augereau (Sohn eines Obsthändlers, zum Herzog von Castiglione ernannt). Vgl. Bleibtreu, Carl, Marschälle, Generale, Soldaten Napoleons I. – Berlin: Alfred Schall 1898, Zitat: S. 386; dort auch des öfteren „Genie Bonapartes“ in Bezug auf Napoleons Auswahl von Führungspersonal, z. B. S. 379, 432.
4. Reines Charisma ist spezifisch wirtschaftsfremd. Es konstituiert, wo es auftritt, einen „Beruf“ im emphatischen Sinn des Worts: als „Sendung“ oder innere „Aufgabe“. Es verschmäht und verwirft, im reinen Typus, die ökonomische Verwertung der Gnadengaben als Einkommenquelle, – was freilich oft mehr Anforderung als Tatsache bleibt. Nicht etwa, daß das Charisma immer auf Besitz und Erwerb verzichtete, wie das unter Umständen (s. gleich)
24
Propheten und ihre Jünger tun. Der Kriegsheld und seine Gefolgschaft suchen Beute, der plebiszitäre Herrscher oder charismatische Parteiführer materielle Mittel ihrer Macht, [496]der erstere außerdem: materiellen Glanz seiner Herrschaft zur Festigung seines Herrenprestiges. Was sie alle verschmähen – solange der genuin charismatische Unten, S. 496 f., Zeile 19 ff.
y
Typus besteht – ist: die traditionale oder rationale Alltagswirtschaft, die Erzielung von regulären „Einnahmen“ durch eine darauf gerichtete kontinuierliche wirtschaftliche Tätigkeit. Mäzenatische – großmäzenatische (Schenkung, Stiftung, Bestechung, Großtrinkgelder) – oder: bettelmäßige Versorgung auf der einen, Beute, gewaltsame oder (formal) friedliche Erpressung auf der andren Seite sind die typischen Formen der charismatischen Bedarfsdeckung. Sie ist, von einer rationalen Wirtschaft her gesehen, eine typische Macht der „Unwirtschaftlichkeit“. Denn sie lehnt jede Verflechtung in den Alltag ab. Sie kann nur, in voller innerer Indifferenz, unsteten Gelegenheitserwerb sozusagen „mitnehmen“. „Rentnertum“ als Form der Wirtschaftsenthobenheit kann – für manche Arten – die wirtschaftliche Grundlage charismatischer Existenzen sein. Aber für die normalen charismatischen „Revolutionäre“ pflegt das nicht zu gelten. [496]A: genuincharismatische
Die Ablehnung kirchlicher Ämter durch die Jesuiten
25
ist eine rationalisierte Anwendung dieses „Jünger“-Prinzips. Daß alle Helden der Askese, Bettelorden und Glaubenskämpfer dahin gehören, ist klar. Fast alle Propheten sind mäzenatisch unterhalten worden. Der gegen das Missionarsschmarotzertum gerichtete Satz des Paulus: „wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen“, bedeutet natürlich keinerlei Bejahung der „Wirtschaft“, sondern nur die Pflicht, gleichviel wie, „im Nebenberuf“ sich den notdürftigen Unterhalt zu schaffen,[496]Der Begründer des Jesuitenordens, Ignatius von Loyola, hatte den Orden als Priester-Vereinigung und Miliz des Papstes konzipiert. Die Übernahme kirchlicher Ämter abzulehnen, erhob er zum Grundsatz, der allerdings nicht in die Konstitutionen des Ordens aufgenommen wurde. v. Loyola wollte damit die Selbständigkeit und Einheit des Ordens erhalten und die Mitglieder flexibel, insbesondere für die Missions- und Bildungsarbeit, einsetzen können. So entstand eine vom Ordensgeneral und dem Papst zu steuernde Organisation, die unabhängig von der bestehenden Ämterverfassung der Kirche war. Vgl. Gothein, Eberhard, Ignatius von Loyola. – Halle: Verein für Reformationsgeschichte 1885, bes. S. 69, 89 ff.
26
weil das eigentlich charismatische Gleichnis von [497]den „Lilien auf dem Felde“2. Thessalonicher 3, 10: „Und da wir bei euch waren, geboten wir euch solches, daß, so jemand nicht will arbeiten, der soll auch nicht essen“. Weber geht es hier um den frühchristlichen, aus dem Judentum stammenden und von vielen Mönchsorden befolgten Grundsatz von der Unentgeltlichkeit der Verkündigung. Apostel, Propheten [497]und Lehrer sollten auf ihren Missionsreisen entweder von ihrer Hände Arbeit oder von dem freiwillig Gegebenen leben. Vgl. Weber, Religiöse Gemeinschaften, MWG I/22-2, S. 180 f., und Weber, Die Phärisäer, MWG I/21, S. 794 f.
27
nicht im Wortsinn, sondern nur in dem des Nichtsorgens für den nächsten Tag durchführbar war. – Auf der andren Seite ist es bei einer primär künstlerischen charismatischen Jüngerschaft denkbar, daß die Enthebung aus den Wirtschaftskämpfen durch Begrenzung der im eigentlichen Sinn Berufenen auf „wirtschaftlich Unabhängige“ (also: Rentner) als das Normale gilt (so im Kreise Stefan Georges, wenigstens der primären Absicht nach).Matthäus 6, 28: „Und warum sorget ihr für die Kleidung? Schauet die Lilien auf dem Felde, wie sie wachsen; sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht.“
28
In der Anfangszeit waren die meisten Kreismitglieder, ebenso wie Stefan George selbst, ohne Erwerbsberuf. Wie einer der engsten George-Anhänger berichtete, soll Stefan George in einem (undatierten) Gespräch mit Max Weber bestritten haben, von wirtschaftlichen Bedingungen abhängig zu sein (vgl. Wolters, Friedrich, Stefan George und die Blätter für die Kunst. Deutsche Geistesgeschichte seit 1890. – Berlin: Georg Bondi 1930, S. 476, sowie Weber, Charismatismus, MWG I/22-4, S. 465 mit Hg.-Anm. 14). – In der 2. Auflage fügte Marianne Weber an dieser Stelle eine erläuternde Fußnote ein: Weber habe bei dem Beispiel „vermutlich nicht an die auf arbeitslosem Einkommen beruhende, sondern an die den ökonomischen Gütererwerb ablehnende Seite des Rentnertums gedacht“ (WuG2, S. 142, Fn. 1).
5. Das Charisma ist die große revolutionäre Macht in traditional gebundenen Epochen. Zum Unterschied von der ebenfalls revolutionierenden Macht der „ratio“, die entweder geradezu von außen her wirkt: durch Veränderung der Lebensumstände und Lebensprobleme und dadurch, mittelbar[,] der Einstellungen zu diesen, oder aber: durch Intellektualisierung, kann Charisma eine Umformung von innen her sein, die, aus Not oder Begeisterung geboren, eine Wandlung der zentralen Gesinnungs- und Tatenrichtung unter völliger Neuorientierung aller Einstellungen zu allen einzelnen Lebensformen und zur „Welt“ überhaupt bedeutet. In vorrationalistischen Epochen teilen Tradition und Charisma nahezu die Gesamtheit der Orientierungsrichtungen des Handelns unter sich auf.
5. Die Veralltäglichung des Charisma.
§ 11. In ihrer genuinen Form ist die charismatische Herrschaft spezifisch außeralltäglichen Charakters und stellt eine streng [498]persönlich, an die Charisma-Geltung persönlicher Qualitäten und deren Bewährung, geknüpfte soziale Beziehung dar. Bleibt diese nun aber nicht rein ephemer, sondern nimmt sie [A 143]den Charakter einer Dauerbeziehung: – „Gemeinde“ von Glaubensgenossen oder Kriegern oder Jüngern, oder: Parteiverband, oder politischer, oder hierokratischer Verband – an, so muß die charismatische Herrschaft, die sozusagen nur in statu nascendi in idealtypischer Reinheit bestand, ihren Charakter wesentlich ändern: sie wird traditionalisiert oder rationalisiert (legalisiert) oder: beides in verschiedenen Hinsichten. Die treibenden Motive dafür sind die folgenden:
a) das ideelle oder auch materielle Interesse der Anhängerschaft an der Fortdauer und steten Neubelebung der Gemeinschaft, –
b) das noch stärkere ideelle und noch stärkere materielle Interesse des Verwaltungsstabes: der Gefolgschaft, Jüngerschaft, Parteivertrauensmännerschaft usw., daran:
1. die Existenz der Beziehung fortzusetzen, – und zwar sie
2. so fortzusetzen, daß dabei die eigne Stellung ideell und materiell auf eine dauerhafte Alltagsgrundlage gestellt wird: äußerlich Herstellung der Familien-Existenz oder doch der saturierten Existenz an Stelle der weltenthobenen familien-
a
und wirtschaftsfremden „Sendungen“. [498]A: Familien- ; lies: familienfremden
Diese Interessen werden typisch aktuell beim Wegfall der Person des Charisma-Trägers und der nun entstehenden Nachfolgerfrage. Die Art, wie sie gelöst wird – wenn sie gelöst wird und also: die charismatische Gemeinde fortbesteht (oder: nun erst entsteht) – ist sehr wesentlich bestimmend für die Gesamtnatur der nun entstehenden sozialen Beziehungen.
Sie kann folgende Arten von Lösungen erfahren.
a) Neu-Aufsuchen eines als Charisma-Träger zum Herren Qualifizierten nach Merkmalen.
[499]Ziemlich reiner Typus: das Aufsuchen des neuen Dalai Lama (eines nach Merkmalen der Verkörperung des Göttlichen auszulesenden Kindes,
29
ganz[499] Nach lamaistischer Auffassung ging nach dem Tod des Dalai Lama die in ihm inkarnierte Seele des Bodhisattva Avalokiteśvara auf ein Kind über, das dann durch die Befragung von Orakeln aufgefunden wurde. Man suchte in ganz Tibet nach Neugeborenen, die mit besonderen Körpermalen oder unter besonderen Begleitumständen zur Welt gekommen waren. Das als Wiedergeburt erkannte Kind wurde in ein Kloster in Lhasa gebracht, wo es im Alter von sieben oder acht Jahren als Dalai Lama inthronisiert wurde. Vgl. Weber, Umbildung des Charisma, MWG I/22-4, S. 494 f. mit Hg.-Anm. 25.
b
der Aufsuchung des Apis-Stiers ähnlich).[499]A: (ganz
30
Der Apisstier (altägyptisch: Ḥapi, „lebendiger Stier“) wurde im ägyptischen Memphis als Gott verehrt. Nach Herodot 3,28 mußte der Stier schwarz sein, auf der Stirn einen viereckigen weißen Fleck, auf dem Rücken das Bild eines Adlers, im Schweif doppeltes Haar und unter der Zunge das Bild eines Käfers aufweisen.
Dann ist die Legitimität des neuen Charisma-Trägers an Merkmale, also: „Regeln“, für die eine Tradition entsteht, geknüpft (Traditionalisierung), also: der rein persönliche Charakter zurückgebildet.
b) Durch Offenbarung: Orakel, Los, Gottesurteil oder andre Techniken der Auslese. Dann ist die Legitimität des neuen Charisma-Trägers eine aus der Legitimität der Technik abgeleitete (Legalisierung).
Die israelitischen Schofetim
31
hatten zuweilen angeblich diesen Charakter. Das alte Kriegsorakel bezeichnete angeblich Saul.Max Weber spielt hier auf die Deutung der „schofetim“ („Richter“) als erfolgreiche, charismatische Heerführer der alten Bundeszeit an, deren Aufgabe es war, politisch-militärische Entschließungen auszugeben, um Israel aus schwerer Kriegsnot zum Sieg über seine Feinde zu führen. Zur Auseinandersetzung über Bezeichnung und Funktion der „schofetim“ vgl. Weber, Antikes Judentum, MWG I/21, S. 360–364, mit bes. Referenz auf Schwally, Friedrich, Semitische Kriegsaltertümer. – Leipzig: Dieter’sche Verlagsbuchhandlung 1901, S. 99 f.
32
Nach 1 Samuel 14,37 wurde das Kriegsorakel befragt und ermöglichte Saul nach einem Sühneopfer den Sieg Israels über die feindlichen Heere (vgl. Schwally, Semitische Kriegsaltertümer, S. 17 f.). Saul markiert den Übergang vom alten Prophetentum zum Königtum. Andere Überlieferungen sehen seine Legitimierung durch Los der israelitischen Stämme und ihren Tausendschaften (1 Samuel 10,17 ff.), durch Offenbarung und Salbung durch den „Seher“ Samuel (1 Samuel 9, 15.16) oder durch seine Erwählung durch den Geist Gottes (1 Samuel 11). Vgl. dazu Budde, Karl, Die altisraelitische Religion, 3. Aufl. – Gießen: Alfred Töpelmann 1912, S. 52 ff., sowie die entsprechenden Ausführungen in Weber, Antikes Judentum, MWG I/21, S. 380 f. mit Hg.-Anm. 44.
[500]c) Durch Nachfolgerdesignation seitens des bisherigen Charisma-Trägers und Anerkennung seitens der Gemeinde.
Sehr häufige Form. Die Kreation der römischen Magistraturen (am deutlichsten erhalten in der Diktatoren-Kreation
c
und in der Institution des „interrex“)[500]A: Diktaten-Kreation
33
hatte ursprünglich durchaus diesen Charakter. [500]Weber bezieht sich hier auf die Zustände in der römischen Republik. Der interrex (eigentlich: Zwischenkönig) wurde vom Senat als Wahlleiter eingesetzt, wenn die beiden amtshabenden Consuln die Wahlen ihrer Nachfolger nicht selber durchführen konnten. In Notlagen konnte einer der beiden Consuln einen mit allen Befehlsgewalten ausgestatteten Dictator für maximal sechs Monate ernennen. Weber betont hingegen (wie Theodor Mommsen) den Designationsgedanken als eigenständigen Teil des Ernennungsverfahrens: „die Kandidatenzulassung und die Kreation des neuen Beamten durch den alten [galten] als Vorbedingung gültiger Einsetzung“, wobei der römischen Gemeinde nur die Akklamation, später die Wahl zwischen den vorgestellten Kandidaten zufiel. Vgl. Weber, Die Stadt, MWG I/22-5, S. 189 mit Hg.-Erläuterungen.
Die Legitimität wird dann eine durch die Designation erworbene Legitimität.
d) Durch Nachfolgerdesignation seitens des charismatisch qualifizierten Verwaltungsstabs und Anerkennung durch die Gemeinde. Die Auffassung als „Wahl“ bzw. „Vorwahl“- oder „Wahlvorschlagsrecht“ muß diesem Vorgang in seiner genuinen Bedeutung durchaus ferngehalten werden. Es handelt sich nicht um freie, sondern um streng pflichtmäßig gebundene Auslese, nicht um Majoritätsabstimmungen, sondern um richtige Bezeichnung, Auslese des Richtigen, des wirklichen Charisma-Trägers, den auch die Minderheit zutreffend herausgefunden haben kann. Die Einstimmigkeit ist Postulat, das Einsehen des Irrtums Pflicht, das Verharren in [A 144]ihm schwere Verfehlung, eine „falsche“ Wahl ein zu sühnendes (ursprünglich: magisches) Unrecht.
Aber allerdings scheint die Legitimität doch leicht eine solche des unter allen Kautelen der Richtigkeit getroffenen Rechtserwerbs, meist mit bestimmten Formalitäten (Inthronisation usw.).
Dies der ursprüngliche Sinn der Bischofs- und Königs-Krönung durch Klerus oder Fürsten mit Zustimmung der Gemeinde im Okzident und zahlreicher analoger Vorgänge in aller Welt. Daß daraus der Gedanke der „Wahl“ entstand, ist später zu erörtern.
34
Gemeint ist Kap. III, § 14, unten, S. 533–542.
[501]e) Durch die Vorstellung, daß das Charisma eine Qualität des Blutes sei und also an der Sippe, insbesondre den Nächstversippten, des Trägers hafte: Erbcharisma. Dabei ist die Erbordnung nicht notwendig die für appropriierte Rechte, sondern oft heterogen, oder es muß mit Hilfe der Mittel unter a–d der „richtige“ Erbe innerhalb der Sippe festgestellt werden.
Zweikampf von Brüdern kommt bei Negern vor.
35
Erbordnung derart, daß die Ahnengeisterbeziehung nicht gestört wird (nächste Generation), z. B. in China.[501]Zu Zweikämpfen unter „Thronprätendenten von Negerstämmen (namentlich zwischen Brüdern)“ vgl. Weber, Umbildung des Charisma, MWG I/22-4, S. 499 mit Hg.-Anm. 39.
36
Seniorat oder Bezeichnung durch die Gefolgschaft sehr oft im Orient (daher die „Pflicht“ der Ausrottung aller sonst denkbaren Anwärter im Hause Osmans).Der Zusammenhalt der Sippe, auch der kaiserlichen, basierte auf dem stark ausgeprägten Ahnenkult. Nach dem traditionellen chinesischen Glauben hatten die Ahnengeister eine „Vermittler-Rolle für Wünsche der Nachfahren beim Himmelsgeist oder -Gott“. Vgl. Weber, Konfuzianismus, MWG I/19, S. 261; dort mit einem Beispiel aus dem klassischen Urkundenbuch Shu-ching.
37
Der Brudermord war im Osmanischen Reich vom 15. bis 17. Jahrhundert bei der Herrschernachfolge durchaus verbreitet, um Mitbewerber aus der Familie auszuschalten und die Einheit des Reichs zu wahren. Sultan Mehmet II. (1451–1481) erlaubte in einem „Kanun [Gesetz] zur Sicherung der Thronherrschaft“ den Brudermord unter seinen Nachkommen, wenn es „zur Sicherheit der Ruhe der Welt“ zweckmäßig sei. Vgl. Hammer[-Purgstall], Joseph von, Des osmanischen Reichs Staatsverfassung und Staatsverwaltung, dargestellt aus den Quellen seiner Grundgesetze, 1. Theil: Die Staatsverfassung. – Wien: Camesinasche Buchhandlung 1815, S. 98.
Nur im mittelalterlichen Okzident und in Japan, sonst nur vereinzelt, ist das eindeutige Prinzip des Primogeniturerbrechts an der Macht durchgedrungen
38
und hat dadurch die Konsolidierung der politischen Verbände (Vermeidung der Kämpfe mehrerer Prätendenten aus der erbcharismatischen Sippe) sehr gefördert. Die Thronfolge des Erstgeborenen wurde rechtlich festgelegt für das Heilige Römische Reich deutscher Nation in der Goldenen Bulle 1356 und in Japan mit einem 1889 verkündeten Hausgesetz.
Der Glaube gilt dann nicht mehr den charismatischen Qualitäten der Person, sondern dem kraft der Erbordnung legitimen Erwerb. (Traditionalisierung und Legalisierung.) Der Begriff des „Gottesgnadentums“ wird in seinem Sinn völlig verändert und bedeutet nun: Herr zu eignem, nicht von Anerkennung der [502]Beherrschten abhängigem, Recht. Das persönliche Charisma kann völlig fehlen.
Die Erbmonarchie, die massenhaften Erbhierokratien Asiens und das Erbcharisma der Sippen als Merkmal des Ranges und der Qualifikation zu Lehen und Pfründen (s. folgenden §)
39
gehören[502]Siehe besonders Kap. III, §§ 12 b und c, unten, S. 513–527.
d
dahin. [502]A: gehört
f)
e
A: 6.
40
Durch die Vorstellung, daß das Charisma eine durch hierurgische Mittel seitens eines Trägers auf andre übertragbare oder erzeugbare (ursprünglich: magische) Qualität sei: Versachlichung des Charisma, insbesondere: Amtscharisma. Der Legitimitätsglaube gilt dann nicht mehr der Person, sondern den erworbenen Qualitäten und der Wirksamkeit der hierurgischen Akte. Zur Aufzählung der einzelnen Lösungen des Nachfolgeproblems sind die Buchstaben a) bis e) verwendet worden. Die Ziffer 6 ist daher in den 6. Buchstaben des Alphabets, also „f“, geändert worden. Ein Rückverweis auf § 11, Nr. 5 (statt e), unten, S. 504, Z. 21, legt die Vermutung nahe, daß § 11 (ebenso wie § 10) zunächst mit Ziffern und nicht mit Buchstaben untergliedert war. Vgl. dazu auch den Editorischen Bericht, oben, S. 104.
Wichtigstes Beispiel: Das priesterliche Charisma, durch Salbung, Weihe oder Händeauflegung, das königliche, durch Salbung und Krönung übertragen oder bestätigt. Der character indelebilis bedeutet die Loslösung der amtscharismatischen Fähigkeiten von den Qualitäten der Person des Priesters.
41
Eben deshalb gab er, vom DonatismusNach katholischer Lehre erhält der Geistliche durch das Sakrament der Priesterweihe ein unauslöschliches Merkmal („character indelebilis“), das er – selbst im Fall persönlicher Verfehlungen – nicht mehr verliert.
42
und MontanismusDie Donatisten, die im 4./5. Jahrhundert von Nordafrika aus gegen die römische Kirche opponierten, vertraten die Ansicht, daß nur bei sittlicher Würdigkeit des Priesters die von ihm im Namen der Kirche gespendeten Gnadenmittel wirksam seien.
43
ange[503]fangen bis zur puritanischen (täuferischen) Revolution,Die Montanisten – Anhänger einer chiliastischen, asketischen religiösen Bewegung in der Kirche des ausgehenden 2. und beginnenden 3. Jahrhunderts – widersetzten sich der Verdrängung der charismatischen Prediger durch die kirchlichen Amtsträger. Insbesondere glaubten sie, daß „Geistesträger“ die Gabe besäßen, Sünden zu vergeben, ohne ein kirchliches Amt innezuhaben. Diese Gabe hafte, so Adolf Harnack, nicht „an der Amtsübertragung“. Vgl. Harnack, Adolf, Dogmengeschichte, 2., neu bearb. Aufl. – Freiburg i. B. und Leipzig: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) 1893, S. 78; an dieser Stelle annotiert Weber in seinem Handexemplar (Max Weber-Arbeitsstelle, BAdW München): „Anstalts-Gnadenspendung oder Gnadenspendung d[urch] individuelle Charismata“.
44
Anlaß zu steten Kämpfen (der „Mietling“ der Quäker[503]Die „Puritanische Revolution“ ist eine durch den englischen Historiker Samuel Rawson Gardiner (1829–1902) popularisierte Bezeichnung für die Verbindung von politischem und religiösem Kampf in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts (vgl. Gardiner, Samuel Rawson, The First Two Stuarts And The Puritan Revolution 1603–1660. – London: Longmans, Green & Co. 1876). Weber rechnet den Puritanern die später sogenannten „Täufer“ (Baptisten, Quäker usw.) zu. Die Puritaner wandten sich gegen die bischöfliche Verfassung der anglikanischen Kirche und setzten sich für eine Rückkehr zum Prediger- und Ältestenamt ein, über das die Einzelgemeinde zu befinden habe.
45
ist der amtscharismatische Prediger). Als „Mietlinge“ bezeichnete der Begründer der Quäker, George Fox (1624–1691), Priester, die nicht allein aufgrund einer unmittelbaren göttlichen Erleuchtung frei predigten, sondern als theologisch gebildete Berufsprediger besoldet wurden. Vgl. Bernstein, Eduard, Sozialismus und Demokratie in der großen englischen Revolution, 3. Aufl. – Stuttgart: J.H.W. Dietz Nachfolger 1919, S. 298 f., sowie Weber, Max, Die protestantischen Sekten und der Geist des Kapitalismus, in: GARS I, S. 230 (MWG I/18).
§ 12. Mit der Veralltäglichung des Charisma aus dem Motiv der Nachfolger-Beschaffung parallel gehen die Veralltäglichungsinteressen des Verwaltungsstabes. Nur in statu nascendi und solange der charismatische Herr genuin außeralltäglich waltet, kann der Verwaltungsstab mit diesem aus Glauben und Begeisterung anerkannten Herren mäzenatisch oder von Beute oder Gelegenheitserträgen leben. Nur die kleine begeisterte Jünger- und Gefolgen-Schicht ist dazu an sich dauernd bereit, „macht“ ihr Leben aus ihrem „Beruf“ nur „ideell“. [A 145]Die Masse der Jünger und Gefolgen will ihr Leben (auf die Dauer) auch materiell aus dem „Beruf“ machen und muß dies auch, soll sie nicht schwinden.
Daher vollzieht sich die Veralltäglichung des Charisma auch
1. in der Form der Appropriation von Herrengewalten und Erwerbschancen an die Gefolgschaft oder Jüngerschaft und unter Regelung ihrer Rekrutierung.
2. Diese Traditionalisierung oder Legalisierung (je nachdem: ob rationale Satzung oder nicht) kann verschiedene typische Formen annehmen:
[504]1. Die genuine Rekrutierungsart ist die nach persönlichem Charisma. Die Gefolgschaft oder Jüngerschaft kann bei der Veralltäglichung nun Normen für die Rekrutierung aufstellen, insbesondere:
a) Erziehungs-,
b) Erprobungs-Normen.
Charisma kann nur „geweckt“ und „erprobt“, nicht „erlernt“ oder „eingeprägt“ werden. Alle Arten magischer (Zauberer-, Helden-)Askese und alle Noviziate gehören in diese Kategorie der Schließung des Verbandes des Verwaltungsstabes (s. über die charismatische Erziehung Kap. IV).
46
Nur der erprobte Novize wird zu den Herrengewalten zugelassen. Der genuine charismatische Führer kann sich diesen Ansprüchen erfolgreich widersetzen, – der Nachfolger nicht, am wenigsten der (§ 13, Nr. 4)[504]Im unvollendeten Kap. IV, unten, S. 592–600, nicht ausgeführt. Aussagen zur charismatischen Erziehung finden sich in der älteren Fassung von „Wirtschaft und Gesellschaft“, vgl. Weber, Umbildung des Charisma, MWG I/22-4, S. 530–535.
47
vom Verwaltungsstab gekorene. Der Verweis kann sich auf Kap. III, § 13, Nr. 4, unten, S. 532, oder, wenn man analog zum nächsten Verweis „§ 11, Nr. 5“ (unten mit Hg.-Anm.49) einen Lesefehler (11 statt 13) in Kombination mit einer Umnumerierung annimmt, auch auf Kap. III, § 11 d), oben, S. 500, beziehen.
Alle Magier- und Krieger-Askese im „Männerhaus“, mit Zöglingsweihe und Altersklassen gehört hierher. Wer die Kriegerprobe nicht besteht, bleibt „Weib“,
48
d. h. von der Gefolgschaft ausgeschlossen. Max Weber zitiert hier aus der Studie von Heinrich Schurtz, Altersklassen (wie oben, S. 361, Anm. 33), S. 100.
2. Die charismatischen Normen können leicht in traditional ständische (erbcharismatische) umschlagen. Gilt Erbcharisma (§ 11, Nr. 5)
49
des Führers, so liegt Erbcharisma auch des Verwaltungsstabes und eventuell selbst der Anhänger als Regel der Auslese und Verwendung sehr nahe. Wo ein politischer Verband von diesem Prinzip des Erbcharisma streng und völlig erfaßt ist: alle Appropriation von Herrengewalten, Lehen, Pfründen, Erwerbschancen aller Art darnach sich vollziehen, besteht der Typus des „Geschlechterstaats“. Alle Gewalten und Chancen [505]jeder Art werden traditionalisiert. Die Sippenhäupter (also: traditionale, persönlich nicht durch Charismen legitimierte Gerontokraten oder Patriarchen) regulieren die Ausübung, die ihrer Sippe nicht entzogen werden kann. Nicht die Art der Stellung bestimmt den „Rang“ des Mannes oder seiner Sippe, sondern der erbcharismatische Sippenrang ist maßgebend für die Stellungen, die ihm zukommen. Gemeint ist Kap. III, § 11, e), oben, S. 501 f. Zur uneinheitlichen Untergliederung des § 11 vgl. oben, S. 502, Anm. 40.
Hauptbeispiel: Japan vor der Bureaukratisierung,
50
zweifellos in weitem Maße auch China (die „alten Familien“) vor der Rationalisierung in den Teilstaaten,[505]Der Umbruch von der alten Geschlechterverfassung zum bürokratisch verwalteten Einheitsstaat in Japan wird mit dem Taika-Edikt (645/646) datiert. Es leitete umfassende Reformen von Verfassung, Verwaltung und Religion nach chinesischem Vorbild ein.
51
Indien in den Kastenordnungen,Bis zur Reichseinigung Chinas, die Weber auf die Taten Shih Huang-ti’s (246–210 v. Chr.) zurückgeführt hat, war – namentlich in den Teilstaaten Tschu, Han und Wei – die Vorherrschaft der alten Sippen ungebrochen (vgl. dazu Weber, Konfuzianismus, MWG I/19, S. 183 f., mit den entsprechenden Nachweisen). Der Ausdruck „alte Familien“ für die mächtigen Sippen der Frühzeit ist belegt bei: Plath, Johann Heinrich, Über die Verfassung und Verwaltung China’s unter den drei ersten Dynastieen, in: Abhandlungen der Königlich Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-philologische Classe, Band 10, 2. Abt. – München: Verlag der K. Akademie 1865, S. 451–592, hier S. 476.
52
Rußland vor der Durchführung des Mjestnitschestwo und in anderer Form nachher,Den engen Zusammenhang von „Gentilcharismatismus“ (diesen Ausdruck verwendet Weber hier nicht) und Kastenordnung beschreibt Weber, Hinduismus, MWG I/20, bes. S. 116 und 185 ff.
53
ebenso: alle fest privilegierten „Geburtsstände“ (darüber Kap. IV)Durch das „mestničestvo“, ein kompliziertes System von Rang- und Ämterzuweisungen nach Herkunft und Verdiensten, wurde im 15. Jahrhundert der alte russische Geburtsadel abgelöst. Peter der Große ersetzte es schließlich 1722 durch die sog. Rangtabelle, die auf einer Kombination von Dienst und Leistung beruhte.
54
überall. In dem unvollendeten Kap. IV findet sich nur eine kurze Erwähnung der „Geburtsstände“, unten, S. 599.
3. Der Verwaltungsstab kann die Schaffung und Appropriation individueller Stellungen und Erwerbschancen für seine Glieder fordern und durchsetzen. Dann entstehen, je nach Traditionalisierung oder Legalisierung:
a) Pfründen (Präbendalisierung, – siehe oben),
55
Kap. III, § 8, oben, S. 481–483.
b) Ämter (Patrimonialisierung und Bureaukratisierung, – siehe oben),
56
Kap. III, § 7, oben, S. 469–474.
[506]c) Lehen (Feudalisierung),
welche nun statt der ursprünglichen rein akosmistischen
57
Versorgung aus mäzenatischen Mitteln oder Beute appropriiert werden. Näher [506]Hier im ursprünglichen Sinn von griech.: akosmos, „ungeordnet“.
zu a:
α. Bettelpfründen,
ß. Naturalrentenpfründen,
[A 146]γ. Geldsteuerpfründen,
δ. Sportelpfründen,
durch Regulierung der anfänglich rein mäzenatischen (α) oder rein beutemäßigen (ß[,] γ) Versorgung nach rationaler Finanzorganisation.
zu α. Buddhismus, –
zu ß. chinesische und japanische Reispfründen,
58
–In China und Japan wurden die Pfründen für die Beamten und Soldaten in Reis berechnet und zum Teil auch in Reis ausgezahlt („Reisrentenpfründen“). Für China galt dies seit der Ch’in-Herrschaft bis zum Ende der Ch’ing-Dynastie, d. h. vom 3. Jahrhundert v. Chr. bis ins 20. Jahrhundert n. Chr.; in Japan seit dem 17. Jahrhundert bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts. Vgl. Weber, Konfuzianismus, MWG I/19, S. 184, und Weber, Feudalismus, MWG I/22-4, S. 386, 391 (Zitat).
zu γ. die Regel in allen rationalisierten Erobererstaaten, –
zu δ. massenhafte Einzelbeispiele überall, insbesondere: Geistliche und Richter, aber in Indien auch Militärgewalten.
59
Weber meint hier vermutlich die „jagir-Pfründen“. Vgl. dazu oben, S. 479 mit Hg.-Anm. 73.
Zu b: Die „Veramtung“ der charismatischen Sendungen kann mehr Patrimonialisierung oder mehr Bureaukratisierung sein. Ersteres ist durchaus die Regel, letzteres findet sich in der Antike und in der Neuzeit im Okzident, seltener und als Ausnahme anderwärts.
Zu c: α. Landlehen mit Beibehaltung des Sendungscharakters der Stellung als solcher, –
ß. volle lehenmäßige Appropriation der Herrengewalten.
Beides schwer zu trennen. Doch schwindet die Orientierung am Sendungscharakter der Stellung nicht leicht ganz, auch im Mittelalter nicht.
6.1 Die Gliederungsziffer 6. ist doppelt vergeben, vgl. auch unten, S. 533, sowie den Editorischen Bericht, oben, S. 104 mit Anm. 50. Feudalismus.
Die Gliederungsziffer 6. ist doppelt vergeben, vgl. auch unten, S. 533, sowie den Editorischen Bericht, oben, S. 104 mit Anm. 50.
§ 12b. Gesondert zu sprechen ist noch von dem letzten in § 12 Nr. 3 genannten Fall (c: Lehen).
2
Und zwar deshalb, weil daraus eine Struktur des Herrschaftsverbandes entstehen kann, welche vom Patrimonialismus ebenso wie vom genuinen oder Erb-Charismatismus verschieden ist und eine gewaltige geschichtliche Bedeutung gehabt hat: der Feudalismus. Wir wollen Lehens- und Pfründen-Feudalismus als echte Formen unterscheiden. Alle andern, „Feudalismus“ genannten, Formen von Verleihung von Dienstland gegen Militärleistungen sind in Wirklichkeit patrimonialen (ministerialischen) Charakters und sind hier nicht gesondert zu behandeln. Denn von den verschiedenen Arten der Pfründen ist erst später bei der Einzeldarstellung zu reden. Kap. III, § 12, oben, S. 506.
3
Entsprechende Ausführungen sind nicht überliefert.
AA.
4
Lehen bedeutet stets: Es ist nicht ersichtlich, weshalb hier ein doppelter Gliederungsbuchstabe eingeführt wird. Eine übergeordnete Gliederungsebene A, B etc. findet sich nicht in §§ 12, 12a, 12b, sondern nur in § 12c. Zur Gliederungsproblematik vgl. den Editorischen Bericht, oben, S. 103 f.
aa) die Appropriation von Herrengewalten und Herrenrechten. Und zwar können als Lehen appropriiert werden
α. nur eigenhaushaltsmäßige, oder
ß. verbandsmäßige, aber nur ökonomische (fiskalische), oder auch
γ. verbandsmäßige Befehlsgewalten.
[514]Die Verlehnung erfolgt durch Verleihung gegen spezifische, normalerweise: primär militaristische, daneben verwaltungsmäßige Leistungen. Die Verleihung erfolgt in sehr spezifischer Art. Nämlich:
bb) primär rein personal, auf das Leben des Herrn und des Lehensnehmers (Vasallen). Ferner:
cc) kraft Kontrakts, also mit einem freien Mann, welcher (im Fall der hier Lehensfeudalismus genannten Beziehung)
dd) eine spezifische ständische (ritterliche) Lebensführung besitzt.
ee) Der Lehenkontrakt ist kein gewöhnliches „Geschäft“, sondern eine Verbrüderung zu (freilich) ungleichem Recht, welche beiderseitige Treuepflichten zur Folge hat. Treuepflichten, welche
[A 149]αα) auf ständische (ritterliche) Ehre gegründet sind, und
ßß) fest begrenzt sind.
Der Übergang vom Typus „α“ (oben bei der Erörterung „zu c“)
5
zum Typus „ß“ vollzieht sich, wo [514]Gemeint ist Kap. III, § 12, Nr. 3 c), oben, S. 506, Z. 23 ff.
aaa) die Lehen erblich, nur unter Voraussetzung der Eignung und der Erneuerung des Treuegelöbnisses an jeden neuen Herrn durch jeden neuen Inhaber appropriiert werden, und außerdem
bbb) der lehensmäßige Verwaltungsstab den Leihezwang durchsetzt, weil alle Lehen als Versorgungsfonds der Standeszugehörigen gelten.
Das erste ist ziemlich früh im Mittelalter, das zweite im weiteren Verlauf eingetreten. Der Kampf des Herren mit den Vasallen galt vor allem auch der (stillschweigenden) Beseitigung dieses Prinzips, welches ja die Schaffung bzw. Erwirkung einer eigenen patrimonialen „Hausmacht“ des Herren unmöglich machte.
BB. Lehenmäßige Verwaltung (Lehens-Feudalismus) bedeutet bei voller – in dieser absoluten Reinheit ebenso wenig wie der reine Patrimonialismus jemals zu beobachtender – Durchführung:
aa) alle Herrengewalt reduziert sich auf die kraft der Treuegelöbnisse der Vasallen bestehenden Leistungschancen, –
[515]bb) der politische Verband ist völlig ersetzt durch ein System rein persönlicher Treuebeziehungen zwischen dem Herren und seinen Vasallen, diesen und ihren weiterbelehnten (subinfeudierten) Untervasallen und weiter den eventuellen Untervasallen dieser. Der Herr hat Treueansprüche nur an seine Vasallen, diese an die ihrigen usw.
cc) Nur im Fall der „Felonie“ kann der Herr dem Vasallen, können diese ihren Untervasallen usw. das Lehen entziehen. Dabei ist aber der Herr gegen den treubrüchigen Vasallen auf die Hilfe der andern Vasallen oder auf die Passivität der Untervasallen des „Treubrechers“ angewiesen. Jedes von beiden ist nur zu gewärtigen, wenn die einen bzw. die andern auch ihrerseits Felonie ihres Genossen bzw. Herren gegen seine Herren als vorliegend ansehen. Bei den Untervasallen des Treubrechers selbst dann nicht, es sei denn, daß der Herr wenigstens die Ausnahme dieses Falls: Kampf gegen den Oberherren des eigenen Herren, bei der Subinfeudation durchgesetzt hat (was stets erstrebt, nicht immer aber erreicht wurde).
dd) Es besteht eine ständische Lehens-Hierarchie (im Sachsenspiegel: die „Heerschilde“)
6
je nach der Reihenfolge der Subinfeudation. Diese ist aber kein „Instanzenzug“ und keine „Hierarchie“. Denn ob eine Maßregel oder ein Urteil angefochten werden kann und bei wem, richtet sich prinzipiell nach dem „Oberhof“-, nicht nach dem lehenshierarchischen System (der Oberhof kann – theoretisch – einem Genossen des Inhabers der Gerichtsgewalt verlehnt sein, wenn dies auch faktisch nicht der Fall zu sein pflegt).[515]Heerschild bezeichnete zunächst eine bewaffnete Kriegerschar, dann das Lehnsaufgebot eines Lehnsherren und dessen Recht, Vasallen zu haben, schließlich eine Rangstufe in der Lehensordnung. Im Sachsenspiegel Eike von Repgows, entstanden etwa 1220–1234, wurde das Rangverhältnis in der lehnsrechtlichen Ständeordnung durch die Einteilung in sieben Heerschilde festgelegt. An der Spitze stand der König mit seinen Mannen. Es folgten die Heerschilde der Bischöfe und Äbte, der weltlichen Fürsten, des sonstigen Adels, der Freien etc.
7
Bei Oberhöfen (zum Begriff vgl. oben, S. 473, Anm. 59) bildete sich ein eigener Rechtszug aus, der unabhängig von den Lehnsabhängigkeiten war. Weber spielt hier auf den Fall an, daß ein Lehnsabhängiger gegebenenfalls über seinen Lehnsherrn zu Gericht sitzen könnte. Wer bei Rechtsstreitigkeiten die letzte Berufungsinstanz war, Lehns- bzw. Landesherr oder der Oberhof, war letztlich eine Machtfrage. Vgl. dazu Brünneck, Wilhelm von, Zur Geschichte des kulmer Oberhofes, in: Zeitschrift der [516]Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Germanistische Abteilung, Band 34, 1913, S. 1–48, bes. S. 32 ff.
[516]ee) Die nicht als Lehensträger von patrimonialen oder verbandsmäßigen Herrengewalten in der Lehenshierarchie Stehenden sind: „Hintersassen“, d. h. patrimonial Unterworfene. Sie sind den Belehnten soweit unterworfen, als ihre traditionale, insbesondere: ständische, Lage bedingt oder zuläßt, oder als die Gewalt der militaristischen Lehensinhaber es zu erzwingen weiß, gegen die sie weitgehend wehrlos sind. Es gilt, wie gegen den Herren (Leihezwang), so gegen die Nicht-Lehensträger, der Satz: nulle terre
l
sans seigneur.[516]A: Legre
8
– Der einzige Rest der alten unmittelbaren verbandsmäßigen Herrengewalt ist der fast stets bestehende Grundsatz: daß dem Lehensherren die Herren-, vor allem: die Gerichtsgewalten, zustehen da, wo er gerade weilt.Weber bezieht sich hier auf das vollentwickelte Lehnsrecht, in dem der Lehnsherr das bei Mannfall (Tod des Belehnten) an ihn zurückgefallene Gut innerhalb einer Frist wieder vergeben mußte und umgekehrt der Grundsatz „nulle terre sans seigneur“ (kein Land ohne Lehnsherrn) galt. Darin spiegelt sich die französische Rechtsauffassung wider, nach der der König oberster Lehnsherr allen Landes war. Vgl. dazu auch Weber, Feudalismus, MWG I/22-4, S. 401.
9
Dies zeigt sich beispielsweise in der Formel der angionormannischen Könige „ubicunque fuerimus in Anglia“, die Ausdruck der personalen Ausübung der Gerichtsgewalt ohne Bindung an eine feste Residenz oder einen festen Gerichtsort war. Vgl. dazu Weber, Patrimonialismus, MWG I/22-4, S. 316 mit Hg.-Anm. 74.
ff) Eigenhaushaltsmäßige Gewalten (Verfügungsgewalt über Domänen, Sklaven, Hörige), verbandsmäßige fiskalische Rechte (Steuer- und Abgabenrechte) und verbandsmäßige Befehlsgewalten (Gerichts- und Heerbanngewalt, also: Gewalten über „Freie“) werden zwar beide
10
gleichartig Gegenstand der Verlehnung. Weber zählt hier drei verschiedene verlehnbare Gewalten und Rechte auf, vermutlich will er aber mit der Formulierung „beide“ den Gegensatz von eigenhaushaltsmäßigen Gewalten und verbandsmäßigen Befehlsgewalten betonen.
[A 150]Regelmäßig aber werden die verbandsmäßigen Befehlsgewalten Sonderordnungen unterworfen.
In Altchina wurden reine Rentenlehen und Gebietslehen auch im Namen geschieden.
11
Im okzidentalen Mittelalter nicht, wohl aber in der [517]ständischen Qualität und zahlreichen, hier nicht behandelten Einzelpunkten. In einer chinesischen Inschrift aus dem Jahre 219 v. Chr. werden zwei unterschiedliche Fürstentitel aufgeführt: „lieh-hou“ waren diejenigen, die Landpfründen besaßen, [517]während die „luen-hou“ bzw. „kuan-nei hou“ in der Hauptstadt lebten und durch Rentenpfründen versorgt wurden. Diese Unterscheidung findet sich auch noch unter der Han-Dynastie (206 v. Chr.–220 n. Chr.). Vgl. Mémoires historiques de Se-ma Ts’ien. Traduits et annotés par Édouard Chavannes, tome second. – Paris: Ernest Leroux 1897, S. 149 mit Anm. 2, S. 529; sowie Weber, Konfuzianismus, MWG I/19, S. 184 mit Hg.-Anm. 16.
Es pflegt sich für die verbandsmäßigen Befehlsgewalten die volle Appropriation nach Art derjenigen verlehnter Vermögensrechte nur mit mannigfachen – später gesondert zu besprechenden
12
– Übergängen und Rückständen durchzusetzen. Was regelmäßig bleibt, ist: der ständische Unterschied des nur mit haushaltsmäßigen oder rein fiskalischen Rechten und des mit verbandsmäßigen Befehlsgewalten: Gerichtsherrlichkeit (Blutbann vor allem) und Militärherrlichkeit (Fahnlehen Entsprechende Ausführungen über die Appropriation von Herrschaftsrechten und die daraus entstehenden Übergangs- und Mischformen der Herrschaft finden sich nur in der älteren Fassung, vgl. Weber, Patrimonialismus, MWG I/22-4, S. 290 ff. Neuere Ausführungen sind nicht überliefert.
13
insbesondere) Beliehenen (politische Vasallen). Fahnlehen waren die reichsunmittelbaren Lehen, die vom König mittels einer Fahne als Investitursymbol an die weltlichen Fürsten vergeben wurden. Fürst war, wer nur und direkt vom König ein Lehen erhielt und selbst Vasallen hatte.
Die Herrengewalt ist bei annähernd reinem Lehensfeudalismus selbstverständlich, weil auf das Gehorchenwollen und dafür auf die reine persönliche Treue des, im Besitz der Verwaltungsmittel befindlichen, lehensmäßig appropriierten Verwaltungsstabs angewiesen, hochgradig prekär. Daher ist der latente Kampf des Herren mit den Vasallen um die Herrengewalt dabei chronisch, die wirklich idealtypische lehensmäßige Verwaltung (gemäß aa–ff)
14
nirgends durchgesetzt worden oder eine effektive Dauerbeziehung geblieben. Sondern[,] wo der Herr konnte, hat er die nachfolgenden Maßregeln ergriffen: Oben, S. 514, Z. 34 ff.
[518]aa)
m
[518]A: gg)
15
Der Herr sucht, gegenüber dem rein personalen Treueprinzip (cc und dd) Im Erstdruck wird an dieser Stelle die Untergliederung mit „gg)“ fortgeführt, dann erfolgt aber in Zeile 12 und S. 519, Z. 6, eine Neuzählung mit bb) und cc). Da mit den nachfolgenden Ausführungen systematisch ein neuer Abschnitt beginnt (Abwandlung der reinen Lehnsverwaltung) wurde an dieser Stelle zu aa) emendiert.
16
durchzusetzen entweder: Das reine Treueprinzip wird oben, S. 514 f., bei den Unterpunkten aa) und bb) angesprochen. Der Verweis geht aber auf die unter cc) und dd), oben, S. 515, Z. 7ff, genannten Sonderfälle des Treubruchs und der u.U. konkurrierenden Treueversprechen.
αα) Beschränkung oder Verbot der Subinfeudation;
Im Okzident häufig verfügt, aber oft gerade vom Verwaltungsstab, im eigenen Machtinteresse (dies in China in dem Fürstenkartell von 630 v. Chr.).
17
Mit „Fürstenkartell“ dürfte ein um 650 v. Chr. (nicht: 630 v. Chr.) datiertes Fürstenkonzil gemeint sein, das von Max Weber als ein Zusammenschluß mächtiger Fürsten umschrieben wird (vgl. Weber, Konfuzianismus, MWG I/19, S. 190). In Guizhou (Kweichow, Kuei-Chou) beschworen die fünf mächtigsten Vasallen eine 5-Punkte-Verordnung, die u. a. die Ämtererblichkeit und Mehrfachbelehnungen von Untervasallen sowie die „Belehnung ohne Ankündigung“, d. h. ohne Meldung beim Kaiser, verbot. Vgl. die durch Mencius überlieferte Fassung bei: Faber, Ernst, Eine Staatslehre auf ethischer Grundlage oder Lehrbegriff des chinesischen Philosophen Mencius. – Elberfeld: R. L. Friderichs 1877, S. 174.
ßß) die Nichtgeltung der Treuepflicht der Untervasallen gegen ihren Herren im Fall des Krieges gegen ihn, den Oberlehensherren; – wenn möglich aber:
γγ) die unmittelbare Treuepflicht auch der Untervasallen gegen ihn, den Oberlehensherren.
bb) Der Herr sucht sein Recht zur Kontrolle der Verwaltung der verbandsmäßigen Herrengewalten zu sichern durch:
αα) Beschwerderecht der Hintersassen bei ihm, dem Oberlehensherren und Anrufung seiner Gerichte;
ßß) Aufsichtsbeamte am Hofe der politischen Vasallen;
γγ) eigenes Steuerrecht gegen die Untertanen aller Vasallen;
δδ) Ernennung gewisser Beamter der politischen Vasallen;
εε) Festhaltung des Grundsatzes:
aaa) daß alle Herrengewalten ihm, dem Oberlehensherren, ledig werden bei Anwesenheit,
18
darüber hinaus aber Aufstellung des anderen, Vgl. dazu oben, S. 473, Hg.-Anm. 60.
[519]bbb) daß er, als Lehensherr, jede Angelegenheit nach Ermessen vor sein Gericht ziehen könne.
Diese Gewalt kann der Herr gegenüber den Vasallen (wie gegen andere Appropriierte von Herrengewalten) nur dann gewinnen oder behaupten, wenn:
cc) der Herr einen eigenen Verwaltungsstab sich schafft oder wieder schafft oder ihn entsprechend ausgestaltet. Dieser kann sein:
αα) ein patrimonialer (ministerialistischer),
So vielfach bei uns im Mittelalter, in Japan im Bakufu des Shogun
n
, welches die Daimyo’s sehr empfindlich kontrollierte.[519]A: Schapun
19
[519] Die Regierung des Shôgun (bakufu) setzte sich unter der Herrschaft der Tokugawa-Shôgune (1603–1867) aus direkten Gefolgsleuten und Verwandten des Shôgun zusammen. In diese Zeit fielen auch die scharfen Kontrollmaßnahmen gegen die Grund- und Militärherren, Daimyô, wie z. B. die jährlich wechselnde Residenzpflicht am Hof des Shôgun mit der Gestellung von Familienangehörigen als Geiseln (sankinkötai) oder Gebietstausch bzw. Strafversetzung (kunigaye). Vgl. dazu Weber, Patrimonialismus, MWG I/22-4, S. 391 und 317.
ßß) ein extrapatrimonialer, ständisch literatenmäßiger,
[A 151]Kleriker (christliche, brahmanische und Kayasth’s,
20
buddhistische, lamaistische, islamische) oder Humanisten (in China: Konfuzianische Literaten) Die Kaste der Schreiber (Kayastha) stammt nach der hinduistischen Mythologie direkt von einem vedischen Gott ab und war zunächst für den Gottesdienst zuständig. Zum umstrittenen Kastenrang der Schreiberkaste zwischen Brahmanen (Glossareintrag, unten, S. 740) und Kschatriya vgl. Weber, Hinduismus, MWG I/20, S. 146 f.
o
. Über die Eigenart und die gewaltigen Kulturwirkungen s. Kap. IV.Klammer fehlt in A.
21
In dem unvollendeten Kap. IV finden sich keine entsprechenden Ausführungen.
γγ) ein fachmäßig, insbesondere: juristisch und militaristisch geschulter.
In China vergeblich durch Wang An
p
Schi im 11. Jahrhundert vorgeschlagen (aber damals nicht mehr gegen die Feudalen, sondern gegen die Literaten).A: Au
22
Im Okzident für die Zivilverwaltung die Der Versuch, die Examina für Beamte zu reformieren und das Heerwesen neu zu organisieren, stand im Zusammenhang mit einer großangelegten Staatsreform durch Wang An-shih (Kanzler 1070–76). Die konfuzianisch-literarischen Prüfungsgegenstände sollten zugunsten juristisch-praktischer Ausbildung der Beamten zurückgestellt, die besoldeten Truppen durch ein diszipliniertes Volksheer ersetzt werden. Ein Großteil der Reformen wurde wegen der großen Widerstände 1086, nach Wang An-shihs [520]Rücktritt und Tod, wieder rückgängig gemacht. Vgl. Weber, Konfuzianismus, MWG I/19, S. 244–247 und 349, 356.
q
Universitätsschu[520]lung in Kirche (durch das kanonische Recht) und Staat (durch das Römische Recht, in England: das durch römische Denkformen rationalisierte Common Law, durchgesetzt: Keime des modernen okzidentalen Staats). Für die Heeresverwaltung im Okzident: durch Expropriation der als Vorstufe dafür an Stelle des Lehensherrn getretenen kapitalistischen Heeresunternehmer (Kondottieren) durch die Fürstengewalt mittelst der fürstlichen rationalen Finanzverwaltung seit dem 17. Jahrhundert (in England und Frankreich früher) durchgesetzt. A: der
Dieses Ringen des Herren mit dem lehensmäßigen Verwaltungsstab – welches im Okzident (nicht: in Japan) vielfach zusammenfällt, ja teilweise identisch ist mit seinem Ringen gegen die Macht der Stände-Korporationen – hat in moderner Zeit überall
r
mit dem Siege des Herren, und das hieß: der bureaukratischen Verwaltung, geendet, zuerst im Okzident, dann in Japan, in Indien (und vielleicht: in China) zunächst in der Form der Fremdherrschaft. Dafür waren neben rein historisch gegebenen Machtkonstellationen im Okzident ökonomische Bedingungen, vor allem: die Entstehung des Bürgertums auf der Grundlage der (nur dort im okzidentalen Sinne entwickelten) Städte und dann die Konkurrenz der Einzelstaaten um Macht durch rationale (das hieß: bureaukratische) Verwaltung und fiskalisch bedingtes Bündnis mit den kapitalistischen Interessenten entscheidend, wie später darzulegen ist.[520]In A folgt: , zuerst im Okzident,
23
Entsprechende Ausführungen sind nicht überliefert.
§ 12c. Nicht jeder „Feudalismus“ ist Lehens-Feudalismus im okzidentalen Sinn. Sondern daneben steht vor allem
A. der fiskalisch bedingte Pfründen-Feudalismus.
Typisch im islamischen Vorderasien und Indien der Mogul-Herrschaft.
24
[521]Dagegen war der altchinesische, vor Schi Hoang Ti bestehende, Feudalismus wenigstens teilweise Lehensfeudalismus, neben dem allerdings Pfründen-Feudalismus vorkam. Die auf Steuerpacht beruhende Militärpfründe des islamischen Orients beschrieb Weber, Feudalismus, MWG I/22-4, S. 392 f., mit Referenz auf Becker, Steuerpacht und Lehnswesen, S. 81–92. Die Grundlagen des Verwaltungssystems der muslimischen Mogul-Dynastie, die in Indien – mit einer kurzen Unterbrechung – von 1526 bis 1857 herrschte, behandelt Weber, Hinduismus, I/20, S. 137 f., mit Referenz auf Baden-Powell, Baden Henry, The Land-Systems of British India. Being a Manual of the Land-[521]Tenures and of the Systems of Land-Revenue Administration Prevalent in the Several Provinces, vol. II. – Oxford: University Press 1892, S. 200 ff.
25
Der japanische ist bei den Daimyo’s stark durch Eigenkontrolle des Herrn (Bakufu) temperierter Lehensfeudalismus, die Lehen der Samurai und BukeDie Beseitigung des Feudalismus der Teilstaatenzeit wurde von der Annalistik dem Reichseiniger Shih Huang-ti zugeschrieben und auf das Jahr 221 v. Chr. datiert. Wie Weber, Konfuzianismus, MWG I/19, S. 193, anführt, muß es aber in dem von Shih Huang-ti regierten Teilstaat Ch’in bereits vorher neben den Vasallen auch direkt vom Fürsten ausgestattete Beamte und Soldaten gegeben haben. Vgl. dazu auch Weber, Feudalismus, MWG I/22-4, S. 398.
s
aber sind (oft: appropriierte) Ministerialenpfründen (nach der Kokudaka[521]A: Bake
t
– dem Reisrentenertrag – katastriert).A: Kakadaka
26
Zu den strikten Kontrollen der Daimyô durch die Regierung des Shôgun vgl. oben S. 519 mit Hg.-Anm. 19. Die unter den Daimyô stehenden Krieger – die vornehmlich aus dem Provinzadel stammenden „buke“ und die Samurai – erhielten ein Rentenlehen. Es berechtigte zum Bezug einer bestimmten Menge Reis aus einzelnen Grundstücken oder Bezirken. Die Menge war seit der Landvermessung und Ertragseinschätzung unter Toyotomi Hideyoshi (1536–1598) festgelegt. Das „kokudaka“-System bemaß den grundsteuerpflichtigen Ertrag der Felder in „koku“, einem Hohlmaß für Reis, das 180,39 Litern entsprach. Vgl. Yoshida, Sakuya, Geschichtliche Entwickelung der Staatsverfassung und des Lehnwesens von Japan. – Den Haag: Μ. Μ. Couvée o. J. [1890], S. 99 f., sowie Weber, Feudalismus, MWG I/22-4, S. 386.
Von Pfründen-Feudalismus wollen wir da sprechen, wo es sich
aa) um Appropriation von Pfründen handelt, also von Renten, die nach dem Ertrage geschätzt und verliehen werden, – ferner
bb) die Appropriation (grundsätzlich, wenn auch nicht immer effektiv) nur personal, und zwar je nach Leistungen, eventuell also mit Aufrücken erfolgt, –
So die türkischen Sipahi-Pfründen wenigstens legal.
27
Die osmanischen Reiter (Sipahi) erhielten zur Bestreitung ihrer Ausrüstung ein Aufgebotslehen (Timar), das an aktive Kriegsdienste gebunden und weder übertragbar noch vererblich war. Dies besagen die überlieferten Gesetze, vor allem aus der Regierungszeit von Süleyman dem Prächtigen (1520–1566). (Vgl. dazu Hammer-Purgstall, Joseph von, Des Osmanischen Reichs Staatsverfassung und Staatsverwaltung, dargestellt aus den Quellen seiner Grundgesetze, Band 1. – Wien: Camesinasche Buchhandlung 1815, S. 337 ff.) Das System zerfiel im 17. Jahrhundert, die Bestimmungen wurden von beiden Seiten nicht mehr beachtet. Vgl. dazu auch Weber, Feudalismus, MWG I/22-4, S. 389 f., 394.
[522]vor
u
allem aber: [522]A: Vor
cc) nicht primär eine individuelle, freie, personale Treuebeziehung durch Verbrüderungskontrakt mit einem Herren persönlich hergestellt und daraufhin ein individuelles Lehen vergeben wird, sondern primäre fiskalische Zwecke des im übrigen patrimonialen (oft: sultanistischen) Abgabenverbandes des Herren stehen. Was sich (meist) darin ausdrückt: daß katastermäßig abtaxierte Ertragsobjekte vergeben werden.
[A 152]Die primäre Entstehung des Lehens-Feudalismus erfolgt nicht notwendig, aber sehr regelmäßig aus einer (fast) rein naturalwirtschaftlichen, und zwar: personalen Bedarfsdeckung des politischen Verbandes (Dienstpflicht, Wehrpflicht) heraus. Sie will vor allem: statt des ungeschulten und ökonomisch unabkömmlichen und nicht mehr zur vollwertigen Selbstequipierung fähigen Heerbannes
28
ein geschultes, gerüstetes, durch persönliche Ehre verbundenes Ritterheer. Die primäre Entstehung des Pfründen-Feudalismus ist regelmäßig eine Abwandlung geldwirtschaftlicher Finanzgebarung („Rückbildung“ zur Naturalleistungsfinanzierung) und kann erfolgen: [522]„Heerbann“ ist hier in der Bedeutung des germanischen Heerbanns gemeint: als die Gesamtheit der zum Kriegsdienst aufgebotenen, waffenfähigen Freien. Zu Webers kritischer Einschätzung, was dessen Beständigkeit anging vgl. Weber, Agrarverhältnisse3, MWG I/6, S. 160 mit Hg.-Anm. 55.
αα) zur Abwälzung des Risikos schwankender Einnahmen auf Unternehmer (also: als eine Art von Abwandlung der Steuerpacht), also:
aaa) gegen Übernahme der Gestellung von bestimmten Kriegern (Reiter, eventuell Kriegswagen, Gepanzerte
a
, Train, eventuell Geschütze) für das patrimonial-fürstliche Heer. A: Gepanzerten
So in China im Mittelalter häufig: Deputate von Kriegern der einzelnen Gattungen auf eine Flächeneinheit.
29
Als „Mittelalter“ bezeichnet Weber die feudale Teilstaatenzeit in China vom 9. bis 3. Jahrhundert v. Chr. (vgl. Weber, Konfuzianismus, MWG I/19, S. 186–188). Die Lehengröße und die dafür zu erbringenden Aufwendungen schwankten. Als Beispiel fügt Weber (ebd., S. 233, Fn. 10) Informationen aus dem „konfuzianischen Musterstaat“ Lu (855–250 v. Chr.) an, in dem auf eine Katastereinheit „1 Kriegswagen, 4 Pferde, 10 Haupt Rindvieh, 3 Gepanzerte, 64 (nicht gepanzerte) Fußsoldaten“ fielen.
[523]Eventuell außerdem oder auch: nur:
bbb) Bestreitung der Kosten der Zivilverwaltung, und
ccc) Abführung eines Steuerpauschale an die fürstliche Kasse.
So in Indien oft.
30
[523]Die Steuerpauschale – Weber verwendet hier die seltenere Neutrumform – wurde insbesondere unter der Mogulherrschaft (16.–19. Jahrhundert) solidarisch von den Dörfern oder von einem Mittelsmann, dem Lambardar, Talukdar oder Zamindar, erbracht. Vgl. dazu Weber, Hinduismus, MWG I/20, S. 149–151 und 139, besonders gestützt auf Baden-Powell, Baden Henry, The Land-Systems of British India. Being a Manual of the Land-Tenures and of the Systems of Land-Revenue Administration Prevalent in the Several Provinces, vol. I. – Oxford: Clarendon Press 1892, S. 152 ff. und 501 ff.
Dagegen wird natürlich gewährt (schon um diesen Verbindlichkeiten nachkommen zu können):
ddd) Appropriation von Herrenrechten verschiedenen Umfangs, zunächst regelmäßig kündbar und rückkäuflich, in Ermangelung von Mitteln aber faktisch oft: definitiv.
Solche definitiven Appropriatoren werden dann mindestens: Grundherren, oft gelangen sie auch in den Besitz von weitgehenden verbandsmäßigen Herrengewalten.
So, vor allem, in Indien, wo die Zamindar-
b
, Jagirdar- und Talukdar-Grundherrschaften[523]A: Zamindor-
c
durchweg so entstanden sind.A: Tulukdar-Grundherrschaften
31
Aber auch in großen Teilen des vorderasiatischen Orient, wie C[arl] H[einrich] Becker (der den Unterschied gegen das okzidentale Lehenswesen zuerst richtig sah) ausgeführt hatWeber beschreibt hier den Zustand unter der britischen Kolonialherrschaft, wo die früheren Steuerpächter (Zamindari und Talukdari) und Militärpfründner (Jagirdari) zu erblichen Grundherren aufgestiegen waren. Bereits während der Fremdherrschaft der Mogul-Dynastie konnten die Steuerpächter, „welche die Kosten der Verwaltung ihrer Bezirke, die Garantie für alle militärischen und finanziellen Leistungen zu übernehmen“ hatten, sich nahezu ohne Einschränkungen seitens der Regierung Rechte aneignen. Erst unter der britischen Verwaltung galten sie als Grundherren im engeren Wortsinn, weil sie für die Steuersumme ihres Bezirks zu haften hatten und als dessen „Eigentümer“ betrachtet wurden (vgl. Weber, Hinduismus, MWG I/20, S. 138 f., dort auch das Zitat).
d
.A: sah, ausgeführt hat)
32
Primär ist sie Steuerpacht, sekundär wird daraus „Grund[524]herrschaft“. Auch die rumänischen „Bojaren“ sind Abkömmlinge der gemischtesten Gesellschaft der Erde: Juden, Deutsche, Griechen usw., die zuerst als Steuerpächter Herrenrechte appropriierten.Becker, Steuerpacht und Lehnswesen, beschreibt die Entwicklung des orientalischen Lehnswesens seit den Eroberungen der Araber aus der Institution der Steuerpacht. Die Vereinnahmung der Steuererträge durch die Belehnten machte der Seldschuken-Wesir Nizam al-Mulk im Jahr 1087 zum Gesetz und verpflichtete sie im Gegenzug zur Heerfolge. Dadurch wurden die Steuerpächter zu Grundherren. Vgl. dazu auch die ausführlichere Darstellung in Weber, Feudalismus, MWG I/22-4, S. 392–394.
33
[524]Von der Mitte des 14. Jahrhunderts an entwickelten sich die „Bojaren“ (eigentlich: „Kämpfer“; Kriegsgenossen) durch die ihnen von wechselnden Fürsten übertragenen Ländereien und Verwaltungsaufgaben zur mächtigen Großgrundbesitzerschicht der Moldau und Walachei. Als Steuerpächter erreichten sie den Höhepunkt ihrer Macht im 16. Jahrhundert. Ihre Namen verweisen auf ihre Herkunft als Flüchtlinge, darunter Griechen, Deutsche, Ruthenen, Ungarn, Serben und Bulgaren (Juden werden in der Literatur nicht genannt). Vgl. Jorga, Nicolae, Geschichte des rumänischen Volkes im Rahmen seiner Staatsbildungen. – Gotha: Friedrich Andreas Perthes 1905, Band 1, S. 328 f. (zur Herkunft) und Band 2, S. 66 f. (zur Steuereintreibung).
ßß) Es kann die Unfähigkeit der Soldzahlung an ein patrimoniales Heer und dessen (nachträglich legalisierte) Usurpation zur Appropriation der Steuerquellen: Land und Untertanen, an Offiziere und Heer führen.
So die berühmten großen Khanen im Khalifenreich, die Quelle oder das Vorbild aller orientalischen Appropriationen bis auf die des Mameluken-Heeres (welches ja formal ein Sklavenheer war).
34
Max Weber bezieht sich hier offenbar auf die Entwicklung seit dem Kalifat der Abbasiden (750–1258), deren Reich seit dem 9. Jahrhundert zunehmend in politisch autonome Emirate und Teilreiche zerfiel und von den mächtigen persischen Buyiden, den türkischen Seldschuken bis hin zu den Mameluken beherrscht wurde. Letztere übten von 1250–1517 die Herrschaft über Ägypten und Syrien aus. Zur verwaltungstechnischen Seite vgl. Weber, Patrimonialismus, MWG I/22-4, S. 267, und Weber, Feudalismus, ebd., S. 393. – Der Ausdruck „große Khane“ in Bezug auf das Kalifenreich ist nicht üblich, da es sich um einen zentralasiatischen, durch die Mongolen verbreiteten Titel handelt. Es dürften die großen Statthalter und Emire gemeint sein.
Nicht immer führt das zu einer katastermäßig geordneten Pfründen-Verlehnung, aber es steht ihm nahe und kann dahin führen.
Inwieweit die türkischen Sipahi-Lehen dem „Lehen“ oder der „Pfründe“ näher stehen, ist hier noch nicht zu erörtern:
35
legal kennen sie das „Aufrücken“ nach der „Leistung“. Der Bezug ist unklar. Dieselbe Aussage zum legalen „Aufrücken“ findet sich bereits oben, S. 521, Z. 15 f. Eine ausführlichere Darlegung liegt nur in der älteren Fassung, Weber, Feudalismus, MWG I/22-4, S. 388–394, vor.
Es ist klar, daß die beiden Kategorien durch unmerkliche Übergänge verbunden sind und eine eindeutige Zuteilung an den einen oder anderen nur selten mög[A 153]lich ist. Außerdem steht [525]der Pfründen-Feudalismus der reinen Präbendalisierung sehr nahe, und auch da existieren fließende Übergänge.
Nach einer ungenauen Terminologie steht neben dem Lehens-Feudalismus, der auf freiem Kontrakt mit einem Herren ruht, und neben dem fiskalischen Pfründen-Feudalismus noch:
B. der (sogenannte) Polis-Feudalismus,
36
der auf (realem oder fiktivem) Synoikismus von Grundherren zu unter sich gleichem Recht mit rein militaristischer Lebensführung und hoher ständischer Ehre ruht. Ökonomisch bildet der „Kleros“[,] das nur personal und für Einzelerbfolge Qualifizierter appropriierte Landlos, bestellt durch[525]„Polis-“ oder „Stadtfeudalismus“ meint die Zusammensiedelung von Berufskriegern in befestigten Orten, die Land und politische Rechte für sich appropriierten. Er war eine verbreitete Form in der Frühzeit des hellenischen Altertums (ca. 11. bis 7. Jahrhundert v. Chr.). Weber nennt anderenorts als Beispiele des „naturawirtschaft[lichen] Stadtfeudalismus“ Sparta, Kreta und die liparischen Inseln. Vgl. Weber, Allgemeine („theoretische“) Nationalökonomie, § 8, MWG III/1, S. 417 (Zitat); dass. auch in Weber, Agrarverhältnisse, MWG I/6, S. 148 (1. und 2. Fass.) und S. 323 (3. Fass.). Ein Beleg für die Herkunft des Ausdrucks konnte nicht gefunden werden.
e
die Dienste der (als Standesbesitz repartierten) Versklavten,[525]Fehlt in A; durch sinngemäß ergänzt.
f
die Grundlage der Selbstequipierung.A: Versklavten und
37
Max Weber schließt sich hier der u. a. von Eduard Meyer, Geschichte des Alterthums, Band 2, 1. Aufl. – Stuttgart: J. G. Cotta 1893, S. 297 ff. (mit Anstreichungen im Handexemplar, Max Weber-Arbeitsstelle, BAdW München; hinfort: Meyer, Geschichte des Alterthums II1), und Georg Busolt, Griechische Staatskunde, 1. Hälfte (Handbuch der Altertumswissenschaft, 4. Abt., 1. Teil, 1. Band). – München: C. H. Beck 1920, S. 141 f., vertretenen These an, daß das nach der dorisch-ionischen Landnahme verteilte Land privatrechtlichen Charakter hatte und insofern persönlich gebunden war und vererbt werden konnte. Es war trotzdem in den meisten Stadtstaaten unveräußerlich, da es Grundlage der Selbstausrüstung war und somit die Wehrfähigkeit der Gemeinde garantierte. Vgl. Weber, Agrarverhältnisse3, MWG I/6, S. 480 f., sowie Weber, Feudalismus, MWG I/22-4, S. 383.
Nur uneigentlich kann man diesen nur in Hellas (in voller Entwicklung nur in Sparta) nachweislichen, aus dem „Männerhaus“ erwachsenen Zustand, wegen der spezifischen ständischen Ehrekonventionen und der ritterlichen Lebensführung dieser Grundherren, „Feudalismus“ nennen.
38
In Rom entspricht der Ausdruck „fundus“ (= Genossenrecht) zwar dem hellenischen κλῆρος, aber keine Nachrichten liegen über Verfassungen der [526]curia (co-viria = ὰνδρεĩον-Männerhaus) hier vor,Zur einschränkenden Anwendung des Feudalismusbegriffs auf die Herrenschicht Spartas, die Spartiaten, schreibt Weber, Agrarverhältnisse3, MWG I/6, S. 483, daß „der feudale Unterbau hier nicht einer durch Geschlecht, sondern lediglich durch Erziehung ausgelesenen Klasse diente“. Der Begriff „Männerhaus“ geht auf Heinrich Schurtz zurück, vgl. dazu oben, S. 361 mit Hg.-Anm. 33.
39
die ähnlich gestaltet gewesen wären. [526]Weber vergleicht hier griechische und römische Formen der Boden-, Sozial- und Wehrverfassung, „fundus“ setzt er mit „kleros“ gleich und, indem er „fundus“ als „Zugehörigkeit zu den Flurgenossen“ übersetzt (vgl. Weber, Agrarrecht, MWG III/5, S. 88), bedeutet der Besitz eines „vollen Ackerloses“ zugleich die Zugehörigkeit zum Bürgerverband (vgl. Weber, Die Stadt, MWG I/22-5, S. 68). Ebenso stellt Weber „andreion“ und „curia“ (beides als „Männerhaus“ übersetzt) als „Unterabteilungen der zur Polis verbrüderten Wehrgemeinde“ nebeneinander (vgl. ebd., S. 180 f., dort auch mit den Belegstellen für die Begriffsverwendungen). Die Ursprünge der Kurien-Verfassung liegen, wie Weber, Agrarverhältnisse3, MWG I/6, S. 614, ausführt, „nach dem Eingeständnis der Fachmänner“ im Dunkeln.
Im weitesten Sinn pflegt man alle ständisch privilegierten militaristischen Schichten, Institutionen und Konventionen „feudal“ zu nennen. Dies soll hier als ganz unpräzis vermieden werden.
C. Aus dem umgekehrten Grund: weil zwar das verlehnte Objekt (Lehen) da ist, aber
1. nicht kraft freien Kontrakts (Verbrüderung, weder mit einem Herren noch mit Standesgenossen), sondern kraft Befehls des eigenen (patrimonialen) Herren, oder aber zwar frei, aber
2. nicht auf Grund vornehmer ritterlicher Lebensführung, übernommen wird, oder
3. beides nicht,
sind auch
zu 1: die Dienstlehen ritterlich lebender, aber abhängiger, ebenso
zu 2: die Dienstlehen an frei geworbene, nicht ritterliche Krieger, endlich
zu 3: die Dienstlehen an Klienten, Kolonen, Sklaven, welche als Krieger benutzt werden
für uns: Pfründen.
Beispiel zu 1: okzidentale und orientalische Ministerialen, Samurai in Japan;
Beispiel zu 2: kam im Orient vor; z. B. wohl bei den ptolemäischen Kriegern ursprünglich.
40
Daß später infolge der erblichen AppropriationUnter den ersten vier ptolemäischen Königen (323/305–205 v. Chr.) wurde ein Teil der als „misthophoroi“ bezeichneten fremden Söldner in Militärkolonien angesiedelt [527]und mit einem Landlos ausgestattet. Vgl. Meyer, Paul Martin, Das Heerwesen der Ptolemäer und Römer in Ägypten. – Leipzig: B. G. Teubner 1900, S. 7, 16, mit Belegen für Thera (S. 21 f.) und Fayum (S. 33).
g
des [527]Dienstlandes auch die Krieger als Beruf appropriiert galten, ist typisches Entwicklungsprodukt zum Leiturgiestaat; [526]A: Appropriierten
Beispiel zu 3: typisch für die sog. „Kriegerkaste“ in Altägypten,
41
die Mameluken im mittelalterlichen Ägypten, die gebrandmarkten orientalischen und chinesischen (nicht immer, aber nicht selten mit Land beliehenen) KriegerDer Ausdruck „Kriegerkaste“ geht auf Herodot, Historien, 2, 164, zurück. Die Krieger (machimoi) hatten zu Herodots Zeit zinsfreie Ackerlose „von gemäßigtem Umfang“, wie Weber, Agrarverhältnisse3, MWG I/6, S. 420, mitteilt. Vgl. auch Weber, Patrimonialismus, MWG I/22-4, S. 270 f.
42
usw. Weber meint hier offenbar Soldaten zur Zeit Hammurabis, die mit einem Dienstlehen ausgestattet und – wie eine Interpretation des Hammurabi-Codex nahelegte – mit einem eingebrannten Mal versehen waren (vgl. dazu Weber, Agrarverhältnisse3, MWG I/6, S. 381). Für China berichtet Weber, Konfuzianismus, MWG I/19, S. 244, über zwangsweise Rekrutenaushebungen und Brandmarkungen unter der Sung-Dynastie (960–1279). Über Dienstlehen äußert er sich nicht, könnte aber die in diesem Zusammenhang erwähnten „Grenzerdienste“ meinen.
Von „Feudalismus“ spricht man auch dabei durchaus ungenau im Sinn der Existenz – in diesem Fall: (mindestens formal) negativ privilegierter – rein militaristischer Stände. Davon ist in Kap. IV zu reden.
43
Entsprechende Ausführungen finden sich nicht in dem unvollendeten Kap. IV. Über die „‚plebejischen‘ Spielarten des Feudalismus“ hatte sich Weber – mit den oben genannten Beispielen – in der älteren Fassung von „Wirtschaft und Gesellschaft“ geäußert. Vgl. Weber, Feudalismus, MWG I/22-4, S. 383 f., und Weber, Patrimonialismus, MWG I/22-4, S. 271 (Zitat).
§ 13. Das Gesagte kann keinen Zweifel darüber gelassen haben: daß Herrschaftsverbände, welche nur dem einen oder dem andern der bisher erörterten „reinen“ Typen
44
angehören, höchst selten sind. Zumal, namentlich bei der legalen und traditionalen Herrschaft, wichtige Fälle: Kollegialität, Feudalprinzip, noch garnicht oder nur in vagen Andeutungen erörtert sind.Kap. III, §§ 2–10, oben, S. 453–497; vgl. dazu die Einleitung, oben, S. 42 ff.
45
[528]Aber überhaupt ist festzuhalten: Grundlage jeder Herrschaft, also jeder Fügsamkeit, ist ein Glauben: „Prestige“-Glauben, zugunsten des oder der Herrschenden. Dieser ist selten ganz eindeutig. [A 154]Er ist bei der „legalen“ Herrschaft nie rein legal. Sondern der Legalitätsglauben ist „eingelebt“, also selbst traditionsbedingt: – Sprengung der Tradition vermag ihn zu vernichten. Und er ist auch charismatisch in dem negativen Sinn: daß hartnäckige eklatante Mißerfolge jeder Regierung zum Verderben gereichen, ihr Prestige brechen und die Zeit für charismatische Revolutionen reifen lassen. Für „Monarchien“ sind daher verlorene, ihr Charisma als nicht „bewährt“ erscheinen lassende, für „Republiken“ siegreiche, den siegenden General als charismatisch qualifiziert hinstellende, Kriege gefährlich. Auf „kollegiale Behörden“ ist Weber kurz in Kap. III, § 4, oben S. 462, Z. 22 ff., eingegangen. Demgegenüber ist der „Feudalismus“, Kap. III, §§ 12 b und 12 c, oben, S. 513–527, bereits ausführlich behandelt. Die Verweisformulierung läßt darauf schließen, daß die Ausführungen über „Feudalismus“ nachträglich eingefügt worden sind; vgl. dazu den Editorischen Bericht, oben, S. 90 f.
Rein traditionale Gemeinschaften gab es wohl. Aber nie absolut dauernd und – was auch für die bureaukratische Herrschaft gilt – selten ohne persönlich erbcharismatische oder amtscharismatische Spitze (neben einer unter Umständen rein traditionalen). Die Alltags-Wirtschaftsbedürfnisse wurden unter Leitung traditionaler Herren gedeckt, die außeralltäglichen (Jagd, Kriegsbeute) unter charismatischen Führern. Der Gedanke der Möglichkeit von „Satzungen“ ist gleichfalls ziemlich alt (meist allerdings durch Orakel legitimiert). Vor allem aber ist mit jeder extrapatrimonialen Rekrutierung des Verwaltungsstabs eine Kategorie von Beamten geschaffen, die sich von den legalen Bureaukratien nur durch die letzten Grundlagen ihrer Geltung, nicht aber formal, unterscheiden kann.
Absolut nur charismatische (auch: nur erbcharismatische usw.) Herrschaften sind gleichfalls selten. Aus charismatischer Herrschaft kann – wie bei Napoleon – direkt striktester Bureaukratismus hervorgehen oder allerhand präbendale und feudale Organisationen. Die Terminologie und Kasuistik hat also in gar keiner Art den Zweck und kann ihn nicht haben: erschöpfend zu sein und die historische Realität in Schemata zu spannen. Ihr Nutzen ist: daß jeweils gesagt werden kann: was an einem Verband die eine oder andere Bezeichnung verdient oder ihr nahesteht, ein immerhin zuweilen erheblicher Gewinn.
[529]Bei allen Herrschaftsformen ist die Tatsache der Existenz des Verwaltungsstabes und seines kontinuierlich auf Durchführung und Erzwingung der Ordnungen gerichteten Handelns für die Erhaltung der Fügsamkeit vital. Die Existenz dieses Handelns ist das, was man mit dem Wort „Organisation“ meint. Dafür wiederum ist die (ideelle und materielle) Interessensolidarität des Verwaltungsstabes mit dem Herren ausschlaggebend. Für die Beziehung des Herren zu ihm gilt der Satz: daß der auf jene Solidarität gestützte Herr jedem einzelnen Mitglied gegenüber stärker, allen gegenüber schwächer ist. Es bedarf aber einer planvollen Vergesellschaftung des Verwaltungsstabes, um die Obstruktion oder bewußte Gegenaktion gegen den Herren planvoll und also erfolgreich durchzuführen und die Leitung des Herren lahmzulegen. Ebenso wie es für jeden, der eine Herrschaft brechen will, der Schaffung eigner Verwaltungsstäbe zur Ermöglichung eigner Herrschaft bedarf, es sei denn, daß er auf Konnivenz
46
und Kooperation des bestehenden Stabes gegen den bisherigen Herren rechnen kann. In stärkstem Maß ist jene Interessensolidarität mit dem Herren da vorhanden, wo für den Verwaltungsstab die eigne Legitimität und Versorgungsgarantie von der des Herren abhängt. Für den einzelnen ist die Möglichkeit, sich dieser Solidarität zu entziehen, je nach der Struktur sehr verschieden. Am schwersten bei voller Trennung von den Verwaltungsmitteln, also in rein patriarchalen (nur auf Tradition ruhenden), rein patrimonialen und rein bureaukratischen (nur auf Reglements ruhenden) Herrschaften, am leichtesten: bei ständischer Appropriation (Lehen, Pfründe). [529]Von lat. connivere, „die Augen schließen“, etwas stillschweigend dulden oder mit Nachsicht behandeln. Im strafrechtlichen Sinn auch die Verleitung eines Untergebenen zu einer Straftat.
Endlich und namentlich aber ist die historische Realität auch ein steter, meist latenter Kampf zwischen Herren und Verwaltungsstab um Appropriation oder Expropriation des einen oder des anderen. Entscheidend für fast die ganze Kulturentwicklung war
1. der Ausgang dieses Kampfes als solcher,
[530][A 155]2. der Charakter derjenigen Schicht von ihm anhängenden Beamten, welche dem Herren den Kampf gegen feudale oder andere appropriierte Gewalten gewinnen half: rituelle Literaten, Kleriker, rein weltliche Klienten, Ministeriale[,] juristisch geschulte Literaten, fachmäßige Finanzbeamte, private Honoratioren (über die Begriffe später).
47
[530]Der Bezug ist unklar. In Kap. III, § 20, unten, S. 576 ff., wird nur der „Honoratioren“-Begriff erläutert. Eine Behandlung wäre möglicherweise in der angekündigten „Staatssoziologie“ erfolgt.
In der Art dieser Kämpfe und Entwicklungen ging deshalb ein gut Teil nicht nur der Verwaltungs-[,] sondern der Kulturgeschichte auf, weil die Richtung der Erziehung dadurch bestimmt und die Art der Ständebildung dadurch determiniert wurde.
1. Gehalt, Sportelchancen, Deputate, Lehen fesseln in untereinander sehr verschiedenem Maß und Sinn den Stab an den Herren (darüber später).
48
Allen gemeinsam ist jedoch: daß die Legitimität der betreffenden Einkünfte und dieDer Bezug ist unklar. Die materielle Ausstattung des Verwaltungsstabes ist ausführlich in der älteren Fassung der „Herrschaftssoziologie“ beschrieben, bes. in Weber, Patrimonialismus, MWG I/22-4, S. 295–311. Neuere Ausführungen sind nicht überliefert.
h
mit der Zugehörigkeit zum Verwaltungsstab verbundene soziale[530]A: der
i
Macht und Ehre bei jeder Gefährdung der Legitimität des Herren, der sie verliehen hat und garantiert, gefährdet erscheinen. Aus diesem Grund spielt die Legitimität eine wenig beachtete und doch so wichtige Rolle. A: verbundenen sozialen
2. Die Geschichte des Zusammenbruchs der bisher legitimen Herrschaft bei uns zeigte:
49
wie die Sprengung der Traditionsgebundenheit durch den Krieg einerseits und der Prestigeverlust durch die Niederlage andrerseits in Verbindung mit der systematischen Gewöhnung an illegales Verhalten in gleichem Maß die Fügsamkeit in die Heeres- und Arbeitsdisziplin erschütterten und so den Umsturz der Herrschaft vorbereiteten.Gemeint ist die Revolution in Deutschland im November 1918, die mit einer Meuterei von Marinematrosen in Kiel begann und im Reich sowie den deutschen Einzelstaaten zur Ablösung der alten Gewalten führte. Die Abdankung Wilhelms II. wurde am 9. November 1918 von Reichskanzler Max von Baden eigenmächtig verkündet. Der Erosionsprozeß betraf neben der Regierung besonders den Armee- und Polizeiapparat, während die Verwaltungen zumeist weiterfunktionierten.
50
– And[531]rerseits bildet das glatte Weiterfunktionieren des alten Verwaltungsstabes und die Fortgeltung seiner Ordnungen unter den neuen Gewalthabern ein hervorragendes Beispiel für die unter den Verhältnissen bureaukratischer Rationalisierung unentrinnbare Gebundenheit des einzelnen Gliedes dieses Stabes an seine sachliche Aufgabe. Der Grund war, wie erwähnt,Insbesondere die der Bewirtschaftung kriegswichtiger Güter und der Preisfestsetzung dienenden Gesetze und Verordnungen wurden im Verlauf des Krieges von Produzenten und Konsumenten weithin umgangen. Eine konsequente Durchsetzung erwies sich für die Verwaltung und die Strafgerichte als unmöglich.
51
keineswegs nur der privatwirtschaftliche: Sorge um die Stellung, Gehalt und Pension (so selbstverständlich das bei der Masse der Beamten mitspielte), sondern ganz ebenso der sachliche (ideologische): daß die Außerbetriebsetzung der Verwaltung unter den heutigen Bedingungen einen Zusammenbruch der Versorgung der gesamten Bevölkerung (einschließlich: der Beamten selbst) mit den elementarsten Lebensbedürfnissen bedeutet haben würde. Daher wurde mit Erfolg an das (sachliche) „Pflichtgefühl“ der Beamten appelliert, auch von den bisher legitimen Gewalten und ihren Anhängern selbst diese sachliche Notwendigkeit anerkannt.[531]Oben, S. 529, Zeile 5 ff.; gemeint ist die „Interessensolidarität mit dem Herrn“.
52
Direkt nach dem Umsturz forderten Reichskanzler Ebert und die neue preußische Regierung die Beamten – auch unter Garantiezusagen – auf, im Amt zu bleiben, „um auch ihrerseits im Interesse des Vaterlandes zur Erhaltung der Ordnung und Sicherheit beizutragen“ (vgl. Bekanntmachung der Preußischen Regierung, betreffend die Fortsetzung der amtlichen Tätigkeit der Behörden und Beamten. Vom 12. November 1918, in: Preußische Gesetzsammlung, Jg. 1918, Nr. 38, Zitat: S. 187). In seiner Abdankungsurkunde entband Kaiser Wilhelm die Beamten des Deutschen Reichs und Preußens von ihrem ihm gegenüber geleisteten Treueid und erwartete von ihnen, „daß sie bis zur Neuordnung des Deutschen Reichs den Inhabern der tatsächlichen Gewalt in Deutschland helfen, das Deutsche Volk gegen die drohenden Gefahren der Anarchie, der Hungersnot und der Fremdherrschaft zu schützen“ (vgl. Abdankungsurkunde vom 28. November 1918, in: Reichsanzeiger, Nr. 283 vom 30. Nov. 1918, Abendausgabe, S. 2).
3. Der Hergang des gegenwärtigen Umsturzes schuf einen neuen Verwaltungsstab in den Arbeiter- und Soldatenräten.
53
Die Technik der Bildung dieser neuen Stäbe mußte zunächst „erfunden“ werden und war übrigens an die Verhältnisse des Kriegs (Waffenbesitz) gebunden, ohne den der Umsturz überhaupt nicht möglich gewesen wäre (davon und von den [532]geschichtlichen Analogien später).Die Arbeiter- und Soldatenräte folgten auf die am Ende des Ersten Weltkriegs spontan entstandenen Streik-Räte und bestanden in der Revolutionsphase auf Reichsebene bis zur Konstituierung der Weimarer Nationalversammlung, in einigen Einzelstaaten noch bis Mitte 1919 fort. Die Räte waren die (gewählten) Vertretungsorgane der Arbeiter und Soldaten, die neben die bestehenden Verwaltungsorgane in Kommune, Kreis, Land und Reich traten. Auf Reichsebene wurde im November 1918 ein Vollzugsrat aus 14 Arbeiter- und 14 Soldatenvertretern gebildet, der exekutive Aufgaben übernehmen sollte, sich aber gegen den „Rat der Volksbeauftragten“, die eigentliche Regierung, nicht durchsetzen konnte. Die Ausbildung eigener Verwaltungsstrukturen blieb oft in den Anfängen stecken.
54
Nur durch Erhebung charismatischer Führer gegen die legalen Vorgesetzten und durch Schaffung charismatischer Gefolgschaften war die Enteignung der Macht der alten Gewalten möglich und durch Erhaltung des Fachbeamtenstabes auch technisch die Behauptung der Macht durchführbar. Vorher scheiterte gerade unter den modernen Verhältnissen jede Revolution hoffnungslos an der Unentbehrlichkeit der Fachbeamten und dem Fehlen eigner Stäbe. Die Vorbedingungen in allen früheren Fällen von Revolutionen waren sehr verschiedene (s. darüber das Kapitel über die Theorie der Umwälzungen).[532]Hinweis auf das unten, Anm. 55 und 56, erwähnte, aber nicht überlieferte Kapitel über die „Theorie des Umsturzes“ bzw. „Theorie der Umwälzungen“.
55
Ein entsprechendes Kapitel ist nicht überliefert.
4. Umstürze von Herrschaften aus der Initiative der Verwaltungsstäbe haben unter sehr verschiedenen Bedingungen in der Vergangenheit stattgefunden (s. darüber das Kapitel über die Theorie des Umsturzes).
56
Immer war Voraussetzung eine Vergesellschaftung der Mitglieder des Stabes, welche, je nachdem, mehr den Charakter einer partiellen Verschwörung oder mehr einer allgemeinen Verbrüderung und Vergesellschaftung annehmen konnte. Gerade dies ist unter den Existenzbedingungen moderner Beamter sehr erschwert, wenn auch, wie russische Verhältnisse zeigten,Ein entsprechendes Kapitel ist nicht überliefert.
57
nicht ganz unmöglich. In aller Regel aber greifen sie an Bedeutung nicht über das hinaus, was Arbeiter durch (normale) Streiks erreichen wollen und können. Bereits nach der russischen Februar-Revolution 1917 war es den Sowjets der Arbeiter- und Soldatendeputierten gelungen, die Kontrolle über Armee, Eisenbahnen, Post und Telegraphie in ihre Hände zu bekommen und damit wichtige staatliche Funktionen zu übernehmen. Der Zweite Allrussische Sowjetkongreß übertrug dann am 25. Oktober 1917 den Sowjets die formelle Macht im Staat.
5. Der patrimoniale Charakter eines Beamtentums äußert sich vor allem darin, daß Eintritt in ein persönliches Unterwerfungs-(Klientel-)Verhältnis verlangt wird („puer regis“ in der Karolingerzeit,
58
„familiaris“ unter den Angiovinen„puer regis“, der Diener oder Knecht des Königs bei den Merowingern, war der Ministeriale (vgl. Glossar-Eintrag, unten, S. 747) unter den Karolingern. Indem Max Weber dieses Verhältnis als ein „persönliches Unterwerfungs-(Klientel-)Verhältnis“ bezeichnet, scheint er sich der Position von Hans Delbrück anzuschließen, der annahm, daß auch Freie zu pueri regis werden konnten (vgl. Delbrück, Hans, Geschichte der Kriegskunst im Rahmen der politischen Geschichte, 2. Teil, 2. Aufl. – Berlin: Georg Stilke 1909, S. 444–446). Demgegenüber ging Heinrich Brunner vom unfreien Ursprung der pueri regis aus, die aber unter den Karolingern zusammen mit freien Leuten genannt worden seien (vgl. Brunner, Heinrich, Deutsche Rechtsgeschichte, Band 1, 2. Aufl. – Leipzig: Duncker & Humblot 1906, S. 374 f.).
59
usw.). Reste davon sind sehr lange bestehen geblieben. Weber bezieht sich hier – wie aus einer Parallelnennung hervorgeht – auf die Herrschaft des Hauses Anjou (Angiovinen) über Sizilien (1265/66–1282) und das König[533]reich Neapel (1282–1435). Vgl. dazu Weber, Patrimonialismus, MWG I/22-4, S. 287 mit Hg.-Anm. 3.
[533]6.60Die Gliederungsziffer 6. ist doppelt vergeben, vgl. oben, S. 513, sowie die Erläuterungen im Editorischen Bericht, oben, S. 104 mit Anm. 50. Die herrschaftsfremde Umdeutung des Charisma.
Die Gliederungsziffer 6. ist doppelt vergeben, vgl. oben, S. 513, sowie die Erläuterungen im Editorischen Bericht, oben, S. 104 mit Anm. 50.
§ 14. Das seinem primären Sinn nach autoritär gedeutete charismatische Legitimätsprinzip kann antiautoritär umgedeutet werden. Denn die tatsächliche Geltung [A 156]der charismatischen Autorität ruht in der Tat gänzlich auf der durch „Bewährung“ bedingten Anerkennung durch die Beherrschten, die freilich dem charismatisch Qualifizierten und deshalb Legitimen gegenüber pflichtmäßig ist. Bei zunehmender Rationalisierung der Verbandsbeziehungen liegt es aber nahe: daß diese Anerkennung, statt als Folge der Legitimität, als Legitimitätsgrund angesehen wird (demokratische Legitimität), die (etwaige) Designation durch den Verwaltungsstab als „Vorwahl“, durch den Vorgänger als „Vorschlag“, die Anerkennung der Gemeinde selbst als „Wahl“. Der kraft Eigencharisma legitime Herr wird dann zu einem Herren von Gnaden der Beherrschten, den diese (formal) frei nach Belieben wählen und setzen, eventuell auch: absetzen, – wie ja der Verlust des Charisma und seiner
k
Bewährung den Verlust der genuinen Legitimität nach sich gezogen hatte. Der Herr ist nun der frei gewählte Führer. Ebenso entwickelt sich die Anerkennung charismatischer Rechtsweisungen durch die Gemeinde dann zu der Vorstellung: daß die Gemeinde Recht nach ihrem Belieben setzen, anerkennen und abschaffen könne, sowohl generell wie für den einzelnen Fall, – während die Fälle von Streit über das „richtige“ Recht in der genuin charismatischen Herrschaft zwar faktisch oft durch Gemeindeentscheid, aber unter dem psychologischen Druck: daß es nur eine pflichtmäßige und richtige Entscheidung gebe, erledigt wurden. Damit nähert sich die Behandlung des Rechts der legalen Vorstellung. Der wichtigste Übergangstypus ist: die plebiszitäre Herrschaft. Sie hat ihre meisten Typen in dem „Parteiführertum“ im modernen Staat. Aber sie besteht überall da, wo der [534]Herr sich als Vertrauensmann der Massen legitimiert fühlt und als solcher anerkannt ist. Das adäquate Mittel dazu ist das Plebiszit. In den klassischen Fällen beider Napoleons ist es nach gewaltsamer Eroberung der Staatsgewalt angewendet, bei dem zweiten nach Prestige-Verlusten erneut angerufen worden.[533]A: seine
61
Gleichgültig (an dieser Stelle), wie man seinen Realitätswert veranschlagt: es ist jedenfalls formal das spezifische Mittel der Ableitung der Legitimität der Herrschaft aus dem (formal und der Fiktion nach) freien Vertrauen der Beherrschten. [534]Nach dem Staatsstreich vom 18. Brumaire (9. November 1799) ließ Napoleon die neue Konsularverfassung – eigentlich eine demokratisch verschleierte Militärdiktatur – und sich selbst als Ersten Konsul per Plebiszit bestätigen (vgl. dazu Weber, Parlament und Regierung, MWG I/15, S. 539). Sein Neffe Napoleon III. veranlaßte am 7. November 1852 ein Plebiszit, um seinen Staatsstreich vom 2. Dezember 1851 legalisieren zu lassen. Ein weiteres Plebiszit am 8. Mai 1870 wies dem Kaiser im parlamentarisierten Regierungssystem eine herausragende Stellung zu. Vgl. Weber, Umbildung des Charisma, MWG I/22-4, S. 499.
Das „Wahl“-Prinzip, einmal, als Umdeutung des Charisma, auf den Herren angewendet, kann auch auf den Verwaltungsstab angewendet werden. Wahlbeamte, legitim kraft Vertrauens der Beherrschten, daher abberufbar durch Erklärung des Mißtrauens dieser, sind in „Demokratien“ bestimmter Art, z. B. Amerika,
62
typisch. Sie sind keine „bureaukratischen“ Figuren. Sie stehen in ihrer Stellung, weil selbständig legitimiert, in schwacher hierarchischer Unterordnung und mit vom „Vorgesetzten“ nicht beeinflußbaren Chancen des Aufrückens und der Verwendung (Analogien in den Fällen mehrfacher, qualitativ besonderter Charismata, wie sie z. B. zwischen Dalai Lama und Taschi Lama bestehen).Weber dürfte hier insbesondere an das Abberufungsreferendum („recall bzw. „re call election“) denken, das 1903 zuerst in Los Angeles und 1908 in den US-Bundes staaten Michigan und Oregon eingeführt wurde.
63
Eine aus ihnen zusammengesetzte [535]Verwaltung steht als „Präzisionsinstrument“ technisch weit hinter der bureaukratisch aus ernannten Beamten gebildeten zurück. Die beiden geistlichen Oberhäupter des tibetischen Lamaismus wurden als Bodhisattva-Inkarnationen verehrt, wodurch sich unterschiedliche Funktionen ergaben. Der Dalai Lama, der Superior des größten buddhistischen Klosters in Tibet, der Potala in Lhasa, galt seit 1439 als eine Inkarnation des Bodhisattva Avalokiteśvara, während der Taschi-Lama, der Superior des ebenfalls bedeutenden Klosters bKra-śis lhun-po in Südtibet, als eine Inkarnation des Bodhisattva Amitābha verehrt wurde. Der an Heiligkeit höherstehende Dalai Lama war der politisch bedeutsamere und auch (bis 1959) Staatsoberhaupt Tibets, während von dem Taschi-Lama „mehr die exemplarische Leitung des religiösen Lebens“ erwartet wurde. Vgl. Weber, Hinduismus, MWG I/20, S. 454 f. mit Hg.-Erläuterungen, und Weber, Notizen, MWG I/22-4, S. 712.
1. Die „plebiszitäre Demokratie“ – der wichtigste Typus der Führer-Demokratie – ist ihrem genuinen Sinn nach eine Art der charismatischen Herrschaft, die sich unter der Form einer vom Willen der Beherrschten abgeleiteten und nur durch ihn fortbestehenden Legitimität verbirgt. Der Führer (Demagoge) herrscht tatsächlich kraft der Anhänglichkeit und des Vertrauens seiner politischen Gefolgschaft zu seiner Person als solcher. Zunächst: über die für ihn geworbenen Anhänger[,] weiterhin, im Fall diese ihm die Herrschaft verschaffen, innerhalb des Verbandes. Den Typus geben die Diktatoren der antiken und modernen Revolutionen: die hellenischen Aisymneten, Tyrannen und Demagogen, in Rom Gracchus
64
und seine Nachfolger, in den italienischen Städtestaaten die Capitani del popolo und Bürgermeister[535]Von den beiden Gracchen dürfte hier der jüngere und „in der Popularität der Massen“ hochstehende Gaius gemeint sein. Vgl. Weber, Agrarverhältnisse3, MWG I/6, S. 672.
65
(Typus für Deutschland: die Zürcher demokratische Diktatur),Der capitano del popolo war seit der Mitte des 13. Jahrhunderts der „höchste Beamte“ des „popolo“, einer politischen Sondergemeinde innerhalb der meisten großen Stadtkommunen Oberitaliens. Er wurde zunächst – meist – jährlich gewählt und war mit den militärischen, gerichtlichen und Verwaltungsaufgaben des popolo betraut. In vielen Fällen entwickelte sich seine kontrollierende Funktion gegenüber dem Podestà, dem Stadtvogt oder – wie Weber schreibt – Bürgermeister, zu einer offiziell anerkannten Amtsstellung an der Spitze der Kommune. Vgl. Weber, Die Stadt, MWG I/22-5, S. 200 ff., aber auch Salzer, Ernst, Über die Anfänge der Signorie in Oberitalien. Ein Beitrag zur italienischen Verfassungsgeschichte. – Berlin: E. Ebering 1900, bes. S. 144 ff. (hinfort: Salzer, Signorie).
66
in den modernen Staaten die Diktatur Cromwells, der revolutionären Gewalthaber und der plebiszitäre Imperialismus in Frankreich. Wo immer überhaupt nach Legitimität dieser Herrschaftsform gestrebt [536]wurde, wurde sie in der plebiszitären Anerkennung durch das souveräne Volk gesucht. Der persönliche Verwaltungsstab wird charismatisch, aus begabten Plebejern, rekrutiert (bei Cromwell unter Berücksichtigung [A 157]der religiösen Qualifikation,Gemeint ist – wie aus Parallelerwähnungen in Weber, Die Stadt, MWG I/22-5, S. 199 mit Hg.-Anm. 2, sowie aus den Mit- und Nachschriften zu Weber, Wirtschaftsgeschichte, MWG III/6, S. 501, hervorgeht – das Stadtregiment unter Ritter Rudolf Brun (ca. 1290/1300–1360). Dieser hatte am 7. Juni 1336 mit Unterstützung der bis dahin nahezu rechtlosen Handwerker und eines Teils der Ratsherren den alten, von der Kaufmannschaft gestützten Rat der Stadt Zürich stürzen können. Am folgenden Tag wurde er durch eine Volksversammlung zum ersten Bürgermeister Zürichs „mit unumschränkter Gewalt“ auf Lebenszeit gewählt. Er entwarf eine neue Rats- und Zunftverfassung, die bis 1798 gültig war. Durch zwei frühmittelalterliche geistliche Stiftungen im Stadtgebiet war Zürich als Reichsvogtei und seit 1262 als reichsunmittelbare Stadt mit dem Heiligen Römischen Reich deutscher Nation verbunden. Dies erklärt Webers Zuordnung zu Deutschland. Vgl. Dändliker, Karl, Art. Brun, Rudolf B., in: Allgemeine Deutsche Biographie, Band 3. – Leipzig: Duncker & Humblot 1876, S. 438 f., Zitat: S. 439.
67
bei Robespierre neben der persönlichen Verläßlichkeit auch gewisser „ethischer“ Qualitäten,[536]Oliver Cromwell nominierte die 144 Mitglieder des Barebone’s Parliament („Parlament der Heiligen“). In dem Einladungsschreiben vom 6. Juni 1653 hieß es: „[…] it became necessary, that the peace, safety and good government of this Commonwealth should be provided for: And in order thereunto, divers Persons fearing God, and of approved Fidelity and Honesty, are, by myself with the advice of my Council of Officers, nominated“. Vgl. Oliver Cromwell’s Letters and Speeches: With elucidations, edited by Thomas Carlyle, Vol. 2, second edition. – London: Chapman and Hall 1846, S. 386 f., Zitat: S. 386.
68
bei Napoleon ausschließlich nach der persönlichen Begabung und Verwendbarkeit für die Zwecke der kaiserlichen „Herrschaft des Genies“).Zu den engsten Vertrauten Robespierres zählten Antoine de Saint-Just (1767–1794) und Georges Couthon (1755–1794), die ihre revolutionären Ziele mit einer rigoristischen Tugend-Ethik und dem Kult des „l’être suprême“ verbanden. Vgl. auch Weber, Staat und Hierokratie, MWG I/22-4, S. 679 mit Hg.-Anm. 44.
69
Er trägt auf der Höhe der revolutionären Diktatur den Charakter der Verwaltung kraft reinen Gelegenheitsmandats auf Widerruf (so in der Agenten-Verwaltung der Zeit der Wohlfahrtsausschüsse). Napoleon I. berief die tüchtigsten Beamten in seinen Staatsrat. Die Mitglieder waren von ihm frei ernennbar und absetzbar. Der Staatsrat war nicht nur Beratungsgremium und Führungsorgan der Verwaltung, sondern auch Eliteschmiede für den Verwaltungsnachwuchs. Vgl. Mayer, Otto, Theorie des Französischen Verwaltungsrechts. – Straßburg: Karl J. Trübner 1886, S. 72 f., 48 (hinfort: Mayer, Französisches Verwaltungsrecht). Zu Napoleons „Herrschaft des Genies“ vgl. oben, S. 495 mit Hg.-Anm. 23.
70
Auch den durch die Reformbewegungen in den amerikanischen Städten hochgekommenen Kommunaldiktatoren hat die eigne freie Anstellung ihrer Hilfskräfte eingeräumt werden müssen. Am 6. April 1793 wurde der Wohlfahrtsausschuß („Comité de salut public“) als Exekutivorgan des Nationalkonvents eingesetzt. Unter Robespierre galt er als Instrument des Schreckens (bis zum 27. Juli 1794). Die „agents nationaux“ wurden als Exekutivbeamte in die Provinzen geschickt, hatten dort aber vor allem die Aufgabe, revolutionsfeindliche Personen zu enttarnen und im vierzehntägigen Abstand dem Wohlfahrtsausschuß Bericht zu erstatten.
71
Die [537]traditionale Legitimität ebenso wie die formale Legalität werden von der revolutionären Diktatur gleichmäßig ignoriert. Die nach materialen Gerechtigkeitsgründen, utilitarischen Zwecken und Staatsnutzen verfahrende Justiz und Verwaltung der patriarchalen Herrschaft findet in den Revolutionstribunalen und den materialen Gerechtigkeitspostulaten der radikalen Demokratie in der Antike und im modernen Sozialismus ihre entsprechende Parallele (wovon in der Rechtssoziologie zu handeln ist).Im Zuge der Korruptionsbekämpfung begannen die Ostküstenstädte – Brooklyn, Boston, New York – in den Jahren 1882–1885 die Bürgermeister (mayors) mit außerordentlichen Vollmachten auszustatten. Die von den Stadtbewohnern direkt gewählten mayors konnten städtische Beamte nach eigenem Willen ein- oder absetzen und sich über Entscheidungen des Stadtrates hinwegsetzen. Ostrogorski nennt sie daher „municipal dictator[s]“ (vgl. Ostrogorski, Moisei Jakolevich, Democracy and the Organization of Political Parties, vol. 2. – London: Macmillan & Co. 1902, S. 522 f.; hinfort: Ostrogorski, Political Parties II). Seth Low, Bürgermeister von Brooklyn (1881–85), sah in der Ernennung von „unimportant officers“ eher eine Schmälerung der Volksmacht und reklamierte diese für den mayor (vgl. Bryce, James, The American Commonwealth, 2 [537]vols., 2nd edition. – London, New York: Macmillan and Co. 1890 (hinfort: Bryce, American Commonwealth I–II2), hier: vol. I, S. 614, Anm. 2 und S. 594 ff.).
72
Die Veralltäglichung des revolutionären Charisma zeigt dann ähnliche Umbildungen wieEntsprechende Ausführungen über das materiale Naturrecht in Antike und modernem Sozialismus sind nicht überliefert. Jedoch finden sich Ansätze in der älteren Fassung der „Rechtssoziologie“, § 7 „Die formalen Qualitäten des revolutionär geschaffenen Rechts“, MWG I/22-3, bes. S. 603–609.
l
der entsprechende Prozeß sonst zutage fördert: so das englische Soldheer als Rückstand des Freiwilligkeitsprinzips des Glaubenskämpferheeres,[537]Zu erwarten wäre: wie sie
73
das französische Präfektensystem als Rückstand der charismatischen Verwaltung der revolutionären plebiszitären Diktatur.Während des englischen Bürgerkrieges baute Oliver Cromwell ein diszipliniertes, aus puritanischen Gläubigen und Revolutionsanhängern bestehendes Reiterheer (die sog. „ironsides“) auf. Dieses diente als Vorbild für die New Model Army (1645–60), die als erstes stehendes Heer in der englischen Geschichte dem Parlament unterstand.
74
Die Präfekten, durch die Verfassung vom 22. Frimaire VIII (14. Dezember 1799) und ein Gesetz vom 28. Pluviôse VIII (8. Februar 1800) geschaffen, waren die Leiter der Departementsverwaltungen und zugleich die Vertreter des Departements als öffentlicher Körperschaft. Sie wurden vom Staatsoberhaupt ernannt, ohne Anstellungsbedingungen, und waren ebenso frei absetzbar. Vgl. Mayer, Französisches Verwaltungsrecht (wie oben, S. 536, Anm. 69), S. 54 f.
2. Der Wahlbeamte bedeutet überall die radikale Umdeutung der Herrenstellung des charismatischen Führers in einen „Diener“ der Beherrschten. Innerhalb einer technisch rationalen Bureaukratie hat er keine Stätte. Denn da er nicht von dem „Vorgesetzten“ ernannt ist, nicht in seinen Avancementschancen von ihm abhängt, sondern seine Stellung der Gunst der Beherrschten verdankt, so ist sein Interesse an prompter Disziplin, um den Beifall der Vorgesetzten zu verdienen, gering; er wirkt daher wie eine „autokephale“ Herrschaft. Eine technisch hochgradige Leistung läßt sich daher mit einem gewählten Beamtenstabe in aller Regel nicht erzielen. (Der Vergleich der Wahlbeamten der amerikanischen Einzelstaaten mit den ernannten Beamten der Union und ebenso die Erfahrungen mit den kommunalen Wahlbeamten gegenüber den von den plebiszitären Reform-[538]Mayors nach eigenem Ermessen bestellten Committees sind Beispiele.)
75
Dem Typus der plebiszitären Führerdemokratie stehen die (später zu besprechenden)[538]In den meisten US-Einzelstaaten wurden der Gouverneur, die hohen Staatsbeamten und die Richter direkt vom Volk gewählt, während im Bundesstaat die Beamten- und Richterernennungen dem Präsidenten (mit Zustimmung des Senates) zustanden. Zur kritischen Einschätzung beider Systeme, die zunehmend durch Parteirücksichten geprägt wurden, gerade auch auf kommunaler Ebene, vgl. Weber, Bürokratismus, MWG I/22-4, S. 164 f. mit Hg.-Anmerkungen.
76
Typen der führerlosen Demokratie gegenüber, welche durch das Streben nach Minimisierung der Herrschaft des Menschen über den Menschen charakterisiert ist. In Kap. III, § 15, unten, S. 553, und Kap. III, § 22, S. 588, finden sich zwar kurze Erwähnungen, systematische Ausführungen fehlen aber, siehe dazu auch den Verweis auf S. 553 mit Hg.-Anm. 37.
Der Führerdemokratie ist dabei im allgemeinen der naturgemäße emotionale Charakter der Hingabe und des Vertrauens zum Führer charakteristisch, aus welchem die Neigung, dem Außeralltäglichen, Meistversprechenden, am stärksten mit Reizmitteln Arbeitenden als Führer zu folgen, hervorzugehen pflegt. Der utopische Einschlag aller Revolutionen hat hier seine naturgemäße Grundlage. Hier liegt auch die Schranke der Rationalität dieser Verwaltung in moderner Zeit, – die auch in Amerika nicht immer den Erwartungen entsprach.
Beziehung zur Wirtschaft: 1. Die antiautoritäre Umdeutung des Charisma führt normalerweise in die Bahn der Rationalität. Der plebiszitäre Herrscher wird regelmäßig sich auf einen prompt und reibungslos fungierenden Beamtenstab zu stützen suchen. Die Beherrschten wird er entweder durch kriegerischen Ruhm und Ehre oder durch Förderung ihres materiellen Wohlseins – unter Umständen durch den Versuch der Kombination beider – an sein Charisma als „bewährt“ zu binden suchen. Zertrümmerung der traditionalen, feudalen, patrimonialen und sonstigen autoritären Gewalten und Vorzugschancen wird sein erstes, Schaffung von ökonomischen Interessen, die mit ihm durch Legitimitäts-Solidarität verbunden sind, sein zweites Ziel sein. Sofern er dabei der Formalisierung und Legalisierung des Rechts sich bedient, kann er die „formal“ rationale Wirtschaft in hohem Grade fördern.
2. Für die (formale) Rationalität der Wirtschaft schwächend werden plebiszitäre Gewalten leicht insofern, als ihre Legitimitätsabhängigkeit von dem Glauben und der Hingabe der Mas[539]sen sie umgekehrt zwingt: materiale Gerechtigkeitspostulate auch wirtschaftlich zu vertreten, also: den formalen Charakter der Justiz und Verwaltung durch eine materiale („Kadi“-)Justiz (Revolutionstribunale, Bezugscheinsysteme, alle Arten von rationierter und kontrollierter Produktion und Konsumtion) zu durchbrechen. Insoweit er also sozialer Diktator ist, was an moderne sozia[A 158]listische Formen nicht gebunden ist. Wann dies der Fall ist und mit welchen Folgen[,] ist hier noch nicht zu erörtern.
77
[539]Der Bezug ist unklar. Umfassendere Ausführungen, auch die unten, S. 542 mit Hg.-Anm. 88, angekündigte „Sonderdarstellung“, sind nicht überliefert.
3. Das Wahl-Beamtentum ist eine Quelle der Störung formal rationaler Wirtschaft, weil es regelmäßig Parteibeamtentum, nicht fachgeschultes Berufsbeamtentum ist, und weil die Chancen der Abberufung oder der Nichtwiederwahl es an streng sachlicher und um die Konsequenzen unbekümmerter Justiz und Verwaltung hindern. Es hemmt die (formal) rationale Wirtschaft nur da nicht erkennbar, wo deren Chancen infolge der Möglichkeit, durch Anwendung technischer und ökonomischer Errungenschaften alter Kulturen auf Neuland mit noch nicht appropriierten Beschaffungsmitteln zu wirtschaften, hinlänglich weiten Spielraum lassen, um die dann fast unvermeidliche Korruption der Wahlbeamten als Spesen mit in Rechnung zu stellen und dennoch Gewinne größten Umfanges zu erzielen.
Für Abschnitt 1 bildet der Bonapartismus das klassische Paradigma. Unter Nap[oleon] I.: Code Napoleon, Zwangserbteilung,
78
Zerstörung aller überkommenen Gewalten überall in der Welt, dagegen Lehen für verdiente Würdenträger; zwar der Soldat alles, der Bürger nichts, aber dafür: gloire und – im ganzen – leidliche Versorgung des Kleinbürgertums. Unter Nap[oleon] III.: ausgeprägte Fortsetzung der bürgerköniglichen [540]Parole „enrichissez-vous“,Der Code Napoleon (eigentlich: Code civil) trat 1804 in Kraft und galt auch in den von Napoleon besiegten und annektierten Ländern, z. B. im Königreich Italien und in den linksrheinischen deutschen Gebieten. In über 2000 Artikeln regelte er die Rechte der Bürger, vom Ehe-, Scheidungs- und Erbrecht über Gewerbefreiheit und freie Berufswahl bis hin zur Trennung von Staat und Kirche. Die „Zwangserbteilung“ ist in Art. 913 und 919 geregelt und gesteht dem Erblasser nur über einen Teil seines Vermögens die freie testamentarische Verfügung zu („quotité disponible“). Frau und Kinder waren zunächst mit einem gesetzlich festgelegten und abgestuften Anteil zu berücksichtigen. Vgl. dazu Weber, Geschichte der Handelsgesellschaften, MWG I/1, S. 199 mit Hg.-Anm. 36.
79
Riesenbauten, Crédit[540]Die Parole „enrichissez vous“ wurde unter Bürgerkönig Louis Philipp ausgegeben, angeblich zuerst von dessen Minister Guillaume Guizot am 1. März 1843 in der französischen Abgeordnetenkammer.
m
mobilier,[540]A: Credit
80
mit den bekannten Folgen. Die „Société générale du Crédit mobilier“, 1852 als Anlage- und Gründungsbank in Paris gegründet, sollte vor allem zur Finanzierung des Eisenbahnbaus und Großprojekten des In- und Auslandes dienen. In den Krisen 1856/57 und 1864 machten Zeitgenossen häufig den Crédit Mobilier und seine Spekulationsgeschäfte allein verantwortlich. 1867 wurde das Unternehmen umgestaltet und 1902 liquidiert.
Für Abschnitt 2 ist die griechische „Demokratie“ der perikleischen und nachperikleischen Zeit
81
ein klassisches Beispiel. Prozesse wurden nicht, wie der römische, von dem vom Prätor bindend instruierten oder gesetzgebundenen Einzelgeschworenen und nach formalem Recht entschieden. Sondern von der nach „materialer“ Gerechtigkeit, in Wahrheit: nach Tränen, Schmeicheleien, demagogischen Invektiven und Witzen entscheidenden Heliaia (man sehe die „Prozeßreden“ der attischen Rhetoren,Perikies übertrug alle richterliche Gewalt auf das Volksgericht (Heliaia), führte Tagegelder für Geschworene ein und ließ die dritte Bürgerklasse (Zeugiten) zum Ältestenrat (Archontat) zu. Er gilt daher als Vollender der sogenannten radikalen Demokratie, die von seinen Nachfolgern – mit einer kurzen Unterbrechung – bis zur Herrschaft der 30 Tyrannen (404/3 v. Chr.) fortgesetzt wurde. (Vgl. Eduard Meyer, Geschichte des Alterthums, Band 3, 1. Aufl. – Stuttgart: J. G. Cotta 1901, S. 571–573; hinfort: Meyer, Geschichte des Alterthums III1). Weber bezeichnet diese Phase als „Demokratie“, setzt also Anführungszeichen, um Verwechslungen mit dem modernen Begriff auszuschließen (vgl. Weber, Bürokratismus, MWG I/22-4, S. 232 mit Hg.-Anm. 54).
82
– sie finden in Rom nur in politischen Prozessen: Cicero, eine Analogie).Die berühmtesten Redner vor dem attischen Volksgericht (Heliaia) waren Lysias (um 445–380 v. Chr.), Lykurgos (ca. 390–324 v. Chr.) und Demosthenes (384–322 v. Chr.), wobei die von Max Weber aufgezählten Beeinflussungsstrategien am meisten auf Lysias zutreffen. Vgl. auch Burckhardt, Jakob, Griechische Kulturgeschichte, 2. Aufl. in 4 Bänden, hg. v. Jakob Oeri. – Berlin, Stuttgart: W. Spemann [1898–1902], Band 1 [1898], S. 237 f. und Band 3 [1900], S. 337–339.
83
Die Unmöglichkeit der Entwicklung eines formalen Rechts und einer formalen Rechtswissenschaft römischer Art war die Folge. Denn die Heliaia war „Volksgericht“ ganz ebenso wie die „Revolutionsgerichte“ der französischen und der deutschen (Räte-)Revolution, welche keineswegs nur politisch relevante Prozesse vor ihre Laien-Tribunale zogen.Hierbei dürfte Weber insbesondere an die „Verrinischen Reden“ gedacht haben. Cicero trat nur ein einziges Mal als Ankläger in einem Strafprozeß auf, im Jahr 70 v. Chr. gegen den ehemaligen Proprätor von Sizilien, Gaius Verres, der wegen räuberischer Erpressung angeklagt war. Vgl. die Parallelerwähnung in Weber, Recht, MWG I/22-3, S. 502.
84
Dagegen hat [541]keine englische Revolution je die Justiz, außer für hochpolitische Prozesse, angetastet.Revolutionsgerichte sind außerordentliche Strafgerichte mit verkürzten Verfahren. Während der Französischen Revolution wurde ein Revolutionstribunal vor allem zur [541]schnellen Aburteilung von politischen Gegnern installiert und unter Robespierre zu einem Instrument des terreur ausgebaut. Das Tribunal bestand vom 10. März 1793 bis zum 31. Mai 1795. – In Deutschland gab es während der bayerischen Rätezeit im April 1919 ein Revolutionstribunal. Seine Mitglieder waren Laien, nach Parteizugehörigkeit und politischer Richtung ausgewählt und zunächst durch Rechtsanwälte beraten. Geahndet werden sollten Verstöße gegen die Grundsätze der Revolution, tatsächlich befaßte sich das Gericht aber vor allem mit Eigentumsdelikten (Diebstahl und Plünderungen) sowie Schiebung und Ausweisfälschung, nicht mit „Bluturteilen“, wie Radikale forderten.
85
Allerdings war dafür die Friedensrichterjustiz meist Kadijustiz, – aber nur soweit sie die Interessen der Besitzenden nicht berührte, also: Polizeicharakter hatte.Durch die „bill of attainder“ erhielt das Parlament in Einzelfällen die Befugnis, bestimmte Personen ohne gerichtliches Verfahren zu vernehmen und zu verurteilen. Diese politischen Prozesse kamen nur selten vor, häufiger allerdings in den Jahren des englischen Bürgerkrieges. Vgl. Jellinek, Staatslehre2 (wie oben, S. 213, Anm. 18), S. 361 f., der darin allerdings ein Instrument der absoluten Staatsmacht sah.
86
Die englische Lokalverwaltung lag seit dem 13. Jahrhundert zu großen Teilen in den Händen der in der Grafschaft ansässigen Grundherren. Die vom König ernannten Friedensrichter richteten in Zivil- und Strafsachen. Wie willkürlich die Urteile dieser Laienrichter ausfallen konnten, stellte der Jurist Albrecht Mendelssohn Bartholdy anhand von Urteilen für die Jahre 1906/07 zusammen. Vgl. Weber, Bürokratismus, MWG I/22-4, S. 189, mit direkter Referenz auf Mendelssohn Bartholdy, Albrecht, Das Imperium des Richters. Ein Versuch kasuistischer Darstellung nach dem englischen Rechtsleben im Jahre 1906/7 nebst zwei Anhängen […]. – Straßburg: Karl J. Trübner 1908.
Für Abschnitt 3 ist die nordamerikanische Union das Paradigma. Auf die Frage: warum sie sich von oft bestechlichen Parteileuten regieren ließen? antworteten mir anglo-amerikanische Arbeiter noch vor 16 Jahren: weil „our big country“ solche Chancen böte, daß, auch wenn Millionen gestohlen, erpreßt und unterschlagen würden, doch noch Verdienst genug bleibe, und weil diese „professionals“
n
eine Kaste seien, auf die „wir“ (die Arbeiter) „spucken“, während Fachbeamte deutscher Art eine Kaste sein würden, die „auf die Arbeiter spucken“ würden.[541]A: „professionels“
87
Max Weber bezieht sich hier offenbar auf Gespräche, die er während seiner USA-Reise (August bis November 1904) geführt hat und die er auch in seinem Wiener Vortrag „Der Sozialismus“ erwähnte (vgl. Weber, Sozialismus, MWG I/15, S. 604). Die Aussage könnte auf Jerome F. Healy, den Schatzmeister der New York City Typographical Union No. 6, zurückgehen. Max und Marianne Weber hatten ihn am 10. November in New York besucht (vgl. Scaff, Lawrence A., Max Weber in America. – Princeton: Princeton University Press 2011, S. 176, 256, sowie den Reisebrief von Max und Marianne Weber vom 11. November 1904, Bestand Max Weber-Schäfer, Deponat BSB München, Ana 446; MWG II/4). Inhaltlich deckt sich Webers Aussage mit der von James Bryce, daß die Amerikaner den Amtsträger daran mahnen, „that he is the servant [542]of the people and not their master, Iike the bureaucrats of Europe“. VgI. Bryce, American Commonwealth II2 (wie oben, S. 536 f., Anm. 71), S. 128.
[542]Alle Einzelheiten der Zusammenhänge mit der Wirtschaft gehören in die Sonderdarstellung weiter unten,
88
nicht hierher. Entsprechende Ausführungen sind nicht überliefert.
7. Kollegialität und Gewaltenteilung.
§ 15. Eine Herrschaft kann traditional oder rational durch besondere Mittel begrenzt und beschränkt sein.
Von der Tatsache der Beschränkung der Herrschaft durch die Traditions- oder Satzungsgebundenheit als solcher ist also hier nicht die Rede. Sie ist in dem Gesagten (§§
o
3 ff.) schon miterörtert.[542]A: (§
1
Sondern hier handelt es sich um spezifische, die Herrschaft beschränkende soziale Beziehungen und Verbände. Kap. III, §§ 3 bis 9, oben, S. 455–485.
1. Eine patrimoniale oder feudale Herrschaft ist beschränkt durch ständische Privilegien, im Höchstmaß durch die ständische Gewaltenteilung (§ 8), – Verhältnisse, von denen schon die Rede war.
2
Gemeint ist § 9 (nicht: 8), oben, S. 484, Punkt 4.
2. Eine bureaukratische Herrschaft kann beschränkt sein (und muß gerade bei vollster Entwicklung des Legalitätstypus normalerweise beschränkt sein, da[A 159]mit nur nach Regeln verwaltet werde)
p
durch Behörden, welche zu Eigenrecht neben der bureaukratischen Hierarchie stehen und: A: werde),
a) die Kontrolle und eventuelle Nachprüfung der Innehaltung der Satzungen, oder:
b) auch das Monopol der Schaffung aller oder der für das Ausmaß der Verfügungsfreiheit der Beamten maßgeblichen Satzungen, eventuell und vor allem:
c) auch das Monopol der Bewilligung der für die Verwaltung nötigen Mittel besitzen.
Von diesen Mitteln ist weiterhin gesondert zu reden (§ 16).
3
Kap. III, § 16, unten, S. 562 ff.
[543]3. Jede Art von Herrschaft kann ihres monokratischen, an eine Person gebundenen Charakters entkleidet sein durch das Kollegialitätsprinzip. Dieses selbst aber kann ganz verschiedenen Sinn haben. Nämlich:
a) den Sinn: daß neben monokratischen Inhabern von Herrengewalten andre ebenfalls monokratische Gewalthaber stehen, denen Tradition oder Satzung wirksam die Möglichkeit gibt, als Aufschubs- oder Kassationsinstanzen gegen Verfügungen jener zu fungieren (Kassations-Kollegialität).
Wichtigste Beispiele: der Tribun (und ursprünglich: Ephore) der Antike, der capitano del popolo des Mittelalters,
4
der Arbeiter- und Soldatenrat und seine Vertrauensmänner in der Zeit nach dem 9. November 1918 bis zur Emanzipation der regulären Verwaltung von dieser, zur „Gegenzeichnung“ berechtigten, Kontrollinstanz.[543]Max Weber nennt hier die Vertreter von Sonderverbandsbildungen, die das Recht hatten, Beschlüsse oder Gerichtsurteile der legitimen Vertreter des Gesamtverbandes aufzuheben. Dies waren in Rom die Tribunen (im Gegensatz zu den consules), in Sparta die fünf Ephoren (im Gegensatz zu den beiden Königen) und in den mittelalterlichen italienischen Stadtgemeinden der capitano del popolo (im Gegensatz zum podestà). In Rom und den italienischen Kommunen waren sie Vertreter der nicht-adeligen Schichten (der Plebs und des popolo). Aus einer „Art von tribuzinischem Hilfs- und Kontrollrecht gegenüber den Kommunalbehörden“ entwickelten sie sich zu einer Kassationsinstanz. Vgl. Weber, Die Stadt, MWG I/22-5, S. 200–202, 208–214, Zitat: S. 208, dort auch die Nachweise und die Erläuterung des Herausgebers, ebd., S. 32 f.
5
Am 10. November 1918 wurden in Berlin der Rat der Volksbeauftragten (bestehend aus SPD- und USPD-Mitgliedern) und der Vollzugsrat als Organ der Arbeiter- und Soldatenräte bestätigt. Die Exekutive ging an den Rat der Volksbeauftragten, während dem Vollzugsrat die Kontrolle der Reichsverwaltung zufiel. Noch in seiner Eigenschaft als Reichskanzler setzte Friedrich Ebert durch, daß Eingriffe in die Verwaltung durch die Vertrauensleute des Vollzugsrats unterbunden wurden. In manchen Ländern kontrollierten Beauftragte der Arbeiter- und Soldatenräte die Behörden bis hinunter zur Gemeindeebene z. B. durch die Gegenzeichnung von Verwaltungseingängen und -ausgängen.
Oder:
b) den ganz entgegengesetzten Sinn: daß Verfügungen von Behörden nicht monokratischen Charakters, nach vorgängiger Beratung und Abstimmung, erlassen werden, daß also laut Satzung nicht ein einzelner, sondern eine Mehrheit von einzelnen Zusammenwirken muß, damit eine bindende Verfügung zustande kommt (Leistungs-Kollegialität). Es kann dann gelten:
α. Einstimmigkeitsprinzip, oder:
[544]ß. Mehrheitsprinzip.
c) Dem Fall a
6
(Kassationskollegialität) entspricht im Effekt der Fall: daß zur Schwächung der monokratischen Gewalt mehrere, monokratische, gleichberechtigte Inhaber von Herrengewalten stehen, ohne Spezifizierung von Leistungen, so daß also bei Konkurrenz um Erledigung der gleichen Angelegenheit mechanische Mittel (Los, Turnus, Orakel, Eingreifen von Kontrollinstanzen: 2 a) entscheiden müssen, wer sie zu erledigen hat, und mit dem Effekt, daß jeder Gewalthaber Kassationsinstanz gegen jeden andren ist. [544]Bezug ist 3a), oben, S. 543, Z. 5 ff.
Wichtigster Fall: die römische Kollegialität der legitimen Magistratur (Consul, Praetor).
7
Weber nennt hier die beiden höchsten Amtsträger (Magistrate) der Römischen Republik, die – im Gegensatz zu den Tribunen (oben, S. 543 mit Hg.-Anm. 4) – in der Staatsordnung vorgesehene („legitime“) Ämter der Gesamtgemeinde ausübten (vgl. dazu Weber, Die Stadt, MWG I/22-5, S. 209 mit Hg.-Anm. 32). Consul und Praetor hatten die höchste Befehlsgewalt (imperium) inne, wobei die beiden consules höher standen. Entscheidungen dieser Amtsträger konnten nur durch einen Inhaber eines höher- oder gleichgestellten Imperiums kassiert werden. Die beiden jährlich gewählten consules besaßen ein wechselseitiges Interzessionsrecht (vgl. dazu unten, S. 556, Hg.-Anm. 48).
d) Dem Fall b (Leistungs-Kollegialität) steht noch nahe der Fall: daß in einer Behörde zwar ein material monokratischer primus inter pares vorhanden ist, Anordnungen aber normalerweise nur nach Beratung mit andren formal gleichgeordneten Mitgliedern erfolgen sollen und die Abweichung der Ansichten in wichtigen Fällen eine Sprengung des Kollegiums durch Austritte und damit eine Gefährdung der Stellung des monokratischen Herrn zur Folge hat (Leistungs-Kollegialität mit präeminentem Leiter).
Wichtigster Fall: die Stellung des englischen „Prime Minister“ innerhalb des „Cabinet“. Diese hat bekanntlich sehr gewechselt. Der Formulierung nach entsprach sie aber material in den meisten Fällen der Epoche der Kabinettsregierung.
8
In der klassischen Zeit der englischen Kabinettsregierung, vom Beginn des 18. bis in die 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts, stand in der Regel der Führer der herrschenden Partei und First Lord of the Treasury als Premierminister dem Kabinett, dem inneren Ausschuß des Staatsrates, vor. Das Amt selber war (bis 1905) rechtlich nicht verankert [545]und die Stellung des Premiers daher eine schwankende, die vom Machtgefüge abhing. Phasenweise dominierten der König oder aber die Staatssekretäre das Kabinett und damit die Leitung der Regierungsgeschäfte. Vgl. Hatschek, Englisches Staatsrecht II (wie oben, S. 472, Anm. 58), S. 46–51.
[545]Nicht notwendig Abschwächung, sondern eventuell: eine Temperierung der Herrschaft im Sinn der Rationalisierung, bewirken beratende kollegiale Körperschaften neben monokratischen Herren. Aber sie können im Effekt [A 160]die Überhand über den Herren gewinnen. Insbesondere dann, wenn sie ständischen Charakters sind. – Hauptfälle:
e) Dem Fall d steht nahe der andre: daß eine formal nur beratende Körperschaft beigeordnet ist einem monokratischen, durch ihre Entscheidungen überhaupt nicht gebundenen Herren, der nur, durch Tradition oder Satzung, zur Einholung ihres – formal unverbindlichen – Rats verpflichtet ist, dessen Mißachtung im Fall des Mißerfolgs ihn verantwortlich macht.
Wichtigster Fall: Die Beiordnung des Senats als Beratungsinstanz der Magistrate, aus der sich faktisch dessen Herrschaft über die Magistrate entwickelte (durch die Kontrolle der Finanzen).
9
Das Primäre war wohl ungefähr die geschilderte Auffassung. Aus der (faktischen) Finanzkontrolle, noch mehr aber aus der ständischen Identität von Senatoren und (formal) gewählten Beamten entwickelte sich die tatsächliche Bindung der Magistrate an Senatsbeschlüsse: das „si eis placeret“, welches deren Unverbindlichkeit ausdrückte, hieß später soviel wie etwa unser „gefälligst“ bei dringenden Anweisungen. Max Weber bezieht sich auf römische Verhältnisse. Der Senat hatte ursprünglich nur ein Beratungs- und Bestätigungsrecht für die höchsten Amtsträger. Während der Republik entwickelte sich aus der „vorgängige[n] Einwilligung des Senats für den magistratischen Zahlungsbefehl“ das Verfügungsrecht des Senates über die Staatskasse und daraus „die Fesselung der Magistratur“. Vgl. Mommsen, Römisches Staatsrecht III,23 (wie oben, S. 509 f., Anm. 68), S. 1026 ff., Zitate: S. 1031, 1043.
10
Die Redewendung „si eis placeret“ (wenn es ihnen gefiele) ist im klassischen Latein nicht belegt. Vermutlich meint Weber aber die Formel „si eis videatur“ oder „videretur“ (wenn es ihnen richtig erscheinen werde/würde), mit der der Senat seine Beschlüsse in Form eines Ersuchens an den Magistrat zurückleitete, selbst wenn er damit einen Befehl aussprach (vgl. Mommsen, ebd., S. 1027 mit Anm. 2).
f) Wiederum etwas anders stellt sich der Fall: daß in einer Behörde spezifizierte Kollegialität besteht, d. h. die Vorbereitung und der Vortrag der einzelnen zur Kompetenz gehörigen Angelegenheiten Fachmännern – eventuell bei der gleichen Angele[546]genheit: verschiedenen – anvertraut ist, die Entscheidung aber durch Abstimmung der sämtlichen Beteiligten erfolgt.
In den meisten Staatsräten und staatsratsartigen Bildungen der Vergangenheit war dies mehr oder minder rein der Fall (so im englischen Staatsrat der Zeit vor der Kabinettsherrschaft).
11
Sie haben die Fürsten nie expropriiert, so groß ihre Macht zuweilen war. Im Gegenteil hat der Fürst unter Umständen versucht, auf den Staatsrat zurückzugreifen, um die Kabinetts-Regierung (der Parteiführer) abzuschütteln: so in England, vergeblich.[546] Der königliche Staatsrat als kollegialisches Gremium mit konkurrierenden Kompetenzen und Überzeugungen wurde unter Wilhelm III. (Kg. 1689–1702) in seiner Bedeutung durch den mit Parlamentariern besetzten Ministerrat (das erste Kabinett) abgelöst. Wilhelm Hasbach, Kabinettsregierung, S. 45, datiert dies auf das Jahr 1695, während man gemeinhin die Anfänge der Kabinettsregierung etwas unbestimmter auf den Beginn des 18. Jahrhunderts verlegt. Zum Staatsrat vgl. ebd., S. 38 ff.
12
Dagegen entspricht der Typus leidlich den Fachministerien des erbcharismatischen und des plebiszitär-gewaltenteilenden (amerikanischen) Typus, die vom Herren (König, Präsidenten) nach Ermessen ernannt werden, um ihn zu stützen. In den Jahren 1858, 1864 und 1903 gab es Versuche, Verwaltungstätigkeiten vom Kabinett an den Staatsrat (das Privy Council) zu verlagern. Dies scheiterte am Widerspruch des Parlaments, dem das Kabinett verantwortlich ist. Vgl. Hatschek, Englisches Staatsrecht II (wie oben, S. 472, Anm. 58), S. 154 f.
g) Die spezifizierte Kollegialität kann eine bloß beratende Körperschaft sein, deren Voten und Gegenvoten dem Herren zur freien Entschließung vorgelegt werden (wie in lit. c).
13
Gemeint ist Buchstabe e), oben, S. 545, und nicht c).
Der Unterschied ist dann nur: daß hier die Leistungsspezifikation am grundsätzlichsten
q
durchgeführt ist. Der Fall entspricht etwa der preußischen Praxis unter Friedrich Wilhelm I.[546]A: grundsächlichsten
14
Stets stützt dieser Zustand die Herrenmacht. Unter Friedrich Wilhelm I. waren die Regierungsaufgaben auf ein General-Finanz-Direktorium, ein Justiz- und ein Auswärtiges Departement aufgeteilt. Der König nahm nicht an den Beratungen der Ressortchefs teil, sondern ließ sich durch Boten oder Schriftstücke unterrichten, um dann seine Entscheidung zu treffen. Der zuständige Minister hatte daraufhin die Verordnungen des Königs gegenzuzeichnen. Vgl. dazu auch Weber, Bürokratismus, MWG I/22-4, S. 223.
h) Der rational spezifizierten Kollegialität steht am schärfsten gegenüber die traditionale Kollegialität von „Ältesten“, deren kollegiale Erörterung als Garantie der Ermittelung des wirklich [547]traditionalen Rechts angesehen wird, und eventuell: als Mittel der Erhaltung der Tradition gegen traditionswidrige Satzungen durch Kassation dient.
Beispiele: viele der „Gerusien“ der Antike,
15
für die Kassation: der Areopag in Athen,[547] Gerusien bezeichnen die Ältestenräte, vor allem im dorischen Gebiet und Sparta. Sie hatten u. a. das Recht, Gesetzesvorlagen für die Volksversammlung zu erstellen und bestimmte Volksbeschlüsse zu annullieren (Plutarch, Lykurg 6).
16
die „patres“ in Rom (allerdings primär dem Typus 1 – s. unten Der Areopag war ursprünglich die oberste Aufsichtsbehörde in Athen, die über Recht, Sitte und Verwaltung wachte. Spätestens seit den kleisthenischen Reformen (508/7 v. Chr.) reduzierte sich seine Bedeutung auf die Kassation von Beschlüssen der Volksversammlung, insbesondere wenn diese gegen das göttliche Gesetz verstießen. Entmachtet wurde der Areopag endgültig durch Ephialtes (462/1 v. Chr.) und Perikies (458–450 v. Chr.). Vgl. Weber, Agrarverhältnisse3, MWG I/6, S. 500.
17
– zugehörig) Unten, S. 551 f., Buchstabe l); dort aber nicht ausgeführt. Die ursprüngliche Gliederung des Senats dürfte – wie Mommsen, Römisches Staatsrecht III,23 (wie oben, S. 509 f., Anm. 68), S. 844 f., annimmt – auf „decuria“ (Zehnmännerschaft) zurückgehen (10 x 10 = 100 Senatoren bzw. patres), insofern könnte es sich um ein Beispiel der Verschmelzungskollegialität handeln.
r
. [547]A: unten) zugehörig
i) Eine Abschwächung der Herrschaft kann durch Anwendung des Kollegialprinzips auf die (sei es formal, sei es material) höchsten (ausschlaggebenden) Instanzen (den Herrn selbst) unternommen werden. Der Fall liegt in seiner Kasuistik durchaus gleichartig den von d bis g besprochenen. Die einzelnen Zuständigkeiten können a) im Turnus wechseln, oder b) dauernde „Ressorts“ einzelner bilden. Die Kollegialität besteht so lange, als die (formale) Mitwirkung aller zu legitimen Verfügungen erforderlich ist.
[A 161]Wichtigste Beispiele: der Schweizer Bundesrat mit seiner nicht eindeutigen Ressortverteilung und dem Turnus-Prinzip;
18
die revolutionären Kollegien der „Volksbeauftragten“ in Rußland, Ungarn, zeitweise Deutsch[548]land, Der Schweizer Bundesrat besteht aus sieben Mitgliedern. Die Geschäfte werden „nach Departementen unter die einzelnen Mitglieder verteilt“, die Entscheidung fällt aber der Bundesrat als kollegiale Behörde (Art. 103 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 29. Mai 1874). Der Vorsitzende (zugleich der Bundespräsident) wird jährlich aus dem Kreis der Bundesratsmitglieder gewählt (Art. 98 ebd.), der Wechsel findet turnusmäßig statt. Üblich war (bis 1918) auch ein Departementswechsel nach dem Rotationsprinzip, der aber verfassungsmäßig nicht vorgeschrieben war und daher auch ausgesetzt werden konnte. Vgl. auch Weber, Deutschlands künftige Staatsform, MWG I/16, S. 132 mit Hg.-Anm. 9.
19
aus der Vergangenheit: der Venezianer „Rat der Elf“,[548] Vorbild für das Funktionieren von revolutionären Kollegien war der „Rat der Volkskommissare“ in Rußland, der per Dekret am 27.10. (8./9.11.) 1917 eingeführt worden war und bis 1946 bestand. Die Verfassung der Russischen Föderativen Räterepublik vom 10. Juli 1918 sah 18 Volkskommissariate (Ministerien) vor, an deren Spitze jeweils ein Volkskommissar und ein Kollegium standen. Letztlich bestand eine kollektive Verantwortlichkeit der einzelnen Volkskommissare mit ihren Kollegien gegenüber dem Rat der Volkskommissare, so wie dieser wiederum als Ganzes gegenüber dem Zentralen Exekutivausschuß und dem Rätekongreß verantwortlich war. Vgl. Struthahn, Arnold [= Ps. für Karl Radek], Verfassung der Russischen Sozialistischen Föderativen Räte-Republik. – Zürich: Union Verlag 1918, S. 33 f. (= Abschnitte 42–46 der Verfassung). – In Ungarn regierten die Volkskommissare der Räterepublik unter Béla Kun vom 21. März bis 1. August 1919. – In Deutschland war der „Rat der Volksbeauftragten“ die am 10. November 1918 von den Berliner Arbeiter- und Soldatenräten bestätigte Regierung unter dem Vorsitz von Friedrich Ebert und Hugo Haase (nur bis zum 29. Dezember 1918). Mit der Konstituierung der Weimarer Nationalversammlung am 10. Februar 1919 trat der Rat zurück. In den deutschen Einzelstaaten bestanden die letzten Räteregierungen noch bis Mitte 1919.
20
die Kollegien der Anzianen Ein „Rat der Elf“ ist in der Literatur nicht belegt, allerdings scheint es sich auch nicht um eine Verwechslung mit dem späteren (1310 eingesetzten) „Rat der Zehn“ zu handeln (vgl. unten, S. 554, Anm. 40), da Weber den „Rat der Elf“ auch in der Vorlesung „Allgemeine Staatslehre und Politik (Staatssoziologie)“ erwähnt (vgl. Weber, Staatssoziologie, MWG III/7, S. 110). Walter Lenel, auf den sich Weber in seiner „Stadt“-Studie stützt (Weber, Die Stadt, MWG I/22-5, S. 152 ff.), legt nahe, daß ein elfköpfiges, adeliges Wahlmännergremium bei der Dogenwahl 1172 mit dem „Rat der sapientes“ identisch gewesen sein könnte (Zitat: ebd.; vgl. auch Lenel, Walter, Die Entstehung der Vorherrschaft Venedigs an der Adria mit Beiträgen zur Verfassungsgeschichte. – Straßburg: Karl J. Trübner 1897, S. 107 ff.; ähnlich Kretschmayr, Heinrich, Geschichte von Venedig, Band 1. – Gotha: F. A. Perthes 1905, S. 324 f. und 340 f.). Die sapientes waren durch die Stadtbezirke bestimmte Patrizier, die im 12. Jahrhundert zu ständigen Beratern des Dogen auf allen Verwaltungsgebieten wurden und an dessen Entscheidungen mitwirkten oder diese zumindest bezeugten. Das Kollegium begrenzte sowohl die Macht des Dogen als auch die des popolo.
21
usw. Die Kollegien der Anzianen (eigentlich: Ältestenräte) waren die Vertreter des popolo in den oberitalienischen Stadtkommunen. Sie wurden in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts als Kontrollbehörde gegen die überhandnehmende Macht des podestà (des höchsten Amtsträgers der Kommunen) eingeführt. Diese These vertrat Salzer, Ernst, Über die Anfänge der Signorie in Oberitalien. Ein Beitrag zur italienischen Verfassungsgeschichte. – Berlin: E. Ebering 1900, S. 84–87.
Sehr viele Fälle der Kollegialität innerhalb patrimonialer oder feudaler Herrschaftsverbände sind entweder
α. Fälle ständischer Gewaltenteilung (Kollegialität des ständischen Verwaltungsstabs oder der ständisch Appropriierten), – oder
[549]ß. Fälle der Schaffung von mit dem Herren gegen die vergesellschafteten ständischen Gewalthaber solidarischen kollegialen Vertretungen des patrimonialen Beamtentums (Staatsräte; Fall f oben);
22
[549]Oben, S. 545 f., Punkt f).
γ. Fälle der Schaffung von beratenden und unter Umständen beschließenden Körperschaften, denen der Herr präsidiert oder beiwohnt oder über deren Verhandlungen und Voten er unterrichtet wird und durch deren Zusammensetzung teils
αα) aus fachmäßigen Kennern, teils
ßß) aus Personen mit einem spezifischen ständischen Prestige er hoffen kann, seine – gegenüber den steigenden Fachanforderungen – zunehmend nur noch dilettantische Informiertheit soweit zu vervollkommnen, daß ihm eine begründete eigne Entscheidung möglich bleibt (Fall g oben).
23
Oben, S. 546, Punkt g).
In den Fällen γ legt der Herr naturgemäß Gewicht auf Vertretung möglichst heterogener und eventuell entgegengesetzter
αα) Fachmeinungen und
ßß) Interessen, um
1. allseitig informiert zu sein, –
2. die Gegensätze gegeneinander ausspielen zu können.
Im Fall ß legt der Herr umgekehrt oft (nicht: immer) Gewicht auf Geschlossenheit der Meinungen und Stellungnahmen (Quelle der „solidarischen“ Ministerien und Kabinette in den sog. „konstitutionellen“ oder anderen effektiv gewaltenteilenden Staaten).
Im Fall α wird das Kollegium, welches die Appropriation vertritt, Gewicht auf Einhelligkeit der Meinungen und Solidarität legen, sie aber nicht immer erzielen können, da jede Appropriation durch ständisches Privileg kollidierende Sonderinteressen schafft.
Für α sind die Ständeversammlungen, ständischen Ausschüsse und die ihnen vorangehenden auch außerhalb des Okzidents häufigen Vasallenversammlungen (China)
24
typisch. Für ß die ersten, durchweg kollegialen, [550]Behörden der entstehenden modernen Monarchie, zusammengesetzt vor allem (aber nicht nur) aus Juristen und Finanzexperten. Für γ die Staatsräte zahlreicher fremderVasallenversammlungen sind für die chinesische Teilstaatenperiode (858–225 v. Chr.) belegt. Max Weber erwähnte bereits oben (S. 518 mit Hg.-Anm. 17) das „Fürsten[550]kartell“ von 650 v. Chr. und bezog sich in seiner Konfuzianismus-Studie auf weitere Fürstenversammlungen, wie z. B. eine sog. Friedenskonferenz der Vasallen im Jahre 546 v. Chr. Vgl. Weber, Konfuzianismus, MWG I/19, S. 189–191, dort mit Nachweisen.
s
und der entstehenden modernen okzidentalen Monarchie (noch im 18. Jahrh. hatte gelegentlich ein Erzbischof Sitz im englischen „Kabinett“) mit ihren „Räten von Haus aus“[550]Zu ergänzen wäre: Monarchien
25
und ihrer Mischung von Honoratioren und Fachbeamten. „Räte von Haus aus“ waren hochgestellte Personen, die vom Fürsten zu besonderen Verwaltungs- oder Kriegsdiensten nach Bedarf herangezogen werden konnten, aber zu Hause wohnten (vgl. Weber, Bürokratismus, MWG I/22-4, S. 221 mit Hg.-Anm. 26). Unter Georg II. (König 1727–60) nahm der Erzbischof von Canterbury noch gelegentlich an den Kabinettssitzungen („Cabinet Councils“) teil, obwohl er kein Ministeramt bekleidete. Wilhelm Hasbach, Kabinettsregierung, S. 39, 74, vermutet, daß sich dessen Teilnahme aus der Zusammensetzung des mittelalterlichen Staatsrates herleiten läßt.
Jener Umstand des Gegensatzes der ständischen Interessen gegeneinander kann dem Herren beim Feilschen und Ringen mit den Ständen Vorteile schaffen. Denn
k) als „kollegial“ kann man – der äußeren Form wegen – auch Vergesellschaftungen bezeichnen, welche die Vertreter als Delegierte von untereinander kollidierenden ideellen oder Macht- oder materiellen Interessen zusammenschließen sollen, um eine Schlichtung der Interessengegensätze durch Kompromiß zu erreichen (Kompromiß-Kollegialität im Gegensatz zur Amts- und zur parlamentarischen Abstimmungs-Kollegialität).
Der Fall liegt in grober Form in der „ständischen“ Gewaltenteilung vor, welche stets nur durch Kompromiß der Privilegierten zu Entscheidungen gelangte (siehe bald).
26
In rationalisierter Form ist er möglich durch Auslese der Delegierten nach dauernder ständischer oder Klassenlage (s. Kap. IV) Der Bezug ist unklar. Angesprochen wird das Thema unten, S. 553, dort aber wiederum mit einem nicht eingelösten Verweis versehen (unten, S. 553 mit Hg.-Anm. 38). Die „ständische Gewaltenteilung“ wurde bereits in § 9, oben, S. 484 f., behandelt.
27
oder aktuellem Interessengegen[A 162]satz. „Abstimmung“ kann in einer [551]solchen Körperschaft – solange sie diesen Charakter hat – keine Rolle spielen, sondern entweder Kap. IV, §§ 1 und 3, unten, S. 592 ff. und 598.
α. paktiertes Kompromiß der Interessenten oder
ß. vom Herren oktroyiertes Kompromiß nach Anhörung der Stellungnahme der verschiedenen Interessentenparteien.
Über die eigenartige Struktur des sog. „Ständestaats“ später Näheres
t
.[551]A: näheres
28
Die Trennung der Kurien („Lords“ und „Gemeine“: die Kirche hatte ihre gesonderten „convocations“ – in England;[551]Der Bezug ist unklar. Entsprechende Ausführungen zum „Ständestaat“ finden sich lediglich in der älteren Fassung von „Wirtschaft und Gesellschaft“ (vgl. Weber, Feudalismus, MWG I/22-4, S. 411–413). Möglicherweise wäre eine Neubehandlung im Rahmen der angekündigten „Staatssoziologie“ erfolgt.
29
Adel, Geistliche, tiers état in Frankreich; die zahlreichen Gliederungen deutscher Stände) und die Notwendigkeit, durch Kompromiß, zunächst innerhalb des einzelnen Standes, dann zwischen den Ständen, zu Entschließungen zu gelangen (die der Herr oft als unverbindliche Vorschläge behandelte) gehören hierher. An der jetzt wieder sehr modernen Theorie der „berufsständischen Vertretung“ (s. bald)„convocations“ waren die seit dem 13. Jahrhundert nachweislichen Standesvertretungen des englischen Klerus, die eine eigene „geistliche Gesetzgebung, Steuerbewilligung und Gerichtsbarkeit“ ausübten. Analog zum weltlichen Parlament unterteilte sich die convocation von Canterbury im 15. Jahrhundert in ein Ober- und Unterhaus. Obwohl die convocations bereits 1717 faktisch entmachtet waren, bestanden sie noch bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts fort. Vgl. Gneist, Rudolf, Geschichte des Selfgovernment in England oder die innere Entwicklung der Parlamentsverfassung bis zum Ende des achtzehnten Jahrhunderts. – Berlin: Julius Springer 1863, S. 204 (Zitat), und ders., Englische Verfassungsgeschichte, ebd. 1882, S. 498.
30
ist zu tadeln: daß meist die Einsicht fehlt: daß hier Kompromisse, nicht Überstimmungen, das allein adäquate Mittel sind. Innerhalb freier Arbeiter-Räte würden sich die Angelegenheiten materiell als ökonomisch bedingte Macht-, nicht als Abstimmungsfragen erledigen. Kap. III, § 22, unten, S. 587–591.
l) Endlich gibt es – ein damit verwandter Fall – Abstimmungskollegialität in Fällen, wo mehrere bisher autokephale und autonome Verbände sich zu einem neuen Verband vergesellschaften und dabei ein (irgendwie abgestuftes) Einflußrecht auf Entscheidungen durch Appropriation von Stimmen auf ihre Leiter oder deren Delegierte
u
erreichen (Verschmelzungs-Kollegialität). A: Delegierten
[552]Beispiele: die Vertretungen der Phylen, Phratrien und Geschlechter in der antiken Ratsbehörde,
31
der mittelalterliche Geschlechterverband in der Zeit der consules,[552] Bei der Gründung und Organisation der Polis wurden die aus vorgeschichtlicher Zeit stammenden Verbände berücksichtigt. Dies waren – der Größe nach geordnet – die Phylen (Stämme), Phratrien (kultische Bruderschaften, die ursprünglich wohl auf Abstammungsgemeinschaft beruhten) und die Genoi (Sippen, Geschlechter). In den Gremien der Polis waren sie – oft nach einem festgelegten Zahlenschlüssel – vertreten.
32
die Mercadanza der Zünfte, Die „consules“ bildeten seit Ende des 11. Jahrhunderts die Regierung in den oberitalienischen Stadtkommunen, die durch Zusammenschluß der Stände (zumeist: Capitanei, Valvassoren, Bürger) entstanden waren. In der Anfangszeit wurden die consules nach Ständen getrennt in den städtischen Rat gewählt. Vgl. Weber, Die Stadt, MWG I/22-5, S. 129 f., gestützt auf Hegel, Karl von, Geschichte der Städteverfassung von Italien seit der römischen Herrschaft bis zum Ausgang des XII. Jahrhunderts, Band 2. – Leipzig: B.G. Teubner 1847, S. 161 ff.
33
die Delegierten der „Fachräte“ in einen Zentralrat der Arbeiterschaft, Die Mercadanza war, so eine These von Ernst Salzer, in den mittel- und oberitalienischen Städten nicht nur eine Kaufmannsinnung, sondern ein Zusammenschluß aller Handels- und Gewerbetreibenden zu einer Gesamtorganisation, die seit dem ausgehenden 12. Jahrhundert eine wichtige Rolle im Emanzipationskampf des popolo spielte. Max Weber schließt sich hier durch die Wortwahl „Mercadanza der Zünfte“ der These von Salzer an (explizit auch in: Weber, Die Stadt, MWG I/22-5, S. 207 mit Hg.-Anm. 27; vgl. Salzer, Ernst, Über die Anfänge der Signorie in Oberitalien. Ein Beitrag zur italienischen Verfassungsgeschichte. – Berlin: E. Eberling 1900, bes. S. 97 ff., Anm. 23).
34
der „Bundesrat“ oder Senat in Bundesstaaten, die (effektiveVermutlich eine Anspielung auf die während der Revolutionszeit 1918 gebildeten nationalen und regionalen Zentralräte, die sich aus Delegierten der einzelnen und lokalen Arbeiter- und Soldatenräte zusammensetzten. In Baden und Bayern wurden vielfach auch weitere Berufsgruppen („Fachräte“) an den Arbeiter- und Soldatenräten beteiligt, aber in ihrer Zahl beschränkt. Auf Reichsebene war der Zentralrat das von den Rätekongressen gewählte Gremium, das vom Dezember 1918 bis zum Mai 1920 bestand.
v
Kollegialität bei Koalitionsministerien oder Koalitionsregierungskollegien (Maximum: bei Bestellung nach dem Proporz: Schweiz).[552]A: (éffektive
35
Zum Proporz in der Schweiz vgl. unten, S. 557 mit Hg.-Anm. 52.
m) Einen Sondercharakter hat die Abstimmungskollegialität gewählter parlamentarischer Repräsentanten, von der daher gesondert zu handeln sein wird.
36
Denn sie ruht auf entweder Der Bezug ist unklar. Die freie Repräsentation in modernen Parlamenten wird in Kap. III, § 21, Punkt 4), unten, S. 581 ff., behandelt. Denkbar ist auch, daß Weber hier die Zuweisung in die angekündigte „Staatssoziologie“ vor Augen hat.
α. Führerschaft und ist dann Gefolgschaft, oder
[553]ß. auf parteikollegialer Geschäftsführung, und ist dann „führerloser Parlamentarismus“.
Dazu aber ist Erörterung der Parteien notwendig.
37
[553]Kap. III, § 18, unten, S. 566–573.
Kollegialität – außer im Fall der monokratischen Kassationskollegialität – bedeutet, fast unvermeidlich, eine Hemmung präziser und eindeutiger, vor allem schneller Entschließungen (in ihren irrationalen Formen auch: der Fachgeschultheit). Eben diese Wirkung war aber dem Fürsten bei Einführung des Fachbeamtentums meist nicht unerwünscht. Aber eben dies hat sie zunehmend zurückgedrängt, je schneller das notwendige Tempo der Entschließungen und des Handelns wurde. Innerhalb der kollegialen leitenden Instanzen stieg im allgemeinen die Machtstellung des leitenden Mitgliedes zu einer formell und materiell präeminenten (Bischof, Papst in der Kirche, Ministerpräsident im Kabinett). Das Interesse an Wiederbelebung der Kollegialität der Leitung entspringt meist einem Bedürfnis nach Schwächung des Herrschers als solchen. Dann dem Mißtrauen und Ressentiment, weniger der Beherrschten: – die meist nach dem „Führer“ geradezu rufen, – als der Glieder des Verwaltungsstabs gegen die monokratische Führung. Dies gilt aber durchaus nicht nur und nicht einmal vorzugsweise von negativ privilegierten, sondern gerade auch von positiv privilegierten Schichten. Kollegialität ist durchaus nichts spezifisch „Demokratisches“. Wo privilegierte Schichten sich gegen die Bedrohung durch die negativ Privilegierten zu sichern hatten, haben sie stets darnach getrachtet und darnach trachten müssen, keine monokratische Herrengewalt aufkommen zu lassen, welche sich auf jene Schichten hätte stützen können, [A 163]also, neben strengster Gleichheit der Privilegierten (davon gesondert im folgenden §),
38
kollegiale Behörden als Überwachungs- und allein beschließende Behörden geschaffen und aufrechterhalten. Der Bezug ist unklar. Im folgenden § 16, unten, S. 562–564, wird das Thema (strengste Gleichheit der Privilegierten) nicht behandelt. Denkbar wäre auch, daß Weber sich auf das folgende Kap. IV bezieht.
[554]Typen: Sparta,
39
Venedig,[554]In Sparta war dies der Ältestenrat (Gerusia), der sich – so Plutarch, Lykurg 5 – aus den beiden Königen und 28 Geronten zusammensetzte und eine kontrollierend-beratende Funktion gegenüber den Königen einerseits und der Volksversammlung andererseits hatte.
40
der vorgracchische und sullanische Senat in Rom,Zu einer Überwachungs- und nahezu allmächtigen Behörde entwickelte sich der 1310 als außerordentlicher Gerichtshof gegründete „Rat der Zehn“. Vgl. dazu Weber, Die Stadt, MWG I/22-5, S. 156 mit Hg.-Anm. 4, dort mit den entsprechenden Nachweisen.
41
England wiederholt im 18. Jahrhundert,Der Zugang zum römischen Senat war ständisch reguliert. Dies wurde von C. Gracchus durchbrochen, indem der sog. Ritterstand, „die ökonomisch interessierte Bourgeoisie“, größere Mitwirkungsrechte erhielt. Sulla beschränkte 81 v. Chr. den Zugang zum Senat wieder auf die alten senatorischen Geschlechter. Vgl. Weber, Agrarverhältnisse3, MWG I/6, S. 672 (Zitat), sowie Mommsen, Römisches Staatsrecht (wie oben, S. 509 f., Anm. 68), Band III, 13, S. 529 ff. und Band III,23, S. 847 und 897.
42
Bern und andre Schweizer-Kantone,Unter den Hannoverschen Königen erhielt das Kabinett als innerer Ausschuß des Geheimen Staatsrates eine große Machtfülle, da Georg I. und II. (Kge. 1714–27 bzw. 1727–60) kaum oder nicht an den Sitzungen teilnahmen. Das Kabinett, dem nur die wichtigsten Minister angehörten, bestimmte die Regierungspolitik als kollegialisches Gremium. Vgl. Maitland, Frederick W., The Constitutional History of England. A Course of Lectures Delivered. – Cambridge: University Press 1908, S. 395, und Hasbach, Kabinettsregierung, S. 74 f.
43
die mittelalterlichen Geschlechterstädte mit ihren kollegialen Konsuln,Bern, Freiburg, Luzern und Solothurn hatten bis 1798 patrizische Stadtverfassungen und kehrten nach der französischen Herrschaft zu diesen zurück. Die sog. regimentsfähigen Geschlechter bildeten in Bern – verbunden mit einer rigorosen Abschließungspolitik – den Großen Rat der Stadt, aus dem auch die eigentliche Regierungsbehörde, der Kleine Rat, gebildet wurde. Vgl. Heusler, Andreas, Schweizerische Verfassungsgeschichte. – Basel: Frobenius 1920, S. 269 ff. und 337 ff.
44
die Mercadanza, welche die Händler-, nicht die Arbeiter-Zünfte umfaßte: diese letzteren wurden sehr leicht die Beute von Nobili oder Signoren.„consules“, jährlich gewählte Beamte der civitas, bildeten seit Ende des 11. Jahrhunderts in den italienischen Stadtkommunen die Magistratskollegien. Sie „rissen“ die Gerichtsgewalt, den Oberbefehl an sich und „verwalteten alle Angelegenheiten der Kommune“. Vgl. Weber, Die Stadt, MWG I/22-5, S. 129 f., Zitat: S. 130.
45
Die Entwicklung der Mercadanza, ursprünglich ein Zusammenschluß aller Handels- und Gewerbetreibenden, zu einer ausschließlichen Vertretung der Großkaufleute fällt vermutlich ins 14. Jahrhundert (vgl. Salzer, Signorie (wie oben, S. 535, Anm. 65), S. 97 ff., Anm. 23). Parallel dazu kämpften die niederen Zünfte der kleinen Handwerker und Gewerbetreibenden (arti minori) um ihre politische Anerkennung und Rechte, wobei sie entweder von den alten Stadtadelsgeschlechtern oder den erblich gewordenen Stadtregenten instrumentalisiert wurden (vgl. dazu auch Weber, Die Stadt, MWG I/22-5, S. 205 f.).
[555]Die Kollegialität gewährleistet größere „Gründlichkeit“ der Erwägungen der Verwaltung. Wo diese auf Kosten der Präzision und Schnelligkeit bevorzugt werden soll, pflegt – neben den oben erwähnten Motiven – noch heute auf sie zurückgegriffen zu werden. Immerhin teilt sie die Verantwortlichkeit, und bei größeren Gremien schwindet diese gänzlich, während Monokratie sie deutlich und unbezweifelbar festlegt. Große und schnell einheitlich zu lösende Aufgaben werden im ganzen (und rein technisch wohl mit Grund) in die Hand monokratischer, mit der Alleinverantwortung belasteter „Diktatoren“ gelegt.
Weder eine kraftvolle einheitliche äußere noch innere Politik von Massenstaaten ist effektiv kollegial zu leiten. Die „Diktatur des Proletariats“ zum Zwecke der Sozialisierung insbesondere erforderte eben den vom Vertrauen der Massen getragenen „Diktator“.
46
Eben diesen aber können und wollen – nicht etwa: die „Massen“, sondern: – die massenhaften parlamentarischen, parteimäßigen, oder (was nicht den geringsten Unterschied macht) in den „Räten“ herrschenden Gewalthaber nicht ertragen. Nur in Rußland ist er durch Militärmacht entstanden und durch das Solidaritätsinteresse der neu appropriierten Bauern gestützt.[555]Im Rückgriff auf Marx und Engels begründete Lenin bereits im Sommer 1917 die Idee einer „Diktatur des Proletariats“ als Vorstufe einer kommunistischen Gesellschaft. Vgl. Lenin, Staat und Revolution. Die Lehre des Marxismus vom Staat und die Aufgaben des Proletariats in der Revolution. – Belp-Bern: Promachos 1918, bes. S. 131 ff. Den direkten Bezug zu Lenin stellt Weber, Staatssoziologie, MWG III/7, S. 109, her. Zu seiner Rolle als „Diktator“ vgl. die folgende Anmerkung.
47
Der Sieg der Bolschewisten (und damit Lenins) gelang durch die unter Trotzki stehenden Truppeneinheiten am 25. Oktober (7.11.) 1917 in der Hauptstadt St. Petersburg. Die Bauern wurden durch ein Dekret vom 27. Oktober (8/9.11.) 1917 gewonnen, in dem die entschädigungslose Enteignung von Privatland angeordnet und das Land den Kreis-Landkomitees und Bezirksowjets der Bauerndeputierten unterstellt wurde. Am selben Tag wurde Lenin zum Vorsitzenden des neu errichteten „Rats der Volkskommissare“ gewählt, dem ab März 1918 nur noch Bolschewisten angehörten.
Es seien nachstehend noch einige, das Gesagte teils zusammenfassende, teils ergänzende Bemerkungen angefügt:
Kollegialität hat historisch doppelten Sinn gehabt:
a) mehrfache Besetzung des gleichen Amtes oder mehrere direkt in der Kompetenz miteinander konkurrierende Ämter nebeneinander, mit gegenseitigem Vetorecht. Es handelt sich dann um technische Gewaltenteilung zum Zweck der Minimisierung der Herrschaft. Diesen Sinn hatte die „Kollegialität“ vor allem in der römischen Magistratur, deren wichtigster Sinn die Ermöglichung der jedem Amtsakt fremden Interzession der par pote[556]stas war,
48
um dadurch die Herrschaft des Einzelmagistrates zu schwächen. Aber jeder Einzelmagistrat blieb dabei Einzelmagistrat, in mehreren Exemplaren. [556]Das Interzessionsrecht der „par potestas“ umschreibt im republikanischen Rom das Recht des einen Kollegen gegen Amtshandlungen des anderen einzuschreiten (intercedere) und diese ggf. auch zu kassieren. Das Recht galt unter Kollegen der gleichen Gewalt, also von Consul zu Consul oder von Censor zu Censor usw. Weber folgt hier Mommsen, Römisches Staatsrecht I3 (wie oben, S. 509 f., Anm. 68), S. 258 f. und 268 f. Die höchsten Ämter waren jeweils mit mindestens zwei gleichgestellten Kollegen mit gleichgeordneten Kompetenzen besetzt.
b) kollegiale Willensbildung: legitimes Zustandekommen eines Befehls nur durch Zusammenwirken mehrerer, entweder nach dem Einstimmigkeits- oder nach dem Mehrheitsprinzip. Dies ist der moderne, in der Antike nicht unbekannte, aber ihr weniger
a
charakteristische, Kollegialitätsbegriff. – Diese Art der Kollegialität kann entweder 1. Kollegialität der höchsten Leitung, also der Herrschaft selbst, sein, oder 2. Kollegialität ausführender oder 3. Kollegialität beratender Behörden. [556]A: wieder
1. Kollegialität der Leitung kann ihre Gründe haben:
α. darin, daß der betreffende Herrschaftsverband auf Vergemeinschaftung oder Vergesellschaftung mehrerer autokephaler Herrschaftsverbände beruht und alle sich Vergesellschaftenden Machtanteil verlangen (antiker Synoikismus mit der nach Sippen, Phratrien, Phylen gegliederten kollegialen Ratsbehörde;
49
– mittelalterlicher Verband der Geschlechter mit dem repartierten Geschlechterrat;Bei der Zusammensiedlung (Synoikismus), d. h. Gründung der Polis, wurden die bereits vorher vorhandenen Verbände (erläutert oben, S. 552, Anm. 31) bei der Zusammensetzung der Räte berücksichtigt. In Athen war z. B. in vorsolonischer Zeit der Rat im Prytaneion (Rathaus) aus den vier Phylenkönigen und den Vorstehern der 48 Naukarien, die Unterabteilungen der Phylen waren, zusammengesetzt. Vgl. Meyer, Geschichte des Alterthums II1 (wie oben, S. 525, Anm. 37), S. 352 f.
50
– mittelalterlicher Verband der Zünfte in der Mercadanza mit dem Rat der Anzianen oder Zunftdeputierten;Die Zuteilung der Ratsstellen durch die Geschlechter fand sich insbesondere in Venedig. Vgl. Weber, Die Stadt, MWG I/22-5, S. 154 f.
51
– „Bundesrat“ in modernen Bundesstaaten; – effektive Kollegialität bei Ministerien oder höchsten Regierungskollegien, die von Parteikoalitionen [557]gestellt werden (Maximum: bei Repartition der Macht nach dem Proporz, wie zunehmendWeber deutet hier die Mercadanza als die politische Sonderorganisation des popolo, die in der zeitgenössischen Literatur auch als Volksrat beschrieben wurde (vgl. Weber, Die Stadt, MWG I/22-5, S. 201). Ein Zusammenwirken der Vertreter des popolo (Zünfte, Rat der Anzianen und Volkskapitan) ist z. B. in Verona im ausgehenden 13. Jahrhundert belegt (vgl. Salzer, Signorie (wie oben, S. 535, Anm. 65), S. 124–126). Der Rat der Anzianen (antiani populi) setzte sich in der Regel aus acht bis zwölf Mitgliedern zusammen, die von den Zünften und den lokal abgegrenzten Quartieren oder Waffengenossenschaften für kurze Amtszeiten gewählt wurden. Sie vertraten die Interessen der Popularen gegenüber der Kommune. Vgl. Salzer, ebd., S. 146 ff.
b
in der Schweiz)[557]b-b (S. 568, bis: Führer) oder) Zu dieser Textpassage sind Korrekturfahnen überliefert; vgl. dazu den Anhang, unten, S. 710–718.
52
–. Die Kollegialität ist dann ein besonderer Fall des ständischen oder kantonalen Repräsentationsprinzips)[557]Mit Josef Zemp (1834–1908) wurde 1891 erstmals ein Vertreter der Katholisch-Konservativen in den Bundesrat gewählt. Durch einen „freiwilligen Proporz“ beteiligte seitdem die Mehrheitspartei die Oppositionsparteien an der Regierung. Dies auch in einzelnen Kantonen, vgl. dazu Weber, Politik als Beruf, MWG I/17, S. 174 f. mit Hg.-Anm. 18.
c
. – Oder Klammer fehlt in A.
ß. in dem Fehlen eines Führers zufolge: Eifersucht der um die Führerschaft Konkurrierenden oder: Streben der Beherrschten nach Minimisierung der Herrschaft einzelner. Aus einer Mischung dieser Gründe ist sie in den meisten Revolutionen aufgetreten, sowohl als „Rat“ der Offiziere
53
oder auch der Soldaten revoltierender Truppen, wie als Wohlfahrtsausschuß oder Ausschuß von „Volksbeauftragten“.Einen politisch agierenden Offiziersrat gab es beispielsweise während der englischen Revolution unter der Führung von John Lambert (1619–1684).
54
In der normalen Friedensverwaltung hat fast immer das letztgenannte Motiv: die Abneigung gegen den einzelnen „starken Mann“, für die Kollegialität leitender Be[A 164]hörden entschieden: so in der SchweizWährend der (Räte)Revolutionen 1917–19 bildeten die Arbeiter- und Soldatenräte eine Vielzahl von Ausschüssen, von denen zumeist einer als oberstes Regierungs-, Verwaltungs- und Kontrollorgan fungierte. In der Sowjetrepublik hieß er „Zentraler Exekutiv-Ausschuß“, in Deutschland „Rat der Volksbeauftragten“, in Bremen „Aktionsausschuß“.
55
und z. B. in der neuen badischen Verfassung.Die Schweizer Verfassung kennt keinen Staatspräsidenten mit selbständigen staatsrechtlichen Kompetenzen. Die oberste Behörde ist der Bundesrat, aus dessen Kreis jährlich ein Vorsitzender (Bundespräsident) gewählt wird. Vgl. dazu oben, S. 547 mit Hg.-Anm. 18.
56
(Träger dieser Abneigung waren diesmal die Sozialisten, welche die für die Sozialisierung unbedingt erforderliche straffe Einheitlichkeit der Verwaltung aus Besorgnis vor dem „Wahlmonarchen“ opferten.Die Badische Verfassung vom 21. März 1919 verfügte in § 55: „Die Mitglieder des Staatsministeriums beraten und entscheiden in kollegialer Form mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt der Staatspräsident den Ausschlag. Er leitet die Verhandlungen und vertritt das Staatsministerium nach außen.“ Der Staatspräsident wurde alljährlich vom Landtag aus dem Kreis der Minister bestimmt (§ 52). Vgl. Die Badische Verfassung vom 21. März 1919. Mit einer Vorgeschichte und Anmerkungen versehen von Johann A. Zehnter. – Mannheim u. a.: J. Bensheimer 1919, S. 114 f. und 116 (Zitat).
57
Dafür war insbesondere die führerfeindliche Empfindungs[558]weise des (Gewerkschafts-, Partei-, Stadtkreis-)Beamtentums in der Partei maßgebend). – Oder Der Verfassungsentwurf wurde von dem sozialdemokratischen Karlsruher Stadtrat Eduard Dietz (1866–1940) geprägt. Er sah kein eigenständiges Staatsoberhaupt vor. [558]Mit Entschiedenheit lehnte Dietz einen plebiszitär zu wählenden Staatspräsidenten ab, denn dies könne den „Boden für bonapartistische und zäsaristische Staatsstreiche“ ebnen und die Volksvertretung entmachten (vgl. Dietz, Eduard, Entwurf einer neuen badischen Verfassung. Sonderabdruck aus dem Karlsruher „Volksfreund“. – Karlsruhe: Geck & Cie 1919, S. 85). Ähnlich äußerte er sich vor dem Parlament, man würde dadurch nur einen gewählten Großherzog installieren (Redebeitrag Dietz, in: Amtliche Berichte über die Verhandlungen der verfassunggebenden badischen National-Versammlung, Karlsruhe, Nr. 12 vom 28. März 1919, Sp. 454).
γ. in dem ständischen „Honoratioren“-Charakter der für die Besetzung der Leitung ausschlaggebenden und ihren Besitz monopolisierenden Schicht, also: als Produkt ständisch-aristokratischer Herrschaft. Jede ständisch privilegierte Schicht fürchtet das auf emotionale Massenhingabe gestützte Führertum mindestens ebenso stark wie die führerfeindliche Demokratie. Die Senatsherrschaft und die faktischen Versuche, durch geschlossene Ratskörperschaften zu regieren, gehören dahin, ebenso die venezianische und ihr ähnliche Verfassungen.
58
– Oder In Venedig legte ein Gesetz von 1297 fest, daß der Große Rat sich nur aus „als ratsfähig geltenden Familien“ rekrutieren sollte. Die Namen der Familien waren seit 1315 in einer Liste verzeichnet. Vgl. Weber, Die Stadt, MWG I/22-5, Zitat: S. 155 sowie die Nachweise ebd., Hg.-Anm 37.
δ. in dem Kampf des Fürstentums gegen die zunehmende Expropriation durch das fachgeschulte Beamtentum. Die moderne Verwaltungsorganisation beginnt in der obersten Leitung in den okzidentalen Staaten (und übrigens ähnlich auch in den für die dortige Entwicklung vorbildlichen Patrimonialstaaten des Orients: China, Persien, Khalifenreich, osmanisches Reich) durchweg mit kollegialen Behörden. Der Fürst scheut nicht nur die Machtstellung einzelner, sondern hofft vor allem: durch das System der Voten und Gegenvoten in einem Kollegium die Entscheidung selbst in der Hand und, da er zunehmend Dilettant wird, die nötige Übersicht über die Verwaltung zu behalten, besser als bei Abdankung zugunsten der Machtstellung von Einzelbeamten. (Die Funktion der höchsten Behörden war zunächst ein Mittelding zwischen beratenden und verfügenden Kollegien; nur die besonders irrational wirkende Eigenmacht des Fürsten in der Finanzgebarung wurde – so in der Reform des Kaisers
d
Max – von den Fachbeamten sofort gebrochen, und hier mußte der Fürst aus zwingenden Gründen nachgeben.)[558]A: Kaiser
59
– Oder Gemeint ist die Reform von Kaiser Maximilian I., die in der Einführung der „Hofkammerordnung“ von 1498 bestand; vgl. dazu unten, S. 561, Anm. 66.
ε. in dem Wunsch, spezialistische Fachorientierung und auseinandergehende Interessen sachlicher oder persönlicher Art durch kollegiale Bera[559]tung auszugleichen, also: Kompromisse zu ermöglichen. So namentlich in der Leitung der Gemeindeverwaltung, welche einerseits lokal übersehbare und stark technische Probleme vor sich sieht, andrerseits und namentlich aber ihrer Natur nach sehr stark auf Kompromissen von materiellen Interessenten zu beruhen pflegt, – so lange wenigstens, als die Massen sich die Herrschaft der durch Besitz und Schulung privilegierten Schichten gefallen lassen. – Die Kollegialität der Ministerien hat technisch ähnliche Gründe: wo sie fehlt, wie z. B. in Rußland und (weniger ausgeprägt) im deutschen Reich des alten Regimes,
60
war eine effektive Solidarität der Regierungsstellen nie herzustellen, sondern nur der erbittertste Satrapenkampf der Ressorts zu beobachten. – [559]Weber bezieht sich hier auf die Zustände in Rußland vor der Revolution 1905 und im Deutschen Kaiserreich. Vgl. dazu die konkreteren Ausführungen in Weber, Bürokratismus, MWG I/22-4, S. 218 f.
Die Gründe unter α, γ, δ sind rein historischen Charakters. Die moderne Entwicklung der bureaukratischen Herrschaft hat in Massenverbänden – einerlei ob Staaten oder Großstädten – überall zu einer Schwächung der Kollegialität in der effektiven Leitung geführt. Denn die Kollegialität vermindert unvermeidlich 1. die Promptheit der Entschlüsse, – 2. die Einheitlichkeit der Führung, – 3. die eindeutige Verantwortlichkeit des einzelnen, – 4. die Rücksichtslosigkeit nach außen und die Aufrechterhaltung der Disziplin im Innern. – Überall ist daher – auch aus s. Z. zu erörternden ökonomischen und technologischen Gründen
61
– in Massenstaaten mit Beteiligung an der großen Politik die Kollegialität, wo sie erhalten blieb, abgeschwächt worden zugunsten der prominenten Stellung des politischen Führers (leader, Ministerpräsident). Ähnlich wie übrigens auch in fast allen großen patrimonialistischen Verbänden, gerade den streng sultanistischen, stets wieder das Bedürfnis nach einer führenden Persönlichkeit (Großvesier) neben dem Fürsten gesiegt hat, soweit nicht die „Günstlings“-Wirtschaft Ersatz dafür schuf. Eine Person sollte verantwortlich sein. Der Fürst aber war es legal nicht. Entsprechende Ausführungen sind nicht überliefert.
2. Die Kollegialität der ausführenden Behörden bezweckte[,] die Sachlichkeit und, vor allem, Integrität der Verwaltung zu stützen und in diesem Interesse die Macht einzelner zu schwächen. Sie ist aus den gleichen Gründen wie in der Leitung fast überall der technischen Überlegenheit der Monokratie gewichen (so in Preußen in den „Regierungen“).
62
Vgl. dazu oben, S. 462 mit Hg.-Anm. 32.
3. Die Kollegialität nur beratender Körperschaften hat zu allen Zeiten bestanden und wird wohl zu allen Zeiten bestehen. Entwicklungsgeschicht[560]lich sehr wichtig (wie an seinem Ort zu erwähnen):
63
– besonders in jenen Fällen, wo die „Beratung“ des Magistrats oder Fürsten tatsächlich nach der Machtlage eine „maßgebliche“ war, – bedarf sie der Erörterung in dieser Kasuistik nicht. – [560]Der Bezug ist unklar. Ein entsprechender Exkurs findet sich lediglich in der älteren Fassung von „Wirtschaft und Gesellschaft“, vgl. Weber, Bürokratismus, MWG I/22-4, S. 221–228. Neuere Ausführungen sind nicht überliefert.
Unter Kollegialität ist hier stets Kollegialität der Herrschaft verstanden, – also von Behörden, welche entweder selbst verwalten oder die Verwaltung un[A 165]mittelbar (beratend) beeinflussen. Das Verhalten von ständischen oder parlamentarischen Versammlungen gehört, wie im Text angedeutet, noch nicht hierher.
64
Die Erwähnung im Text findet sich oben, S. 553 mit einem entsprechenden Vorweis (vgl. Anm. 38). Die angekündigten Ausführungen sind nicht überliefert.
Die Kollegialität hat geschichtlich den Begriff der „Behörde“ erst voll zur Entfaltung gebracht, weil sie stets mit Trennung des „Bureau“ vom „Haushalt“ (der Mitglieder), behördlichen
e
vom privaten Beamtenstab, Verwaltungsmitteln[560]Lies: des behördlichen
f
vom Privatvermögen verbunden war. Es ist eben deshalb kein Zufall, daß die moderne Verwaltungsgeschichte des Okzidents ganz ebenso mit der Entwicklung von Kollegialbehörden von Fachbeamten einsetzt wie jede dauernde Ordnung patrimonialer, ständischer, feudaler oder anderer traditionaler politischer Verbände es – in anderer Art – auch tat. Nur kollegiale, eventuell solidarisch zusammenstehende Beamtenkörperschaften konnten insbesondre den zum „Dilettanten“ werdenden Fürsten des Okzidents allmählich politisch expropriieren. Bei Einzelbeamten würde die persönliche Obödienz die unumgängliche Zähigkeit des Widerstandes gegen irrationale Anweisungen des Fürsten, ceteris paribus, weit leichter überwunden haben. Nach dem als unabwendbar erkannten Übergang zur Fachbeamtenwirtschaft hat dann der Fürst regelmäßig das beratende Kollegialsystem (Staatsratssystem) mit Voten und Gegenvoten auszubauen gesucht, um, obwohl Dilettant, doch Herr zu bleiben. Erst nach dem endgültigen und unwiderruflichen Siege des rationalen Fachbeamtentums trat – insbesondre den Parlamenten gegen[561]über (s. später)Lies: der Verwaltungsmittel
65
– das Bedürfnis nach monokratisch (durch Ministerpräsidenten) geleiteter Solidarität der höchsten Kollegien, gedeckt durch den Fürsten und ihn deckend, und damit die allgemeine Tendenz zur Monokratie und also: Bureaukratie in der Verwaltung, siegreich auf. [561]Parlamente werden in Kap. III, § 21, Punkt 4 „Freie Repräsentation“, unten, S. 581 ff., besprochen.
1. Man kann sich die Bedeutung der Kollegialität an der Wiege der modernen Verwaltung besonders leicht an dem Kampf der von Kaiser Maximilian in höchster Not (Türkengefahr) geschaffenen Finanzbehörden mit seiner Gepflogenheit, über den Kopf der Beamten und ad hoc nach Laune Anweisungen und Pfandurkunden herzugeben,
66
klar machen. Am Finanzproblem begann die Expropriation des Fürsten, der hier zuerst politischer Nichtfachmann (Dilettant) wurde. Zuerst in der italienischen Signorie mit ihrem kaufmännisch geordneten Rechnungswesen,Mit der „Hofkammerordnung“ vom 13. Februar 1498 versuchte Maximilian I. die zentrale Finanzverwaltung des Reiches nach burgundisch-österreichischem Vorbild (vgl. unten, Anm. 68) zu reformieren. Die unter dem Eindruck der Türkengefahr lancierte Reform zielte auf eine systematische und intakte Steuererhebung, weshalb Maximilian die Mitglieder der Hofkammer nicht mehr nach ständischen Kriterien, sondern nach der fachlichen Qualifikation rekrutierte. Da Maximilian sich in der „Hofkammerordnung“ dazu verpflichtet hatte, sämtliche Finanzgeschäfte der Krone über die Hofkammer abwickeln zu lassen, war danach die fortwährend geübte Praxis des deutschen Königs, sich durch eigenmächtige Anweisungen und Verpfändungen zu bereichern, der Gegenstand von Konflikten mit der Hofkammer, die diese aber oftmals für sich entscheiden konnte. Vgl. Adler, Sigmund, Die Organisation der Centralverwaltung unter Kaiser Maximilian I. – Leipzig: Duncker & Humblot 1886, S. 80 ff.
67
dann in den burgundisch-französischen, dann in den deutschen Kontinentalstaaten,Zum Zusammenhang von rationaler Buchhaltung und Signorie, der monokratischen, stadtfürstlichen Herrschaft des 13. bis 15. Jahrhunderts, vgl. Weber, Die Stadt, MWG I/22-5, S. 232.
68
selbständig davon bei den Normannen in Sizilien und England (Exchequer).Im 15. Jahrhundert galt Burgund (unter einer Seitenlinie der französischen Valois) als europäische Großmacht, deren Finanzverwaltung auf Buchhaltung, langfristiger Budgetierung und umfangreichen Geldanleihen beruhte. Übertragen wurde dieses System unter Maximilian I., verheiratet mit Maria von Burgund, auf die österreichische Verwaltung und sollte dann mit der Hofkammerordnung (oben, Anm. 66) auf die deutsche Reichsverwaltung angewendet werden.
69
Im Orient haben die Divane, in China die Yamen, in Japan das [562]BakufuIn der Zentralverwaltung, die die Normannen in ihren Reichen in England (1066–1154) und Sizilien (1091–1194) aufrichteten, stellte der Exchequer die bedeutendste Behörde dar. Er war aus der Abteilung des Hofes entstanden, die mit der Einziehung der dem König geschuldeten Gelder befaßt war. Seine Aufgaben bestanden später in der Aufsicht über die königlichen Finanzen und der Kontrolle der von den Sheriffs [562]eingezogenen Einnahmen. Vgl. dazu Weber, Feudalismus, MWG I/22-4, S. 416 mit Hg.-Anm. 95.
g
usw.,[562]A: Bukufu
70
eine entsprechende, nurDer Divan (von pers. Liste), der Staatsrat in den muslimischen Ländern, setzte sich aus den höchsten Würdenträgern des Landes zusammen; das galt auch für das zwischen 1861 und 1901 bestehende Tsungli Yamen in China. Der von Weber hier gebrauchte Ausdruck „Yamen“ für Amt, Behörde wird in der zeitgenössischen Literatur selten für die Ministerien oder Ressorts verwendet, bezeichnet aber nicht den Staatsrat (vgl. dazu Weber, Bürokratismus, MWG I/22-4, S. 222; dort mit der vollständigen Bezeichnung). In der zentralen japanischen Regierungsstelle („bakufu“) waren die höchsten Ämter bis 1867 mit Verwandten und getreuen Vasallen des herrschenden Tokugawa-Hauses besetzt. Der Lesefehler „Bukufu“ in der Druckfassung findet sich auch in den Korrekturfahnen, unten, S. 713 mit textkritischer Anm. l.
h
– in Ermangelung von rational geschulten Fachbeamten und also angewiesen auf die empirischen Kenntnisse „alter“ Beamter –A: nur,
i
nicht zur Bureaukratisierung führende Rolle gespielt, in Rom: der Senat. A: Beamter,
2. Die Kollegialität hat für die Trennung von privatem Haushalt und Amtsverwaltung eine ähnliche Rolle gespielt wie die voluntaristischen
71
großen Handelsgesellschaften für die Trennung von Haushalt und Erwerbsbetrieb, Vermögen und Kapital. Zur Spezialbedeutung von „voluntaristisch“ vgl. Kap. II, oben, S. 248, Ziffer 4.
§ 16. Die Herrengewalt kann ferner abgemildert werden:
3.
72
durch spezifizierte Gewaltenteilung: Übertragung spezifisch verschiedener, im Legalitätsfall (konstitutionelle Gewaltenteilung) rational bestimmter „Funktionen“ als Herrengewalten auf verschiedene Inhaber, derart, daß nur durch ein Kompromiß zwischen ihnen in Angelegenheiten, welche mehrere von ihnen angehen, Anordnungen legitim zustande kommen. Die Ziffer „3.“ kommt in der Aufstellung (Abschwächung der Herrengewalt) bereits oben, S. 543, vor.
1. „Spezifizierte“ Gewaltenteilung bedeutet im Gegensatz zur „ständischen“: daß die Herrengewalten je nach ihrem sachlichen Charakter unter verschiedene Macht- (oder Kontroll-)Inhaber „verfassungsmäßig“ (nicht notwendig: im Sinn der gesatzten und geschriebenen Verfassung) verteilt sind. Derart entweder, daß Verfügungen verschiedener Art nur durch verschiedene oder daß Verfügungen gleicher Art nur durch Zusammenwirken (also: ein nicht formal erzeugbares Kompromiß) mehrerer Machthaber legitim geschaffen werden können. Geteilt sind aber auch hier nicht: „Kompetenzen“, sondern: die Herrenrechte selbst.
[563][A 166]2. Spezifizierte Gewaltenteilung ist nichts unbedingt Modernes. Die Scheidung zwischen selbständiger politischer und selbständiger hierokratischer Gewalt – statt Cäsaropapismus oder Theokratie
73
– gehört hierher. Nicht minder kann man die spezifizierten Kompetenzen der römischen Magistraturen[563]Bei den beiden Herrschaftsformen sind geistliche und weltliche Herrschaftsausübung eng miteinander verbunden. Beim Cäsaropapismus hat der weltliche Herrscher auch die höchste Macht in kirchlichen Dingen, während bei der Theokratie die Priester auch die Funktionen des weltlichen Herrschers versehen. Vgl. Weber, Staat und Hierokratie, MWG I/22-4, S. 582 f.
74
als eine Art der „Gewaltenteilung“ auffassen. Ebenso die spezifizierten Charismata des Lamaismus.Theodor Mommsen vertrat die These, daß die in der Römischen Republik neugeschaffenen Ämter „sämmtlich Specialkompetenzen“ dargestellt hätten (vgl. Mommsen, Römisches Staatsrecht II,13 (wie oben, S. 509 f., Anm. 68). S. 536). Dies betraf – im Gegensatz zu den ursprünglichen Ober- und Unterbeamten (Consuln und Quästoren) – die Ädilen (Polizeigewalt, Marktaufsicht), Censoren (Administrativgerichtsbarkeit und Vermögensverwaltung), Prätoren (Zivilgerichtsbarkeit).
75
Ebenso die weitgehend selbständige Stellung der chinesischen (konfuzianischen) Hanlin-Akademie und der „Zensoren“ gegenüber dem Monarchen.Damit dürfte die bereits angesprochene Funktionsaufteilung zwischen Dalai Lama und Taschi Lama gemeint sein. Vgl. oben, S. 534 mit Hg.-Anm. 63.
76
Ebenso die schon in Patrimonialstaaten, ebenso aber im römischen Prinzipat, übliche Trennung der Justiz- und Finanz- (Zivil-) von der Militärgewalt in den Unterstaffeln.Die Kaiserliche Akademie (Han-lin yuan), eine Einrichtung aus der Zeit der T’ang-Dynastie (618–907), versammelte die geistige Elite des Landes. Sie wachte über die Einhaltung der konfuzianischen Lehre, auch beim Kaiser, und war außerdem für die historische Überlieferung zuständig. Das Zensorat (tu ch’a yuan) war ebenfalls eine alte Behörde mit Kontrollbefugnissen über die Beamtenschaft, einschließlich der höchsten Staatsgremien. Die Unabhängigkeit beider Institutionen kommt darin zum Ausdruck, daß sie dem Kaiserhaus Vorschriften erteilten bzw. öffentlich Kritik übten. Vgl. dazu Weber, Konfuzianismus, MWG I/19, S. 174 ff. mit Nachweisen.
77
Und letztlich natürlich überhaupt jede Kompetenzverteilung. Nur verliert der Begriff der „Gewaltenteilung“ dann jede Präzision. Er ist zweckmäßigerweise auf die Teilung der höchsten Herrengewalt selbst zu beschränken. Tut man das, dann ist die rationale, durch Satzung (Konstitution) begründete Form der Gewaltenteilung: die konstitutionelle, durchaus modern. Jedes Budget kann im nicht parlamentarischen, sondern „konstitutionellen“ Staat nur durch Kompromiß der legalen Autoritäten (Krone und – eine oder mehrere – Repräsentantenkammern) zustande kommen. [564]Geschichtlich ist der Zustand in Europa aus der ständischen Gewaltenteilung entwickelt, theoretisch in England durch Montesquieu,Weber bezieht sich hier auf die Verwaltungsorganisation in den kaiserlichen Provinzen während des Prinzipats. Als „Unterbeamte“ standen neben dem Provinzstatthalter der kaiserliche „procurator provinciae“ für die Kassen- und Steuerverwaltung, ein oder mehrere „legati iuridici“ für die Justizverwaltung sowie die „legati Augusti legionis“ für die Verwaltung einzelner in der Provinz stationierter Legionen. Vgl. Mommsen, Römisches Staatsrecht II,13 (wie oben, S. 509 f., Anm. 68), S. 245 f., Zitat: S. 245.
78
dann Burke,[564]Am Beispiel Englands entwickelte Montesquieu in seinem Hauptwerk „De l’esprit des lois“ 1748 erstmals seine Lehre von der Gewaltenteilung. Im Handexemplar Max Webers – Montesquieu, De l’esprit des lois, von 1869, Max Weber-Arbeitsstelle, BAdW München – finden sich in dem betreffenden Kapitel (XI. Buch, Kap. 6) Anstreichungen und Marginalien. Doppelt angestrichen ist die Aufzählung der drei Gewalten: „la puissance législative, la puissance exécutrice des choses qui dépendent du droit des gens, et la puissance exécutrice des celles qui dépendent du droit civil“ (ebd., S. 142).
79
begründet. Weiter rückwärts ist die Gewaltenteilung aus der Appropriation der Herrengewalten und Verwaltungsmittel an Privilegierte und aus den steigenden regulären ökonomisch-sozial bedingten (Verwaltungs-) und irregulären (vor allem durch Krieg bedingten) Finanzbedürfnissen erwachsen, denen der Herr ohne Zustimmung der Privilegierten nicht abhelfen konnte, aber – oft nach deren eigener Ansicht und Antrag – abhelfen sollte. Dafür war das ständische Kompromiß nötig, aus dem geschichtlich das Budgetkompromiß und die Satzungskompromisse – die keineswegs schon der ständischen Gewaltenteilung in dem Sinn zugehören, wie der konstitutionellen – erwachsen sind. Im letzten Teil seines Buches beschreibt Edmund Burke, Reflections, S. 277–518, die Vorteile der englischen Gewaltenteilung im Gegensatz zur Machtkonzentration der französischen Nationalversammlung.
3. Konstitutionelle Gewaltenteilung ist ein spezifisch labiles Gebilde. Die wirkliche Herrschaftsstruktur bestimmt sich nach der Beantwortung der Frage: was geschehen würde, wenn ein satzungsgemäß unentbehrliches Kompromiß (z. B. über das Budget) nicht zustande käme. Ein budgetlos regierender König von England würde dann (heute) seine Krone riskieren, ein budgetlos regierender preußischer König nicht, im vorrevolutionären deutschen Reich wären die dynastischen Gewalten ausschlaggebend gewesen.
80
Nachdem der preußische König Wilhelm I. von 1862 bis 1867 ohne ein vom Abgeordnetenhaus bewilligtes Budget regiert hatte, war die Frage nach einer „Verfassungslücke“ unter deutschen Staatsrechtlern virulent. Während Paul Laband, Das Budgetrecht nach den Bestimmungen der Preußischen Verfassungsurkunde unter Berücksichtigung der Verfassung des Norddeutschen Bundes. – Berlin: J. Guttentag 1871, nach juristischen Lösungen für die aufgetretene „Verfassungslücke“ suchte, vertrat Georg Jellinek, Art. Budgetrecht, in: HdStW3, Band 3, 1909, S. 308–323, die Ansicht, daß der Konflikt aufgrund der Machtlage entschieden worden sei.
§ 17. Beziehungen zur Wirtschaft. 1. Die (rationale Leistungs-)Kollegialität von legalen Behörden kann die Sachlichkeit und persönliche Unbeeinflußtheit der Verfügungen steigern und dadurch die Bedingungen der Existenz rationaler Wirtschaft [565]günstig gestalten, auch wo die Hemmung der Präzision des Funktionierenden negativ ins Gewicht fällt. Die ganz großen kapitalistischen Gewalthaber der Gegenwart ebenso wie diejenigen der Vergangenheit bevorzugen aber im politischen wie im Partei- wie im Leben aller Verbände, die für sie wichtig sind, eben deshalb die Monokratie als die (in ihrem Sinn) „diskretere“, persönlich zugänglichere und leichter für die Interessen der Mächtigen zu gewinnende Form der Justiz und Verwaltung, und auch nach deutschen Erfahrungen mit Recht. – Die Kassationskollegialität und die aus irrationalen Appropriationen der
k
Macht eines traditionalen Verwaltungsstabes entstandenen kollegialen Behörden können umgekehrt irrational wirken. Die im Beginn der Entwicklung des Fachbeamtentums stehende Kollegialität der Finanzbehörden hat im ganzen wohl zweifellos die (formale) Rationalisierung der Wirtschaft begünstigt. [565]A: oder
Der monokratische amerikanische Partei-Boß, nicht die oft kollegiale, offizielle Parteiverwaltung ist dem interessierten Parteimäzenaten „gut“. Deshalb ist er unentbehrlich. In Deutschland haben große Teile der sog. „Schwerindustrie“ die Herrschaft der Bureaukratie gestützt und nicht den (in Deutschland bisher kollegial verwalteten) Parlamentarismus:
81
aus dem gleichen Grunde. [565]In „Parlament und Regierung“ schreibt Weber (wesentlich drastischer), daß „die Schwerindustriellen, bei uns wie ein Mann auf Seiten des bureaukratischen Obrigkeitsstaates und gegen Demokratie und Parlamentarismus“ stehen. Er bezieht sich auf das enge Zusammengehen von Oberster Heeresleitung und Schwerindustrie in der sog. „Kühlmannkrise“ im Januar 1918, vgl. MWG I/15, S. 485 (Zitat) sowie den Brief an Mina Tobler vom 16. Januar 1918, MWG II/10, S. 58 f. mit Hg.-Anm.
2. Die Gewaltenteilung pflegt, da sie, wie jede Appropriation, feste, wenn auch noch nicht rationale, Zuständigkeiten schafft und dadurch ein Moment der „Berechenbarkeit“ in das Funktionieren des Behördenapparats trägt, der (formalen) Rationalisierung der Wirtschaft günstig zu sein. Die auf Aufhebung der Gewaltenteilung gerichteten Bestrebungen (Räterepublik, Konvents- und Wohlfahrtsaus[A 167]schußregierungen)
82
sind durchweg auf (mehr oder minder) material rationale Umgestaltung der [566]Wirtschaft eingestellt und wirken dementsprechend der formalen Rationalität entgegen. Gemeint sind die Gremien der französischen Revolution sowie der Räterevolutionen 1917 bis 1919.
Alle Einzelheiten gehören in die Spezialerörterungen.
83
[566] Entsprechende Ausführungen sind nicht überliefert.
8. Parteien.
§ 18. Parteien sollen heißen auf (formal) freier Werbung beruhende Vergesellschaftungen mit dem Zweck, ihren Leitern innerhalb eines Verbandes Macht und ihren aktiven Teilnehmern dadurch (ideelle oder materielle) Chancen (der Durchsetzung von sachlichen Zielen oder der Erlangung von persönlichen Vorteilen oder beides) zuzuwenden. Sie können ephemere oder auf Dauer berechnete Vergesellschaftungen sein, in Verbänden jeder Art auftreten und als Verbände jeder Form: charismatische Gefolgschaften, traditionale Dienerschaften, rationale (zweck- oder wertrationale, „weltanschauungsmäßige“) Anhängerschaften[,] entstehen. Sie können mehr an persönlichen Interessen oder an sachlichen Zielen orientiert sein. Praktisch können sie insbesondere offiziell oder effektiv ausschließlich: nur auf Erlangung der Macht für den Führer und Besetzung der Stellen des Verwaltungsstabes
1
durch ihren Stab gerichtet sein (Patronage-Partei). Oder sie können vorwiegend und bewußt im Interesse von Ständen oder Klassen Hier ist der Verwaltungsstab des Staates oder übergeordneten politischen Verbandes gemeint.
l
(ständische bzw. Klassen-Partei) oder an konkreten sachlichen Zwecken oder an abstrakten Prinzipien (Weltanschauungs-Partei) orientiert sein. Die Eroberung der Stellen des Verwaltungsstabes für ihre Mitglieder pflegt aber mindestens Nebenzweck, die sachlichen „Programme“ nicht selten nur Mittel der Werbung der Außenstehenden als Teilnehmer zu sein. [566]Zu ergänzen wäre: agieren
Parteien sind begrifflich nur innerhalb eines Verbandes möglich, dessen Leitung sie beeinflussen oder erobern wollen; jedoch sind interverbändliche Partei-Kartelle möglich und nicht selten.
[567]Parteien können alle Mittel zur Erlangung der Macht anwenden. Da wo die Leitung
2
durch (formal) freie Wahl besetzt wird und Satzungen durch Abstimmung geschaffen werden, sind sie primär Organisationen für die Werbung von Wahlstimmen und bei Abstimmungen vorgesehener Richtung legale Parteien. Legale Parteien bedeuten infolge ihrer prinzipiell voluntaristischen (auf freier Werbung ruhenden) Grundlage praktisch stets: daß der Betrieb der Politik Interessentenbetrieb ist (wobei hier der Gedanke an „ökonomische“ Interessenten noch ganz beiseite bleibt: es handelt sich um politische, also ideologisch oder an der Macht als solcher, orientierte Interessenten). Das heißt: daß er in den Händen [567] Gemeint ist die Leitung des politischen Verbandes oder Staates.
a) von Parteileitern und Parteistäben liegt, – denen
b) aktive Parteimitglieder meist nur als Akklamanten, unter Umständen als Kontroll-, Diskussions-, Remonstrations-, Parteiresolutions-Instanzen
m
[567]A: Parteirevolutions-Instanzen
3
zur Seite treten, – während Zur Emendation von „Parteirevolutions-“ zu „Parteiresolutions-Instanzen“ vgl. auch die Ausführungen in Weber, Parlament und Regierung, MWG I/15, S. 529 f., mit vergleichbarer Charakterisierung der „aktiven“ Parteimitglieder. Der Lesefehler findet sich auch in den Korrekturfahnen, unten, S. 717 mit textkritischer Anm. v.
c) die nicht aktiv mit vergesellschafteten Massen (der Wähler und Abstimmenden) nur Werbeobjekt für Zeiten der Wahl oder Abstimmung sind (passive „Mitläufer“), deren Stimmung nur in Betracht kommt als Orientierungsmittel für die Werbearbeit des Parteistabes in Fällen aktuellen Machtkampfes.
Regelmäßig (nicht immer) verborgen bleiben
d) die Parteimäzenaten.
n
Durchschuß fehlt in A.
Andre als formal-legal organisierte Parteien im formal-legalen Verband können primär vor allem sein
a) charismatische Parteien: Zwist über die charismatische Qualität des Herren: über den charismatisch „richtigen“ Herrn (Form: Schisma);
b) traditionalistische Parteien: Zwist über die Art der Ausübung der traditionalen Gewalt in der Sphäre der freien Willkür [568]und Gnade des Herren (Form: Obstruktion oder offene Revolte gegen „Neuerungen“);
o
[568]A: „Neuerungen“).
[A 168]c) Glaubensparteien, regelmäßig, aber nicht unvermeidlich, mit a identisch: Zwist über Weltanschauungs- oder Glaubens-Inhalte (Form: Häresie, die auch bei rationalen Parteien – Sozialismus – vorkommen kann);
d) reine Appropriations-Parteien: Zwist mit dem Herrn
4
und dessen Verwaltungsstab über die Art der Besetzung der Verwaltungsstäbe, sehr oft (aber natürlich nicht notwendig) mit b identisch. [568]Gemeint ist der Leiter des übergeordneten politischen Verbandes oder Staates.
Der Organisation nach können Parteien den gleichen Typen angehören wie alle andren Verbände, also charismatisch-plebiszitär (Glauben an den Führer) oder
b
traditional (Anhänglichkeit an das soziale Prestige des Herren oder präeminenten Nachbarn) oder rational (Anhänglichkeit an die durch „statutenmäßige“ Abstimmung geschaffenen Leiter und Stäbe) orientiert sein, sowohl was die Obödienz der Anhänger als was die der Verwaltungsstäbe betrifft. b(S. 557, ab: zunehmend–)b Zu dieser Textpassage sind Korrekturfahnen überliefert; vgl. dazu den Anhang, unten, S. 710–718.
Alles Nähere (Materiale) gehört in die Staatssoziologie.
5
Entsprechende Ausführungen sind nicht überliefert.
Wirtschaftlich ist die Partei-Finanzierung eine für die Art der Einflußverteilung und der materiellen Richtung des Parteihandelns zentral wichtige Frage: ob kleine Massenbeiträge, ob ideologischer Mäzenatismus, ob interessierter (direkter und indirekter) Kauf, ob Besteuerung der durch die Partei zugewendeten Chancen oder der ihr unterlegenen Gegner: – auch diese Problematik gehört aber im einzelnen in die Staatssoziologie.
6
Entsprechende Ausführungen sind nicht überliefert.
1. Parteien gibt es ex definitione nur innerhalb von Verbänden (politischen oder andern) und im Kampf um deren Beherrschung. Innerhalb der Parteien kann es wiederum Unterparteien geben und gibt es sie sehr häufig (als ephemere Vergesellschaftungen typisch bei jeder Nominationskampagne für den Präsidentschaftskandidaten bei amerikanischen Parteien,
7
[569]als Dauer-Vergesellschaftungen z. B. in Erscheinungen wie den „Jungliberalen“ bei uns vertreten gewesen).Während der Nominationskampagne zu den Präsidentschaftswahlen 1912 hatte der progressive Flügel der republikanischen Partei die Nominierung von Theodore Roose[569]velt unterstützt, um die Wiederwahl des amtierenden Republikaners William Howard Taft zu verhindern. Als Roosevelts Nominierung bei der Republican National Convention im Juni scheiterte, gründete er eine eigenständige „Progressive Party“. Vgl. dazu Weber, Umbildung des Charisma, MWG I/22-4, S. 506 f. mit Hg.-Anm. 57.
8
– Für interverbandliche Parteien s. einerseits (ständisch) die Guelfen und Ghibellinen in Italien im 13. Jahrh.,Bereits Ende der 1890er Jahre entstanden lokale Vereine der nationalliberalen Jugend, die sich zu Landesverbänden und dann am 20. Oktober 1900 zum „Reichsverband der Vereine der nationalliberalen Jugend“ zusammenschlossen. Als relativ selbständige Bewegung waren sie aber mit der Parteiorganisation verbunden. Dieser Konnex wurde beim Berliner Delegiertentag 1912 gelöst und die finanziellen Beihilfen für die Jungliberalen wurden eingestellt. Politisch bekannten sich die Jungliberalen zum Imperialismus, sie forderten eine fortschrittliche Sozialpolitik und eine liberale Gestaltung von Verfassung und Verwaltung in den deutschen Einzelstaaten sowie eine Demokratisierung der innerparteilichen Organisationsstruktur. Vgl. Köhler, Curt, Der Jungliberalismus. Eine historisch-kritische Darstellung. – Köln: Jungnationalliberaler Reichsverband 1912, bes. S. 19 f.
9
und die modernen Sozialisten (Klasse)Guelfen und Ghibellinen bekämpften sich als Anhänger des Papstes bzw. des staufischen Kaisers in den nord- und mittelitalienischen Städten. Sie waren Organisationen der „interlokal organisierten Adelsparteien“ und damit nicht „an die Grenzen je einer einzelnen politischen Gemeinschaft“ gebunden. Die Guelfen beherrschten u. a. die Städte Bologna, Genua und Perugia, die Ghibellinen u. a. Assisi, Pisa und Siena. Zu den Zitaten vgl. Weber, Die Stadt, MWG I/22-5, S. 159, und Weber, „Klassen“, „Stände“ und „Parteien“, MWG I/22-1, S. 271.
10
andrerseits. Im September 1864 gründeten Sozialisten und radikale Republikaner aus 13 europäischen Ländern und den USA in London die „Internationale Arbeiterassoziation“, die als erster internationaler Zusammenschluß der Arbeiterklasse betrachtet werden kann (sog. Erste Internationale). Vgl. auch Weber, „Klassen“, „Stände“ und „Parteien“, MWG I/22-1, S. 271 f. mit Hg.-Anm. 41.
2. Das Merkmal der (formal!) freien Werbung, der (formal, vom Standpunkt der Verbandsregeln aus) voluntaristischen Grundlagen der Partei, wird hier als das ihr Wesentliche behandelt und bedeutet jedenfalls einen soziologisch tiefgreifenden Unterschied gegen alle von seiten der Verbandsordnungen vorgeschriebenen und geordneten Vergesellschaftungen. Auch wo die Verbandsordnung – wie z. B. in den Vereinigten Staaten und bei unserem Verhältniswahlrecht
11
– von der Existenz der Parteien Notiz [570]nimmt, sogar: ihre Verfassung zu regulieren unternimmt, bleibt doch jenes voluntaristische Moment unangetastet. Wenn eine Partei eine geschlossene, durch die Verbandsordnungen dem Verwaltungsstab eingegliederte Vergesellschaftung wird – wie z. B. die „parte Guelfa“ in den trecentistischen Florentiner StatutenDie Verfassung der Vereinigten Staaten überläßt Wahlregelungen den Einzelstaaten. Diese erließen zwischen 1884 und 1891 „ballot reform laws“ und führten damit das sog. australische System ein. Dadurch wurden die Wahlen geheim und die Durchführung zumindest teilweise in die öffentliche Hand gelegt (Druck und Verbreitung der Wahllisten). Die Gesetze sollten den Einfluß der Parteien regulieren, führten aber gleichzeitig zu deren staatlicher Anerkennung (vgl. Bryce, American Commonwealth II2 (wie oben, S. 536 f., Anm. 71), S. 148 mit Anm. 2, und Ostrogorski, Political Parties II (wie oben, S. 536, Anm. 71), S. 499 ff., bes. S. 507 „legal status“). – Mit der Einführung des Verhältniswahlrechtes in Deutschland (Reichswahlgesetz vom 30. November 1918, dann Art. 17 der Weimarer Reichsverfassung vom 11. August 1919) und dem [570]„System der streng gebundenen Liste“ (Reichswahlgesetz § 20) nahm der Staat indirekt Einfluß auf die Listenaufstellung der Parteien (vgl. Jellinek, Walter, Revolution und Reichsverfassung. Bericht über die Zeit vom 9. November 1918 bis zum 31. Dezember 1919, in: Jahrbuch des öffentlichen Rechtes der Gegenwart, Band 9, 1920, S. 1–128, hier S. 29 f.).
12
es schließlich wurde –[,] so ist sie keine „Partei“ mehr, sondern ein Teilverband des politischen Verbandes. In den „Statuta domini capitanei civitatis Florentie“ von 1322–25 heißt es, daß keine Gesetze angenommen oder bestätigt werden dürfen, die gegen die Statuten oder Anordnungen der Kommune von Florenz, des Volkskapitans oder der parte guelfa verstoßen (vgl. Statuti della repubblica Fiorentina, editi a cura del Comune di Firenze da Romolo Caggese, vol. 1: Statuti del capitano del popolo. – Firenze: Galileiana 1910, S. 22 = liber primus, c. 9). Die parte Guelfa hatte nach der Vertreibung der Ghibellinen aus Florenz ihre Macht sichern und wichtige Teile des Stadtregiments übernehmen können. 1275 bemächtigte sie sich auch der Form nach der Kommune und verwandelte sich „aus einer herrschenden Partei in eine organisierte Staatsbehörde“ (vgl. Davidsohn, Robert, Geschichte von Florenz, Band II,1. – Berlin: Ernst Siegfried Mittler und Sohn 1908, S. 613 ff., und das Zitat in Band II,2, ebd., 1908, S. 117; hinfort: Davidsohn, Geschichte II,1). Zu den Parallelausführungen vgl. Weber, Die Stadt, MWG I/22-5, S. 204 mit den Hg.-Erläuterungen.
3. Parteien in einem genuin charismatischen Herrschaftsverband sind notwendig schismatische Sekten, ihr Kampf ist ein Glaubenskampf und als solcher nicht endgültig austragbar. Ähnlich kann es im streng patriarchalen Verband liegen. Den Parteien im modernen Sinn sind diese beiden Parteiarten, wo sie rein auftreten, normalerweise fremd. Gefolgschaften von Lehens- und Amtsprätendenten, geschart um einen Thronprätendenten, stehen sich in den üblichen erbcharismatischen und ständischen Verbänden typisch gegenüber. Persönliche Gefolgschaften sind auch in den Honoratiorenverbänden (aristokratischen Städtestaaten), aber auch in manchen Demokratien durchaus vorwiegend. Ihren modernen Typus nehmen die Parteien erst im legalen Staat mit Repräsentativverfassung an
p
. Die Darstellung erfolgt weiterhin in der Staatssoziologie.[570]A: vor
13
Entsprechende Ausführungen sind nicht überliefert.
4. Beispiele für reine Patronage-Parteien im modernen Staat sind in klassischer Art die beiden großen amerikanischen Parteien des letzten Menschenalters.
14
Beispiele für sachliche und „Weltanschauungs“-Parteien [571]lieferten s. Z. der alte Konservatismus, der alte Liberalismus und die alte bürgerliche Demokratie, später die Sozialdemokratie – bei ihnen allen mit sehr starkem Einschlag von Klasseninteresse – und das Zentrum; das letztere ist seit Durchsetzung fast aller Forderungen sehr stark reine Patronage-Partei geworden. In den USA besetzte nach den Wahlen die siegreiche Partei (republikanische oder demokratische Partei) die öffentlichen Ämter mit ihren Anhängern („spoils system“). Trotz der civil service reform der 1880er Jahre blieb diese Praxis weitgehend intakt. Teilweise führte sie auch zu paritätischer Ämterbesetzung („,bi-partisan‘ boards“). Vgl. [571]Ostrogorski, Political Parties II (wie oben, S. 536, Anm. 71), S. 499 ff., Zitat: S. 508, und Bryce, American Commonwealth II2 (wie oben, S. 536 f., Anm. 71), S. 130 f.
15
Bei allen, auch bei der reinsten Klassen-Partei pflegt aber für die Haltung der Parteiführer und des Parteistabs das eigne (ideelle und materielle) Interesse an Macht, Amtsstellungen und Versorgung mit ausschlaggebend zu sein und die Wahrnehmung der Interessen ihrer Wählerschaft nur soweit stattzufinden, als ohne Gefährdung der Wahlchancen un[A 169]vermeidlich ist. Dies letztgenannte Moment ist einer der Erklärungsgründe der Gegnerschaft gegen das Parteiwesen. Nachdem das Zentrum wesentliche kirchenpolitische Ziele im Ausgang des Kulturkampfes erreicht hatte, sei es, wie Weber an anderer Stelle behauptet, zur „unoffiziell“ betriebenen Patronage für katholische Amtsanwärter und -interessenten übergegangen. Vgl. Weber, Parlament und Regierung, MWG I/15, S. 504 f.
3.
16
Über die Organisationsformen der Parteien ist s. Z. gesondert zu handeln. Die Ziffer „3.“ kommt bereits oben, S. 570, Zeile 7, vor.
17
Allen gemeinsam ist: daß einem Kern von Personen, in deren Händen die aktive Leitung: die Formulierung der Parolen und die Auswahl der Kandidaten liegt, sich „Mitglieder“ mit wesentlich passiverer Rolle zugesellen, während die Masse der Verbandsglieder nur eine Objektrolle spielt, und die Wahl zwischen den mehreren von der Partei ihnen präsentierten Kandidaten und Programmen hat. Dieser Sachverhalt ist bei Parteien ihres voluntaristischen Charakters wegen unvermeidlich und stellt das dar, was hier „Interessenten“ betrieb genannt ist. (Unter „Interessenten“ Entsprechende Ausführungen sind nicht überliefert.
q
sind hier, wie gesagt,[571]A: Interessenten“
18
„politische“, nicht etwa „materielle“ Interessenten gemeint). Es ist der zweite Hauptangriffspunkt der Opposition gegen das Parteiwesen als solches und bildet die formale Verwandtschaft der Parteibetriebe mit dem gleichfalls auf formal freier Arbeitswerbung Oben, S. 567, Zeile 9 und 10.
r
ruhenden kapitalistischen Betrieb. A: Arbeitswertung
4.
19
Das Mäzenatentum als Finanzierungsgrundlage ist keineswegs nur „bürgerlichen“ Parteien eigen. Paul Singer z. B. war ein sozialistischer Parteimäzenat (wie übrigens auch ein humanitärer Mäzenat) größten Stils (und: reinsten Wollens, soviel irgend bekannt). Seine ganze Stellung als [572]Vorstand der Partei beruhte darauf. Die Ziffer „4.“ kommt bereits oben, S. 570, Zeile 19, vor.
20
Die russische (Kerenskij-)Revolution ist (in den Parteien) durch ganz große Moskauer Mäzenaten mit finanziert worden.[572]Der jüdische Berliner Fabrikant Paul Singer engagierte sich seit 1868 (nach Kontakten zu August Bebel und Wilhelm Liebknecht) im Berliner Arbeiterverein, dann seit 1884 in der Stadtverordnetenversammlung und als Reichstagsabgeordneter in der sozialdemokratischen Fraktion. Nach Ablauf der Sozialistengesetze wurde er 1890 auch offiziell Vorstandsmitglied der SPD (er gehörte bereits seit 1885 zur Parteileitung). Sein humanitäres Engagement galt insbesondere einem Berliner Obdachlosenverein, dessen Leitung er 1875 übernommen hatte.
21
Andre deutsche Parteien (der „Rechten“) durch die Schwerindustrie;Alexander F. Kerenskij, Vorsitzender der sozialistischen Trudoviki („Arbeitergruppe“) und Duma-Mitglied, war aktiv am Sturz des zaristischen Regimes im Februar (März) 1917 beteiligt. Dem ersten Kabinett der Provisorischen Regierung (von März bis Mai 1917) gehörten einflußreiche Männer des Moskauer Finanz- und Industriekapitals, A. I. Gutschkow (Gučkov), N. B. Terestschenko (Tereščenko) und A. I. Konowalow (Konovalov), an. Weber vermutete, daß die neue Regierung durch die Textilunternehmerfamilie Morozov und „andere Führer des erzreaktionären Großkapitals“ finanziert worden sei (vgl. Weber, Rußlands Übergang zur Scheindemokratie, MWG I/15, S. 248). Diese Kreise beabsichtigten die Abdankung des unfähigen Zaren, aber keine generelle Abschaffung der Monarchie. Vgl. dazu Kerenski, Alexander, Erinnerungen. Vom Sturz des Zarentums bis zu Lenins Staatsstreich. – Dresden: Carl Reissner 1928, S. 239.
22
das Zentrum gelegentlich von katholischen Multimillionären.Gemeint sind vermutlich die Nationalliberale Partei und die Deutschkonservativen bis zum Ende des Kaiserreichs sowie die Deutsche Volkspartei und insbesondere die Deutschnationale Volkspartei in der Weimarer Republik.
23
Der katholische Industrielle August Thyssen unterstützte bis zur Julikrise 1917 das Zentrum, insbesondere Matthias Erzberger, ohne aber selbst Zentrumsmitglied zu sein. Vgl. dazu Weber, Parlament und Regierung, MWG I/15, S. 530 f. mit Hg.-Anm. 4.
Die Parteifinanzen sind aber für die Forschung aus begreiflichen Gründen das wenigst durchsichtige Kapitel der Parteigeschichte und doch eines ihrer wichtigsten. Daß eine „Maschine“ (Caucus, über den Begriff später)
24
geradezu „gekauft“ wird, ist in Einzelfällen wahrscheinlich gemacht. Im übrigen besteht die Wahl: entweder die Wahl-Kandidaten tragen den Löwenanteil der Wahlkosten (englisches System)Eine kurze Erwähnung findet sich in Kap. III, § 21, unten, S. 587. Eine ausführliche Erläuterung des Begriffs ist nicht überliefert. Zur „Gladstone-Chamberlainsche[n] Caucusdemokratie“ vgl. Weber, Bürokratismus, MWG I/22-4, S. 202, sowie zum Begriff den Glossar-Eintrag, unten, S. 740.
25
– Resultat: Plutokratie der Kandidaten –, oder die „Maschine“ – Resultat: Abhängigkeit der Kandidaten von Parteibeamten. In der einen oder andren Form ist dies so, seit [573]es Parteien als Dauerorganisationen gibt, im trecentistischen ItalienDaß der Abgeordnete die Wahlkosten sowie auch einen Teil der Registrationskosten (neben weiteren, oft erheblichen Ausgaben für den Wahlkreis) zu tragen hatte, beschreibt Hasbach, Kabinettsregierung, S. 112. Sidney Low nennt für die Vorkriegszeit eine Summe von 600 bis 2000 Pfund Sterling Wahlkosten (vgl. Low, Regierung Englands (wie oben, S. 481, Anm. 80), S. 172).
26
so gut wie in der Gegenwart. Diese Dinge dürfen nur nicht durch Phrasen verhüllt werden. Eine Partei-Finanzierung hat gewiß Grenzen ihrer Macht: sie kann im ganzen nur das als Werbemittel auftreten lassen, was „Markt“ hat. Aber wie beim kapitalistischen Unternehmertum im Verhältnis zum Konsum ist allerdings heut die Macht des Angebots durch die Suggestion der Reklamemittel (namentlich der nach rechts oder links – das ist gleichgültig – „radikalen Parteien“) ungeheuer gesteigert. [573]Gemeint sind wohl die Parteien der Guelfen und GhibelIinen. Vom Parteivermögen der Guelfen in Florenz zu Beginn des 14. Jahrhunderts wird berichtet, daß es durch die Vertreibung der gegnerischen Partei mit anschließenden Vermögenskonfiskationen sehr bedeutend gewesen sei, so daß es von sechs Prioren verwaltet wurde. Vgl. Davidsohn, Geschichte II,1 (wie oben, S. 570, Anm. 12), S. 618 f.
9.27Die Gliederungsziffer 9. ist doppelt vergeben, vgl. auch unten, S. 579, sowie den Editorischen Bericht, oben, S. 90. Herrschaftsfremde Verbandsverwaltung und Repräsentanten-Verwaltung.
Die Gliederungsziffer 9. ist doppelt vergeben, vgl. auch unten, S. 579, sowie den Editorischen Bericht, oben, S. 90.
§ 19. Verbände können bestrebt sein, die – in einem gewissen Minimalumfang unvermeidlich – mit Vollzugsfunktionen verbundenen Herrschaftsgewalten tunlichst zu reduzieren (Minimisierung der Herrschaft), indem der Verwaltende als lediglich nach Maßgabe des Willens, im „Dienst“ und kraft Vollmacht der Verbandsgenossen fungierend gilt. Dies ist bei kleinen Verbänden, deren sämtliche Genossen örtlich versammelt werden können und sich untereinander kennen und als sozial gleich werten, im Höchstmaß erreichbar, aber auch von größeren Verbänden (insbesondre Stadtverbänden der Vergangenheit und Landbezirksverbänden) versucht worden. Die üblichen technischen Mittel dafür sind
a) kurze Amtsfristen, möglichst nur zwischen je zwei Genossenversammlungen,
b) jederzeitiges Abberufungsrecht (recall),
c) Turnus- oder Los-Prinzip bei der Besetzung, so daß jeder einmal „daran kommt“, – also: Vermeidung der Machtstellung des Fach- und des sekretierten Dienstwissens,
[574]d) streng imperatives Mandat für die Art der Amtsführung (konkrete, nicht: generelle, Kompetenz), festgestellt durch die Genossenversammlung,
e) strenge Rechenschaftspflicht vor der Genossenversammlung,
f) Pflicht, jede besondersartige und nicht vorgesehene Frage der Genossenversammlung (oder einem Ausschuß) vorzulegen,
g) zahlreiche nebengeordnete und mit Sonderaufträgen versehene Ämter, – also:
h) Nebenberufs-Charakter des Amts.
[A 170]Wenn der Verwaltungsstab durch Wahl bestellt wird, dann erfolgt sie in einer Genossenversammlung. Die Verwaltung ist wesentlich mündlich, schriftliche Aufzeichnungen finden nur soweit statt, als Rechte urkundlich zu wahren sind. Alle wichtigen Anordnungen werden der Genossenversammlung vorgelegt.
Diese und diesem Typus nahestehende Arten der Verwaltung sollen „unmittelbare Demokratie“ heißen, solange die Genossenversammlung effektiv ist.
1. Die
s
nordamerikanische town-ship[574]Zu erwarten wäre: Das
30
Weber verwendet hier das Femininum, das im Deutschen als Spezialbezeichnung für die südafrikanischen Townships übernommen worden ist. Richtiger wäre hier zur Bezeichnung der US-amerikanischen (Stadt-)Gemeinden oder Verwaltungsbezirke das Neutrum, wie unten, S. 577, Zeile 2.
28
und der schweizerische Kleinkanton (Glarus, Schwyz, beide Appenzell usw.)[574]Als „townships“ wurden die sich selbst verwaltenden, ländlichen Siedlungen der Neuenglandstaaten bezeichnet. Kirchen- und Gemeindezugehörigkeit der zumeist puritanischen Siedler bedingten sich oft wechselseitig. Die Mitglieder (durchschnittlich bis zu 3000) versammelten sich mindestens einmal jährlich, bestimmten die politischen Richtlinien und die Verantwortlichen für das kommende Jahr. Diese streng demokratische Selbstverwaltung wurde bis ins 19. Jahrhundert praktiziert. Vgl. Bryce, American Commonwealth I2 (wie oben, S. 536 f., Anm. 71), S. 561 ff., auch mit Vergleichen zur Schweizer Landsgemeinde, ebd., S. 566, 578.
29
stehen bereits der Größe [575]nach an der Grenze der Möglichkeit „unmittelbar demokratischer“ Verwaltung (deren Technik hier nicht auseinandergesetzt werden soll).Unmittelbare Demokratie mit jährlichem Zusammentritt der Bürgerschaft gab es kurz vor dem Ersten Weltkrieg noch in den Kantonen Uri, Obwalden, Nidwalden, Glarus, Appenzell-Innerrhoden und Appenzell-Außerrhoden. In den Kantonen Zug und Schwyz war sie hingegen 1815 bzw. 1848 abgeschafft worden. Die Kantone hatten einen Bevölkerungsumfang von 13.000 bis nahezu 56.000 Einwohnern. Vgl. Hasbach, Wilhelm, Die moderne Demokratie. Eine politische Beschreibung. – Jena: Gustav Fischer 1912, S. 136.
31
Die attische Bürgerdemokratie überschritt tatsächlich diese Grenze weit,[575]Entsprechende Ausführungen sind nicht überliefert, hätten ihren Ort aber vermutlich in der geplanten „Staatssoziologie“ gehabt.
32
das parliamentumEduard Meyer gab für die Zeit der „radicalen Demokratie“ den Umfang der attischen Bürgerschaft um 460 v. Chr. mit 60.000 erwachsenen Männern an, von denen die Mehrzahl in Athen und Umgebung gewohnt habe (Meyer, Geschichte des Alterthums III1 (wie oben, S. 540, Anm. 81), S. 548 mit einer Anstreichung im Handexemplar Max Webers; Max Weber-Arbeitsstelle, BAdW München). Jeder Vollbürger war in der Volksversammlung stimmberechtigt. Nach neueren Schätzungen lag die Zahl bei 35.000 bis 40.000 Stimmberechtigten, von denen durchschnittlich 6.000 an den Volksversammlungen teilnahmen.
t
der frühmittelalterlichen italienischen Stadt[575]Zu erwarten wäre: parlamentum
33
erst recht. Vereine, Zünfte, wissenschaftliche, akademische, sportliche Verbände aller Art verwalten sich oft in dieser Form. Aber sie ist ebenso auch übertragbar auf die interne Gleichheit „aristokratischer“ Herren-Verbände, die keinen Herrn über sich aufkommen lassen wollen. Wie Weber, Die Stadt, MWG I/22-5, S. 147, beschreibt, waren die Bürgerversammlungen der italienischen mittelalterlichen Städte Massenversammlungen, die „durch Akklamation die Vorschläge der Honoratioren genehmigte[n] oder dagegen tumultierte[n], nie aber […] die Wahlen oder die Maßregeln der Stadtverwaltung wirklich dauernd entscheidend bestimmte[n]“. Dort verwendet Weber auch den mittellateinischen Ausdruck „parlamentum“ (ebd., S. 145 f. mit Hg.-Anm. 1) und nicht den lateinisch-angelsächsischen Ausdruck „parliamentum“.
2. Wesentliche Vorbedingung ist neben der örtlichen oder personalen (am besten: beiden) Kleinheit des Verbandes auch das Fehlen qualitativer Aufgaben, welche nur durch fachmäßige Berufsbeamte zu lösen sind. Mag auch dies Berufsbeamtentum in strengster Abhängigkeit zu halten versucht werden, so enthält es doch den Keim der Bureaukratisierung und ist, vor allem, nicht durch die genuin „unmittelbar demokratischen“ Mittel anstellbar und abberufbar.
3. Die rationale Form der unmittelbaren Demokratie steht dem primitiven gerontokratischen oder patriarchalen Verband innerlich nahe. Denn auch dort wird „im Dienst“ der Genossen verwaltet. Aber es besteht dort a) Appropriation der Verwaltungsmacht, – b) (normal:) strenge Traditionsbindung. Die unmittelbare Demokratie ist ein rationaler Verband oder kann es doch sein. Die Übergänge kommen sogleich zur Sprache.
34
Kap. III, §§ 20 bis 22, unten, S. 576–591.
[576]§ 20. „Honoratioren“ sollen solche Personen heißen, welche
1. kraft ihrer ökonomischen Lage imstande sind, kontinuierlich nebenberuflich in einem Verband leitend und verwaltend ohne Entgelt oder gegen nominalen oder Ehren-Entgelt tätig zu sein und welche
2. eine, gleichviel worauf beruhende, soziale Schätzung derart genießen, daß sie die Chance haben, bei formaler unmittelbarer Demokratie kraft Vertrauens der Genossen zunächst freiwillig, schließlich traditional, die Ämter inne zu haben.
Unbedingte Voraussetzung der Honoratiorenstellung in dieser primären Bedeutung: für die Politik leben zu können, ohne von ihr leben zu müssen, ist ein spezifischer Grad von „Abkömmlichkeit“ aus den eignen privaten Geschäften. Diesen besitzen im Höchstmaß: Rentner aller Art: Grund-, Sklaven-, Vieh-, Haus-, Wertpapier-Rentner. Demnächst solche Berufstätige, deren Betrieb ihnen die nebenamtliche Erledigung der politischen Geschäfte besonders erleichtert: Saisonbetriebsleiter (daher: Landwirte), Advokaten (weil sie ein „Bureau“ haben) und einzelne Arten andrer freier Berufe. In starkem Maß auch: patrizische Gelegenheitshändler. Im Mindestmaß: gewerbliche Eigenunternehmer und Arbeiter. Jede unmittelbare Demokratie neigt dazu, zur „Honoratiorenverwaltung“ überzugehen. Ideell: weil sie als durch Erfahrung und Sachlichkeit besonders qualifiziert gilt. Materiell: weil sie sehr billig, unter Umständen geradezu: kostenlos, bleibt. Der Honoratiore ist teils im Besitz der sachlichen Verwaltungsmittel bzw. benutzt sein Vermögen als solches, teils werden sie ihm vom Verband gestellt.
1. Als ständische Qualität ist die Kasuistik des Honoratiorentums später zu erörtern.
35
Die primäre Quelle ist in allen primitiven Gesellschaften: Reichtum, dessen Besitz allein oft „Häuptlings“-Qualität gibt (Bedingungen s. Kap. IV).[576]Entsprechende Ausführungen sind nicht überliefert.
36
Weiterhin kann, je nachdem, erbcharismatische Schätzung oder die Tatsache der Abkömmlichkeit mehr im Vordergrund stehen. Zu ständischen Merkmalen siehe Kap. IV, § 3, unten, S. 598 ff. Weitere Ausführungen finden sich dort nicht.
[577]2. Im Gegensatz zu dem auf naturrechtlicher Grundlage für effektiven Turnus eintretenden town-ship der Amerikaner
37
konnte man in den unmittelbar demokratischen Schweizer Kantonen bei Prüfung der Beamtenlisten leicht die Wiederkehr [A 171]ständig derselben Namen und, erst recht, Familien verfolgen.[577]„Rotation in office“ beruhte auf der demokratischen Grundüberzeugung der Amerikaner, daß jeder Bürger das gleiche Vermögen für ein Amt habe und damit auch die gleiche Chance verdiene, es auszuüben. Vgl. Bryce, American Commonwealth II2 (wie oben, S. 536 f., Anm. 71), S. 127 f.
38
Die Tatsache der größeren Abkömmlichkeit (zum „gebotenen Ding“) war auch innerhalb der germanischen Dinggemeinden und der zum Teil anfangs streng demokratischen Städte Norddeutschlands eine der Quellen der Herausdifferenzierung der „meliores“ und des Ratspatriziats.Familienkontinuitäten bei der Besetzung des obersten Gemeindeamtes finden sich beispielsweise in den Landammännerlisten der ältesten Schweizer Demokratien, in den Landsgemeindekantonen Uri, Schwyz, Zug und Glarus, wie eine Zusammenstellung von Heinrich Ryffel vom 13. bis ins 19. Jahrhundert belegt. Vgl. Ryffel, Heinrich, Die schweizerischen Landsgemeinden. – Zürich: Schultheß & Co. 1903, S. 152 f.
39
Das „gebotene Ding“ war die nach Bedarf einberufene Versammlung der germanischen (Rechts-)Genossen. Im Gegensatz zum „echten“ und an festen Terminen stattfindenden Ding war die Teilnahme am außerordentlichen Ding nur für die Schöffen verpflichtend (vgl. Weber, Die Stadt, MWG I/22-5, S. 146 mit Hg.-Anm.3). In Lübeck und Hamburg wurde der Rat aus der vermögenden, ratsfähigen Oberschicht (zumeist Kaufleuten) gebildet, den sog. „meliores“ (mlat. für Ratsmänner oder Ratsbürger). In Lübeck übernahmen sie das Amt lebenslänglich und waren in jedem dritten Jahr freigestellt, hatten aber auch dann bei wichtigeren Angelegenheiten (vergleichbar dem „gebotenen Ding“) zu erscheinen. Frensdorff bezeichnet den turnusmäßigen Wechsel in der Geschäftsleitung als das „demokratische Element“ und weist auf Ansätze zu patrizischer Abschließung unter den Ratsmännern hin (vgl. Frensdorff, Ferdinand, Die Stadt- und Gerichtsverfassung Lübecks im XII. und XIII. Jahrhundert. – Lübeck: v. Rohdensche Buchhandlung 1861, S. 27, 101 f. (Zitat) und S. 200).
3. Honoratiorenverwaltung findet sich in jeder Art von Verbänden, z. B. typisch auch in nicht bureaukratisierten politischen Parteien. Sie bedeutet stets: extensive Verwaltung und ist daher, wenn aktuelle und sehr dringliche Wirtschafts- und Verwaltungsbedürfnisse präzises Handeln erheischen, zwar „unentgeltlich“ für den Verband, aber zuweilen „kostspielig“ für dessen einzelne Mitglieder.
Sowohl die genuine unmittelbare Demokratie wie die genuine Honoratiorenverwaltung versagen technisch, wenn es sich um Verbände über eine gewisse (elastische) Quantität hinaus (einige Tausend vollberechtigte Genossen) oder um Verwaltungsaufgaben handelt, welche Fachschulung einerseits, Stetigkeit der Leitung andrerseits erfordern. Wird hier nur mit dau[578]ernd angestellten Fachbeamten neben wechselnden Leitern gearbeitet, so liegt die Verwaltung tatsächlich normalerweise in den Händen der ersteren, die die Arbeit tun, während das Hineinreden der letzteren wesentlich dilettantischen Charakters bleibt.
Die Lage der wechselnden Rektoren, die im Nebenamt akademische Angelegenheiten verwalten[,] gegenüber den Syndiken
a
,[578]Ältere, eingedeutschte Form für: syndici
40
unter Umständen selbst den Kanzleibeamten, ist ein typisches Beispiel dafür. Nur der autonom für längeren Termin gekorene Universitätspräsident (amerikanischen Typs)[578]Zur Zeit Max Webers stand an der Spitze der deutschen Universität ein Rektor (eigentlich: Prorektor, der Landesfürst war Rektor), der aus und von dem Kreis der ordentlichen Professoren in der Regel auf ein Jahr gewählt war und dabei in Forschung und Lehre tätig blieb. Die Verwaltung lag in den Händen eines dauerhaft bestellten Syndikus, der Jurist war und vom zuständigen Ministerium bestellt wurde.
41
könnte – von Ausnahmenaturen abgesehen – eine nicht nur aus Phrasen und Wichtigtuerei bestehende „Selbstverwaltung“ der Universitäten schaffen, und nur die Eitelkeit der akademischen Kollegien einerseits, das Machtinteresse der Bureaukratie andrerseits sträubt sich gegen das Ziehen solcher Konsequenzen. Ebenso liegt es aber, mutatis mutandis, überall. Der amerikanische Universitätspräsident steht an der Spitze des „Board of Trustees“ (der obersten Universitätsbehörde) und wird von dieser gewählt. Zuständig für die Besitz- und Finanzverwaltung der Universität (eigentlich nicht für Unterrichts- und engere Fakultätsfragen) genießt er – je nach Talent – großes öffentliches Ansehen. Vgl. Fullerton, George Stuart, Die von den deutschen abweichenden Einrichtungen an den nordamerikanischen Hochschulen, in: Verhandlungen des IV. Deutschen Hochschullehrertages zu Dresden am 12. und 13. Oktober 1911. Bericht erstattet vom geschäftsführenden Ausschuß. – Leipzig: Verlag des Literarischen Zentralblattes für Deutschland (Eduard Avenarius) 1912, S. 53–63, bes. S. 57, sowie die Bemerkungen Max Webers dazu, ebd., S. 75 f. (MWG I/13).
Herrschaftsfreie unmittelbare Demokratie und Honoratiorenverwaltung bestehen ferner nur so lange genuin, als keine Parteien als Dauergebilde entstehen, sich bekämpfen und die Ämter zu appropriieren suchen. Denn sobald dies der Fall ist, sind der Führer der kämpfenden und – mit gleichviel welchen Mitteln – siegenden Partei und sein Verwaltungsstab herrschaftliches Gebilde, trotz Erhaltung aller Formen der bisherigen Verwaltung.
Eine ziemlich häufige Form der Sprengung der „alten“ Verhältnisse.
[579]9.42[579]Die Gliederungsziffer 9. ist doppelt vergeben, vgl. auch oben, S. 573 mit Hg.-Anm. 27. Repräsentation.
[579]Die Gliederungsziffer 9. ist doppelt vergeben, vgl. auch oben, S. 573 mit Hg.-Anm. 27.
§ 21. Unter Repräsentation wird primär der (in Kap. I, § 11)
43
erörterte Tatbestand verstanden: daß das Handeln bestimmter Verbandszugehöriger (Vertreter) den übrigen zugerechnet wird oder von ihnen gegen sich als „legitim“ geschehen und für sie verbindlich gelten gelassen werden soll und tatsächlich wird. Kap. I, § 11, oben, S. 202; dort heißt es (statt „Repräsentation“) „Vertretungsgewalt“.
Innerhalb der Verbandsherrschaften aber nimmt Repräsentation mehrere typische Formen an:
1. Appropriierte Repräsentation. Der Leiter (oder ein Verbandsstabsmitglied) hat das appropriierte Recht der Repräsentation. In dieser Form ist sie sehr alt und findet sich in patriarchalen und charismatischen (erbcharismatischen, amtscharismatischen) Herrschaftsverbänden der verschiedensten Art. Die Vertretungsmacht hat traditionalen Umfang.
Schechs
b
von Sippen oder Häuptlinge von Stämmen, Kastenschreschthi[579]Nebenform von: Scheichs
c
,A: Kastenschreschts
44
Erbhierarchen von Sekten, Dorf-patels,Schreschthi (Skt.: śreṣṭhin: „Bester“, „Höchster“) sind bei Weber die Gildenältesten bzw. der Vorstand der Gilden in Indien. Die Kastenvorsteher und -ältesten heißen hingegen „sar panch“, wie Weber, Hinduismus, MWG I/20, S. 188, angibt (vgl. dort auch die Begriffserläuterungen, ebd., S. 630 f.).
45
Obermärker,„patel“ bezeichnet den Dorfvorsteher bzw. Dorfvorstand in Indien. Vgl. Weber, Hinduismus, MWG I/20, S. 141, 150, 618 (Begriffserläuterung).
46
Erbmonarchen und alle ähnlichen patriarchalen und patrimonialen Leiter von Verbänden aller Art gehören hierher. Befugnis zum Abschluß von Verträgen und zu satzungsartigen Abmachungen mit den Ältesten der Nachbarverbände finden sich schon in sonst primitiven Verhältnissen (Australien).Der Obermärker war der höchste Amtsträger in der mittelalterlichen Markgenossenschaft. Formell von den Mitgliedern der markgenossenschaftlichen Versammlung („Märkerding“) gewählt, handelte es sich meist um einen in der Mark ansässigen Grundherrn. Er leitete das Märkerding, sorgte für den Schutz des markgenossenschaftlichen Gebiets nach außen sowie für die Feststellung von Verstößen gegen die Ordnung in der Mark („Markfrevel“). Vgl. von Maurer, Georg Ludwig, Geschichte der Markenverfassung in Deutschland. – Erlangen: Ferdinand Enke 1856, S. 201 ff.
47
Ratzel berichtet von „tendi“ (Ältestenräten) bei den australischen Aborigines, die unter dem Vorsitz von „rupulle“ (Wahlhäuptlingen) stattfanden. Letztere waren befugt, [580]Verhandlungen mit benachbarten Clans oder Stämmen zu führen (vgl. Ratzel, Friedrich, Völkerkunde, Band I, 2. Aufl. – Leipzig, Wien: Bibliographisches Institut 1894, S. 347). Kohler bezeichnet die Vermittler zwischen den Stämmen als „geweihte, geheiligte Boten“ (vgl. Kohler, Josef, Die Anfänge des Rechts und das Recht der primitiven Völker, in: ders. und Leopold Wenger, Allgemeine Rechtsgeschichte (Die Kultur der Gegenwart, Teil II, Abt. VII,1). – Leipzig, Berlin: B. G. Teubner 1914, S. 1–48, hier S. 45).
[580][A 172]Der appropriierten Repräsentation sehr nahe steht
2. die ständische (eigenrechtliche) Repräsentation. Sie ist insofern nicht „Repräsentation“, als sie primär als Vertretung und Geltendmachung lediglich eigner (appropriierter) Rechte (Privilegien) angesehen wird. Aber sie hat insofern Repräsentationscharakter (und wird daher gelegentlich auch als solche angesehen),
48
als die Rückwirkung der Zustimmung zu einem ständischen Rezeß über die Person des Privileginhabers hinaus auf die nicht privilegierten Schichten, nicht nur der Hintersassen, sondern auch anderer, nicht durch Privileg ständisch Berechtigter, wirkt, indem ganz regelmäßig deren Gebundenheit durch die Abmachungen der Privilegierten als selbstverständlich vorausgesetzt oder ausdrücklich in Anspruch genommen wird. Die These, daß der Landes- oder Grundherr in den Ständeversammlungen bereits als Vertreter seiner Untergebenen auftrat, findet sich – wie Jellinek, Staatslehre2 (wie oben, S. 213, Anm. 18), S. 557, schreibt – „in der Literatur der Staatslehre des späteren Mittelalters“, besonders bei Gierke, Otto, Das deutsche Genossenschaftsrecht, Band 3. – Berlin: Weidmann 1881, S. 595 ff.
Alle Lehenshöfe und Versammlungen ständisch privilegierter Gruppen, κατ’ έξοχὴν aber die „Stände“ des deutschen Spätmittelalters und der Neuzeit gehören hierher. Der Antike und den außereuropäischen Gebieten ist die Institution nur in einzelnen Exemplaren bekannt, nicht aber ein allgemeines „Durchgangsstadium“ gewesen.
3. Den schärfsten Gegensatz hierzu bildet die gebundene Repräsentation: gewählte (oder durch Turnus oder Los oder andere ähnliche Mittel bestimmte) Beauftragte, deren Vertretungsgewalt durch imperative Mandate und Abberufungsrecht nach Innen und Außen begrenzt und an die Zustimmung der Vertretenen gebunden ist. Diese „Repräsentanten“ sind in Wahrheit: Beamte der von ihnen Repräsentierten.
Das imperative Mandat hat von jeher und in Verbänden der allerverschiedensten Art eine Rolle gespielt. Die gewählten Vertreter der Kommu[581]nen z. B. in Frankreich waren fast immer durchaus an ihre „cahiers de
d
doléances“ gebunden.[581]A: des
49
– Zurzeit findet sich diese Art der Repräsentation besonders in den Räterepubliken,[581]Beschwerdehefte (cahiers de doléances) sind seit 1468 nachweisbar. Die Beschwerden wurden – getrennt nach den drei Ständen – regional gesammelt und dem jeweiligen gewählten Vertreter für die Zusammenkunft der états généraux mitgegeben. Parallel zu den Beschwerden gaben die Wähler ihren Vertretern auch Instruktionen für die Verhandlungen, zu deren Einhaltung sie durch Schwur oder Widerruf des Mandats angehalten werden konnten. Vgl. Holtzmann, Französische Verfassungsgeschichte (wie oben, S. 481, Anm. 79), S. 380, sowie Jellinek, Staatslehre2 (wie oben, S. 213, Anm. 18), S. 560 f., ferner Zweig, Egon, Die Lehre vom Pouvoir Constituant. Ein Beitrag zum Staatsrecht der französischen Revolution. – Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) 1909, S. 219.
50
für welche sie Surrogat der in Massenverbänden unmöglichen unmittelbaren Demokratie ist. Gebundene Mandatare sind sicherlich Verbänden der verschiedensten Art auch außerhalb des mittelalterlichen und modernen Okzidents bekannt, doch nirgends von großer historischer Bedeutung gewesen. Die Bindung der Delegierten oder der gewählten Räte durch imperatives Mandat von der Betriebs- oder kommunalen Ebene bis hin zu einem (nationalen) Zentralrat gab es in der Russischen Sozialistischen Föderativen Sowjetrepublik (1917–22), in der Räterepublik Ungarn (1919) sowie 1918/19 im Deutschen Reich, einigen deutschen Ländern und Stadtrepubliken.
4. Freie Repräsentation. Der Repräsentant, in aller Regel gewählt (eventuell formell oder faktisch durch Turnus bestimmt) ist an keine Instruktion gebunden, sondern Eigenherr über sein Verhalten. Er ist pflichtmäßig nur an sachliche eigene Überzeugungen, nicht an die Wahrnehmung von Interessen seiner Deleganten gewiesen.
Freie Repräsentation in diesem Sinn ist nicht selten die unvermeidliche Folge der Lücken oder des Versagens der Instruktion. In andern Fällen aber ist sie der sinngemäße Inhalt der Wahl eines Repräsentanten, der dann insoweit: der von den Wählern gekorene Herr derselben, nicht: ihr „Diener“, ist. Diesen Charakter haben insbesondere die modernen parlamentarischen Repräsentationen angenommen, welche die allgemeine Versachlichung: Bindung an abstrakte (politische, ethische) Normen: das Charakteristikum der legalen Herrschaft, in dieser Form teilen.
[582]Im Höchstmaß gilt diese Eigenart für die Repräsentativ-Körperschaften der modernen politischen Verbände: die Parlamente. Ihre Funktion ist ohne das voluntaristische Eingreifen der Parteien nicht zu erklären: diese sind es, welche die Kandidaten und Programme den politisch passiven Bürgern präsentieren und durch Kompromiß oder Abstimmung innerhalb des Parlaments die Normen für die Verwaltung schaffen, diese selbst kontrollieren, durch ihr Vertrauen stützen, durch dauernde Versagung ihres Vertrauens stürzen, wenn es ihnen gelungen ist, die Mehrheit bei den Wahlen zu erlangen.
Der Parteileiter und der von ihm designierte Verwaltungsstab: die Minister, Staats- und, eventuell, Unterstaatssekretäre, sind die „politischen“, d. h. vom Wahlsieg ihrer Partei in ihrer Stellung abhängigen, durch eine Wahlniederlage zum Rück[A 173]tritt gezwungenen Staatsleiter. Wo die Parteiherrschaft voll durchgedrungen ist, werden sie dem formalen Herren: dem Fürsten, durch die Parteiwahl zum Parlament oktroyiert, der von der Herrengewalt expropriierte Fürst wird auf die Rolle beschränkt:
1. durch Verhandlungen mit den Parteien den leitenden Mann auszuwählen und formal durch Ernennung zu legitimieren, im übrigen
2. als legalisierendes Organ der Verfügungen des jeweils leitenden Parteihaupts zu fungieren.
Das „Kabinett“ der Minister, d. h. der Ausschuß der Mehrheitspartei, kann dabei material mehr monokratisch oder mehr kollegial organisiert sein; letzteres ist bei Koalitionskabinetten unumgänglich, ersteres die präziser fungierende Form. Die üblichen Machtmittel: Sekretierung des Dienstwissens und Solidarität nach außen dienen gegen Angriffe stellensuchender Anhänger oder Gegner. Im Fall des Fehlens materialer (effektiver) Gewaltenteilung bedeutet dies System die volle Appropriation aller Macht durch die jeweiligen Parteistäbe: die leitenden, aber oft weitgehend auch die Beamtenstellen werden Pfründen der Anhängerschaft: parlamentarische Kabinettsregierung.
Auf die Tatsachen-Darlegungen der glänzenden politischen Streitschrift W[ilhelm] Hasbachs gegen dies System (fälschlich eine „politische [583]Beschreibung“ genannt)
51
ist mehrfach zurückzukommen.[583]Die Schrift von Hasbach, Kabinettsregierung, basiert auf einer Aufsatzreihe, die in der „Zeitschrift für Sozialwissenschaft“ 1917/18 erschienen war. Mit dem Untertitel „Eine politische Beschreibung“ beanspruchte der Autor, wie er im „Vorwort“ mitteilt, wissenschaftlichen Rang für seine „objektive Sammlung der Tatsachen“ (ebd., S. XI–XII). Im Kern formuliert Hasbach eine scharfe Kritik an der parteiengesteuerten parlamentarischen Kabinettsregierung in England und an deren Muster folgenden Regierungen.
52
Meine eigne Schrift über „Parlament und Regierung im neu geordneten Deutschland“ hat ausdrücklich ihren Charakter als einer nur aus der Zeitlage heraus geborenen Streitschrift betont.Explizit nimmt Weber im Folgenden nicht mehr Bezug auf Hasbach, setzt sich jedoch, unten, S. 584 f., Nr. 3–4, mit dessen Thesen auseinander.
53
Die Schrift Max Webers, Parlament und Regierung, erschien Anfang Mai 1918. Sie beruht auf fünf überarbeiteten Artikeln, die von April bis Juni 1917 in der „Frankfurter Zeitung“ erschienen waren und einen Beitrag zur aktuellen Diskussion um die Parlamentarisierungsbestrebungen der Reichstagsmehrheit darstellten. Daß es sich um eine politische Schrift handelte, geht aus dem Untertitel „Zur politischen Kritik des Beamtentums und Parteiwesens“ hervor und wurde von Max Weber ausdrücklich in der „Vorbemerkung“ betont (vgl. Weber, Parlament und Regierung, MWG I/15, S. 432–433, mit dem Editorischen Bericht, bes. S. 424–425).
Ist die Appropriation der Macht durch die Parteiregierung nicht vollständig, sondern bleibt der Fürst (oder ein ihm entsprechender, z. B. plebiszitär gewählter, Präsident) eine Eigenmacht, insbesondre in der Amtspatronage (einschließlich der Offiziere), so besteht: konstitutionelle Regierung. Sie kann insbesondre bei formeller Gewaltenteilung bestehen. Ein Sonderfall ist das Nebeneinanderstehen plebiszitärer Präsidentschaft mit Repräsentativparlamenten: plebiszitär-repräsentative Regierung.
Die Leitung eines rein parlamentarisch regierten Verbandes kann andrerseits schließlich auch lediglich durch Wahl der Regierungsbehörden (oder des Leiters) durch das Parlament bestellt werden: rein repräsentative Regierung.
Die Regierungsgewalt der Repräsentativorgane kann weitgehend durch Zulassung der direkten Befragung der Beherrschten begrenzt und legitimiert sein: Referendums-Satzung.
1. Nicht die Repräsentation an sich, sondern die freie Repräsentation und ihre Vereinigung in parlamentarischen Körperschaften ist dem Okzident eigentümlich, findet sich in der Antike und sonst nur in Ansätzen (Delegiertenversammlungen bei Stadtbünden, grundsätzlich jedoch mit gebundenen Mandaten).
[584]2. Die Sprengung des imperativen Mandats ist sehr stark durch die Stellungnahme der Fürsten bedingt gewesen. Die französischen Könige verlangten für die Delegierten zu den Etats généraux bei Ausschreibung der Wahlen regelmäßig die Freiheit: für die Vorlagen des Königs votieren zu können,
54
da das imperative Mandat sonst alles obstruiert hätte. Im englischen Parlament führte die (s. Z. zu besprechende)[584]Die Generalstände (états généraux) traten 1302 zum ersten Mal zusammen. Die Versammlungen setzten sich aus Vertretern von Klerus, Adel und drittem Stand zusammen. Versuche der Wähler, die Delegierten durch imperative Mandate zu binden, wurden vom König abgewehrt, bereits im Mittelalter und schließlich auch für die im Mai 1789 einberufenen Generalstände. Der König setzte sich – wie es noch im Juni 1789 hieß – für die Beschränkung der Mandate zugunsten der Gewissensentscheidung und Wahlfreiheit der Abgeordneten ein. Vgl. Holtzmann, Französische Verfassungsgeschichte (wie oben, S. 481, Anm. 79), S. 211 f., 380 f., sowie Jellinek, Staatslehre2 (wie oben, S. 213, Anm. 18), S. 561 mit Anm. 3.
55
Art der Zusammensetzung und Geschäftsführung zum gleichen Resultat. Wie stark sich infolgedessen, bis zu den Wahlreformen von 1867,Entsprechende Ausführungen sind nicht überliefert.
56
die Parlamentsmitglieder als einen privilegierten Stand ansahen, zeigt sich in nichts so deutlich wie in dem rigorosen Ausschluß der Öffentlichkeit (schwere Bußen für Zeitungen, die über die Verhandlungen berichteten, noch Mitte des 18. Jahrhunderts).In den Wahlreformen von 1867 wurde das Nutzungsrecht an einer Wohnung zum entscheidenden Kriterium für das aktive Wahlrecht; vorher war es von (Grund-)Besitz, Steueraufkommen, Korporations- oder Gildemitgliedschaft abhängig. Vgl. Hasbach, Kabinettsregierung, S. 107 f.
57
Die Theorie: daß der parlamentarische Deputierte „Vertreter des ganzen Volkes“ sei, das heißt: daß er an Aufträge nicht gebunden (nicht „Diener“, sondern eben – ohne Phrase gesprochen – Herr) sei, war in der Literatur schon entwickelt, ehe die französische Revolution ihr die seitdem klassisch gebliebene (phrasenhafte) Form verlieh.Im Jahr 1738 erklärte das Unterhaus, die Veröffentlichung von Berichten als „Breach of Privilege“. Das Verbot wurde 1762 anläßlich der kritischen „Briefe“ in der Wochenschrift „North Briton“ verschärft, stillschweigend fallen gelassen wurde es, als sich die Stadt London 1771 für die verfolgten Drucker einsetzte. Vgl. Redlich, Josef, Recht und Technik des Englischen Parlamentarismus. Die Geschäftsordnung des House of Commons in ihrer geschichtlichen Entwicklung und gegenwärtigen Gestalt. – Leipzig: Duncker & Humblot 1905, S. 291 f.
58
Der Abgeordnete der französischen Nationalversammlung ist „le représentant de la Nation tout entière“, eingeführt durch Gesetz vom 22. Dezember 1789 (vgl. Jellinek, Staatslehre2 (wie oben, S. 213, Anm. 18), S. 562). Der Gedanke der freien, ungebundenen Vertretung findet sich bereits bei Montesquieu, De l’esprit des lois, S. 145 (mit Anstreichungen im Handexemplar Max Webers, Max Weber-Arbeitsstelle, BAdW München): „[…] la parole des députés seroit plus l’éxpression de la voix de la nation; mais cela […] rendrait chaque député le maître de tous les autres“.
3. Die Art, wie der englische König (und nach seinem Muster andere) durch die unoffizielle, rein parteiorientierte, Kabinettsregierung allmählich [585]expropriiert wurde,
59
und die Gründe für diese an sich singuläre (bei dem Fehlen der Bureaukratie in England[585]Seit dem beginnenden 18. Jahrhundert gelang es der Kabinettsregierung, die Machtbefugnisse des Königs zu begrenzen. Er wurde zunächst in der Auswahl der Minister beschränkt (seit Wilhelm III. sollten diese nur noch der Mehrheitsfraktion des Unterhauses angehören), dann von den Kabinettsberatungen ausgeschlossen (seit 1718 nahm mit Ausnahme von Georg III. kein König mehr an den Kabinettssitzungen teil) und schließlich von der Regierungsbildung entbunden (diese ging im 19. Jahrhundert an den Prime Minister über). Vgl. Hübner, Rudolf, Die parlamentarische Regierungsweise Englands in Vergangenheit und Gegenwart (Recht und Staat in Geschichte und Gegenwart, Heft 10). – Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) 1918, S. 22–26.
e
nicht so „zufällige“[,] wie oft behauptet wird),[585]A: England,
60
aber universell [A 174]bedeutsam gewordene Entwicklung sind hier noch nicht zu erörtern.Die Zufallstheorie vertrat Sidney Low, der behauptete, daß die konstitutionelle Monarchie und das Kabinettsystem in England „ein modernes und zufälliges Erzeugnis“ seien. Vgl. Low, Regierung Englands (wie oben, S. 481, Anm.80), S. 16 und 253 (Zitat).
61
Ebenso nicht das amerikanische plebiszitär-repräsentative System der funktionalen Gewaltenteilung, die Entwicklung des Referendums (wesentlich: eines Mißtrauensinstruments gegen korrupte Parlamente) und die in der Schweiz und jetzt in manchen deutschen Staaten damit kopulierte rein repräsentative Demokratie.Entsprechende Ausführungen sind nicht überliefert.
62
Hier waren nur einige der Haupttypen festzustellen. Ein Referendum sahen die neuen Verfassungen von Baden (21. März 1919), Bayern (14. August 1919) und Württemberg (25. September 1919) sowie die Weimarer Reichsverfassung (11. August 1919) vor; in den Verfassungstexten ist zumeist von „Volksabstimmung“ die Rede. Vgl. dazu auch Rosenthal, Eduard, Die Entwicklung des Verfassungsrechts in den thüringischen Staaten seit November 1918, in: Jahrbuch des öffentlichen Rechtes der Gegenwart, Band 9, 1920, S. 226–244, hier S. 230.
4. Die sog. „konstitutionelle“ Monarchie, zu deren Wesenheiten vor allem die Appropriation der Amtspatronage einschließlich der Minister und der Kommandogewalt an den Monarchen zu zählen pflegt, kann faktisch der rein parlamentarischen (englischen) sehr ähnlich sein, wie umgekehrt diese einen politisch befähigten Monarchen keineswegs, als Figuranten, aus effektiver Teilnahme an der Leitung der Politik (Eduard VII.) ausschaltet.
63
Über die Einzelheiten später.Eduard VII. griff – im Gegensatz zum viktorianischen Königtum – richtungweisend in die Politik ein (vgl. dazu Jellinek, Staatslehre2 (wie oben, S. 213, Anm. 18), S. 664 mit Anm. 1, sowie Weber, Erhaltung des Charisma, MWG I/22-4, S. 562 mit Hg.-Anm. 57). Zugleich Auseinandersetzung mit Hasbach, Kabinettsregierung, S. 269 ff., der die deutsche „konstitutionelle“ Monarchie der englischen Kabinettsregierung vorzog.
64
Entsprechende Ausführungen sind nicht überliefert; ansatzweise ist das Thema in der älteren Fassung von „Wirtschaft und Gesellschaft“ behandelt, vgl. Weber, Erhaltung des Charisma, MWG I/22-4, S. 562 f.
[586]5. Repräsentativ-Körperschaften sind nicht etwa notwendig „demokratisch“ im Sinn der Gleichheit der Rechte (Wahlrechte) Aller.
65
Im geraden Gegenteil wird sich zeigen,[586]Weber greift hier eine These von Hasbach, Kabinettsregierung, S. 260, auf: „Repräsentation ist nicht Delegation und der Demokratie nicht wesensverwandt“.
66
daß der klassische Boden für den Bestand der parlamentarischen Herrschaft eine Aristokratie oder Plutokratie zu sein pflegte (so in England). Entsprechende Ausführungen über die Trägerschichten des englischen Parlamentarismus liegen nicht vor. Über die englische Honoratiorenverwaltung finden sich Ausführungen in der älteren Fassung von „Wirtschaft und Gesellschaft“, vgl. insbes. Weber, Patrimonialismus, MWG I/22-4, S. 351–361. Neuere Ausführungen sind nicht überliefert.
Zusammenhang mit der Wirtschaft: Dieser ist höchst kompliziert und späterhin gesondert zu erörtern.
67
Hier ist vorweg nur folgendes allgemein zu sagen: Entsprechende Ausführungen über den Zusammenhang von Repräsentation, Parlamentarismus und Wirtschaft liegen nicht vor.
1. Die Zersetzung der ökonomischen Unterlagen der alten Stände bedingte den Übergang zur „freien“ Repräsentation, in welcher der zur Demagogie Begabte ohne Rücksicht auf den Stand freie Bahn hatte. Grund der Zersetzung war: der moderne Kapitalismus.
2. Das Bedürfnis nach Berechenbarkeit und Verläßlichkeit des Fungierens der Rechtsordnung und Verwaltung, ein vitales Bedürfnis des rationalen Kapitalismus, führte das Bürgertum auf den Weg des Strebens nach Beschränkung der Patrimonialfürsten und des Feudaladels durch eine Körperschaft, in der Bürger ausschlaggebend mitsaßen und welche die Verwaltung und Finanzen kontrollierte und bei Änderungen der Rechtsordnung mitwirken sollte.
3. Die Entwicklung des Proletariats war zur Zeit dieser Umbildung noch keine solche, daß es als politische Macht ins Gewicht gefallen wäre und dem Bürgertum gefährlich erschienen wäre. Außerdem wurde unbedenklich durch Zensuswahlrecht jede Gefährdung der Machtstellung der Besitzenden ausgeschaltet.
[587]4. Die formale Rationalisierung von Wirtschaft und Staat, dem Interesse der kapitalistischen Entwicklung günstig, konnte durch Parlamente stark begünstigt werden. Einfluß auf die Parteien schien leicht zu gewinnen.
5. Die Demagogie der einmal bestehenden Parteien ging den Weg der Ausdehnung des Wahlrechts. Die Notwendigkeit der Gewinnung des Proletariats bei auswärtigen Konflikten und die – enttäuschte – Hoffnung auf dessen, gegenüber den Bürgern, „konservativen“ Charakter veranlaßten Fürsten und Minister überall, das (schließlich:) gleiche Wahlrecht zu begünstigen.
6. Die Parlamente fungierten normal, solange in ihnen die Klassen von „Bildung und Besitz“: – Honoratioren also, – sozusagen „unter sich waren“, rein klassenorientierte Parteien nicht, sondern nur ständische und durch die verschiedene Art des Besitzes bedingte Gegensätze vorherrschten. Mit dem Beginn der Macht der reinen Klassenparteien, insbesondere der proletarischen, wandelte und wandelt sich die Lage der Parlamente. Ebenso stark aber trägt dazu die Bureaukratisierung der Parteien (Caucus-System) bei, welche spezifisch plebiszitären Charakters ist und den Abgeordneten aus einem „Herren“ des Wählers zum Diener der Führer der Parteimaschine macht. Davon wird gesondert zu reden sein.
68
[587]Entsprechende Ausführungen über die Parteien sind nicht überliefert.
§ 22. 5. Repräsentation durch Interessenvertreter soll diejenige Art der Repräsentantenkörperschaften heißen, bei welcher die Bestellung der Repräsentanten nicht frei und ohne Rücksicht auf die berufliche oder ständische oder klassenmäßige Zugehörigkeit erfolgt, sondern nach Berufen, ständischer oder [A 175]Klassen-Lage gegliedert Repräsentanten durch je ihresgleichen bestellt werden, und zu einer – wie jetzt meist gesagt wird: – „berufsständischen Vertretung“
69
zusammentreten. Die Errichtung von berufsständischen Vertretungen war vor und im Ersten Weltkrieg vor allem von konservativen, antiparlamentarischen Gruppen gefordert worden. Weber bekämpfte sie in seinen politischen Aufsätzen ab 1917 als Idee „einflußreicher Literatenkreise“ mit organischen Gesellschaftsvorstellungen, vgl. z. B. Weber, Wahlrecht und Demokratie in Deutschland, MWG I/15, S. 355 f.
[588]Eine solche Repräsentation kann Grundverschiedenes bedeuten
1. je nach der Art der zugelassenen Berufe, Stände, Klassen,
2. je nachdem Abstimmung oder Kompromiß das Mittel der Erledigung von Streit ist,
3. im ersteren Fall: je nach der Art der ziffernmäßigen Anteilnahme der einzelnen Kategorien.
Sie kann hochrevolutionären sowohl wie hochkonservativen Charakters sein. Sie ist in jedem Fall das Produkt der Entstehung von großen Klassenparteien.
Normalerweise verbindet sich mit der Absicht der Schaffung dieser Art von Repräsentation die Absicht: bestimmten Schichten das Wahlrecht zu entziehen. Entweder:
a) den durch ihre Zahl immer überwiegenden Massen durch die Art der Verteilung der Mandate auf die Berufe material,
f
[588]Zu erwarten wäre: material, oder
b) den durch ihre ökonomische Machtstellung überwiegenden Schichten durch Beschränkung des Wahlrechts auf die Nichtbesitzenden formal (sog. Rätestaat).
70
[588]Die Verfassung der Russischen Sozialistischen Föderativen Sowjetrepublik vom 10. Juli 1918 sah ein Klassenwahlrecht vor, nach dem die Gruppen, die ihren Lebensunterhalt nicht durch „produktive und gemeinnützliche Arbeit“ aufbrachten, vom Wahlrecht ausgeschlossen waren. Das betraf vor allem Rentiers, Unternehmer und Händler. Vgl. Verfassung der Russischen Föderativen Räte-Republik. Beschluß der V. Allrussischen Räte-Versammlung, gefaßt in der Sitzung vom 10. Juli 1918, in: Struthahn, Arnold [= Ps. für Karl Radek], Verfassung der Russischen Sozialistischen Föderativen Räte-Republik. – Zürich: Union Verlag 1918, S. 25–45, Zitat: S. 40 (= Abschnitt 64 und 65 der Verfassung).
Geschwächt wird – theoretisch wenigstens – durch diese Art der Repräsentation der ausschließliche Interessentenbetrieb (der Parteien) der Politik, wennschon, nach allen bisherigen Erfahrungen, nicht beseitigt. Geschwächt kann, – theoretisch – die Bedeutung der finanziellen Wahlmittel werden, auch dies in zweifelhaftem Grade. Der Charakter der Repräsentativkörperschaften dieser Art neigt zur Führerlosigkeit. Denn als berufsmäßige Interessenvertreter werden nur solche Repräsentanten in Betracht kommen, welche ihre Zeit ganz in den Dienst der [589]Interessenvertretung stellen können, bei den nicht bemittelten Schichten also: besoldete Sekretäre der Interessentenverbände.
1. Repräsentation mit dem Kompromiß als Mittel der Streitschlichtung ist allen historisch älteren „ständischen“ Körperschaften eigen. Es herrscht heut in den „Arbeitsgemeinschaften“
71
und überall da, wo „itio in partes“[589]Max Weber spielt hier auf die von Gewerkschafts- und Arbeitgebervertretern ausgehandelte Zusammenarbeit zur „Wiederaufrichtung“ der deutschen Wirtschaft in paritätisch besetzten Arbeitsgemeinschaften an, die durch das sog. Stinnes-Legien-Abkommen vom 15. November 1918 geregelt worden war. Die Zentralarbeitsgemeinschaft der industriellen und gewerblichen Arbeitgeber und Arbeitnehmer bestand vom November 1918 bis zum Januar 1924. Vgl. dazu auch oben, S. 291 mit Hg.-Anm. 9.
72
und Verhandlung zwischen den gesondert beratenden und beschließenden Einzelgremien die Ordnung ist. Da sich ein Zahlenausdruck für die „Wichtigkeit“ eines Berufs nicht finden läßt, da vor allem die Interessen der Arbeitermassen und der (zunehmend wenigeren) Unternehmer, deren Stimme„itio in partes“ (lat.), das „Auseinandertreten in Teile oder Parteien“ vor einer Abstimmung; speziell ist damit die konfessionell getrennte Abstimmung in den Kurien des Reichstags im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation gemeint.
g
, als besonders sachkundig, – aber allerdings auch: besonders persönlich interessiert, – irgendwie abgesehen von ihrer Zahl ins Gewicht fallen muß, oft weitestgehend antagonistisch sind, so ist ein formales „Durchstimmen“ bei Zusammensetzung aus klassenmäßig oder ständisch sehr heterogenen Elementen ein mechanisiertes Unding: der Stimmzettel als ultima ratio ist das Charakteristikum streitender und über Kompromisse verhandelnder Parteien, nicht aber: von „Ständen“. [589]A: Stimmen
2. Bei „Ständen“ ist der Stimmzettel da adäquat, wo die Körperschaft aus sozial ungefähr gleich geordneten Elementen: z. B. nur aus Arbeitern, besteht, wie in den „Räten“. Den Prototyp gibt da die Mercadanza der Zeit der Zunftkämpfe: zusammengesetzt aus Delegierten der einzelnen Zünfte, abstimmend nach Mehrheit, aber faktisch unter dem Druck der Separationsgefahr bei Überstimmen besonders mächtiger Zünfte.
73
Schon der Eintritt der „Angestellten“ in die Räte zeigt Probleme: regelmäßig hat man ihren Stimmenanteil mechanisch beschränkt.Die mächtigsten und wohlhabendsten Zünfte – zumeist die großen Kaufmannsgilden – dominierten die Mercadanza (zum Begriff vgl. oben, S. 552 mit Hg.-Anm. 33) und konnten bei der Gefahr des Überstimmtwerdens mit dem Austritt drohen. Im 14. Jahrhundert kam es zu Aufständen der gewerblichen und Kleinunternehmer-Zünfte (arti minori) gegen die Vormacht der arti maggiori. Vgl. dazu Weber, Die Stadt, MWG I/22-5, S. 204 f.
74
Vollends wo Vertreter von [590]Bauern und Handwerkern eintreten sollen, kompliziert sich die Lage. Sie wird durch Stimmzettel gänzlich unentscheidbar, wo die sogenannten „höhern“ Berufe und die Unternehmer mit einbezogen werden sollen. „Paritätische“ Zusammensetzung einer Arbeitsgemeinschaft mit Durchstimmen bedeutet: daß gelbe GewerkschafterDie Arbeiter- und Soldatenräte wollten den Anteil der Angestellten beschränken. Davon berichtet Heinrich Laufenberg (1872–1932), der selber führend im Hamburger [590]Arbeiterrat 1918/19 tätig war. Die Forderung der neugebildeten Angestelltenräte nach Vertretung im Arbeiter- und Soldatenrat sei vom Rat abgelehnt worden, „da die Kopfzahl der Exekutive und bestimmte Partei- und Betriebsvertretungen festgelegt“ worden seien. Vgl. Laufenberg, Heinrich, Die Räteidee in der Praxis des Hamburger Arbeiterrats, in: AfSSp, Band 45, Heft 3, 1919, S. 591–628, Zitat: S. 600.
75
den Unternehmern, liebedienerische Unternehmer den Arbeitern zum Siege verhelfen: also die klassenwürdelosesten Elemente den Ausschlag geben. Die sog. gelben oder „wirtschaftsfriedlichen“ Gewerkschaften reorganisierten sich nach der Novemberrevolution und schufen den „Nationalverband deutscher Gewerkschaften“, dem beispielsweise der „Deutsche Arbeiterbund“ oder der „Bund der Bäcker- und Konditorgehilfen“ angehörten. Emil Lederer, der für das „Archiv“ über die neuesten sozialpolitischen Entwicklungen berichtete, sah im „Auftauchen der gelben Organisationen“ und ihrer Beteiligung an den von Arbeitgebern und Arbeitnehmern paritätisch besetzten „Arbeitsgemeinschaften“ (vgl. dazu oben, S. 589, Hg.-Anm. 71) „ein deutliches Symptom“ für die Verschiebung der Machtverhältnisse zugunsten der Arbeitgeber und damit eine Gefahr für den Bestand der Arbeitsgemeinschaften. Vgl. Lederer, Emil, Die Gewerkschaftsbewegung 1918/19 und die Entfaltung der wirtschaftlichen Ideologien in der Arbeiterklasse, in: AfSSp, Band 47, 1920/21, S. 239–269, Zitate: S. 240.
Aber auch zwischen den Arbeitern in rein proletarischen „Räten“ würden ruhige Zeiten scharfe Antagonismen schaffen, die wahrscheinlich eine faktische Lahmlegung der Räte, jedenfalls aber alle Chancen für eine geschickte Politik des Ausspielens der Interessenten gegeneinander bewirken würden: dies ist der Grund, [A 176]weshalb die Bureaukratie dem Gedanken so freundlich gesonnen ist.
76
Vollends bestünde die gleiche Chance für Bauernvertreter gegen Arbeitervertreter. Jedenfalls kommt jegliche nicht strikt revolutionäre Zusammensetzung solcher Repräsentativkörperschaften letztlich nur auf eine neue Chance der „Wahlkreisgeometrie“Worauf Weber hier anspielt, konnte nicht ermittelt werden.
77
in anderer Form hinaus. Mit „Wahlkreisgeometrie“ werden die Analysen und Entscheidungen hinsichtlich des geographischen Zuschnitts von Wahlkreisen bezeichnet. Weil im Mehrheitswahlsystem von der Abgrenzung der Wahlkreise der Erfolg der Kandidaten abhängen kann, war die Gestaltung der Wahlkreise in den USA seit dem frühen 19. Jahrhundert Anlaß zu vielerlei Manipulationen („Gerrymandering“). Vgl. Hasbach, Wilhelm, Die Moderne Demokratie. Eine politische Beschreibung. – Jena: Gustav Fischer 1912, S. 450 ff.
3. Die Chancen der „berufsständischen“ Vertretungen sind nicht gering. In Zeiten der Stabilisierung der technisch-ökonomischen Entwicklung werden sie überaus groß sein. Dann wird das „Parteileben“ aber ohnedies [591]weitgehend abflauen. Solange diese Voraussetzung nicht besteht, ist selbstverständlich kein Gedanke daran, daß berufsständische Repräsentativkörperschaften die Parteien eliminieren würden. Von den „Betriebsräten“
78
angefangen – wo wir den Vorgang schon jetzt sehen – bis zum Reichswirtschaftsrat[591]Das Betriebsrätegesetz vom 4. Februar 1920 sah in seinen Allgemeinen Bestimmungen vor, „in allen Betrieben, die in der Regel mindestens zwanzig Arbeitnehmer beschäftigen, Betriebsräte zu errichten“ (Betriebsrätegesetz, wie oben, S. 201, Anm. 86, § 1, S. 147). Je nach Betriebsgröße waren zwischen 3 und max. 30 Betriebsräte vorgesehen (ebd., § 15, S. 150). Noch vor Abschluß des Gesetzes versuchten die Gewerkschaften, die den Betriebsräten zunächst kritisch gegenüberstanden, diese zu einem „Organ der Gewerkschaften“ zu machen (vgl. Lederer, Emil, Die Gewerkschaftsbewegung 1918/19 und die Entfaltung der wirtschaftlichen Ideologien in der Arbeiterklasse, in: AfSSp, Band 47, 1919/20, S. 219–269, Zitat: S. 245). Politisch getragen wurde dieses Anliegen von MSPD und rechtem USPD-Flügel.
79
werden im Gegenteil eine Unmasse neuer Pfründen für bewährte Parteizugehörige geschaffen, die auch ausgenützt werden. Das Wirtschaftsleben wird politisiert, die Politik ökonomisiert. Zu all diesen Chancen kann man je nach dem letzten Wertstandpunkt grundverschieden stehen. Nur: die Tatsachen liegen so und nicht anders. Die Weimarer Reichsverfassung sah in Art. 165 die Einrichtung eines Reichswirtschaftsrates, bestehend aus Arbeiter- und Wirtschaftsräten, vor. Übergangsweise wurde am 4. Mai 1920 – wenige Wochen vor Webers Tod – per Verordnung ein „vorläufiger Reichswirtschaftsrat“ als „Gutachterorgan der Reichsregierung“ eingesetzt. Der Rat sollte Gesetzentwürfe zu sozial- und wirtschaftspolitischen Fragen „von grundlegender Bedeutung“ vor Einbringung in den Reichstag prüfen. Wie von Weber befürchtet, entstand eine personalintensive Institution: Das Plenum umfaßte 326 Mitglieder aus 10 verschiedenen Berufs- und Vertretergruppen, hinzu kamen (bis 1923) 53 Ausschüsse und Unterausschüsse mit bis zu 30 Mitgliedern sowie die festangestellten Bürokräfte. Vgl. die Angaben des Bürodirektors des vorläufigen Reichswirtschaftsrates: Hauschild, Harry, Der vorläufige Reichswirtschaftsrat 1920–1926. Denkschrift. – Berlin: E.S. Mittler & Sohn 1926, bes. das Vorwort, S. 1–11, Zitate: S. 1 f.
Sowohl die genuine parlamentarische Repräsentation mit voluntaristischem Interessentenbetrieb der Politik, wie die daraus entwickelte plebiszitäre Parteiorganisation mit ihren Folgen, wie der moderne Gedanke rationaler Repräsentation durch Interessenvertreter sind dem Okzident eigentümlich und nur durch die dortige Stände- und Klassen-Entwicklung erklärlich, welche schon im Mittelalter hier, und nur hier, die Vorläufer schuf. „Städte“ und „Stände“ (rex et regnum),
80
„Bürger“ und „Proletarier“ gab es nur hier. „rex et regnum“ ist in mittelalterlichen Quellen eine Formel für den König und sein Reich, worunter aber auch die Polarität von König und Adel (als den Repräsentanten des regnum bzw. populus) verstanden wurde.
[592][A 177]Kapitel IV. Stände und Klassen.
1. Begriffe.
§ 1. „Klassenlage“ soll die typische Chance
1. der Güterversorgung,
2. der äußeren Lebensstellung,
3. des inneren Lebensschicksals
heißen, welche aus Maß und Art der Verfügungsgewalt (oder des Fehlens solcher) über Güter oder Leistungsqualifikationen und aus der gegebenen Art ihrer Verwertbarkeit für die Erzielung von Einkommen oder Einkünften innerhalb einer gegebenen Wirtschaftsordnung folgt.
„Klasse“ soll jede in einer gleichen Klassenlage befindliche Gruppe von Menschen heißen.
a) Besitzklasse soll eine Klasse insoweit heißen, als Besitzunterschiede die Klassenlage primär bestimmen.
b) Erwerbsklasse soll eine Klasse insoweit heißen, als die Chancen der Marktverwertung von Gütern oder Leistungen die Klassenlage primär bestimmen.
c) Soziale Klasse soll die Gesamtheit derjenigen Klassenlagen heißen, zwischen denen ein Wechsel
α. persönlich,
β. in der Generationenfolge
leicht möglich ist und typisch stattzufinden pflegt.
Auf dem Boden aller drei Klassenkategorien können Vergesellschaftungen der Klasseninteressenten (Klassenverbände) entstehen. Aber dies muß nicht der Fall sein: Klassenlage und Klasse bezeichnet an sich nur Tatbestände gleicher (oder ähnlicher) typischer Interessenlagen, in denen der einzelne sich ebenso wie zahlreiche andere befindet. Prinzipiell konstituiert die Verfügungsgewalt über jede Art von Genußgütern, Beschaffungsmitteln, Vermögen, Erwerbsmitteln, Leistungsqualifikation [593]je eine besondere Klassenlage und nur gänzliche „Ungelerntheit“ Besitzloser, auf Arbeitserwerb Angewiesener bei Unstetheit der Beschäftigung eine einheitliche. Die Übergänge von der einen zur anderen sind sehr verschieden leicht und labil, die Einheit der „sozialen“ Klasse daher sehr verschieden ausgeprägt.
a) Die primäre Bedeutung einer positiv privilegierten Besitzklasse liegt in
α. der Monopolisierung hoch im Preise stehender (kostenbelasteter) Verbrauchsversorgung beim Einkauf,
β. der Monopollage und der Möglichkeit planvoller Monopolpolitik beim Verkauf,
γ. der Monopolisierung der Chance der Vermögensbildung durch unverbrauchte Überschüsse,
δ. der Monopolisierung der Kapitalbildungschancen durch Sparen, also der Möglichkeit von Vermögensanlage als Leihkapital, damit der Verfügung über die leitenden (Unternehmer-) Positionen,
[A 178]ε. ständischen (Erziehungs-)Privilegien, soweit sie kostspielig sind.
I. Positiv privilegierte Besitzklassen sind typisch: Rentner. Sie können sein:
a) Menschenrentner (Sklavenbesitzer),
1
[593]Zu den „Menschenbesitzrenten“ vgl. Kap. II, oben, S. 445, Z. 11; dort auch als erster Punkt einer Klassifikation der Rentenarten. Zu Webers Begriffsschöpfung der „Rentensklaven“ vgl. Kap. II, oben, S. 350 mit Hg.-Anm. 1.
b) Bodenrentner,
c) Bergwerksrentner,
d) Anlagenrentner (Besitzer von Arbeitsanlagen und Apparaten),
2
Zu den Anlagenrenten vgl. Kap. II, oben, S. 446 mit Hg.-Anm. 44 und dem dortigen Hinweis auf den Begriff „Anlagen“, oben, S. 307 f.
e) Schiffsrentner,
f) Gläubiger, und zwar:
α. Viehgläubiger,
β. Getreidegläubiger,
γ. Geldgläubiger;
[594]g) Effektenrentner.
II. Negativ privilegierte Besitzklassen sind typisch
a) Besitzobjekte (Unfreie, – s. bei „Stand“),
3
[594] Entsprechende Ausführungen finden sich nicht in Kap. IV, § 3 über Stände, unten, S. 598–600.
b) Deklassierte („proletarii“ im antiken Sinn),
4
Die proletarii standen nach der Volkseinteilung durch Servius Tullius als Bürger der untersten Klasse außerhalb der Zenturienordnung, denn sie konnten dem Staat nur durch ihre Nachkommen, nicht durch ihr Vermögen dienen (vgl. Gellius, Noctae Atticae 16,10). Max Weber richtet sich gegen diese allgemein verwendete Wortbedeutung, die u. a. auch Mommsen vertrat. Er versteht den proletarius als „cives proletarius“, d. h. als Nachfahren eines verschuldeten, aber einst grundsässigen Vollbürgers. Vgl. Weber, Römische Agrargeschichte, MWG I/2, S. 159 f. mit Hg.-Erläuterungen, sowie Weber, Die Stadt, MWG I/22-5, S. 255 mit Hg.-Anm. 162.
c) Verschuldete,
d) „Arme“.
Dazwischen stehen die „Mittelstandsklassen“,
5
welche die mit Besitz oder Erziehungsqualitäten ausgestatteten, daraus ihren Erwerb ziehenden Schichten aller Art umfassen. Einige von ihnen können „Erwerbsklassen“ sein (Unternehmer mit wesentlich positiver, Proletarier mit negativer Privilegierung) Der Doppelbegriff, der den Begriff „Mittelstand“ mit dem Klassenbegriff kombiniert, ist seit der Jahrhundertwende in Deutschland belegbar. Er umfaßt sehr heterogene Berufsgruppen, die zwischen Großkapitalisten und Lohnarbeitern anzusiedeln sind: den alten Mittelstand, d. h. selbständig wirtschaftende Handwerker, Detailhändler und Landwirte, sowie den neuen Mittelstand, der sich aus abhängig Beschäftigten (Beamten, Privatangestellten), Grundstücks- und Hausbesitzern und den freien Berufen (Ärzte, Rechtsanwälte, Künstler) zusammensetzt.
a
. Aber nicht alle (Bauern, Handwerker, Beamte)[594]Schließende Klammer fehlt in A.
6
sind es. Weber meint hier öffentliche und private Beamte, vgl. unten, S. 596, Buchstabe a) zu „Mittelklassen“, Z. 15.
Die reine Besitzklassengliederung ist nicht „dynamisch“, d. h. sie führt nicht notwendig zu Klassenkämpfen und Klassenrevolutionen. Die stark positiv privilegierte Besitzklasse der Menschenrentner z. B. steht neben der weit weniger positiv privilegierten der Bauern, ja der Deklassierten oft ohne alle Klassengegensätze, zuweilen mit Solidarität (z. B. gegenüber den Unfreien). Nur kann der Besitzklassengegensatz:
1. Bodenrentner – Deklassierter,
[595]2. Gläubiger – Schuldner (oft = stadtsässiger Patrizier – landsässiger Bauer oder stadtsässiger Kleinhandwerker),
zu revolutionären Kämpfen führen, die aber nicht notwendig eine Änderung der Wirtschaftsverfassung, sondern primär lediglich der Besitzausstattung und -verteilung bezwecken (Besitzklassenrevolutionen).
Für das Fehlen des Klassengegensatzes war die Lage des „poor white trash“ (sklavenlose Weiße)
7
zu den Pflanzern in den Südstaaten klassisch. Der poor white trash war noch weit negerfeindlicher als die in ihrer Lage oft von patriarchalen Empfindungen beherrschten Pflanzer. Für den Kampf der Deklassierten gegen die Besitzenden bietet die Antike die Hauptbeispiele,[595]Der Ausdruck „poor white trash“ („armer weißer Dreck“) wurde Mitte der 1850er Jahren in den USA allgemein gebräuchlich, um die besitzlose weiße Unterschicht in den Südstaaten zu bezeichnen (vgl. dazu Weber, Die Stadt, MWG I/22-5, S. 254, und Weber, Ethnische Gemeinschaften, MWG I/22-1, S. 178 f. mit Hg.-Anm. 20). Über den Zusammenhang der sog. Rassen- und Klassenfrage vgl. Max Webers Brief an W.E.B. Du Bois, vor dem 8. November 1904, University of Massachusetts Library, Amherst (MWG II/4).
8
ebenso für den Gegensatz: Gläubiger – Schuldner und: Bodenrentner – Deklassierter. Radikale Vertreter der Deklassierten, verschuldete Freie, die im Altertum mit Schuldverknechtung und -Versklavung rechnen mußten, forderten Neuverteilung des Bodens und Schuldenerlaß. Bekanntestes Beispiel einer Schuldenenthebung (Seisachthie) sind die Solonischen Reformen Ende des 6. Jahrhunderts v. Chr. in Athen. Vgl. Weber, Agrarverhältnisse3, MWG I/6, S. 490 f.
§ 2. b)
9
Die primäre Bedeutung einer positiv privilegierten Erwerbsklasse liegt in: Der Gliederungsbuchstabe knüpft an die Gliederung zu „Klassen“ in § 1, oben, S. 592, Z. 17, an.
α. der Monopolisierung der Leitung der Güterbeschaffung im Interesse der Erwerbsinteressen ihrer Klassenglieder durch diese,
β. der Sicherung ihrer Erwerbschancen durch Beeinflussung der Wirtschaftspolitik der politischen und andren Verbände.
I. Positiv privilegierte Erwerbsklassen sind typisch: Unternehmer:
a) Händler,
b) Reeder,
c) gewerbliche Unternehmer,
[596]d) landwirtschaftliche Unternehmer,
e) Bankiers und Finanzierungsunternehmer, unter Umständen:
f) mit bevorzugten Fähigkeiten oder bevorzugter Schulung ausgestattete „freie Berufe“ (Anwälte, Ärzte, Künstler),
[A 179]g) Arbeiter mit monopolistischen Qualitäten (eigenen oder gezüchteten und geschulten).
II. Negativ privilegierte Erwerbsklassen sind typisch: Arbeiter in ihren verschiedenen qualitativ besonderten Arten:
a) gelernte,
b) angelernte,
c) ungelernte.
Dazwischen stehen auch hier als „Mittelklassen“ die selbständigen Bauern und Handwerker. Ferner sehr oft:
a) Beamte (öffentliche und private),
b) die unter I f erwähnte Kategorie und die Arbeiter mit ausnahmsweisen (eignen oder gezüchteten oder geschulten) monopolistischen Qualitäten.
c)
10
Soziale Klassen sind [596] Der Gliederungsbuchstabe c) setzt die Ausführungen zu „c) Soziale Klasse“ (oben, S. 592, Z. 20) fort.
α. die Arbeiterschaft als Ganzes, je automatisierter der Arbeitsprozeß wird,
β. das Kleinbürgertum und
γ. die besitzlose Intelligenz und Fachgeschultheit (Techniker, kommerzielle und andere „Angestellte“, das Beamtentum, untereinander eventuell sozial sehr geschieden, je nach den Schulungskosten),
δ.
b
[596]A: d) und ausgerückte Zeile.
11
die Klassen der Besitzenden und durch Bildung Privilegierten. Hier werden vier (α bis δ) soziale Klassen aufgeführt, weshalb d) zu δ emendiert wurde.
Der abgebrochene Schluß von K[arl] Marx’ Kapital wollte sich offenbar mit dem Problem der Klasseneinheit des Proletariats trotz seiner qualita[597]tiven Differenzierung befassen.
12
Die steigende Bedeutung der an den Maschinen selbst innerhalb nicht allzu ausgedehnter Fristen angelernten auf Kosten der „gelernten“ sowohl, wie zuweilen auch der „ungelernten“ Arbeit ist dafür maßgebend. Immerhin sind auch angelernte Fähigkeiten oft Monopolqualitäten (Weber erreichen zuweilen typisch das Höchstmaß der Leistung nach 5 Jahren!).[597] Der dritte und letzte Band von Marx, Das Kapital, war 1894 postum erschienen. In dem kurzen, unvollendeten Kapitel „Die Klassen“ (ebd., III,2, S. 421 f.; ΜΕGΑ II/15, S. 856–859) hält Marx an den drei „großen gesellschaftlichen Klassen“ – Lohnarbeiter, Kapitalisten und Grundeigentümer – fest, obwohl es in jeder eine „unendliche Zersplitterung der Interessen und Stellungen“ gebe (ebd., S. 422; MEGA II/15, S. 859). Dann bricht der Text ab. Zur Differenzierung des Proletariats gibt es hingegen einige Bemerkungen im 17. Abschnitt „Der kommerzielle Profit“ (ebd., III,1, S. 264–286; MEGA II/15, S. 276–296). Dort wird „der kommerzielle Arbeiter“ „der besser bezahlten Klasse von Lohnarbeitern“ zugerechnet und durch höher qualifizierte Arbeit gekennzeichnet (ebd., S. 284 f.; MEGA II/15, S. 294 f.). In einer Anmerkung von Friedrich Engels heißt es zu dieser Stelle: „Eine Lücke von zwei Seiten im Manuskript deutet an, daß dieser Punkt noch weiter entwickelt werden sollte.“ (ebd., S. 285; MEGA II/15, S. 295).
13
Der Übergang zum „selbständigen“ Kleinbürger wurde früher von jedem Arbeiter als Ziel erstrebt. Aber die Möglichkeit der Realisierung ist immer geringer. In der Generationenfolge ist sowohl für α Bei der Maschinenweberei sei der „Höhepunkt der Geübtheit“ bei „etwa 5 Jahren“ anzusetzen, vgl. Weber, Zur Psychophysik der industriellen Arbeit, MWG I/11, S. 288, Fn. 41.
c
[597]A: a
14
wie für β Hier und im folgenden sind griechische Buchstaben erforderlich, da sie die Gliederungspunkte α bis δ unter „c) Soziale Klassen“ wieder aufgreifen. Die lateinischen Buchstaben der Druckfassung wurden emendiert.
d
der „Aufstieg“ zur sozialen Klasse γA: b
e
(Techniker, Kommis) relativ am leichtesten. Innerhalb der Klasse δA: c
f
kauft Geld zunehmend – mindestens in der Generationenfolge – Alles. Klasse γA: d
h
hat in den Banken und Aktienunternehmungen, die BeamtenA: c
15
die Chancen des Aufstiegs zu δ Der Satz ist in der Druckfassung verderbt. Gemeint ist aber, daß einerseits Privatangestellte und andererseits öffentliche Beamte Aufstiegschancen haben.
i
.A: d
g
Satzverderbnis in A.
Vergesellschaftetes Klassenhandeln ist am leichtesten zu schaffen
a) gegen den unmittelbaren Interessengegner (Arbeiter gegen Unternehmer, nicht: Aktionäre, die wirklich „arbeitsloses“ Einkommen beziehen, auch nicht: Bauern gegen Grundherren),
b) nur bei typisch massenhaft ähnlicher Klassenlage,
c) bei technischer Möglichkeit leichter Zusammenfassung, insbesondere bei örtlich gedrängter Arbeitsgemeinschaft (Werkstattgemeinschaft),
[598]d) nur bei Führung auf einleuchtende Ziele, die regelmäßig von Nicht-Klassenzugehörigen (Intelligenz) oktroyiert oder interpretiert werden.
§ 3. Ständische Lage soll heißen eine typisch wirksam in Anspruch genommene positive oder negative Privilegierung in der sozialen Schätzung, begründet auf:
a) Lebensführungsart, – daher
b) formale Erziehungsweise, und zwar
α. empirische oder:
β. rationale Lehre[,] und den Besitz der entsprechenden Lebensformen;
c) Abstammungsprestige oder Berufsprestige.
Praktisch drückt sich ständische Lage aus vor allem in:
α. connubium,
β. Kommensalität, – eventuell:
γ. oft: monopolistischer Appropriation von privilegierten Erwerbschancen oder Perhorreszierung bestimmter Erwerbsarten,
[A 180]δ.
k
[598]A: d) doppelter Einzug fehlt in A.
16
ständischen Konventionen („Traditionen“) anderer Art. [598]„Ständische Konventionen“ sind ein weiteres Kriterium für den praktischen Ausdruck ständischer Lage, daher wurde die Ziffer ,,d)“ in „δ“ geändert.
Ständische Lage kann auf Klassenlage bestimmter oder mehrdeutiger Art ruhen. Aber sie ist nicht durch sie allein bestimmt: Geldbesitz und Unternehmerlage sind nicht schon an sich ständische Qualifikationen, – obwohl sie dazu führen können –, Vermögenslosigkeit nicht schon an sich ständische Disqualifikation, obwohl sie dazu führen kann. Andrerseits kann ständische Lage eine Klassenlage mit- oder selbst allein bedingen, ohne doch mit ihr identisch zu sein. Die Klassenlage eines Offiziers, Beamten, Studenten, bestimmt durch sein Vermögen, kann ungemein verschieden sein, ohne die ständische Lage zu differenzieren, da die Art der durch Erziehung geschaffenen Lebensführung in den ständisch entscheidenden Punkten die gleiche ist.
[599]„Stand“ soll eine Vielheit von Menschen heißen, die innerhalb eines Verbandes wirksam
a) eine ständische Sonderschätzung, – eventuell also auch
b) ständische Sondermonopole in Anspruch nehmen.
Stände können entstehen
a) primär, durch eigene ständische Lebensführung, darunter insbesondere durch die Art des Berufs (Lebensführung- bzw. Berufsstände),
b) sekundär, erbcharismatisch, durch erfolgreiche Prestigeansprüche kraft ständischer Abstammung (Geburtsstände),
c) durch ständische Appropriation von politischen oder hierokratischen Herrengewalten als Monopole (politische bzw. hierokratische Stände).
Die geburtsständische Entwicklung ist regelmäßig eine Form der (erblichen) Appropriation von Privilegien an einen Verband oder an qualifizierte einzelne. Jede feste Appropriation von Chancen, insbesondere Herrenchancen,
17
neigt dazu, zur Ständebildung zu führen. Jede Ständebildung neigt dazu, zur monopolistischen Appropriation von Herrengewalten und Erwerbschancen zu führen. [599] Der Ausdruck „Herrenchancen“ kommt im Werk Max Webers nur an dieser Stelle vor. Im Gegensatz zu „Herrengewalten“ könnten hier Chancen gemeint sein, die an die Herrenstellung geknüpft sind.
Während Erwerbsklassen auf dem Boden der marktorientierten Wirtschaft wachsen, entstehen und bestehen Stände vorzugsweise auf dem Boden der monopolistisch leiturgischen oder der feudalen oder der ständisch patrimonialen Bedarfsdeckung von Verbänden. „Ständisch“ soll eine Gesellschaft heißen, wenn die soziale Gliederung vorzugsweise nach Ständen, „klassenmäßig“, wenn sie vorzugsweise nach Klassen geschieht. Dem „Stand“ steht von den „Klassen“ die „soziale“ Klasse am nächsten, die „Erwerbsklasse“ am fernsten. Stände werden oft ihrem Schwerpunkt nach durch Besitzklassen gebildet.
Jede ständische Gesellschaft ist konventional, durch Regeln der Lebensführung, geordnet, schafft daher ökonomisch irrationale Konsumbedingungen und hindert auf diese Art durch monopolistische Appropriationen und durch Ausschaltung der [600]freien Verfügung über die eigne Erwerbsfähigkeit die freie Marktbildung. Davon gesondert.
l
[600]Hier endet Kap. IV; weitere Ausführungen sind nicht überliefert. Vgl. die Übersicht zum Editorischen Bericht, oben, S. 108 f.
18
[600]Entsprechende Ausführungen finden sich nur in der älteren Fassung von „Wirtschaft und Gesellschaft“, vgl. Weber, Patrimoniale und feudale Strukturformen der Herrschaft in ihrem Verhältnis zur Wirtschaft, MWG I/22-4, S. 425–443. Neuere Ausführungen sind nicht überliefert.