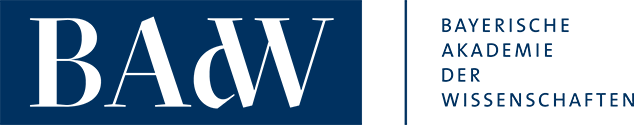[1]Einleitung
1. Der Charakter der Vorträge „Wissenschaft als Beruf“ und „Politik als Beruf“
Max Webers Vorträge „Wissenschaft als Beruf“ und „Politik als Beruf“ sind Schlüsseltexte für seine Antworten auf zentrale Fragen der modernen Kultur. Manche sehen in ihnen gar Bausteine einer auch heute noch richtungweisenden Konfession. Tatsächlich antwortete er hier noch direkter als sonst in grundsätzlicher Weise auf die geistige und politische Situation seiner Zeit, auf die damit verbundenen Sinnfragen. Dies gibt den beiden Vorträgen ihren inneren Zusammenhang. Doch neben dem inneren steht der äußere. Die Vorträge waren durch denselben Anlaß und denselben Adressatenkreis motiviert. Dies vor allem ist der Grund, weshalb sie hier gemeinsam ediert werden. Anders als bei den von Marianne Weber und von Johannes Winckelmann besorgten Ausgaben, ist „Wissenschaft als Beruf“ absichtlich nicht dem Korpus der Schriften zur Wissenschaftslehre und „Politik als Beruf“ absichtlich nicht dem Korpus der Schriften zur Politik einverleibt.
Die beiden Vorträge unterscheiden sich sowohl von Webers wissenschaftlichen Abhandlungen oder akademischen Vorlesungen als auch von seinen politischen Artikeln oder Wahlreden. Sie verfolgen ein anderes Ziel. Es sind ‚philosophische‘ Texte, mit denen der einzelne zu Tatsachenerkenntnis und Selbstbestimmung hingeführt und zugleich für verantwortungsvolle Arbeit im Dienste einer überpersönlichen Sache gewonnen werden soll. An der Bereitschaft zu solcher entsagungsvoller Arbeit in der Spannung von Hingabe und Distanz hing für Weber die Zukunft sowohl der deutschen Nation wie der modernen Kultur. Beide waren für ihn aufeinander bezogen. Die Sorge um den Zustand der Nation verband sich bei ihm mit der Sorge um den Zustand der modernen Kultur.
1
Max Weber dachte national.[1] Vgl. Jaspers, Karl, Max Weber. Politiker, Forscher, Philosoph, 2. Aufl. – München: Piper 1958, hier zitiert nach Jaspers, Karl, Max Weber. Gesammelte Schriften. – München: Piper 1988, S. 81 (hinfort: Jaspers, Max Weber).
2
[2]Und doch bekämpfte er diejenigen, die den ‚deutschen Geist‘ als ein „Eigenes, Selbstgewachsenes und Höheres“ dem aufklärerischen demokratischen Individualismus Westeuropas und Amerikas entgegensetzten.Karl Jaspers stilisierte Weber 1958 sogar zum „letzte[n] nationale[n] Deutsche[n]“. Vgl. ebd., S. 50. National heißt natürlich weder nationalistisch noch gar chauvinistisch. Auf diesen Unterschied war Weber selber sehr bedacht. National heißt auch nicht staatlich. Nation ist Weber vielmehr ein ‚innerer‘, Staat dagegen ein ‚äußerer‘ Wert. Freilich müssen Nation und Staat, innere und äußere Seite, aufeinander bezogen werden. Doch die eine repräsentiert den ‚Geist‘, die andere die ‚Form‘. Über die problematischen Aspekte von [2]Webers politischem Denken in dieser Hinsicht die grundlegende Arbeit von Mommsen, Wolfgang J., Max Weber und die deutsche Politik 1890–1920, 2. Aufl. – Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) 1974 (hinfort: Mommsen, Max Weber). Für Jaspers war Weber zugleich „der größte Deutsche unseres Zeitalters“. Vgl. Jaspers, Max Weber, S. 50.
3
Max Weber dachte aber auch kosmopolitisch. Und doch bekämpfte er jene gesinnungsethischen Pazifisten, die die Notwendigkeit eines deutschen nationalen Machtstaates und die damit einhergehende „Verantwortung vor der Geschichte“ leugneten.So etwa Maurenbrecher, Max, Der Krieg als Ausgangspunkt einer deutschen Kultur, in: Die Tat. Monatsschrift für die Zukunft deutscher Kultur, 9. Jg., 1917, S. 104. Mit Maurenbrecher und seinen Auffassungen setzte sich Weber vor allem auf den beiden Lauensteiner Kulturtagungen im Jahre 1917 kritisch auseinander (MWG I/15, S. 701–707).
4
Auch als das Deutsche Reich am Ende des Ersten Weltkriegs aufgrund seiner ‚Gefühls- und Eitelkeitspolitik‘, die nicht nur von feudal-konservativen, sondern auch von bürgerlichen Kreisen unterstützt worden war, am Boden lag,Vgl. u. a. MWG I/15, S. 95ff. Die Deutschen sollten rückhaltlos friedlich ihre Eigenart im Kreis des Völkerbunds pflegen. Aber ob man in diesem Sinne nationaler Pazifist sein könne, hänge, so wünschenswert dies auch sei, nicht nur von den Deutschen selber ab. Vgl. dazu MWG I/16, S. 109.
5
hoffte er, in Abwandlung eines Wortes von Treitschke, auf seine dritte Jugend.Zur Gefahr dieser Politik, die sich insbesondere im Streben nach einem Siegfrieden und in damit verbundenen Annexionsgelüsten äußerte, bereits Webers Ausführungen über „Deutschland unter den europäischen Weltmächten“ Ende 1916 (MWG I/15, S. 153–194, bes. S. 164–169).
6
Wollte man diese Chance einer dritten Jugend nutzen, so mußte das politische Handeln eine Entwicklungslinie wieder aufnehmen und weiterführen, die mit den Ereignissen von 1806/1807 und von 1848/1849 begonnen hatte. Dies setzte voraus, daß sich das Bürgertum politisch endlich auf eigene Füße stellte und seine Kräfte mit denen der Arbeiterschaft zu sachlicher Politik zusammenführte,Vgl. dazu etwa Webers Rede über Deutschlands Wiederaufrichtung am 2. Januar 1919 in Heidelberg vor einem vorwiegend studentischen Publikum, über die mehrere Zeitungsberichte existieren (MWG I/16, S. 415–428, bes. S. 419–420).
7
ferner: daß die akademische Jugend sich an diesem historischen Bündnis aktiv beteiligte. Dazu mußte sie Abschied nehmen von Illusionen: von der Illusion, man könne die rationale, wissenschaftsbestimmte Erkenntnis [3]durch das Erlebnis ersetzen, aber auch von der Illusion, eine Gesinnungspolitik, die nicht nur die Realitäten Deutschlands, sondern die des Lebens souverän mißachtet, sei authentischer als eine rationale, machtbezogene Verantwortungspolitik. Die beiden Vorträge waren Reden an die deutsche akademische und demokratische Jugend,Vgl. dazu etwa die Formulierungen in „Deutschlands künftige Staatsform“, MWG I/16, S. 106–107, wo es unter anderem heißt: Weit entscheidender als bestimmte staatstechnische Lösungen sei die Frage, „ob das Bürgertum in seinen Massen einen neuen verantwortungsbereiteren und selbstbewußteren politischen Geist anziehen wird. Bisher herrschte seit Jahrzehnten der Geist der ,Sekurität‘: der Geborgenheit im obrigkeitlichen Schutz, der ängstlichen Sorge vor jeder Kühnheit der Neuerung, kurz: der feige Wille zur Ohnmacht.“ In ähnlicher Form hatte Weber bereits vor der Jahrhundertwende, etwa in der Freiburger Antrittsvorlesung, gegen das satte Bürgertum polemisiert.
8
sie waren und sind Reden über die individuelle und politische Selbstbestimmung unter den Bedingungen der modernen Kultur. [3] Vgl. in diesem Zusammenhang auch den Aufruf der DDP an die demokratische Jugend vom 30. Januar 1919, den auch Max Weber unterschrieb, abgedruckt in MWG I/16, S. 514–517.
Um den geistigen und politischen Zustand, den „Weltzustand überhaupt“,
9
ins Bewußtsein der Hörer, dann: der Leser zu rufen, genügte es also nicht, nur das nationale Schicksal zu diagnostizieren. Eine universalgeschichtliche Perspektive war verlangt. Weber hatte sie sich mit einer vergleichend und entwicklungsgeschichtlich ausgerichteten Kulturwissenschaft erarbeitet, die die wertbezogene und zugleich werturteilsfreie Erforschung der Eigenart aller großen Kulturkreise umfaßte. Auf diesem Hintergrund erst traten die Eigenart des okzidentalen Kulturkreises und die mit ihm verbundenen Lebensprobleme, aber auch die Lebensprobleme Deutschlands in helles Licht. Das heißt zugleich, daß die Vorträge nicht allein eine praktische Absicht verfolgten, sondern auch eine Summe gaben, und zwar eine Summe sowohl von Webers wichtigsten kulturwissenschaftlichen Erkenntnissen wie von seinen wichtigsten politischen Überzeugungen.So Jaspers, Max Weber, S. 81.
10
Diese Feststellung schließt natürlich nicht aus, daß dabei auch ‚Erfahrungen des Tages‘ mitschwingen, insbesondere in „Politik als Beruf“. Vgl. dazu die Einleitung von Wolfgang J. Mommsen in MWG I/16, S. 17f.
Doch fragen wir zunächst: Wie ist es gerade zu diesen beiden Vorträgen gekommen? Obgleich sie zusammengehören, bilden sie doch keine Einheit. Sie behandeln nicht nur verschiedene Themen, sie sind auch nicht zur selben Zeit entstanden, wenngleich vermutlich zur selben Zeit druckfertig gemacht. Die Vorträge selber wurden in einem Abstand von über einem Jahr, „Wissenschaft als Beruf“ am 7. November 1917, „Politik als Beruf“ am 28. Januar 1919, gehalten.
11
Zwischen diesen Daten liegen die endgültige militärische Niederlage des Deutschen Reiches und die Novemberrevolution. Zwischen diesen Daten liegen aber auch Webers Rückkehr zu den bei Kriegsbeginn verlassenen Manuskripten über die Wirtschaft und die gesellschaftlichen Ordnungen und MächteZur Datierung der Vorträge unten, S. 43–46.
12
und die weitere Um- und Aus[4]arbeitung der vergleichenden Studien über die Wirtschaftsethik der Kulturreligionen, deren Veröffentlichung inzwischen bis zum antiken Judentum fortgeschritten war. Zwischen diesen Daten liegen schließlich aber auch die Fortführung der Publizistik zu außen- und zunehmend auch innenpolitischen, insbesondere verfassungspolitischen Fragen sowie die Teilnahme am Wahlkampf für die deutsche Nationalversammlung,Obgleich der genaue Zeitpunkt, zu dem Weber die Arbeit an diesen verlassenen Manuskripten wieder aufnahm, nicht bekannt ist, kann man aus dem Titel der Vorlesung, die er im Sommersemester 1918 in Wien hielt, schließen, daß er dabei zumindest auch auf Teile seines noch unveröffentlichten Beitrags zum Grundriß der Sozialökonomik zurück[4]gegriffen hat. Der Vorlesungstitel lautete gemäß Vorlesungsverzeichnis: „Wirtschaft u. Gesellschaft (Positive Kritik der materialistischen Geschichtsauffassung)“. Nach Marianne Weber trug Weber die Ergebnisse seiner religions- und herrschafts- bzw. staatssoziologischen Forschungen vor, also vermutlich zwei Kernstücke aus der alten Fassung von „Die Wirtschaft und die gesellschaftlichen Ordnungen und Mächte“ für den Grundriß. Vgl. Weber, Marianne, Max Weber. Ein Lebensbild. – Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) 1926 (Nachdruck = 3. Aufl. Tübingen 1984), S. 617 (hinfort: Weber, Marianne, Lebensbild1), und zur Ergänzung Heuss, Theodor, Erinnerungen 1905–1933, 5. Aufl. – Tübingen: Rainer Wunderlich Verlag Hermann Leins 1964, S. 225 (hinfort: Heuss, Erinnerungen). Weber hatte bereits am 25. Oktober 1917 die Grundzüge seiner Herrschaftssoziologie in Wien vorgetragen. Darüber existiert ein Zeitungsbericht. Vgl. Neue Freie Presse, Nr. 19 102 vom 26. Okt. 1917, S. 10.
13
den er für die neugegründete Deutsche Demokratische Partei auch dann noch führte, als die Kandidatur für ein Mandat unter ihn verletzenden Umständen bereits gescheitert war.Weber hatte 1917 begonnen, in Fortsetzungen größere politische Artikel zu, wie er formulierte, „staatstechnischen Fragen“ einer Neuordnung Deutschlands für die Frankfurter Zeitung zu schreiben, war im November 1918 gar vorübergehend als eine Art freier Mitarbeiter in deren Redaktion eingetreten und machte ab Dezember 1918 Wahlkampf für die neugegründete DDP. Die wohl wichtigsten Ergebnisse seines politischen Journalismus sind die in der Frankfurter Zeitung erschienenen Artikelfolgen „Deutscher Parlamentarismus in Vergangenheit und Zukunft“ und „Die Staatsform Deutschlands“, die auch als eigenständige Broschüren „Parlament und Regierung im neugeordneten Deutschland“ (MWG I/15, S. 432–596) bzw. „Deutschlands künftige Staatsform“ (MWG I/16, S. 97–146) veröffentlicht wurden, sowie ferner die Schrift „Wahlrecht und Demokratie in Deutschland“ (MWG I/15, S. 347–396).
14
Diese werk- und zeitgeschichtlichen Zusammenhänge motivieren dazu, sich etwas eingehender mit der Entstehungsgeschichte der Vorträge zu beschäftigen. Die weitere umfaßt vor allem die Werkgeschichte seit Webers Ausscheiden aus dem militärischen Dienst am 30. September 1915,Vgl. dazu u. a. die Einleitung von Wolfgang J. Mommsen zu MWG I/16, S. 15f.
15
die engere vor allem seine Verbindung mit dem [5]Freistudentischen Bund, Landesverband Bayern in München, der die Vortragsreihe „Geistige Arbeit als Beruf“ plante und durchführte.Vgl. dazu MWG I/15, S. 23f. Weber, der wegen der bevorstehenden Auflösung der Reserve-Lazarettkommission und der damit einhergehenden Neuordnung der Befehlsverhältnisse um seine Entlassung nachgesucht hatte, trug ab 1. Oktober 1915 wieder Zivil, ging aber noch für einige Zeit regelmäßig ins Büro, um seinen Nachfolger einzuarbeiten. Vgl. Brief Marianne Weber an Helene Weber vom 1. Okt. 1915, Bestand Max Weber-Schäfer, Deponat BSB München, Ana 446: „Ja, u. Max spaziert heute zum ersten Mal wieder in Civil herum, freilich noch den ganzen Tag in’s Büro, denn sein Nachfolger ist der Aufgabe garnicht gewachsen, u. man weiß nicht[,] wie’s werden soll. – Ich bin doch traurig u. mißvergnügt, daß Max diese Arbeit[,] mit der er nun doch so ganz verwachsen ist u. der er sich trotz ihres aufreibenden ‚Stumpfsinns‘ mit ergreifender Pflichttreue hingegeben hat[,] vor dem Ende des Krieges verlassen muß.“
16
[5] Zu Plan und Durchführung der Vortragsreihe siehe die Editorischen Berichte.
2. Die weitere Entstehungsgeschichte der Vorträge: Max Weber als politischer Redner und akademischer Lehrer
Beginnen wir mit der weiteren Entstehungsgeschichte. Vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs arbeitete Max Weber intensiv an seinen Beiträgen für den Grundriß der Sozialökonomik.
17
Mit Ausbruch des Ersten Weltkriegs verließ er seinen Schreibtisch und damit eine Reihe weit gediehener, aber noch nicht abgeschlossener Manuskripte. Im darauffolgenden Jahr verrichtete er vornehmlich eine zeitraubende und einförmige wissenschaftsferne Verwaltungstätigkeit als Militärisches Mitglied in der Heidelberger Reserve-Lazarettkommission. Nahezu zeitgleich mit dem Ausscheiden aus diesem Dienst begann er die religionssoziologischen Skizzen zur Wirtschaftsethik der Weltreligionen zu veröffentlichen, deren Um- und Ausarbeitung ihn dann ab Winter 1915/16 wissenschaftlich vor allem beschäftigte. Zugleich griff er mit ersten politischen Artikeln in die Außenpolitik, insbesondere die Kriegspolitik, ein.Zu den werkgeschichtlichen Zusammenhängen vgl. Schluchter, Wolfgang, Religion und Lebensführung, 2 Bände. – Frankfurt: Suhrkamp 1988, Band 2, Kap. 13 und 14, S. 557–634 (hinfort: Schluchter, Lebensführung).
18
Weber hoffte zunächst auf eine politische Verwendung. Nicht zuletzt deshalb ging er Mitte November 1915 nach Berlin. Doch obgleich er sich dort mit Unterbrechungen bis Mitte 1916 bereithielt, kam es, außer zu seiner Mitarbeit in eher ‚privaten‘ Vereinigungen wie Friedrich Naumanns Arbeitsausschuß für Mitteleuropa und einem Ausschuß des Vereins für Sozialpolitik, nur zu sporadischen informellen Kontakten mit hochrangigen Regierungsbeamten, nicht aber zu einer ihn befriedigenden Chance, auf den politischen Entscheidungsprozeß Einfluß zu nehmen.Vgl. vor allem die Abhandlungen „Zur Frage des Friedenschließens“ und „Bismarcks Außenpolitik und die Gegenwart“ in MWG I/15, S. 49–92, die noch 1915 verfaßt sind. Weber orientiert sich bei seinen außenpolitischen Analysen an den Gesichtspunkten militärische Sicherheit, ökonomische Interessengemeinschaft und nationale Kulturgemeinschaft. Diese drei rationalen Prinzipien der Außenpolitik müßten von jeder Nation zu einem tragfähigen Ausgleich gebracht werden, so auch von Deutschland. Vgl. dazu MWG I/15, S. 189. Weber trat von Beginn an für einen Verständigungsfrieden ein, gegen die Annexion Belgiens im Westen, für einen polnischen Nationalstaat als Puffer gegen Rußland im Osten.
19
Weber nutzte diese Zeit deshalb vor allem dazu, Literatur zu China und [6]Indien durchzuarbeiten.Vgl. dazu MWG I/15, S. 126–130, S. 134–152 und S. 645–647.
20
Die Hinduismusstudie, die er 1916/17 in drei Folgen im Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, als Fortsetzung der Konfuzianismusstudie[6] Vgl. etwa Brief von Max Weber an Marianne Weber von „Dienstag“ [16. Mai 1916], Bestand Max Weber-Schäfer, Deponat BSB München, Ana 446: „Ich fühle mich so wohl und arbeitsfähig, sobald ich mit chinesischen und indischen Sachen zu schaffen habe; sehne mich sehr danach.“
21
und auf der Grundlage eines jener 1914 verlassenen Manuskripte, veröffentlichte,MWG I/19.
22
ist bereits Resultat dieser intensiven wissenschaftlichen Beschäftigung.Demnächst MWG I/20.
23
Nachdem die vor Ausbruch des Krieges bereits untersuchten „chinesischen und indischen Sachen“ auf diese Weise abermals durchforscht waren, vertiefte er sich im Herbst 1916 ebenfalls erneut in das Judentum. Er arbeitete am Alten Testament und analysierte dabei besonders „die Propheten, Psalmen u. das Buch Hiob“.Zu diesem Aspekt der Werkgeschichte vgl. Schluchten Lebensführung, Band 2, Kap. 13, S. 557–596 sowie die Editorischen Berichte zu MWG I/19, S. 31ff. und demnächst zu I/20.
24
Gerade die vorexilischen Unheilspropheten mit ihrer Unabhängigkeit von den politischen Autoritäten und vom Demos, aber auch mit ihrer außenpolitischen Orientierung sprachen ihn jetzt besonders an. Gab es nicht gewisse Ähnlichkeiten zwischen der außenpolitischen Lage Altisraels und der des Deutschen Reiches? Und fühlte er sich nicht mit Blick auf diese Lage politisch zunehmend selbst in die Rolle der vorexilischen Unheilspropheten gedrängt? In den ab 1917 veröffentlichten Folgen über das antike JudentumBrief von Marianne Weber an Helene Weber vom 12. Okt. [1916], Bestand Max Weber-Schäfer, Deponat BSB München, Ana 446. Die entsprechende Passage des Briefes lautet: „Der Max hat sich jetzt grade in das alte Testament vertieft, analysiert die Propheten, Psalmen u. das Buch Hiob – u. liest mir abends manchmal ein bißchen vom Neusten vor – das tut dann gut nach all der Tagesverzettlung.“
25
setzte er diesen ersten politischen Demagogen der Weltgeschichte ein eindrucksvolles literarisches Denkmal, das in der historischen Thematik auf das Aktuelle weist.Demnächst MWG I/21.
26
So schien er zwischen der Gegenwart und den ent[7]ferntesten Vergangenheiten zu pendeln. Aber die chinesischen, indischen und jüdischen Welten waren ihm offenbar nicht nur Vergangenheiten, sondern zugleich andere Gegenwarten.Über die Rolle der vorexilischen Propheten Schluchter, Lebensführung, Band 2, Kap. 7,4, S. 173ff.; über den Umschlag der historischen Thematik ins Aktuelle, genauer: ins Persönlich-Aktuelle Weber, Marianne, Lebensbild1, S. 604–605. Weber, so ihre Einschätzung, seien jetzt, 1916, die vorexilischen Unheilspropheten „als die ersten geschichtlich beglaubigten ‚politischen Demagogen‘“ erschienen, und besonders seine Analyse des Jeremia habe wie die der Puritaner „starke innere Beteiligung durchschimmern“ lassen. Gelegentlich einer Rede am 1. Dezember 1918 formulierte Weber sein Bedürfnis nach Unabhängigkeit in politischen Fragen laut Zeitungsbericht wie folgt: Er trete, obgleich er vielen Mitgliedern der Sozialdemokratie bis zur Ununterscheidbarkeit nahestehe, dieser Partei dennoch nicht bei, „weil er auf die Unabhängigkeit seiner Meinungsäußerung dem Demos gegenüber noch weniger verzichten könne wie gegenüber autoritären Gewalten“. MWG I/16, S. 379.
27
[7] Vgl. dazu die schöne Bemerkung von Karl Jaspers über das Verhältnis von Gegenwarts- und Vergangenheitsbewußtsein bei Weber in Jaspers, Max Weber, S. 83.
Das Jahr 1916 brachte nicht allein die Um- und Ausarbeitung wichtiger wissenschaftlicher Texte und erste Ergebnisse einer aktiv in die Tagespolitik eingreifenden politischen Publizistik, sondern auch die Eroberung der politischen ‚Rednertribüne‘. Auf die erste öffentliche politische Rede seit der Krankheit, auf die Nürnberger Rede am 1. August für den „Deutschen National-Ausschuß für einen ehrenvollen Frieden“, bei der er sich „auf Anweisung“ noch zurückhielt,
28
folgte die große Rede über „Deutschlands weltpolitische Lage“ für den Fortschrittlichen Volksverein am 27. Oktober 1916 in München,Vgl. dazu den Editorischen Bericht und die dort abgedruckten Zeitungsberichte über die Rede in MWG I/15, S. 648–689.
29
die er auch für den Druck ausarbeitete.MWG I/15, S. 690–700.
30
Hatte er in Nürnberg noch eher vorsichtig formuliert und die Vertreter eines Siegfriedens eher schonungsvoll behandelt, so ließ er jetzt alle politischen Rücksichten, insbesondere gegenüber den Alldeutschen, fallen. Er war nun tatsächlich in die von den vorexilischen Unheilspropheten vorgeprägte Rolle des politischen Demagogen geschlüpft. Weber rechnete schonungslos mit der Prestigepolitik der Rechten ab, zeigte die in seinen Augen in erster Linie politischen, nicht wirtschaftlichen Kriegsursachen auf, deren wichtigste sei: die Bedrohung eines selbständigen deutschen nationalen Machtstaats durch Rußland. Schon deshalb sei Deutschlands Kriegseintritt gerechtfertigt gewesen. Seine erfolgreiche Selbstbehauptung, die Bewahrung seiner Ehre und seiner militärischen Sicherheit, verlangten zwar die Neuordnung insbesondere Mitteleuropas, aber nicht unbedingt Annexion. Deutsche Machtstaatlichkeit müsse an die nationale Kulturgemeinschaft gebunden bleiben. Nur auf dieser Grundlage könne es einen Verständigungsfrieden geben, auch mit Rußland. Dieses müsse allerdings seinen Expansionsdrang zügeln, der aufs intimste mit dem Zarismus als System verbunden sei. Später, nach der Februar- und der Oktoberrevolution in Rußland, betonte Weber immer wieder, Deutschlands Leistung in diesem Kriege sei gewesen, zur Überwindung des zaristischen Systems beigetragen zu haben. Gerade nach dessen Sturz sei ein wichtiges Hindernis einer rationalen Außenpolitik für Europa weggeräumt. Doch ein Verständigungsfriede setze voraus, daß Deutschland von den Kriegsgegnern als nationaler Machtstaat mit eigenen Kulturaufgaben anerkannt bleibe. Denn Deutschland sei kein Kleinstaat, sondern ein Großstaat, kein reiner Kulturstaat, [8]sondern ein Machtstaat und schon deshalb in „Machtverhängnisse“ verstrickt. Dies müßten die Deutschen ohne Eitelkeit als ihre „Verantwortung vor der Geschichte“ annehmen. Wer dies außerhalb, aber auch innerhalb Deutschlands verkenne, sei politisch ein Tor. Und weiter: „Nicht von den Schweizern, den Dänen, Holländern, Norwegern wird die Nachwelt Rechenschaft fordern über die Gestaltung der Kultur der Erde. Nicht sie würde sie schelten, wenn es auf der Westhälfte unseres Planeten gar nichts mehr geben würde als die angelsächsische Konvention und die russische Bureaukratie. Und das mit Recht. Denn nicht die Schweizer oder Holländer oder Dänen konnten das hindern. Wohl aber wir. Ein Volk von 70 Millionen zwischen solchen Welteroberungsmächten hatte die Pflicht, Machtstaat zu sein.“MWG I/15, S. 153–194.
31
[8] MWG I/15, S. 192.
Weber antizipierte also schon in der Phase deutscher militärischer Erfolge als Ergebnis des Krieges eine Neuordnung Europas. Sie sollte auf den untereinander bündnisfähigen Groß- und Machtstaaten England, Frankreich, Rußland, Österreich-Ungarn, Italien und Deutschland sowie den ihnen angelagerten Klein- und Kulturstaaten beruhen. Doch die dauerhafte deutsche nationale Selbstbehauptung nach außen erforderte auch Reformen im Innern, und zwar wiederum ganz unabhängig davon, wie es um das deutsche Kriegsglück stand. Je länger der Krieg dauerte, desto stärker beschäftigte Weber die notwendige Neuordnung Deutschlands in einem neugeordneten Europa. Und je mehr er darüber nachdachte, desto mehr steigerte sich seine Polemik nach rechts, aber dann auch nach links. Dabei nahm er einige seiner Vorkriegsgedanken wieder auf und entwickelte sie unter den sich ständig wandelnden politischen Konstellationen weiter. Er orientierte sich dabei an der in seinen Augen technisch besten Staatsform in modernen Großstaaten, der parlamentarischen Monarchie.
32
Erst als sich die Hohenzollerndynastie durch die Flucht Wilhelms II. in das Oberste Hauptquartier in Spa endgültig selbst desavouiert hatte, bekannte er sich zur parlamentarischen Republik als der Deutschland nun einzig angemessenen Staatsform, wobei er, im Interesse der Führerauslese, dem Parlamentarismus plebiszitäre Elemente und, im Interesse der Einheit, dem Föderalismus unitarische Elemente entgegensetzte. Die Politik im Rahmen dieser Staatsform aber sollte von liberalen und sozialdemokratischen Kräften geprägt sein, weder von denen auf der Rechten noch von denen auf der Linken. Außer den großen Verfassungsschriften vor allem aus den Jahren 1917/18 wie „Wahlrecht und Demokratie in Deutschland“ und „Parlament und Regierung im neugeordneten Deutschland“ (MWG I/15, S. 347–396, bzw. S. 432–596) vgl. etwa die Rede über Deutschlands Wiederaufrichtung vom 2. Januar 1919 in Heidelberg, MWG I/16, S. 415.
[9]Webers politische Orientierung, die seine außen- und innenpolitischen Stellungnahmen leitete, besitzt neben der tagespolitischen aber auch eine grundsätzliche Seite. Politik galt ihm wie Wirtschaft, Wissenschaft, Kunst, Erotik und Religion als eine Sphäre eigenen Rechts, die weder ausschließlich von Klassen- und Ständeinteressen noch ausschließlich vom Ideal der „Brüderlichkeit“ bestimmt sein darf. Das Begriffspaar, das im Zusammenhang mit Politik bei ihm vor allem auftaucht, heißt nicht nützlich-schädlich, auch nicht wahr-falsch oder schön-häßlich, ja nicht einmal gut-böse, sondern ehrenhaft-schändlich. Einer politischen Pflicht nicht zu genügen provoziert nicht so sehr Gefühle des Ungenügens oder der Schuld, als vielmehr solche der Scham. Gewiß, der ‚Verantwortung vor der Geschichte‘ kann nur gerecht werden, wer sein Handeln an letzten Werten verankert. Jede Machtpolitik rein als solche ist letztlich zur Nichtigkeit verdammt. Denn sie bleibt innerlich haltlos. Eine realistische Politik, für die Weber eintritt und die er in „Politik als Beruf“ als Verantwortungspolitik bezeichnet, darf eben nicht verwechselt werden mit sogenannter Realpolitik. Aber politische Werte sind, sieht man von den in den Menschenrechten formulierten ab, nicht, jedenfalls nicht in erster Linie, universalistische Menschheitswerte, sondern partikularistische Kulturwerte, und deshalb zerstört nicht allein die totale Ökonomisierung, sondern auch die totale Moralisierung das Eigenrecht der Politik. Gewiß, eine Politik, die nicht zur bloßen Machtpolitik verkommen will, muß sich außer auf Kulturwerte auch auf ethische Werte beziehen. Deshalb stellte Weber im zweiten Teil seines Vortrags „Politik als Beruf“ das immer problematische Verhältnis von Politik und Ethik in den Mittelpunkt. Doch sowenig der ethische Wertbezug gerade auch bei einer realistischen Politik, einer Verantwortungspolitik, fehlen darf, so sehr bleibt wahr, daß Politik vom Machtpragma beherrscht wird. Wer sich aber auf Macht als Mittel einlasse, der schließe mit diabolischen Gewalten einen Pakt. Mag die gelingende existentielle Kommunikation durchherrscht sein vom Geist der Liebe,
33
die politische ist immer durchherrscht vom Geist des Kampfs. Menschliche Güte und nationale Ehre, das sind gewiß Werte, an die sich gleichermaßen ideelle Interessen heften. Aber dies macht sie noch nicht vereinbar. Zwischen ethischen und politischen Geboten, zwischen moralischer Selbstbestimmung und kollektiver Selbsterhaltung und Selbsterweiterung herrscht Spannung. Und obgleich die politisch organisierte äußere Freiheit die Verwirklichung der inneren Freiheit erleichtert, verschwindet diese Spannung zwischen Ethik und Politik selbst unter demokratischen Bedingungen nicht. [9] Vgl. dazu die Formulierung in „Wissenschaft als Beruf“, unten, S. 109f.
Webers politische Orientierung ist deshalb auch in einer Werttheorie gegründet. Diese spielt deutlich in Anlage und Durchführung beider Vorträge hinein. Sie ist in den tagespolitischen Stellungnahmen zwar ständig mit [10]im Spiel, ausgearbeitet aber wurde sie in anderen Teilen des Werks, vor allem in der Religionssoziologie, am deutlichsten in der berühmten „Zwischenbetrachtung“.
34
1916/17 kommt ein neuer, wichtiger Baustein hinzu. Er findet sich im Wertfreiheitsaufsatz, den Weber 1913 zunächst für den sogenannten Werturteilsstreit im Verein für Sozialpolitik, der im Januar 1914 stattfand, geschrieben und für den internen Gebrauch verteilt hatte und den er nun, zu Beginn des Jahres 1917, in überarbeiteter Form veröffentlichte.[10] MWG I/19, S. 479–522.
35
Dazu fügte er in das ursprüngliche Manuskript „werttheoretische Ausführungen“ in „größter Kürze“ ein. Sie bringen auf den Begriff, was schon die Anlage der „Zwischenbetrachtung“ leitet: daß wir in aufeinander nicht reduzierbare, miteinander nicht harmonisierbare Wertbezüge hineingestellt und daß wir deshalb unser eigenes Schicksal zu wählen gezwungen sind. An diese „aller menschlichen Bequemlichkeit unwillkommene, aber unvermeidliche“ Erkenntnis will Weber als ein „Vertreter der Wertkollision“Vgl. Weber, Max, Der Sinn der „Wertfreiheit“ der soziologischen und ökonomischen Wissenschaften, in: Logos, Band 7, 1917, S. 40–88 (hinfort: Weber, Wertfreiheit). Demnächst MWG I/12.
36
in „Wissenschaft als Beruf“ und „Politik als Beruf“ gerade die Jugend erinnern, auch daran, daß ihre verständliche Sehnsucht nach dem versöhnten Leben, falls sie nicht durch „die geschulte Rücksichtslosigkeit des Blickes“ in die Realitäten kontrolliert werde, an seiner tragischen Zerrissenheit scheitern und die Enttäuschung letztlich zu Weltanpassung oder Weltflucht führen müsse.Weber, Wertfreiheit, S. 57f. Zur systematischen Bedeutung dieser werttheoretischen Betrachtungen vgl. Schluchter, Lebensführung, Band 1, S. 288ff.
37
Vgl. „Politik als Beruf“, unten, S. 251. Weber unterscheidet drei Reaktionen: „Verbitterung oder Banausentum, einfaches stumpfes Hinnehmen der Welt und des Berufes oder, das dritte und nicht Seltenste: mystische Weltflucht bei denen, welche die Gabe dafür haben, oder – oft und übel – sie als Mode sich anquälen“. Die ersten beiden aber lassen sich als Varianten von Weltanpassung verstehen.
Weber hatte sich also 1916 die politische ,Rednertribüne‘ erobert. Dieses Wirken in die Öffentlichkeit setzte er 1917 in verstärktem Maße fort. Jetzt behandelte er außer politischen zunehmend auch wissenschaftliche Themen. Am 24. Januar sprach er im Sozialwissenschaftlichen Verein in München über „Die soziologischen Grundlagen der Entwicklung des Judentums“,
38
dabei aus seinen laufenden Arbeiten über Altisrael berichtend,Ein Bericht über diesen Vortrag findet sich in: Das Jüdische Echo. Bayerische Blätter für die jüdischen Angelegenheiten, 4. Jg., Nr. 4, 26. Jan. 1917, S. 40f. Es handelt sich um eine Wochenschrift, die jeden Freitag erschien. Webers öffentlicher Vortrag fand am „Mittwoch Abend vor zahlreichen Zuhörern im Sozialwissenschaftlichen Verein“ statt. Ebd., S. 40.
39
[11]am 25. Oktober trug er in der Soziologischen Gesellschaft in Wien über „Probleme der Staatssoziologie“ vor, wobei die Herrschaftssoziologie mit den bekannten drei Typen der legitimen Herrschaft, der rational-legalen, der traditionalen und der charismatischen, darüber hinaus aber noch ein vierter Typus, die auf der okzidentalen Stadtentwicklung gründende ‚demokratische‘ Herrschaft, im Mittelpunkt standen.Interessant ist der Schluß des Berichts, der lautet: „Eine unerwartet große Zahl von – meistens jüdischen – Zuhörern folgte dem sehr fesselnden Vortrag, der nicht immer eine [11]strenge Gliederung des Stoffes erkennen ließ (z. T. deshalb, weil Prof. Weber nur auf ein wissenschaftlich vorgebildetes Publikum gerechnet hatte, und deshalb mitunter bei Einzelheiten, die zum Verständnis des Ganzen notwendig waren, länger als beabsichtigt verweilen mußte), aber dafür eine Fülle interessanter Einzelheiten brachte. Die Mehrzahl der Hörer hatte den Eindruck, hier Dinge vernommen zu haben, die den meisten bis dahin vollständig unbekannt gewesen.“ Ebd., S. 41.
40
Dazwischen lagen die Lauensteiner Kulturtagungen, die vom 29. bis 31. Mai und vom 29. September bis 3. Oktober, allerdings ,hinter verschlossenen Türen‘ und in ausgewähltem Kreise, stattfanden, ferner die politische Rede vor dem Fortschrittlichen Volksverein in München vom 8. Juni, bei der es um die für eine „Demokratisierung unseres Staatslebens“ notwendigen Reformen der Reichsverfassung ging.Vgl. den Bericht in Neue Freie Presse, Nr. 19 102 vom 26. Okt. 1917, S. 10. Zur Frage einer drei- oder viergliedrigen Herrschaftstypologie vgl. Schluchter, Lebensführung, Band 2, Kap. 8,6, S. 236ff., und Kap. 12, S. 535–554. Die juristische Fakultät der Universität zu Wien hatte Weber unico loco als Nachfolger des verstorbenen Eugen von Philippovich vorgeschlagen. Er hielt sich in diesen Tagen zu Berufungsverhandlungen in Wien auf.
41
Darüber hinaus hatte er die Absicht, Mitte September in Heppenheim bei einem Volksbildungskursus über „Staat und Verfassung“ zu sprechen.Vgl. MWG I/15, S. 710–713, hier: S. 712.
42
Doch den Höhepunkt dieses Wirkens brachte der November, als die Münchener Öffentlichkeit Gelegenheit hatte, innerhalb von drei Tagen sowohl den Mann der Politik wie den der WissenschaftVgl. MWG I/15, S. 19, Anm. 26. In den Briefen von Max Weber ist vom 18. September die Rede, in einem Brief von Marianne an Helene Weber aber vom 14. September. Sie schreibt am 13. September, Bestand Max Weber-Schäfer, Deponat BSB München, Ana 446: „Morgen hält Max einen Vortrag auf einem Volksbildungskurs in Heppenheim über ,Staat und Verfassung‘ – da fahren wir (Tobelchen mit Anhang u. ich) mit u. es wird das erste Mal sein, daß ich ihn seit St. Louis also seit 13 Jahren öffentlich reden höre.“
43
zu hören: am 5. November mit der Rede für einen Verständigungsfrieden und gegen [12]die alldeutsche Gefahr,Weber betonte am Beginn seiner politischen Rede vom 5. November 1917, er spreche als Politiker, nicht als Mann der Wissenschaft (MWG I/15, S. 724), dagegen später, bei „Politik als Beruf“, obwohl ebenfalls von Politik handelnd, er spreche als Mann der Wissenschaft, nicht als Politiker.
44
am 7. November mit der Rede „Wissenschaft als Beruf“.[12] Die Veranstaltung endete mit der Annahme einer Resolution, deren Inhalt Webers Position zu den außen- und innenpolitischen Problemen gut reflektiert. Sie ist abgedruckt in ΜWG I/15, S. 722.
45
Marianne Weber erwähnt darüber hinaus Vorträge im Sommer 1917 über indische Kasten, jüdische Propheten und die soziologischen Grundlagen der Musik. Vgl. Weber, Marianne, Lebensbild1, S. 607. Es dürfte sich aber um Lesungen im privaten Kreis gehandelt haben.
1917 rückte darüber hinaus eine weitere Möglichkeit in greifbare Nähe: die Rückkehr in den Hörsaal, auf eine Professur. In Wien sollte Weber Nachfolger des verstorbenen Eugen von Philippovich werden, auch Göttingen hatte sich um ihn bemüht, und in München und Heidelberg stand eine Berufung zumindest zur Diskussion. Das Angebot aus Wien kam im Sommer, und Weber entschloß sich schließlich trotz erheblicher Bedenken, es nicht einfach auszuschlagen. Ende Oktober weilte er zu Verhandlungen in Wien und sagte für das Sommersemester 1918, zum ersten Mal seit der Krankheit, wenigstens ein ‚Probekolleg‘ zu.
46
Vgl. den Brief von Marianne Weber an Helene Weber vom 1. Nov. [1917], Bestand Eduard Baumgarten, Privatbesitz: „Der Max kam gestern abend nach 10tägiger Verschollenheit von Wien ganz munter heim. Man hat ihn dort sehr umworben, willigt in alle Bedingungen u. wünscht[,] daß er im nächsten Semester ein zweistündiges Probekolleg dort liest – um zu prüfen[,] ob seine Kräfte für ein Ordinariat ausreichen etc. Ich glaube nicht, daß er sich schließlich für Wien entscheiden wird, aber dieses Sommersemester, das nur drei Monate dauert u. ihm nur eine sehr bescheidene Lehrpflicht auferlegt, dazu willkommene Gelegenheit[,] politische Einblicke zu gewinnen u. allerlei zutunliches neues Menschenvolk um sich zu haben, verlockt ihn sehr[,] und ich muß es ihm wohl herzlich gönnen.“
„Wissenschaft als Beruf“ fällt also in eine lebensgeschichtliche Phase, in der Weber sich die wegen der Krankheit teilweise verlassenen und seitdem weitgehend brachliegenden Wirkungsfelder mit wachsender Entschlossenheit zurückerobert, in der er seine wiedergewonnene Kraft nicht mehr nur als Forscher, sondern auch als Politiker und als Lehrer zu bewähren sucht. Es ist eine Phase, in der ein Anflug von Optimismus sein von Krankheitserfahrung geprägtes Lebensgefühl überlagert.
47
Der Forscher hatte sein großangelegtes und sich ständig erweiterndes Projekt über die Wirtschaftsethik aller Weltreligionen entscheidend vorangetrieben. Mit dem in Aussicht genommenen ,Probekolleg‘ in Wien, das er dann unter dem Titel „Wirtschaft u. Gesellschaft (Positive Kritik der materialistischen Geschichtsauffas[13]sung)“ ankündigte, waren die Weichen für eine nicht bloß sporadische Weiterarbeit an dem bei Ausbruch des Krieges verlassenen Grundrißbeitrag gestellt. Der Politiker hatte in einflußreichen Artikeln und Broschüren, wie etwa „Wahlrecht und Demokratie in Deutschland“ und „Parlament und Regierung im neugeordneten Deutschland“,Vgl. dazu etwa den Brief von Max Weber an Mina Tobler vom 28.Aug. [1917], Privatbesitz, in dem es über die politische Lage heißt: „Nun, ich sehe der Zukunft jetzt mit Optimismus entgegen, so viele Sorgen auch geblieben sind. Wenn wir vernünftig sind und nicht glauben, die Welt beherrschen zu können, so kommen wir schon mit Ehre durch, militärisch und sonst auch. Aber es wäre gut, es ginge zu Ende.“
48
sowie in Reden zu der außen- und innenpolitischen Lage des Reiches pointiert Stellung genommen, war dabei für einen Verständigungsfrieden und für die Parlamentarisierung der Reichsverfassung wie für die Demokratisierung des deutschen Staatslebens eingetreten. Angesichts der Friedensresolution der Mehrheitsparteien im deutschen Reichstag vom 19. Juli 1917 und angesichts der Entwicklung in Rußland schien ein Verständigungsfrieden tatsächlich noch erreichbar; die schnellen Wechsel im Reichskanzleramt von Bethmann Hollweg zu Michaelis und zu Hertling hatten den Einfluß der Mehrheitsparteien auf die politischen Entscheidungen über den Interfraktionellen Ausschuß vergrößert, was der Forderung nach Parlamentarisierung neuen Nachdruck verlieh, wiewohl diese auch weiterhin auf den hartnäckigen Widerstand der konservativen Kräfte in Preußen und im Reich stieß. Der Lehrer aber hatte den Dialog mit Teilen der akademischen Jugend wieder aufgenommen, und zwar nicht mehr nur im kleinen Rahmen der inzwischen schon berühmten Sonntagnachmittage im Heidelberger Haus in der Ziegelhäuser Landstraße 17, sondern in dem größeren Rahmen der Kulturtagungen auf Burg Lauenstein. Weber nutzte Gelegenheiten wie die auf Burg Lauenstein auch dazu, sich mit geradezu verletzender Kälte gegen den wachsenden Irrationalismus und den Erlebniskult deutscher Intellektueller zu wenden.[13] Vgl. MWG I/15, S. 347–396, bzw. S. 432–596. Die erste erschien 1917, die zweite 1918.
49
Diese „moderne intellektualistische Romantik des Irrationalen“, die vom Nietzsche-Kult über den George-Kreis bis zu den Anarchosyndikalisten reichte, [14]verteufelte in seinen Augen den „Intellektualismus“, auch und gerade den wissenschaftlichen, der vielen zudem noch als westlich und gerade darin als undeutsch galt.In der „Einleitung“ zu der Aufsatzfolge über die Wirtschaftsethik der Weltreligionen vom September 1915 hatte Weber sarkastisch formuliert: „So überaus gleichgültig es für die religiöse Entwicklung der Gegenwart ist, ob unsere modernen Intellektuellen das Bedürfnis empfinden, neben allerlei andern Sensationen auch die eines ‚religiösen‘ Zustandes als ‚Erlebnis‘ zu genießen, gewissermaßen um ihr inneres Ameublement stilvoll mit garantiert echten alten Gerätschaften auszustatten […]“. Vgl. MWG I/19, S. 101. Angriffe wie diese sind sicherlich nicht nur, aber doch auch gegen den Kreis um den Verleger Eugen Diederichs gerichtet, der die Lauensteiner Tagungen veranstaltete. Weber schrieb nach der ersten Tagung in einem Brief an Mina Tobler, undat. [Anfang Juni 1917], Privatbesitz: „Dies war keine Pfingsterholung, – aber es war ganz gut[,] daß ich da war, denn es war ein ‚Schwindel‘ in Vorbereitung und den konnte ich scharf koupieren.“ Über die Entkoppelung von bürgerlichem Kulturbegriff und liberaler politischer Orientierung und über das Spektrum irrationaler Strömungen vgl. auch Mommsen, Wolfgang J., Der autoritäre Nationalstaat. Verfassung, Gesellschaft und Kultur im deutschen Kaiserreich. – Frankfurt: Fischer 1990, S. 257ff., bes. S. 284ff.
50
Tatsächlich war bei der akademischen Jugend die Abneigung gegen den wissenschaftlichen Intellektualismus weit verbreitet. Ihr trat Weber mit seinem Intellektualismus entgegen, und es war wohl gerade sein leidenschaftliches Werben für intellektuelle Rechtschaffenheit und rücksichtslose Sachlichkeit, was ihn manchem nicht nur als Forscher, Politiker und Lehrer, sondern auch als politischen und menschlichen Führer erscheinen ließ. Schon auf den Lauensteiner Kulturtagungen vermochte er damit außer manchen Köpfen auch manche Herzen zu bewegen.[14] Vgl. die Formulierungen in „Wissenschaft als Beruf“, unten, S. 92f. und 108. Dem in der Zeit weitverbreiteten Gegensatz von deutscher Kultur und westlicher Zivilisation, von deutscher Seele und westlichem Intellekt, von deutscher Tiefe und westlicher Oberflächlichkeit, von Musik und (bloßer) Literatur hat wenig später Thomas Mann klassischen Ausdruck gegeben. Vgl. Mann, Thomas, Betrachtungen eines Unpolitischen. – Frankfurt: Fischer 1988, bes. S. 45ff. (Die erste Auflage wurde 1918 veröffentlicht, Vorabdrucke waren seit 1916 in Zeitschriften und Zeitungen erschienen, so auch in den Münchner Neuesten Nachrichten, in einem auch von Weber geschätzten Publikationsorgan.) Thomas Mann meint mit seinem Angriff auf die Zivilisationsliteraten auch seinen Bruder Heinrich, Weber mit seinem Angriff auf die ,Erlebnisliteraten‘ auch seinen Bruder Alfred. Alfred Weber suchte diese verschiedenen Tendenzen durch seine Unterscheidung zwischen Gesellschaftsprozeß, Zivilisationsprozeß und Kulturbewegung, denen er verschiedene Formen und Gesetze der Entwicklung zuordnete, theoretisch zu verbinden. Vgl. bes. Weber, Alfred, Prinzipielles zur Kultursoziologie. (Gesellschaftsprozeß, Zivilisationsprozeß und Kulturbewegung), in: AfSS, Band 47,1920, S. 1–49.
51
Dies wiederholte sich am 7. November 1917 in München, bei der Rede „Wissenschaft als Beruf“. Besonders Karl Löwith gibt in seinem aus der Erinnerung im Exil geschriebenen BerichtVgl. dazu auch Webers eigene Unterscheidung zwischen Lehrer und Führer in „Wissenschaft als Beruf“, unten, S. 101f., sowie die in den Editorischen Berichten zitierten Äußerungen von Teilnehmern.
52
die Wirkung dieser Rede auf eine durch Kriegserfahrung tief sensibilisierte Gruppe von Studenten eindrucksvoll wieder: „In seinen Sätzen war die Erfahrung und das Wissen eines ganzen Lebens [15]verdichtet, alles war unmittelbar aus dem Innern hervorgeholt und mit dem kritischsten Verstande durchdacht, gewaltsam eindringlich durch das menschliche Schwergewicht, welches ihm seine Persönlichkeit gab. Der Schärfe der Fragestellung entsprach der Verzicht auf jede billige Lösung. Er zerriß alle Schleier der Wünschbarkeiten, und doch mußte jeder empfinden, daß das Herz dieses klaren Verstandes eine tiefernste Humanität war.“Der Bericht enthält allerdings sachliche Unrichtigkeiten, die viel Verwirrung gestiftet haben. Löwith datiert den Vortrag falsch und behauptet, er sei „wörtlich so, wie er gesprochen wurde, veröffentlicht worden“. Vgl. Löwith, Karl, Mein Leben in Deutschland vor und nach 1933. Ein Bericht. – Stuttgart: J. B. Metzler 1986, S. 16 (hinfort: Löwith, Bericht). Da Löwith schreibt, erst im Dezember 1917 sei für ihn persönlich der Krieg zu Ende gewesen, hat man geschlossen, er habe am 7. November 1917 den Vortrag nicht hören können, dieser müsse also entweder später oder aber zweimal stattgefunden haben. Dies ist jedoch ein voreiliger Schluß. Eine Überprüfung der Matrikel an der Universität München hat ergeben, daß Löwith bereits im Wintersemester 1917/18 dort eingeschrieben war. Seine Erinnerung kann sich also durchaus, ja sie muß sich auf den 7. November beziehen. Daß Webers Vortrag nicht wörtlich so, wie gesprochen, veröffentlicht wurde, ergibt sich aus der Druckgeschichte. Vgl. dazu den Editorischen Bericht zu „Wissenschaft als Beruf“, unten, S. 61ff. Zur Datierung der Vorträge vgl. unten, S. 43–46.
53
[15] Löwith, Bericht, S. 16–17.
Als Weber über ein Jahr später den Vortrag „Politik als Beruf“ in derselben Vortragsreihe und vor einem ähnlichen Publikum hielt, ist eine vergleichbare Wirkung ausgeblieben. Löwith notiert kurz und bündig: „Ein zweiter Vortrag über Politik als Beruf hatte nicht mehr denselben hinreißenden Schwung.“
54
Weber selber bestätigt indirekt diesen Eindruck. Wenige Tage vor dem Vortrag schrieb er an Else Jaffé: „Der Vortrag wird schlecht: es steckt mir Anderes als dieser ‚Beruf‘ im Kopf und Herzen.“Ebd., S. 17.
55
Lange hatte er gezögert, den zunächst zugesagten Vortrag überhaupt noch zu halten, und es bedurfte offenbar einer politischen Erpressung, um ihn schließlich doch dazu zu bewegen.Brief von Max Weber an Else Jaffé von „Donnerstag früh“ [23. Januar 1919], Privatbesitz.
56
Was hatte sich verändert? Was war geschehen? Vgl. dazu den Editorischen Bericht zu „Politik als Beruf“, unten, S. 120.
Die politische Lage, die Weber bereits 1917 mit großer Sorge beobachtete, hatte sich weiter verschlechtert. Nun sah er Deutschland durch den Krieg weitgehend aus eigener Schuld zu dem „Pariavolk der Erde“ gemacht.
57
Die in seinen Augen maßlose Eitelkeitspolitik der Rechten, im Verein mit der Unfähigkeit der politischen Führung bereits unter Bethmann Hollweg, dann unter Hertling, den Primat der Politik gegenüber dem Militär durchzusetzen, hatte Deutschlands internationale Position entscheidend geschwächt. Die vom Militär zusammen mit der Rechten bestimmte Politik des uneingeschränkten U-Boot-Krieges, gegen die er sich von Beginn an gewandt hatte,Vgl. den Bericht der Heidelberger Neuesten Nachrichten über Webers Wahlrede vom 2. Januar 1919 in Heidelberg zu Deutschlands Wiederaufrichtung, MWG I/16, S. 419.
58
hatte dazu geführt, daß die USA in den Krieg gegen Deutschland eingetreten waren, die vom Militär bestimmte Rußlandpolitik dazu, daß in Brest-Litowsk die Chancen, einen Frieden mit Rußland zu erreichen, der die Grundlage für einen umfassenden Frieden, auch mit den Westmächten, hätte bilden können, verspielt worden waren. Zu diesen beiden schweren außenpolitischen Fehlern des alten Regimes häufte die Revolution in Webers Sicht neue. So hoffte etwa der in München als bayerischer Ministerpräsident an die Macht gelangte Kurt Eisner, der, wie Weber abschätzig bemerkte, mit einem linken Literatenvölkchen regierte, durch die Veröffentli[16]chung von Schuld-Akten die Alliierten gnädig zu stimmen. Webers Verbitterung über diese in seiner Sicht mit Würdelosigkeit verbundene Gesinnungspolitik ging tief.Vgl. MWG I/15, S. 99–125.
59
Auch die von diesen und ähnlichen Gruppierungen geforderten verfassungspolitischen Entwicklungen schienen ihm ungeeignet, Deutschland im Innern zu stärken und vor allem die Deutschen innerlich endlich zu einer realistischen Politik, zu einer Verantwortungspolitik, zu führen. Für ihn waren, als er „Politik als Beruf“ vortrug, die völlige Entmachtung Deutschlands und, wie schon zu Zeiten Napoleons, die Fremdherrschaft in greifbare Nähe gerückt. Der politische Horizont hatte sich ihm endgültig verdüstert. Er sah, wie es am Schluß von „Politik als Beruf“ heißt, für Deutschland zunächst eine „Polarnacht von eisiger Finsternis und Härte“ voraus.[16] Vgl. dazu etwa MWG I/16, S. 432, S. 453–454, ferner auch die von blanker Wut diktierten Äußerungen über Liebknecht und Rosa Luxemburg vor deren Ermordung, ebd., S. 441.
60
Vgl. „Politik als Beruf“, unten, S. 251.
Weber mußte sich aber inzwischen auch mit einem anderen Rückschlag abfinden: Die Rückkehr ins Lehramt, die er seit 1917 immer ernsthafter in Erwägung gezogen hatte, würde von ihm größere Opfer verlangen als erhofft. Gewiß: Dem ‚Probekolleg‘ während des Sommersemesters 1918 in Wien war ein geradezu sensationeller Erfolg beschieden gewesen. Dies ist durch viele Berichte, auch durch Webers eigene, bezeugt. Theodor Heuss zum Beispiel, der einige dieser Vorlesungen besucht hatte, faßte seinen Eindruck so zusammen: „Er war die Sensation der Universität geworden, ,man‘ mußte ihn einmal gesehen, gehört haben – so war er im größten Hörsaal gelandet, wo eine ehrfurchtslose Neugier immer die Türen sich öffnen, sich schließen ließ, ich war ganz bieder empört, zumal ich spürte, wie er darunter litt, und sagte ihm das. Die Antwort habe ich nie vergessen: ,Sie haben recht; man kann doch nicht in solchen Raum das Wort Askese hineinbrüllen.‘“
61
Doch es waren weniger diese widrigen äußeren Umstände, als vielmehr die selbstauferlegte Verpflichtung, Katheder und Rednertribüne auseinanderzuhalten, die ihm schwer zu schaffen machte. Nach den ersten Stunden schrieb er: „Herrgott, ist das eine Strapaze! 10 Vorträge sind nichts gegen 2 Stunden. Einfach das Gebundensein an Disposition, an Nachschreibenkönnen der Leute usw. […]“Heuss, Erinnerungen, S. 225.
62
Dann: „[…] es hat sich nichts, rein gar nichts gegen die Zeit vor 20 Jahren geändert […]“.Brief von Max Weber an Marianne Weber von „Dienstag“ [7. Mai 1918], Bestand Max Weber-Schäfer, Deponat BSB München, Ana 446.
63
Unter dem Gesichtspunkt der eigenen Kräfteökonomie, so die Wiener Erfahrung, [17]blieb der Hörsaal gegenüber der Rednertribüne und der Feder das weit härtere Los. Das ,Probekolleg‘ erschöpfte ihn völlig, machte ihn ,stumpf‘ und ,bleiern müde‘. In diesem Zustand kehrte er Ende Juli von Wien nach Heidelberg zurück. Im Juni 1918, kurz nachdem er, mitten im laufenden Semester, die Berufung an die Universität Wien abgelehnt hatte, heißt es in einem Brief an Mina Tobler: „Natürlich ist es doch – mehr als ich erwartete – schmerzlich, auch die Grenzen des eigenen Könnens so empfindlich zu spüren. Aber – das ist ja nichts Neues, und ,das andere Ufer‘ mit seiner gewissen Einsamkeit gegenüber allen Gesunden, auch den Nächststehenden, ist mir ja vertraut.“Brief von Max Weber an Marianne Weber, undat. [16. Juni 1918], Bestand Max Weber-Schäfer, Deponat BSB München, Ana 446.
64
[17] Brief von Max Weber an Mina Tobler von „Samstag früh“ [15. Juni 1918], Privatbesitz.
Weber lehnte die Berufung nach Wien freilich nicht deshalb ab, weil er nach dieser bedrückenden Erfahrung entschlossen gewesen wäre, nun ein für allemal auf die Rückkehr ins Lehramt zu verzichten, sondern deshalb, weil er aus politischen Gründen in Deutschland bleiben wollte
65
und weil sich ihm hier inzwischen günstigere berufliche Möglichkeiten boten. Eine bestand darin, die Nachfolge von Lujo Brentano in München anzutreten, in jener Stadt, mit der er nach Heidelberg, nicht zuletzt aufgrund der Entwicklungen von 1916 bis 1918, inzwischen wohl am engsten verbunden war.In Webers Absageschreiben an das Ministerium in Wien heißt es unter anderem: „Die Absicht nach Wien zu übersiedeln, hatte bei mir den Sinn eines Ausscheidens aus jeder politischen Betätigung. Es ist unter den gegebenen politischen Umständen aber schwierig, sich der Verpflichtung an seinem sei es auch noch so bescheidenen Teile in Deutschland politisch sich zu betätigen zu entziehen.“ Brief Max Webers vom 5. Juni 1918 an das k.u.k. Ministerium des Kultus und Unterrichts (Abschrift; masch., mit eigenhändigen Korrekturen Max Webers), ZStA Merseburg, Rep. 92, NI. Max Weber, Nr. 30/13.
66
Als er über „Politik als Beruf“ sprach, war bereits klar, daß er, trotz der Erfahrung von Wien, ins Lehramt zurückkehren würde. Dafür gab es auch ökonomische Gründe. Denn Weber konnte es sich nicht länger leisten, nur für seine Arbeit, er mußte auch wieder von ihr leben. Er brauchte ein reguläres Gehalt. Sosehr er wünschte, es ausschließlich mit der Feder oder als freier Dozent verdienen zu können, sowenig täuschte er sich darüber, daß dies nicht gehen würde. Nur die Rückkehr auf ein Ordinariat oder Extraordinariat brächte ökonomische Sicherheit. Dies aber würde, das hatte das Probekolleg gezeigt, in jedem Falle Verzicht bedeuten. Kurz vor dem Vortrag „Politik als Beruf“ schrieb er an Else Jaffé, ihm sei bewußt, „daß ich [18]die Übernahme des Lehramtes natürlich mit dem Hinausgehen aus aller ‚Politik‘ gesundheitlich erkaufen müßte, weil ich Beides nicht leisten könnte“.Vgl. dazu Lepsius, Μ. Rainer, Max Weber in München. Rede anläßlich der Enthüllung einer Gedenktafel, in: Zeitschrift für Soziologie, Jg. 6, 1977, S. 103–118. Weber hatte ja seit seiner ,Rückkehr in die Öffentlichkeit‘ regelmäßig in München gesprochen: im Fortschrittlichen Volksverein, im Sozialwissenschaftlichen Verein und vor der Münchener Freistudentenschaft. Außerdem waren ihm die Münchner Neuesten Nachrichten nach der Frankfurter Zeitung zum zweiten Forum für seine politischen Artikel geworden. Persönliche Beziehungen – Else Jaffé – kamen hinzu.
67
[18] Brief von Max Weber an Else Jaffé vom 20. Jan. 1919, Privatbesitz.
Weber nahm die Berufung an die Universität München im März 1919 trotz anderer Möglichkeiten dann tatsächlich an und verzichtete, nach dem Zwischenspiel, besser: Endspiel, Versailles, auch tatsächlich auf seine heimliche Liebe, die Politik.
68
Dies wurde als das direkte oder indirekte Eingeständnis eines politischen Scheiterns, die damit einhergehende verstärkte Konzentration auf die wissenschaftliche Arbeit als eine Flucht, die Form aber, in der sich diese in den Weber noch verbliebenen knapp eineinhalb Jahren äußerte, gar als eine Fortsetzung des politischen Kampfes mit anderen Mitteln interpretiert.Zur Politik als heimlicher Liebe vgl. Brief an Mina Tobler, undat., Privatbesitz.
69
Nun bedeutete dieser Verzicht angesichts des für Webers Leben so charakteristischen Wechselspiels von Wissenschaft und Politik zweifellos für ihn ein Opfer, das er vielleicht nicht für alle Zeit erbracht hätte. Und vermutlich wog es zu diesem Zeitpunkt weniger schwer, weil er enttäuscht, in Versailles gar für eine Strategie und für Ziele, die er nicht teilte, ‚eingespannt‘ worden war.Vgl. dazu Roth, Guenther, Weber’s Political Failure, in: Telos, No. 78, Winter 1988/89, S. 136–149, hier S. 138.
70
Doch darf man bei der Suche nach Motiven einen Sachverhalt nicht unterschätzen. Spätestens seit Ende des Krieges wurde es für Weber ganz unabhängig von politischen Konstellationen immer unausweichlicher, zwischen seinem wissenschaftlichen und seinem tagespolitischen Engagement zu wählen. Gewiß: Die politische Entwicklung seit der Novemberrevolution und die Art seiner Verwicklung in sie dürften ihm den Abschied von der Tagespolitik erleichtert haben. Aber es spricht wenig dafür, daß seine Wahl anders ausgefallen wäre, hätte er ‚größere‘ tagespolitische Erfolge gehabt. Denn Weber war zwar ein eminent politischer, weil öffentlich wertender Mensch, aber im Grunde kein Berufspolitiker, jedenfalls kein Parteipolitiker, der gänzlich von der Politik hätte leben können. Dafür machte er, wie er selbst wohl durchaus sah, zu viele taktische Fehler,Vgl. dazu die Einleitung von Wolfgang J. Mommsen zu MWG I/16, S. 30f.
71
war sein Bedürfnis nach Unabhängigkeit gegenüber den politischen Autoritäten wie gegenüber dem Demos, aber auch sein Bedürfnis [19]nach rückhaltloser Ehrlichkeit gegenüber den unbequemen Tatsachen zu groß.Von den drei Qualitäten, die nach Weber den Politiker auszeichnen sollten, Leidenschaft, Verantwortungsgefühl und Augenmaß (vgl. dazu die Formulierungen in „Politik als Beruf“, unten, S. 227), ließ er bei seinen tagespolitischen Stellungnahmen das Augenmaß mitunter vermissen, wie man seinen Wahlreden im Dezember 1918 und Januar 1919 entnehmen kann. Auch er tat in der politisch aufgeheizten Atmosphäre des Wahlkampfes ab und zu Äußerungen, gegen die sich seine Feder wohl gesträubt hätte. Ausgesprochene taktische Fehler unterliefen ihm zum Beispiel bei seiner Kandidatur für die Nationalversammlung. Vgl. MWG I/16, S. 15.
72
Sein entscheidender Beitrag zur deutschen Politik bestand auch weniger in seinem doch eher sporadischen tagespolitischen Handeln,[19] Das sah vielleicht am klarsten Karl Jaspers. Vgl. Jaspers, Max Weber, S. 67–68.
73
nicht einmal in seiner teilweise durchaus einflußreichen politischen Publizistik,Im Grunde läßt sich nur sein vorübergehendes Engagement für die DDP als solches interpretieren.
74
als vielmehr in seinem politischen Denken, mit dem er politisches Handeln, das diesen Namen verdient, allererst ermöglichen wollte. Auch der Vortrag „Politik als Beruf“ gehört in diesen Zusammenhang. Darin verzichtete er trotz vieler Anspielungen bewußt auf direkte tagespolitische StellungnahmenDabei ragt sicherlich der Einfluß auf verfassungspolitische Entscheidungen, die schließlich zur Weimarer Reichsverfassung führten, heraus. Vgl. dazu das Urteil von Wolfgang J. Mommsen in: MWG I/16, S. 12: „Aber sein Wirken hat dennoch deutliche Spuren hinterlassen; zumindest auf diesem Gebiete ist es ihm gelungen, wenn auch nur indirekt und aus dem zweiten Glied heraus, die politischen Entscheidungen des Tages in nicht unwesentlichem Maße zu beeinflussen.“ Dieses Urteil stützt sich außer auf Webers publizistische Tätigkeit auf seine Mitwirkung bei den Verfassungsberatungen im Reichsamt des Innern vom 9. bis 12. Dezember 1918 in Berlin.
75
und versuchte statt dessen, einen Beitrag zur Theorie der Politik, in seiner Terminologie: zur Staatslehre oder Staatssoziologie,Vgl. „Politik als Beruf“, unten, S. 157.
76
zu geben. Als solcher ist der von ihm für die Drucklegung zum politischen Traktat gewandelte Vortrag zugleich „ein Dokument des Standes demokratischen Denkens in jenem kritischen Augenblick deutscher Geschichte“ geworden, wie dies Immanuel Birnbaum in der Rückschau treffend formuliert.Ebd., S. 161.
77
Vgl. Birnbaum, Immanuel, Erinnerungen an Max Weber, in: Max Weber zum Gedächtnis, hg. von René König und Johannes Winckelmann, 2. Aufl. – Köln/Opladen: Westdeutscher Verlag 1985, S. 21 (hinfort: König/Winckelmann (Hg.), Gedächtnis).
Für Webers Entscheidung, in die Universität zurückzukehren und aus aller Politik auszuscheiden, gab es aber neben äußeren auch gewichtige innere Gründe. Trotz seiner zahlreichen politischen Reden, trotz seines extensiven politischen Journalismus, trotz seines sich steigernden tagespolitischen Engagements blieb er ja auch von 1916 bis zu Beginn des Jahres 1919 immer noch in erster Linie ein Mann der Wissenschaft. Die Veröffentlichung der religionssoziologischen Skizzen zur Wirtschaftsethik der Weltreligionen war kontinuierlich weitergegangen. Es ist sehr wahrscheinlich, ja nachgerade sicher, daß diese Skizzen, mit Ausnahme von „Einleitung“, Konfuzianismusstudie und „Zwischenbetrachtung“, unter Verwendung älterer Manuskripte ab Winter 1915/16 überhaupt erst in die uns heute bekannte Fassung gebracht worden sind.
78
Diese Skizzen aber [20]bilden nur die sichtbaren Ergebnisse eines riesigen kulturtheoretischen und kulturhistorischen Arbeitsprogramms, dessen Umrisse bereits vor dem Kriege feststanden. Es gewann seit Webers Austritt aus der Lazarettverwaltung nur immer klarere Kontur. Dabei kam es zu Gewichtsverlagerungen, Kürzungen, aber auch zu Ausweitungen. Schon 1915 antizipierte er, daß neben dem bei Ausbruch des Krieges bereits weit gediehenen Grundrißbeitrag in nicht allzu ferner Zukunft auch eine Wirtschaftsethik der Kulturreligionen mit einer überarbeiteten Protestantischen Ethik in Buchform stehen werde. Als sich Weber zur Rückkehr in die Universität entschloß, war die Arbeit an diesem Doppelprojekt sehr weit gediehen. Die vita contemplativa, die seine Verwirklichung unabdingbar verlangte, stand mit der vita activa des tagespolitischen Handelns seit langem in Konflikt. Trotz der Qual, die ihm der Hörsaal bereitete,Nachweise dazu in Schluchter, Lebensführung, Band 2, Kap. 13, S. 557–596.
79
konnte dieser, anders als die politische Rednertribüne, direkt für das Arbeitsprogramm genutzt werden. Der Rückzug von der Tagespolitik machte in diesem Sinne Webers Leben einfacher.[20] Dies gilt auch für die Münchener Zeit, in der Weber, ähnlich wie in Wien, mit seinen Vorlesungen dennoch großen Erfolg hatte. Er las vor mehreren hundert Studenten, gewöhnlich im Auditorium Maximum. Aber die Vorlesungen machten ihm dennoch keine Freude: „Das Kolleglesen ist Pflicht – nicht angenehm, liegt mir gar nicht. Schreibstil und Sprechstil sind etwas Verschiedenes, das vermögen merkwürdiger Weise so viele Menschen zu vergessen oder zu unterdrücken. ‚Kolleg‘ aber ist Sprech-Schreibstil, denn die verd[ammten] Jungens sollen ja nachschreiben[,] und ich weiß selbst, wie gut das ist.“ Brief an Mina Tobler vom 3. Jan. [1920], Privatbesitz. Und bereits zuvor: „Das ‚Anstrengende‘ bei Vorlesungen liegt – ich sehe es jetzt – darin: daß Sprech- und Schreib-Stil bei mir absolut verschieden sind. Hemmungslos kann ich nur bei freier Rede (nach Notizen) sprechen. Im Kolleg aber muß ich ‚verantwortliche‘ Formulierungen geben, und das strengt unsinnig an, mich wenigstens, denn dann spreche ich im Schrift-Stil, also gehemmt, gequält, geradezu physisch geschunden im Gehirn.“ Brief an Mina Tobler von „Samstag“ [26. Juli 1919], Privatbesitz.
80
Er hatte die Berufung nach München ja nur unter der Bedingung angenommen, daß ihm erlaubt sein werde, statt Nationalökonomie Soziologie und Staatslehre zu lesen.Diese Vereinfachung hatte auch eine persönliche Seite: Die Konstellation Max Weber-Marianne Weber-Mina Tobler-Else Jaffé-Alfred Weber hatte sich verändert. Erst ihre Berücksichtigung ergäbe ein volles Bild. Dieses kann hier nicht gezeichnet werden. Der selbstverordnete Rückzug konnte Weber natürlich nicht davor schützen, dennoch in tagespolitische Ereignisse hineingezogen zu werden, wie etwa in die Hochverratsprozesse gegen Ernst Toller und Otto Neurath oder in den Fall Arco. Doch dies ändert nichts an dem Sachverhalt, daß sich Weber, um eine Formulierung von Wolfgang J. Mommsen zu verwenden, „an dieser Wegmarke seines Lebens ostentativ für die Rolle des Gelehrten“ entschieden hat. Vgl. MWG I/16, S. 37.
81
Schrift und Wort sollten soweit als möglich eine Einheit sein. [21]Bereits in Wien hatte er seine Religions- und Herrschaftssoziologie aus dem Grundrißbeitrag vorgetragen, im Sommersemester 1919, dem ersten Münchener Semester, las er die grundbegriffliche Einführung dazu, „Die allgemeinen Kategorien der Gesellschaftswissenschaft“.Vgl. den Brief von Marianne Weber an Helene Weber vom 17. Febr. [1919], Bestand Max Weber-Schäfer, Deponat BSB München, Ana 446: „Aus Bonn ist ein derart glänzendes Angebot da, nur 2stündige Lehrverpflichtung, alles[,] was man will[,] u. 20 000 Mk garantierte Einnahmen!! daß es wirklich aufregend ist. Es fragt sich nun[,] ob München sich darauf einläßt[,] Max statt Nationalökonomie Soziologie u. Staatslehre lesen zu lassen u. [21]eine begrenzte Lehrpflicht (vier Stunden) zuzubilligen, dann gehen wir natürlich nach München, obwohl der dort gebotene Gehalt nur sehr bescheiden ist.“
82
Vgl. Brief von Max Weber an Marianne Weber von „Montag Nachm[ittag]“ [PSt. 16. Juni 1919], Bestand Max Weber-Schäfer, Deponat BSB München, Ana 446: „Grade eben schickte ich meine Kolleg-Anzeige fort an das Rektorat, fange Dienstag (5–6) an (,Die allgemeinsten Kategorien der Gesellschaftswissenschaft‘) […]“. Für das Wintersemester 1919/20 kündigte er zunächst zwei Stunden „Wirtschaftsgeschichte“ sowie zwei Stunden „Staaten, Klassen, Stände“ an, ließ aber dann die zweite Vorlesung zugunsten der ersten fallen, die er schließlich unter dem Titel „Abriß der universalen Sozial- und Wirtschaftsgeschichte“ vierstündig hielt. Im Sommersemester 1920 las er vier Stunden „Allgemeine Staatslehre und Politik (Staatssoziologie)“ und zwei Stunden „Sozialismus“. Sieht man von der „Wirtschaftsgeschichte“ ab, so sind dies alles Themen, die mit dem Grundrißbeitrag in direktem Zusammenhang stehen. Die „Wirtschaftsgeschichte“ bot Weber nur auf Drängen der Studenten an. In einem Brief an Mina Tobler, undat. [PSt. 15. Jan. 1920], Privatbesitz, heißt es darüber: „Diese Materie ödet mich, bei der gebotenen unwürdigen Hast.“
Weber verließ also bald nach dem Vortrag „Politik als Beruf“ die politische Rednertribüne, um sich erneut ganz auf das Schreiben zu konzentrieren und in den Hörsaal zurückzufinden. Trotz der bereits geleisteten immensen wissenschaftlichen Arbeit lag noch ein riesiges Arbeitsprogramm vor ihm, dessen Kern in den beiden Großprojekten „Die Wirtschaft und die gesellschaftlichen Ordnungen und Mächte“ und „Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie“ bestand. Das erste sollte vermutlich mehrere Teile, das zweite vier Bände umfassen.
83
Darüber hinaus wollte er offenbar die um 1910 begonnenen, über die Jahre zwar immer wieder berührten, aber letztlich liegengebliebenen soziologischen Studien zur Musik, Kunst, Architektur und Literatur aufnehmen und weiterführen, ein Interessengebiet, auf dem von 1912 bis 1918 Georg Lukács vielleicht sein wichtigster wissenschaftlicher Gesprächspartner gewesen war.Dazu Schluchter, Lebensführung, Band 2, S. 610 und S. 579.
84
Als Weber daranging, die zwar in verschiedene Stimmungen getauchten, aber von derselben Lebenserfahrung geprägten Vorträge vom November 1917 und Januar 1919 druckfertig zu machen, war dies die Perspektive. Sie zielte auf die Begründung einer verstehenden Soziologie, die, als Handlungs-, Ordnungs- und Kulturtheorie, gleichsam zwischen Psychologie und Rechtsdogmatik angesiedelt und im Gegenzug zu den „Dilettanten-Leistungen geistreicher Phi[22]losophen“ „streng sachlich-wissenschaftlich“ entwickelt, im Dienst des historischen Erkennens und darin zugleich des Erkennens der Gegenwart und ihrer Entwicklungstendenzen steht.Weber las die Manuskripte von Georg Lukács zur Ästhetik gründlich, die dieser von 1912 bis 1918 schrieb, um sich damit an der Universität Heidelberg für Philosophie zu habilitieren. Diese Lektüre ist auch in „Wissenschaft als Beruf“ reflektiert. Vgl. unten, S. 107. Ein weiterer wichtiger Gesprächspartner war natürlich die Pianistin Mina Tobler in allen Fragen der Musik.
85
Eine solche Erfahrungswissenschaft sollte in ihren theoretischen und historischen Teilen Tatsachenerkenntnis und Selbsterkenntnis fördern, sollte einer leidenschaftlichen und zur Tat entschlossenen akademischen Jugend Klarheit und intellektuelle Rechtschaffenheit, Augenmaß und Verantwortungsgefühl, Distanz und Würde vermitteln, sollte darin auch dem Vaterland dienen, insofern dessen glücklichere Zukunft in Webers Augen nicht zuletzt an diese gelebten Tugenden, an die aus ihnen entspringende „Festigkeit des Herzens“ gebunden blieb, eine Festigkeit, die auch noch „dem Scheitern aller Hoffnungen gewachsen ist“.[22] Weber schrieb am 8. November 1919 an seinen Verleger Paul Siebeck, er wolle seinem Grundriß-Band eine „lehrhafte“ Form geben, „die ich für die Sache angemessen halte, um endlich ,Soziologie‘ streng sachlich-wissenschaftlich zu behandeln statt der Dilettanten-Leistungen geistreicher Philosophen“. Daraus darf man freilich nicht folgern, er habe ein dürres und abstraktes Buch schreiben wollen. Dies verneinte Weber ausdrücklich. Vgl. Notiz an den Verlag von Anfang 1920, beides VA Mohr/Siebeck, Deponat BSB München, Ana 446.
86
So in „Politik als Beruf“, unten, S. 252.
Tatsächlich setzte Weber seine Hoffnung für Deutschland zunehmend außer auf „staatstechnische“ Regelungen vor allem auf die Haltung der akademischen Jugend. In der Rede über Deutschlands Wiederaufrichtung vom 2. Januar 1919 hatte er daran erinnert, „daß das Vaterland nicht das Land der Väter, sondern das Land der Kinder“ sei.
87
Sie vor allem, so kann man ergänzen, hatten zu lernen, was es heißt, ein Leben zu führen, sich zur Persönlichkeit zu bilden. Folgt man Webers Soziologie, so setzte dies bestimmte Formen, aber auch einen bestimmten ,Geist‘ voraus. In einem instruktiven Brief an Otto Crusius, Professor für klassische Philologie in München und Teilnehmer der Lauensteiner Kulturtagungen, schrieb er schon am 24. November 1918, noch bevor er sich in den Wahlkampf stürzte, bei der Lösung der anstehenden Kulturprobleme gehe es zuoberst darum, moralische ,Anständigkeit‘ zurückzugewinnen. Für die Bewältigung dieser massiven Erziehungsaufgabe blieben als Mittel „nur das amerikanische: ‚Club‘ – und exklusive, d. h. auf Auslese der Personen ruhende Verbände jeder Art schon in der Kindheit und Jugend, einerlei zu welchem Zweck: Ansätze dazu bei der ,Freideutschen Jugend‘“; als ,Geist‘ aber nur die Sachlichkeit und die „Ablehnung aller geistigen Narkotika jeder Art, von der Mystik angefangen bis zum ,Expressionismus‘“. Nur so könne ein echtes Schamgefühl entstehen, welches allein politische und auch menschliche ,Haltung‘ gebe, „gegen den ekelhaften Exhibitionismus der innerlich Zu[23]sammengebrochenen“.Vgl. MWG I/16, S. 419.
88
Daran zeigt sich, wie sehr Weber diese Hoffnung auch mit der freideutschen Jugend verknüpfte, zu der er wohl die Freie Studentenschaft rechnete, und wie sehr seine beiden Vorträge vor der Münchener Freien Studentenschaft auch in diesem Zusammenhang stehen. Das führt zu der Frage, wie sich Webers Beziehung zur freideutschen Jugend, insbesondere zur Freien Studentenschaft, entwickelte, und damit zu der Frage nach der engeren Entstehungsgeschichte der Vorträge „Wissenschaft als Beruf“ und „Politik als Beruf“. [23] Vgl. Weber, Marianne, Lebensbild1, S. 647f., hier korrekt zitiert nach dem Original im ZStA Merseburg, Rep. 92, Nl. Max Weber, Nr. 9.
3. Die engere Entstehungsgeschichte der Vorträge „Wissenschaft als Beruf“ und „Politik als Beruf“
Max Weber war während seines dreisemestrigen Studiums der Rechts- und Staatswissenschaften an der Universität Heidelberg, das er im Sommersemester 1882 begonnen hatte, der Allemannia zu Heidelberg beigetreten. Als Student bejahte er deren Sonderleben und Sonderehre, die um Satisfaktionsfähigkeit und Bestimmungsmensur kreisten. Obgleich er schon als junger Wissenschaftler in seinen Analysen des autoritär verformten deutschen Bürgertums den Erziehungswert des Reserveoffiziers- und Korpsstudentenwesens bezweifelte und sich im Laufe der Jahre von diesen Institutionen militärischer und studentischer ,Sitte‘ und ,Ehre‘ immer deutlicher distanzierte,
89
trat er erst nach der Novemberrevolution, vermutlich am 17. November 1918, im Zusammenhang mit einer öffentlichen Auseinandersetzung um den Symbolwert des Farbentragens, aus seiner Verbindung aus.Vgl. dazu Schluchter, Wolfgang, Rationalismus der Weltbeherrschung. Studien zu Max Weber. – Frankfurt: Suhrkamp 1980, Kap. 4, bes. S. 167f. (hinfort: Schluchter, Rationalismus).
90
Zunächst hatte er in öffentlicher Versammlung vom Couleurwesen als von feudalem Unfug gesprochen, der nicht mehr in die Zeit passe und niemandem nütze, dann in seinem Austrittsschreiben die Berechtigung dieser studentischen Lebensform in einem neugeordneten Deutschland sowie ihre Fähigkeit zur Reform verneint. In einem Vortrag am 13. März 1919 über „Student und Politik“, der kurz vor der Annahme seiner Berufung an die Universität München, ausschließlich vor Studierenden, stattfand,Vgl. dazu MWG I/16, S. 191–195. Das Austrittsdatum ist unsicher. Vgl. ebd., S. 191.
91
[24]machte er klar, daß für ihn das politisch Bedenkliche des Couleurwesens in seiner „Exklusivität auf der Basis der Satisfaktionsfähigkeit“ bestehe.Der Vortrag fand vor dem „Politischen Bund deutscher Studenten (Bund deutsch-nationaler Studenten)“ in München statt. In der öffentlichen Ankündigung heißt es: „Einlaß nur für Studierende“. Übrigens kündigte Weber bei dieser Veranstaltung öffentlich an, er werde bei Übernahme des Ordinariats von Lujo Brentano aus der Politik ausscheiden. Am 14. März 1919 brachte die Münchener Zeitung folgende Notiz: „In einer Studenten[24]versammlung, über die an anderer Stelle berichtet wird, äußerte der demokratische Politiker Professor Max Weber (Heidelberg), daß er in dem Moment, in dem er beabsichtige, in den Lehrkörper der Münchener Universität einzutreten, von der Politik Abschied nehme. Beides sei zu schwer, Politik zu treiben und nützliche Tatsachen und Kenntnisse der Wissenschaft zu vermitteln. Offenbar vertritt Professor Weber die Anschauung, daß ihm als Nachfolger Brentanos die Münchener Professur einen größeren Aufgabenkreis der wissenschaftlichen und Lehrtätigkeit bringt, als die zu Heidelberg, von wo aus er sich bekanntlich eifrig politisch betätigte.“ Vgl. MWG I/16, S. 483. Der Zeitung war offensichtlich nicht bekannt, daß Weber in Heidelberg seit seiner Krankheit keine Lehrveranstaltung mehr abgehalten hatte.
92
Diese Exklusivität schließe Demokratisierung aus. Sie stütze ein falsches Verständnis von der Sonderstellung des Akademikers. Diese, so offensichtlich Webers Meinung, dürfe sich nicht länger mit berufsständischen Prätentionen begründen, sie müsse vielmehr durch eine geistesaristokratische Lebensführung individuell verdient werden, durch eine selbstbestimmte Lebensführung, die alle feudalen Reminiszenzen verschmähe und sich gegenüber dem Leben der Nichtakademiker nicht verschließe. MWG I/16, S. 482–484, hier S. 484.
Weber erteilte also der farbentragenden Studentenschaft öffentlich eine radikale Absage. Er hielt sie nach Form und Geist für unvereinbar mit der von ihm erstrebten künftigen deutschen Staatsform, der parlamentarischen Republik. Aber seine Absage galt auch Teilen der nichtfarbentragenden Studentenschaft. Das wird aus dem Bericht über den Vortrag gleichfalls klar. Weber kritisiert „Erscheinungen, die aus der freien Jugendbewegung bekannt sind, und die im Grunde auf eine Emanzipation von der Autorität hinauslaufen und jenes Literatentum großgezüchtet haben, dem im Interesse der geistig Gesunden energisch zu Leibe gegangen werden müsse“. Obgleich keine Namen genannt werden, kann kaum zweifelhaft sein, daß er auch Gustav Wyneken und seine Anhänger meinte.
93
Mit diesen hatte er [25]sich bereits auf Burg Lauenstein kritisch auseinandergesetzt. Seine Sympathie galt offenbar nur jenen studentischen Gruppierungen, die, wie etwa die Freistudenten, an der Idee der Universität als einer wissenschaftlichen Ausbildungs- und Bildungsanstalt orientiert waren, die an eine Erziehung zu Selbsttätigkeit und Selbständigkeit durch den Umgang mit fachwissenschaftlichen Problemen glaubten und die bei ihrer hochschulpolitischen Arbeit auf jedes künstliche Sonderbewußtsein sowie auf eine rein akademische parteipolitische Blockbildung verzichteten.Vgl. dazu den Bericht von der ersten Lauensteiner Kulturtagung vom 29. bis 31. Mai 1917, wo es unter anderem heißt: „Professor Weber wandte sich hier gegen die Jugendbewegung, über die er offenbar nur nach der Wynekenschen Richtung hin orientiert war; er tat dies mit soviel Sarkasmus, daß ihm ein großer Teil der anfänglichen Sympathien bei den Hörern verloren ging […]“. Vgl. MWG I/15, S. 703. Die Ablehnung Wynekens durch Weber kommt auch in einem anderen Dokument zum Ausdruck, das die Verbindung zu den Vorträgen „Wissenschaft als Beruf“ und „Politik als Beruf“ direkt herstellt. In dem Brief von Frithjof Noack vom 26. Oktober 1924 an Marianne Weber, Bestand Max Weber-Schäfer, Deponat BSB München, Ana 446, in dem dieser über seine Recherchen zur Entstehungsgeschichte der beiden Vorträge berichtet, heißt es: „Weber war vor allem froh, daß nicht Wyneken den Erziehungsvortrag hielt, den er sehr verachtete: ‚Demagogen der Jugend usw.‘“ Diese Ablehnung bekommt auch dadurch eine besondere Pointe, daß Webers Bruder Alfred ein Anhänger Wynekens war. Zu Wynekens Wirkung auf andere ‚Geister‘ vgl. auch dessen Briefwechsel mit Walter Benjamin, der nach anfänglicher [25]Anhängerschaft mit ihm vollständig brach. Dazu Götz von Olenhusen, Irmtraut und Albrecht, Walter Benjamin, Gustav Wyneken und die Freistudenten vor dem Ersten Weltkrieg, in: Jahrbuch des Archivs der deutschen Jugendbewegung, 13, 1981, S. 99–128. Ferner Walter Benjamin, Gesammelte Schriften, hg. von Rolf Tiedemann und Hermann Schweppenhäuser. – Frankfurt: Suhrkamp 1977, Band II,1, S. 9–87, bes. S. 60–66 (über das Verhältnis von Freier Studentenschaft und Freischar) und Band II,3, S. 824–888. Der Brief, in dem sich Benjamin von Wyneken lossagt, findet sich S. 885–887.
94
Zum letzteren ebenfalls der Zeitungsbericht MWG I/16, S. 484.
Tatsächlich gebührt der Freien Studentenschaft im Rahmen des deutschen Studententums vom Ende des 19. Jahrhunderts bis zur Neuordnung Deutschlands nach dem Ersten Weltkrieg eine Sonderstellung. Ihr kommt eine große entwicklungsgeschichtliche Bedeutung zu. Von ihren Gegnern wahlweise als jüdisch, sozialistisch, rationalistisch, pazifistisch, kollektivistisch oder auch subjektivistisch diffamiert und bekämpft, war sie in der Neuzeit „die erste zielbewußte Trägerin der großzügigen sozialen Bestrebungen, die das Wohl aller wirtschaftlich schwachen Studenten im Auge hatten“. Darüber hinaus war sie „durch das Betonen der studentischen Hochschulgemeinschaft und der Notwendigkeit allgemeiner Studentenausschüsse die Wegbereiterin der großen studentischen Einheitsbewegung, die 1919 in der Gründung der deutschen Studentenschaft ihr Ziel“ erreichte.
95
Ihr Kampf galt dabei vor allem der mit der Struktur des Kaiserreichs aufs engste verknüpften privilegierten Stellung der Korporationen. Die freistudentische Bewegung, die unter dem Namen Finkenschaftsbewegung begonnen hatte,Vgl. Schulze, Friedrich, und Ssymank, Paul, Das deutsche Studententum von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart 1931, 4., völlig neu bearbeitete Auflage. – München: Verlag für Hochschulkunde 1932, S. 381 (hinfort: Schulze/Ssymank, Studententum).
96
läßt sich geradezu als eine Sammlung aller gegen die Korporationen gerichteten studentischen Bestrebungen am Beginn des Jahrhunderts verstehen. Das Ziel, das diese Sammlungsbewegung letztlich verfolgte, bringt eine Entschließung besonders prägnant zum Ausdruck, die 1906 auf dem Weimarer Freistudententag gefaßt wurde. Dort heißt es unter anderem: „Das letzte und höchste Ziel der freistudentischen Bewegung ist die Wiederherstellung der alten civitas academica, die Einigung der Ge[26]samtstudentenschaft zu einer in sich geschlossenen selbständigen Körperschaft, die an jeder Hochschule als Ganzes neben dem Lehrkörper, der Gesamtheit der Dozenten, behördlich anerkannt wird und gleich diesem einen wesentlichen Bestandteil des Hochschulkörpers mit einer eigenen, gesetzlich festgelegten Verfassung bildet. Diese Gesamtstudentenschaft kann ihre Vertretung nicht durch einen Teilausschuß erhalten, der nur Angehörige bestimmter Parteien umfaßt, sondern lediglich durch einen für alle Studenten verbindlichen, auf parlamentarischer Grundlage beruhenden Ausschuß, in dem jede Gruppe der akademischen Jugend die gebührende Vertretung findet, an dessen Lasten und Vorteilen alle Studierenden gleichmäßig teilnehmen, und dem sich kein Teil der Studentenschaft entziehen kann, auch wenn er auf seine eigene Vertretung daran verzichtet.“Die Bezeichnung ‚Finken‘ galt zunächst als Spottname, ähnlich wie die Bezeichnung ,Wilde‘, die gleichfalls verwandt wurde.
97
[26] Schulze/Ssymank, Studententum, S. 420. Vgl. auch Behrend, Felix, Der freistudentische Ideenkreis. Programmatische Erklärungen, hg. im Auftrage der Deutschen Freien Studentenschaft. – München: Bavaria-Verlag 1907. Die Freistudenten wandten sich gegen den „bierseligen Couleurstudenten“ als Prototyp des Studenten und gegen die „Vorherrschaft des Korporationsprinzips, die Früh- und Dämmerschoppen, die Klassenteilung, die geringen Bildungsinteressen“ im studentischen Leben. Vgl. ebd., S. 18. Sie traten statt dessen für Selbsterziehung im Rahmen einer akademischen Kulturgemeinschaft ein, für die die Ideen der Einheit der Wissenschaften, der Einheit von Forschung und Lehre und der Einheit von Lehrenden und Lernenden bestimmend blieben.
Die freistudentische Bewegung war als eine Sammlungsbewegung der ‚Nichtinkorporierten‘ – so die Sprache der Zeit – von Beginn an pluralistisch. Sie vertrat ein Toleranz- und Neutralitätsprinzip, schätzte selbständige Überzeugungen und beschränkte ihre politische Betätigung auf rein akademische Angelegenheiten.
98
So konnte sie männliche und zunehmend auch weibliche Studierende der verschiedensten weltanschaulichen und politischen Orientierungen unter ihrem Dach vereinigen. Sie zeigte zudem erhebliche Unterschiede nach Universitäten. Gerade auch die Freie Studentenschaft in München, die Weber zu den beiden Vorträgen einlud, hatte ihr eigenes Profil.Zum Toleranz- und Neutralitätsprinzip ebd., S. 29. Das Neutralitätsprinzip schloß übrigens die Idee politischer Bildung keineswegs aus. Im Gegenteil: Es gehört zu den Eigenarten der Freistudenten, daß sie gerade die Bedeutung der politischen Bildung betonten und deshalb in den Abteilungen, in denen sich ihre Bildungsarbeit vollzog, die Sozialwissenschaften besonders berücksichtigten. Vgl. ebd., S. 33.
99
Alle Gruppierungen verband freilich das Bekenntnis zur [27]klassischen deutschen Universitätsidee, sie glaubten vor allem an Bildung durch Wissenschaft und an die akademische Freiheit als Lehr- und Lernfreiheit.Immanuel Birnbaum, der nach dem Studium in Freiburg und Königsberg im Sommersemester 1913 nach München kam und bald in die Spitze der Münchener Freien Studentenschaft aufstieg, schreibt in seinen Erinnerungen: „Aber auch die studentische Bewegung in München übte starke Anziehungskraft auf mich aus. Sie hatte dort dem Grundgedanken der Freien Studentenschaft eine neue programmatische Wendung gegeben, indem sie nicht mehr alle Nichtinkorporierten als Freistudenten in Anspruch nahm, sondern ihre Organisation als eine akademische Partei deklarierte, die für Gleichberechtigung, gewählte studentische Vertretungen und Ausbau eines studentischen Selbstbildungswesens eintreten wollte.“ Birnbaum, Immanuel, Achtzig Jahre dabeigewesen. Erin[27]nerungen eines Journalisten. – München: Süddeutscher Verlag 1974, S. 45 (hinfort: Birnbaum, Achtzig Jahre).
100
Gerade deshalb gehörte es zu den offenen und immer wieder erörterten Fragen, wie diese Ideen auszulegen und in einem Universitätssystem zu verwirklichen seien, dessen Studentenzahlen seit der Reichsgründung dramatisch angestiegen warenVgl. Behrend, Der freistudentische Ideenkreis, S. 5–8.
101
und dessen Struktur sich unter dem Druck wachsender Spezialisierung der Wissenschaften, vor allem der Naturwissenschaften, tiefgreifend wandelte. Weber reagierte auf diese Diskussionen: Er ging in „Wissenschaft als Beruf“ auf diese Entwicklungen ausführlich ein. Von 1872 bis 1919/20 stieg die Zahl der Universitätsstudenten von ca. 16 000 auf ca. 118 000. Dazu Schulze/Ssymank, Studententum, S. 428 und S. 465.
Die freistudentische Bewegung erreichte ihren Höhepunkt vor dem Ersten Weltkrieg. Dies gilt auch für die freideutsche Bewegung, die von jener zunächst unterschieden werden muß. Anders als die freistudentische Bewegung entstand die freideutsche aus dem Zusammenschluß mehrerer Verbände der Jugendbewegung, und zwar im Oktober 1913 auf dem Hohen Meißner bei Kassel. Unter den studentischen Verbänden war der wichtigste die Deutsche Akademische Freischar, die zwar gleichfalls gegen die Korporationen, zunächst aber auch gegen die Freie Studentenschaft stand.
102
Diese 1913 gegründete freideutsche Bewegung zeigte von Beginn an Risse. Bald gab es offenen Streit zwischen den beteiligten Verbänden, insbesondere zwischen jenen, denen diese Bewegung in erster Linie eine Jugendkulturbewegung, und jenen, denen sie in erster Linie eine Jugendgemeinschaftsbewegung war. Was die zusammengeschlossenen Verbände bei all ihrer Unterschiedlichkeit, die schnell zu Abspaltungen führte, zunächst miteinander verband, war ein eigentümlicher Gefühlsnationalismus.Vgl. Freideutsche Jugend. Zur Jahrhundertfeier auf dem Hohen Meißner 1913. – Jena: Eugen Diederichs 1913. Folgende Verbände sind dort aufgeführt: Deutsche Akademische Freischar, Deutscher Bund abstinenter Studenten, Deutscher Vortruppbund, Bund deutscher Wanderer, Jungwandervogel, Österreichischer Wandervogel, Germania-Bund abstinenter Schüler, Freie Schulgemeinde Wickersdorf, Bund für Freie Schulgemeinden, Landschulheim am Solling, Akademische Vereinigungen Marburg und Jena, Dürerbund, Comeniusgesellschaft, Bodenreform, Völkerverständigung, Frauenbewegung, Abstinenzbewegung, Rassenhygiene.
103
Besonders in der Akademischen Freischar setzten sich aber mit dem Fortgang des Krieges pazifistische Strömungen durch. Dies begün[28]stigte die Annäherung an die Freistudentenschaft, die inzwischen ihre alte, freilich nie sehr gefestigte „Einheitlichkeit“ weitgehend verloren hatte.Dazu Schwab, Alexander, Die Richtungen in der Meissnerbewegung, in: Studentenschaft und Jugendbewegung, hg. vom Vorort der Deutschen Freien Studentenschaft. – München: Max Steinebach 1914, S. 34–46. Die Gruppe um Wyneken trat schnell wieder aus (bzw. wurde hinausgedrängt).
104
Auch in ihr breitete sich seit Ausbruch des Krieges pazifistisches Gedankengut aus. Die wachsende Bedeutung gerade dieser Tendenz in diesem Teil der Studentenschaft machte der ‚Fall Foerster‘ sichtbar. Friedrich Wilhelm Foerster, Professor der Pädagogik an der Universität München, hatte bereits seit längerem in Schrift und Wort einen christlich begründeten Pazifismus vertreten.[28] Vgl. Schulze/Ssymank, Studententum, S. 459–460. Dort wird gesagt, die Bewegung habe sich nach Ausbruch des Krieges nur an etwa fünf Hochschulen wirklich am Leben erhalten.
105
Auf seiner Grundlage setzte er sich 1917 in seinen Vorlesungen für einen sofortigen Verständigungsfrieden ein. Um seinem angeblich defaitistischen Einfluß auf die Studentenschaft entgegenzuwirken, bildete sich, wie Immanuel Birnbaum in seinen Erinnerungen berichtet, „unter den Münchener Studenten und Studentinnen ein Ausschuß, der gegen die Propaganda Foersters protestierte und Störungen seiner Vorlesungen organisierte. Ein Gegenausschuß nahm den schwungvollen Friedensprediger in Schutz.“Vgl. zu Foersters Position etwa seine Schrift: Politische Ethik und Politische Pädagogik. Mit besonderer Berücksichtigung der kommenden deutschen Aufgaben. 3., stark erweiterte Auflage der „Staatsbürgerlichen Erziehung“. – München: Ernst Reinhardt 1918, bes. S. 327–348 („Cäsar und Christus“). Dort setzt sich Foerster besonders mit Otto Baumgarten, Max Webers Vetter, auseinander.
106
Den Gegenausschuß unterstützten auch Münchener Freistudenten. Andere Freistudentenschaften, etwa die von Breslau und Königsberg, aber auch die Akademischen Freischaren setzten sich mit öffentlichen Erklärungen für Foerster ein.Vgl. Birnbaum, Achtzig Jahre, S. 59.
107
Weber nahm in beiden Reden zu diesem bei den Münchener Freistudenten heftig diskutierten ,Fall Foerster‘ Stellung. In „Wissenschaft als Beruf“ dient er ihm unter anderem dazu, das logische Prinzip der Werturteilsfreiheit und sein institutionelles Korrelat, die Lehr- und Lernfreiheit, zu erläutern, sich also zur Aufgabe der Universität und zur Rolle des akademischen Unterrichts zu äußern, in „Politik als Beruf“ aber dazu, den gesinnungsethischen Charakter des christlichen Pazifismus, seinen angeblichen Illusionismus und mangelnden Realitätssinn, darzutun. Dazu Schulze/Ssymank, Studententum, S. 459–460. Vgl. auch die von Ernst Toller und Elisabeth Harnisch unterzeichnete Erklärung Heidelberger Studenten, in: Die Tat. Monatsschrift für die Zukunft deutscher Kultur, 9. Jg., Heft 9, 1917/18, S. 820.
Schon dieser Hinweis auf den ,Fall Foerster‘ zeigt: Trotz der Sympathie, die Weber offensichtlich der Freien Studentenschaft im Unterschied zu den Korporationen entgegenbrachte, sah er auch in ihr ,Fehlentwicklungen‘ wirksam. Viele seiner Ausführungen in den beiden Reden mußten deshalb Mitglieder dieses Kreises provozieren und waren wohl auch durchaus pro[29]vokativ gemeint. Dies gilt nicht nur für Webers prinzipiellen Antipazifismus, der damals wie heute viele schockierte. Es gilt vor allem für seine Diagnose der ‚Krankheit‘ der akademischen Jugend, die auch Teile der Freistudentenschaft befallen hatte, vor allem aber für die von ihm verordnete Therapie. Weber sah diese ‚Krankheit‘ in der Sehnsucht der akademischen Jugend nach der Befreiung vom wissenschaftlichen Rationalismus durch das ‚Erlebnis‘, in ihrem „modischen Persönlichkeitskult“, überhaupt in ihrer „stark entwickelten Prädisposition zum Sichwichtignehmen“.
108
Wo, wie im Falle Foerster, der Lehrer die Rolle des Führers beanspruchte oder, schlimmer noch, wo Kollegen mit weniger lauterer Gesinnung „‚persönlich‘ gefärbte Professoren-Prophetie“ betrieben,mung nur noch verstärkt und ihr gerade nicht entgegengewirkt. Tatsächlich stiftete die Rede „Wissenschaft als Beruf“ mit ihren scharfen Attacken gegen das ‚Erleben‘ als den Hauptgötzen der akademischen Jugend und mit ihrer restriktiven Auffassung von der Aufgabe der Universität und der Rolle des akademischen Lehrers bei den Münchener Freistudenten eine Vetokoalition zwischen zwei sonst einander bekämpfenden Lagern: zwischen den „‚Bildungs‘-Freunden“ und den „Schwärmern für den ‚wissenschaftlichen Verstandesgebrauch‘“. Nur ein kleiner Kreis, so schrieb Immanuel Birnbaum nach dem Vortrag „Wissenschaft als Beruf“ an Weber, habe sich uneingeschränkt seiner Position angeschlossen. Dazu gehörten vornehmlich solche, die „durch Prof[essor] Husserls Logos-Aufsatz (Philosophie als reine Wissenschaft) und den Methodenstreit der Historiker u[nd] die nationalökonomische Werturteils-Debatte darauf vorbereitet“ gewesen seien.[29] So Weber, Wertfreiheit, S. 45.
110
wurde diese schädliche GrundstimEbd., S. 43. Weber urteilt über Foerster in „Politik als Beruf“ wie folgt: „Der von mir der zweifellosen Lauterkeit seiner Gesinnung nach persönlich hochgeschätzte, als Politiker freilich unbedingt abgelehnte Kollege F. W. Förster […]“ Vgl. unten, S. 240. Brief Immanuel Birnbaums an Max Weber vom 26. Nov. 1917, Bestand Max Weber-Schäfer, Deponat BSB München, Ana 446. Vgl. auch den Editorischen Bericht zu „Wissenschaft als Beruf“, unten, S. 60 f.
Tatsächlich konnte Weber mit seinem Wissenschafts- und Politikverständnis sowie mit seiner Auffassung von den Aufgaben und dem Erziehungswert der Universität weder bei den Studierenden noch bei seinen Professorenkollegen auf ungeteilte Zustimmung rechnen. Er vertrat, angesichts der Zeitströmungen, eine Minderheitsposition. Wie Birnbaums Bemerkung zeigt, war sie tief in die Wissenschafts- und Politikgeschichte des Kaiserreichs verwoben. Husserls Naturalismuskritik
111
sowie der Metho[30]den- und Werturteilsstreit gehörten tatsächlich zu ihrem Hintergrund. Schon bevor Weber den Vortrag „Wissenschaft als Beruf“ hielt, hatte er, wie bereits erwähnt, im Logos sein überarbeitetes Gutachten zum Werturteilsstreit erscheinen lassen. Darin finden sich viele Argumente, die auch in den beiden Reden, insbesondere in „Wissenschaft als Beruf“, vorgetragen werden. Es lohnt sich deshalb, einen Blick auf diesen Text zu werfen. Dadurch lassen sich auch die von Birnbaum geschilderten negativen Reaktionen auf Webers Position besser verstehen. Das gilt ganz besonders für Husserls Kritik an der Reduktion von Erkenntnistheorie auf Erkenntnispsychologie. Um diesen Reduktionismus abzuwehren, bezog sich Weber auch auf Husserls logische Untersuchungen. Daraus darf man freilich noch keine Sympathie für die phänomenologische Methode ableiten. Auch der südwestdeutsche Neukantianismus kämpfte gegen die Reduktion von Erkenntnistheorie auf Erkenntnispsychologie.
Im Wertfreiheitsaufsatz begreift Weber ,Wertfreiheit‘ als ein logisches Prinzip und als eine Maxime des (universitätspolitischen) Handelns. Als logisches Prinzip bezieht sie sich auf die Heterogenität von Erkenntnis- und Wertungs-, Tatsachen- und Geltungssphäre. Hier steht sie im Zusammenhang einer radikalen Naturalismuskritik. Weber kämpft gegen die Naturalisierung des Bewußtseins und gegen die von Ideen und Idealen, also gegen die Naturalisierung der Geltungssphäre. Weder darf ein sinngebender Akt an eine körperliche Erscheinung assimiliert werden noch Geltung an Wirksamkeit. Wo dies geschieht, sind naturalistische Selbsttäuschungen unvermeidlich. Hierin stimmt Weber mit Rickert, Simmel und anderen, darunter auch Husserl, überein.
112
Anders als diese folgt er dabei jedoch einer eigenständigen Werttheorie mit wenigstens drei Prämissen: Heterogenität von Erkenntnissphäre und Wertungssphäre, Ausdehnung der Wertungssphäre auch auf nichtethische Werte, Kollision zwischen den Wertsphären, die nicht mit wissenschaftlichen Mitteln zu lösen ist.[30]Solche naturalistischen Selbsttäuschungen diskutieren beide teilweise an denselben Autoren, etwa an Wilhelm Ostwald. Vgl. dazu Husserl, Edmund, Philosophie als strenge Wissenschaft, in: Logos, Band 1, 1911, S. 289–341, bes. S. 295, und Weber, Max, „Energetische“ Kulturtheorien. [Rez.] Wilhelm Ostwald: Energetische Grundlagen der Kulturwissenschaft, in: AfSS, 29. Band, 2. Heft, 1909, S. 575–598 (demnächst MWG I/ 12).
113
Dazu ausführlich Schluchter, Lebensführung, Band 1, S. 288 ff. Helmuth Plessner urteilt über Webers Verhältnis zu Husserl: „Weber respektierte den Husserlschen Ernst, aber die Sache war ihm zuwider.“ Vgl. Plessner, Helmuth, In Heidelberg 1913, in: König/ Winckelmann (Hg.), Gedächtnis, S. 30–34, hier S. 33.
Weber verlangt also vom akademischen Lehrer, daß er aus prinzipiellen Gründen zwei Probleme voneinander scheide: die Objektivität logischer und empirischer Erkenntnisse einerseits, die Subjektivität und Objektivierbarkeit praktischer Bewertungen andererseits. Nur, wer sich über die Heterogenität dieser Probleme klar sei und dies auch deutlich mache, werde seine Hörer nicht „zur Konfusion verschiedener Sphären miteinander“ verbilden, nur er entgehe der Gefahr, daß er die Feststellung von Tatsachen und die Stellungnahme zu den großen Problemen des Lebens „in die gleiche kühle Temperamentlosigkeit“ taucht.
114
Es ist Aufgabe des akade[31]mischen Lehrers, Fragen der wissenschaftlichen Erkenntnis unbefangen, sachlich und nüchtern zu bearbeiten und zu präsentieren. Für die Erfüllung dieser Aufgabe hat er sich qualifiziert. Ob er in seiner Eigenschaft als Lehrer aber auch die zweite Kategorie von Problemen behandeln solle, ist für Weber selbst eine praktische Frage. Die Stellungnahme dazu entscheide deshalb darüber, welche Erziehungsaufgabe man der Universität noch zugestehe. Bejahe man auch diese zweite Aufgabe, so spreche man der Universität einen umfassenden Erziehungswert zu. Diese Position lasse sich ohne inneren Widerspruch so lange vertreten, wie man die Heterogenität von Erkenntnis- und Wertungssphäre anerkenne. Dann entscheide man sich dafür, daß der akademische Lehrer kraft seiner Qualifikation auch „heute noch die universelle Rolle: Menschen zu prägen, politische, ethische, künstlerische, kulturliche oder andere Gesinnung zu propagieren“, in Anspruch nehmen dürfe.Weber, Wertfreiheit, S. 41.
115
Davon, könnte man hinzufügen, hatten noch die Berliner Universitätsgründer geträumt. Verneine man dies – und die Voraussetzungen, die diese klassische deutsche Universitätsidee einst trugen, sind nach Weber unter dem wachsenden Subjektivismus der modernen Kultur zerfallen[31]Ebd., S. 42.
116
–, so bleibe nur, die Erziehung an der Universität auf die „fachmäßige Schulung seitens fachmäßig Qualifizierter“ zu beschränken.Weber sagt dies mit Bezug auf die Entwicklung der letzten 40 Jahre in der Nationalökonomie. Vgl. ebd., S. 43.
117
Weber sagt ausdrücklich, daß dies sein Standpunkt sei.Ebd., S. 42.
118
Aufgabe der Universität zu seiner Zeit ist demnach offenbar nicht mehr die Erziehung zum Kulturmenschen, sondern nur noch die zum Fachmenschen.Ebd.
119
Weber unterscheidet ja typologisch drei Arten von Erziehung: die charismatische Erziehung auf der Grundlage von außeralltäglichem Wissen, durch die eine im Menschen bereits vorhandene Gabe erweckt wird, die Kulturerziehung auf der Grundlage von Bildungswissen, durch die dem Menschen ein Charakter ankultiviert wird, und die Fachschulung auf der Grundlage von spezialisiertem Fachwissen, durch die der Mensch für nützliche Tätigkeiten abgerichtet wird. Vgl. MWG I/19, S. 302 ff.
Bezieht man diese Überlegung auf die von Birnbaum berichteten negativen Reaktionen, so wird sofort verständlich, weshalb die „,Bildungs‘-Freunde“ Weber nicht folgen konnten. Sie sahen in der Universität offensichtlich eine Bildungsanstalt im klassischen Sinn. Weniger verständlich dagegen ist, weshalb er auch von den „Schwärmern für den ,wissenschaftlichen Verstandesgebrauch‘“ abgelehnt wurde. Das wird erst klarer, wenn man Webers Position noch weiter charakterisiert. Gewiß, Weber sah in der Universität tatsächlich in erster Linie einen Ort fachmäßiger Schulung. Aber dies heißt nicht, daß er, wie vermutlich jene „Schwärmer“, einem naiven, unre[32]flektierten Fachmenschentum das Wort redete. Bereits in seinen berühmten Studien über den asketischen Protestantismus hatte er sich kritisch zu diesem Fachmenschentum geäußert. Dort bezeichnete er diejenigen, die die innere Beschränktheit des modernen Fachmenschen nicht sehen, mit Nietzsches Zarathustra als jene letzten Menschen, die das Glück erfunden hätten. Für sie wählte er die Formel: Fachmenschen ohne Geist, Genußmenschen ohne Herz.
120
Zwar soll Fachschulung sein, aber keine, die nicht zugleich zu intellektueller Rechtschaffenheit und vor allem zu Selbstbegrenzung erzöge. Eine solche Fachschulung aber läßt sich als Fachbildung verstehen. Denn sie schärft das Bewußtsein für die Grenzen des Fachmenschentums selber, dafür, daß die Sinnprobleme des Lebens durch Fachschulung allein nicht zu lösen sind.[32]Weber, Max, Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie, Band 1. – Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) 1920, S. 204 (hinfort: Weber, Religionssoziologie I), demnächst MWG I/18, und Zarathustra, Vorrede, 5.
121
Vgl. Weber, Wertfreiheit, S. 42.
Weber hält also die Universitäten nicht für fähig, Kulturmenschen alten Stils hervorzubringen. Auch hier ist für ihn das Ideal des „vollen und schönen Menschentums“, an dem sich noch die deutsche Klassik orientierte, dahin.
122
Aber er wehrt sich doch zugleich auch dagegen, daß sie zu einem bornierten Fachmenschentum, zu Fachmenschen ohne Geist, erziehen. Er will den selbstkritischen Fachmenschen, der drei Dinge gelernt hat: „1. […] sich mit der schlichten Erfüllung einer gegebenen Aufgabe zu bescheiden; – 2. Tatsachen, auch und gerade persönlich unbequeme Tatsachen, zunächst einmal anzuerkennen und ihre Feststellung von der bewertenden Stellungnahme dazu zu scheiden; – 3. seine eigene Person hinter die Sache zurückzustellen und also vor allem das Bedürfnis zu unterdrücken: seine persönlichen Geschmacks- und sonstigen Empfindun[33]gen ungebeten zur Schau zu stellen.“Vgl. Weber, Religionssoziologie I, S. 203. Weber sieht bekanntlich in den Werken des späten Goethe, in Faust II und in den Wanderjahren, den Abschied von diesem Ideal. Diese Einschätzung spielt auch bei seiner Kritik an den neuidealistischen Bestrebungen eine Rolle, wie sie sich vor allem in den Kreisen um den Verleger Eugen Diederichs entwickelt hatten und auf den Lauensteiner Kulturtagungen eine zentrale Rolle spielten. Zu den Bestrebungen Eugen Diederichs allgemein Hübinger, Gangolf, Kulturkritik und Kulturpolitik des Eugen-Diederichs-Verlags im Wilhelminismus. Auswege aus der Krise der Moderne? In: Troeltsch-Studien, Band 4: Umstrittene Moderne. Die Zukunft der Neuzeit im Urteil der Epoche Ernst Troeltschs, hg. von Horst Renz und Friedrich Wilhelm Graf. – Gütersloh: Gerd Mohn 1987, S. 92–114, ferner Eugen Diederichs, Leben und Werk. Ausgewählte Briefe und Aufzeichnungen, hg. von Lulu von Strauss und Torney-Diederichs. – Jena: Eugen Diederichs 1936, bes. S. 270–308. Zu Organik, Harmonie und Humanität als Leitbegriffen der deutschen Klassik auch Lukács, Georg, Goethe und seine Zeit, 2. Aufl. – Berlin: Aufbau Verlag 1953, S. 57–75. Für Weber wurde Gundolfs Goethebuch wichtig, vgl. Gundolf, Friedrich, Goethe. – Berlin: Georg Bondi 1916 (hinfort: Gundolf, Goethe).
123
Er will den selbstkritischen Fachmenschen, der darüber hinaus Ideale hat und dafür frei und offen eintritt. Einer Sache verpflichtete, selbstbestimmte Menschen soll die Universität prägen. Dafür braucht sie akademische Lehrer, die um den Zusammenhang von Tat und Entsagung wissen und ihn glaubhaft vorleben. [33]Weber, Wertfreiheit, S. 44.
Wenn Weber mit allem Nachdruck darauf besteht, die Rolle des akademischen Lehrers, der als wissenschaftlicher Fachmann zu seinen Studenten spricht, von der Rolle des gelehrten Staatsbürgers, der sich an das allgemeine Publikum wendet, zu unterscheiden, so ist man an Kants Aufklärungsschrift erinnert.
124
Wie bei Kant, gehören auch bei Weber diese Rollen zu Institutionen, die nach Kontrollmechanismen und Rationalitätskriterien verschieden sind. Anders als öffentliche Versammlung und Vortrag stehen nämlich Hörsaal und Vorlesung unter dem „Privileg der Unkontrolliertheit“.Kant hatte dies den Unterschied zwischen dem Privatgebrauch und dem öffentlichen Gebrauch der Vernunft genannt Vgl. Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? A 487, 488.
125
Dies aber lasse Mißbrauch zu. Diese Gefahr könne hier nicht durch „Hineinreden der Öffentlichkeit, z. B. der Presse-Öffentlichkeit“, gebannt werden,Weber, Wertfreiheit, S. 43. Weber spricht von der „Sturmfreiheit des Katheders“. Dies ist institutionell gemeint. Es heißt natürlich nicht, daß die Studierenden keine Kritik an einer vorgetragenen Lehrmeinung üben dürften. Auch für Weber war klar, daß Zweifel und Kritik das Lebenselixier der Wissenschaft sind. Es heißt mit Fichte: „Denn der radikalste Zweifel ist der Vater der Erkenntnis.“ Vgl. ebd., S. 47.
126
sondern allein durch die Selbstbegrenzung des akademischen Lehrers, dadurch, daß er sich jeder Gesinnungspropaganda enthalte. Solche Selbstbegrenzung ist Weber selber, wie bereits angedeutet, sicherlich schwergefallen. Dennoch suchte er sie im Hörsaal zu verwirklichen, und die Sachlichkeit, die er seiner Leidenschaftlichkeit sichtbar abringen mußte, wirkte vielleicht gerade deshalb auf manche Hörer um so nachhaltiger.Dazu Weber, Wertfreiheit, S. 43.
127
Ein gutes Beispiel dafür ist der Bericht von Julie Meyer-Frank, die seit dem Wintersemester 1917/18 in München studierte und Weber außer bei den beiden Vorträgen auch in seinen Münchener Vorlesungen und Seminaren erlebte. Sie schreibt: „Mit scharfen Betonungen dagegen trug Max Weber vor, wie ein Dirigent mit der Hand den Schwung und Rhythmus seiner Rede begleitend, einer Hand, die merkwürdig zierlich war bei dem großhäuptigen, hochgebauten Manne. Ich hörte bei ihm die großen Vorlesungen ‚Soziologische Kategorienlehre‘, ‚Sozial- und Wirtschaftsgeschichte‘ und nahm an seinem Seminar teil. Ich weiß, daß die Kategorienlehre, eingebaut in Webers Buch ‚Wirtschaft und Gesellschaft‘, heute Studenten große Schwierigkeiten bereitet, daß sie sich kaum durch die abstrakten Formulierungen hindurchbeißen können. Aber damals folgten wir mit Spannung, ja mit erwartender Erregung, den kurzen Sätzen, die wie Peitschenschläge einer unerbittlichen Logik Definitionen, abstrakte Auslegung und bildhaftes Beispiel gaben, deren jeder bedeutungsvoll war und die sich zu einer neuen Erkenntnis rundeten. Ich habe niemals Vorlesungsnotizen so sorgfältig wie diese übertragen und weder vorher [34]noch nachher je so stark das Bewußtsein des Lernens gehabt.“ Vgl. Meyer-Frank, Julie, Erinnerungen an meine Studienzeit, in: Vergangene Tage. Jüdische Kultur in München, hg. von Hans Lamm. – München: Langen Müller 1982, S. 212–216, hier S. 216 (hinfort: Meyer-Frank, Erinnerungen). Sie war gleichfalls Mitglied der Münchener Freien Studentenschaft. Eine andere Reaktion gibt Helmuth Plessner wieder, der gleichfalls die Vorlesung über die Kategorienlehre besuchte: „Der Besuch ließ auch rasch nach, was ihm nur recht war. Darstellung lag ihm nicht, weder im Kolleg noch im Buch. Prophetie gar auf dem Katheder haßte er. Ein überfülltes Kolleg – oder war es eine der damals häufigen Studentenversammlungen? – begann er mit dem George-Zitat: Schon Ihre Zahl ist Verbrechen. Sein rednerisches Können verbannte er, wenn er dozierte. In dem Kategorien-Kolleg gab er, ein wahres Bild innerweltlicher Askese, soweit ich mich erinnere, pure Definitionen und Erläuterungen: Trockenbeerauslese, Kellerabzug.“ Vgl. Plessner, Helmuth, In Heidelberg 1913, in: König/Winckelmann (Hg.), Gedächtnis, S. 34.
[34]Tatsachen zu sehen und sie anzuerkennen; sich rückhaltlos in den Dienst einer überpersönlichen Sache zu stellen und die von ihr ausgehende Forderung des Tages zu erfüllen; klar und nüchtern zu denken; sich für seine Sache verantwortlich zu fühlen – dazu soll der akademische Lehrer den Studierenden erziehen. Es sind unspektakuläre Tugenden, die hier gefordert werden, ‚alltägliche‘, nicht ,außeralltägliche‘. ,Held‘ ist auch der, dem es gelingt, den Alltag zu bewältigen, ohne sich dabei bloß anzupassen. Immer wieder lobt Weber vor den Studierenden die ‚Normalität‘ in diesem Sinn. Solches Lob konnte wohl nicht viele der von Krieg und Revolution aufgewühlten jungen Menschen begeistern. Sie suchten nicht das Alltägliche, sondern das Außeralltägliche, nicht den nüchternen Lehrer, sondern den Helden oder Propheten, nicht einen zur Sinngebung unfähigen wissenschaftlichen Rationalismus, sondern die substantielle Sittlichkeit oder die religiöse unio mystica, die sich freilich nur allzuoft als pseudoreligiös erwies. Weber stellt sich sowohl gegen Substantialismus wie gegen Romantizismus. Viele hat bis heute das erste noch mehr als das zweite irritiert. Werner Mahrholz, der wie Immanuel Birnbaum der Freistudentischen Bewegung in München in führender Position angehörte und mit diesem zusammen die beiden Vorträge organisierte, sprach vermutlich vielen aus dem Herzen, als er zu „Wissenschaft als Beruf“ im November 1919 notierte: „Erschütternd ist die Stellung gerade der Führernaturen unter den Professoren: ihnen wird mehr und mehr die Wissenschaft zu einer Form des anständigen Selbstmordes, ein Weg zum Sterben in stoischem Heroismus.“
128
Vgl. Mahrholz, Werner, Die Lage der Studentenschaft, in: Die Hochschule, 3. Jg., 8. Heft, Nov. 1919, S. 230. Mahrholz war übrigens Vorsitzender der Veranstaltung, bei der Weber seinen Vortrag „Politik als Beruf“ hielt. Er kannte Weber bereits von der ersten Lauensteiner Kulturtagung, an der beide teilgenommen hatten. Ähnliches hatte Edgar Jaffé aus Anlaß dieser Tagung, zweifellos mit Bezug auf Max Weber, geschrieben: „Auch die Predigt resignierter Arbeit und bescheidener Wahrhaftigkeit erschien nur wie die Vergoldung dieses Grabes (gemeint ist das Grab des Geistes, W.S.) durch die letzten Strahlen einer Sonne, die ihre erwärmende Kraft verloren hat.“ Vgl. Jaffé, Edgar, Lauenstein, in: Europäische Staats- und Wirtschaftszeitung, II, Nr.42 vom 20. Oktober 1917, S. 995.
[35]Doch es gab auch den kleinen Kreis derer, die Weber mit seinem Plädoyer für das von religiösen Grundlagen emanzipierte Ideal innerweltlicher Berufsaskese überzeugte, für die er gerade als nüchterner Lehrer zugleich ein Führer war. Karl Löwith gehörte sicherlich zu ihnen.
129
Weitere ließen sich nennen.[35]Seine Reaktion wurde bereits zitiert. Vgl. oben, Anm. 53.
130
Viele davon scheinen jüdischer oder protestantischer Herkunft und politisch linksliberal oder sozialdemokratisch, einige auch sozialistisch orientiert gewesen zu sein. Einer, der in dieses Bild besonders gut paßt, ist der bereits öfter erwähnte Immanuel Birnbaum. Er vor allem sorgte dafür, daß die beiden Reden vor der Münchener Freien Studentenschaft gehalten und dann auch noch, in überarbeiteter und erweiterter Form, in ihrem Namen veröffentlicht wurden. Einige Namen finden sich im Protokoll des Gesprächs von Birnbaum mit Horst J. Helle am 3. März 1982, Max Weber-Archiv, München, S. 4, andere in König/Winckelmann (Hg.), Gedächtnis.
Birnbaum hatte sein Studium in Freiburg bei Gerhart von Schulze-Gaevernitz, Heinrich Rickert und Friedrich Meinecke begonnen und war dann über Königsberg, wo er der Freien Studentenschaft beitrat, nach München gekommen, angezogen vor allem von der Lehrtätigkeit Lujo Brentanos und Heinrich Wölfflins. Dies sind alles Namen, die in Webers geistiges Umfeld gehören. Ihn selber hat er wohl erst später, bei politischen Diskussionen im Haus von Lujo Brentano, kennengelernt.
131
Nachdem er zunächst Vorsitzender der Jugendorganisation der Fortschrittlichen Volkspartei in München gewesen war, trat er im Herbst 1917 der Sozialdemokratie bei.Vgl. Birnbaum, Achtzig Jahre, S. 60–61.
132
Birnbaum war 1913/14 an die Spitze der Münchener Freistudentenschaft gelangt und hatte sich an ihrer Arbeit auch noch nach Abschluß seines Studiums bis zur Einrichtung des Allgemeinen Studentenausschusses in München im Zuge der Revolution maßgeblich beteiligt. Zu Pfingsten 1919 wurde er auf dem Ersten Allgemeinen Deutschen Studententag zu einem der drei Vorsitzenden gewählt.Birnbaum schreibt, in Freiburg habe er am Akademischen Freibund teilgenommen, „einer formlosen Studentenvereinigung mit politisch linksliberaler Tendenz“. Ebd., S. 38. In einem Gespräch sagt Birnbaum sogar, Weber habe ihn in die SPD geschickt, und nicht nur ihn, sondern auch seinen Freund Mahrholz und andere! Siehe Gespräch Birnbaums mit Horst J. Helle am 3. März 1982, Protokoll, S. 10–11, Max Weber-Archiv, München.
133
Er trug also dazu bei, daß die Ziele, die sich die freistudentische Bewegung einst gesetzt hatte, tatsächlich verwirklicht wurden. Am Ende dieser Entwicklung stand die verfaßte Studentenschaft. Vgl. Birnbaum, Achtzig Jahre, S. 75.
„Wissenschaft als Beruf“ und „Politik als Beruf“ waren Teil einer Vortragsreihe, die der „Freistudentische Bund. Landesverband Bayern“,
134
[36]vermutlich seit dem Sommer des Jahres 1917, plante. Dieser Reihe gab er den Titel „Geistige Arbeit als Beruf“. Sie wurde durch den Aufsatz „Beruf und Jugend“ von Alexander Schwab provoziert, den dieser unter dem Pseudonym Franz Xaver SchwabDer „Freistudentische Bund. Landesverband Bayern“ war die Organisation ehemaliger Freistudenten, die auch nach Ablegung ihrer Examina in der Freistudentischen Bewe[36]gung aktiv bleiben wollten. Vgl. dazu: Philipp Löwenfeld, in: Jüdisches Leben in Deutschland. Band 2: Selbstzeugnisse zur Sozialgeschichte im Kaiserreich, hg. von Monika Richarz. – Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt 1979, S. 310–324, hier S. 316 f.
135
in der Monatsschrift „Die weißen Blätter“ vom 15. Mai 1917 veröffentlicht hatte.Siehe dazu den Editorischen Bericht zu „Wissenschaft als Beruf“, unten, S. 51 f.
136
Darin nennt er den Beruf den Götzen, der gestürzt werden müsse. Er sei der Götze der heutigen westeuropäisch-amerikanischen bürgerlichen Welt. Er bilde ihren Kern, um den sich alles drehe. Er habe sich zwischen die Grundkräfte unseres Daseins, das (leibliche) Leben und den Geist, geschoben, obgleich er diesen „Urmächten in ihrer reinen Göttlichkeit völlig fremd“ sei.Zu den Einzelheiten vgl. die Editorischen Berichte.
137
Nur Entfremdung könne aus dieser Situation erwachsen, Entfremdung des Lebens und des Geistes voneinander und deshalb auch von sich selbst. Ihre Wiederversöhnung sei das Gebot der Stunde, die nur dort gelingen könne, wo die Herrschaft des Berufs und des mit ihm verbundenen Spezialistentums überwunden werde. Wie einst die „Griechen der blühenden Zeit“, so könne auch die heutige Jugend zum vollen und schönen Menschentum kommen. Dazu müsse sie erst einmal die Gefährdungen der Seele durch den Beruf erkennen. Dies würde sie ganz von selbst in eine radikale Opposition zur bürgerlichen Welt bringen, mit der die Ideologie, aus der Not der knechtenden Berufsarbeit eine sittliche Tugend zu machen, untrennbar verbunden sei.Schwab, Franz Xaver, Beruf und Jugend, in: Die weißen Blätter. Eine Monatsschrift, Jg. 4, Heft 5, Mai 1917, S. 97–113, hier S. 104.
138
Schwab spricht in diesem Zusammenhang auch vom „westeuropäisch-amerikanischen Menschentum“. Vgl. ebd., S. 97.
Schwabs romantischer Antikapitalismus dürfte für sich genommen die Münchener Freistudenten kaum besonders erregt haben. Solche Tendenzen waren bei den verschiedenen Jugend- und Studentenbewegungen der Zeit keine Seltenheit. Erregen aber mußte sie Schwabs Feststellung, keine der einschlägigen Jugend- und Studentengruppen habe sich bisher ernsthaft mit dem Berufsproblem beschäftigt, auch nicht die Freistudenten.
139
Und er wies zugleich einen Weg, wie diesem beklagenswerten Zustand abzuhelfen sei. Man solle sich zunächst mit den Arbeiten von Max und Alfred Weber auseinandersetzen. Denn „die einzigen Menschen unserer [37]Zeit, die an sichtbarer Stelle Wichtiges über den Beruf geäußert haben, sind die Brüder Max und Alfred Weber in Heidelberg“.Schwab nennt neben den Freistudenten den George-Kreis, den Wandervogel, Sprechsaal und Anfang, die Freischar und die abstinenten Studenten, Lietz und Wyneken und den „ganzen Wickersdorfer Kreis“. Vgl. ebd., S. 105.
140
[37]Ebd., S. 104. Ferner der Editorische Bericht zu „Wissenschaft als Beruf“, unten, S. 54.
Wir wissen nicht, wann Birnbaum oder ein anderes Mitglied des Bayerischen Landesverbandes der Freistudenten zum ersten Mal an Weber mit der Bitte herantrat, im Rahmen der als Reaktion auf Schwabs Provokation gedachten Reihe zunächst über „Wissenschaft als Beruf“, dann auch noch über „Politik als Beruf“ zu sprechen. Was man mit Gründen vermuten kann, ist in den Editorischen Berichten ausgeführt. Hier interessieren nicht diese Fragen des äußeren Ablaufs, sondern die geistigen Auseinandersetzungen. Und da fällt auf, daß sich Weber in der am 7. November 1917 gehaltenen Rede „Wissenschaft als Beruf“, mit der die Reihe eröffnet wurde, Schwabs Provokation zumindest indirekt stellte. Er zerstörte nicht nur gnadenlos jenen Mythos vom vollen und schönen Menschentum, dem dieser anhing,
141
er zeigte auch, daß Beruf und Lebenssinn keineswegs unvereinbare Gegensätze sein müssen. Freilich, so seine Botschaft, gilt es diesen Zusammenhang richtig zu verstehen. Er ergibt sich gerade nicht aus der Entschränkung, sondern nur aus der von Schwab so beklagten Beschränkung der beruflichen Arbeit. Nicht nur für die Wissenschaft gilt, daß „eine wirklich endgültige und tüchtige Leistung […] heute stets: eine spezialistische Leistung“ ist.Daß Weber in „Wissenschaft als Beruf“ auf das Griechentum eingeht, ist möglicherweise Schwabs rückwärts gewandter Utopie geschuldet und nicht, wie mitunter behauptet, Georg Lukács, der in seiner von Weber zum Druck vermittelten Theorie des Romans ja gleichfalls das bürgerliche Zeitalter als Zeitalter vollendeter Sündhaftigkeit mit der griechischen Welt kontrastiert. Vgl. Lukács, Georg, Theorie des Romans. Ein geschichtsphilosophischer Versuch über die Formen der großen Epik, in: Zeitschrift für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft, XI, 1916, S. 221–271 und S. 390–431, bes. 1 (Geschlossene Kulturen).
142
Nur demjenigen, der in der Lage ist, sich rücksichtslos und kontinuierlich einer begrenzten Sache hinzugeben und die daraus erwachsenden Forderungen des Tages zu erfüllen, erschließt sich der „heute wirklich noch bedeutsam gebliebene Sinn“ von Beruf.„Wissenschaft als Beruf“, unten, S. 80.
143
Weber, Wertfreiheit, S. 45.
Nun mag solcher ,Berufssinn‘ für den Wissenschaftler und akademischen Lehrer plausibel erscheinen. Ist er es aber auch für den Politiker? Hat dieser nicht auf die großen kollektiven Lebensprobleme Antworten zu geben, die weder durch Fachschulung noch durch Fachbildung zu erlangen sind? Gewiß, nach Weber unterliegt die moderne Demokratie, die ja dem Politiker kein „Privileg der Unkontrolliertheit“ läßt, im Großstaat der Bürokratisierung. Sie ist „bürokratisierte Demokratie“.
144
Dies heißt, daß man in ihr mit [38]der „Notwendigkeit langjähriger fachlicher Schulung, immer weitergehender fachlicher Spezialisierung und einer Leitung durch ein derart gebildetes Fachbeamtentum“ rechnen muß.Vgl. zu diesem Begriff unter anderem MWG I/15, S. 606, und zur Interpretation [38]Schluchter, Wolfgang, Aspekte bürokratischer Herrschaft. Studien zur Interpretation der fortschreitenden Industriegesellschaft, Neuausgabe. – Frankfurt: Suhrkamp 1985, Kap. 3.
145
Es heißt aber nicht, daß man diesem gebildeten Fachbeamtentum, so unentbehrlich es ist, auch die politische Leitung überlassen darf. Auch die moderne „Großstaatsdemokratie“ als Massendemokratie brauche politische Führer. Und diese stellen für Weber geradezu das Gegenbild zu den Beamten, aber auch zu den Wissenschaftlern dar.MWG I/15, S. 606–607.
146
Freilich: Wie es verschiedene Auffassungen vom Wissenschaftler und vom akademischen Lehrer gibt, so gibt es auch verschiedene Auffassungen vom politischen Führer. Weber diskutiert sie in der zweiten Rede, in „Politik als Beruf“, wobei er für den Druck lange Passagen gerade unter diesem Gesichtspunkt einfügt, und er zeichnet schließlich das Bild des Verantwortungspolitikers, in Abgrenzung vom Gesinnungspolitiker einerseits, vom Machtpolitiker andererseits. Der Verantwortungspolitiker muß zustimmungsfähige politische Positionen formulieren können und bereit sein, sie auf eigenes Risiko zu vertreten. Er muß sich aber auch auf die „diabolischen Mächte“ einlassen, die in jeder, auch der legitimen Gewaltsamkeit lauern,Zur Abgrenzung dieser drei Rollen voneinander und zu ihren normativen und institutionellen Bezügen ausführlich Schluchter, Wolfgang, Wertfreiheit und Verantwortungsethik. Zum Verhältnis von Wissenschaft und Politik bei Max Weber. – Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) 1971.
147
und er muß schließlich fähig sein, sich ihrer korrumpierenden Wirkung zu entziehen. Kurz: Er muß leidenschaftlich einer Sache dienen, Verantwortung für sie übernehmen und sie mit Augenmaß, kühler Distanz und der „geschulten Rücksichtslosigkeit des Blickes in die Realitäten des Lebens“Vgl. „Politik als Beruf“, unten, S. 241.
148
verwirklichen. Ein solcher politischer Führer verdient Gefolgschaft. Aber entscheidend ist: Ihm folgt man nicht aus „romantischer Sensation“Ebd., unten, S. 249.
149
oder aus „Anbetung der Macht“,Ebd., unten, S. 250.
150
sondern aus rationaler Einsicht. Ebd., unten, S. 229.
Der Wissenschaftler als selbstkritischer Fachmensch und der Politiker als verantwortungsethischer Führer stehen sich also scheinbar unvereinbar gegenüber. Dort nüchternes Erkennen, hier leidenschaftliches Bekennen, dort Aufweis des Möglichen, hier auch der Griff nach dem scheinbar Unmöglichen.
151
Doch zeigt sich schnell, daß dies nicht Webers letztes Wort ist. Beide Figuren weisen trotz ihrer Verschiedenheit Gemeinsamkeiten auf. Vgl. dazu die bezeichnende Formulierung in: Wertfreiheit, S. 63.
[39]Zunächst läßt sich ja nicht übersehen, daß Weber in „Politik als Beruf“ wie bereits in „Wissenschaft als Beruf“ eine Argumentation vortrug, die geeignet war, eine Vetokoalition zwischen zwei sich sonst bekämpfenden Lagern zu stiften. Um es in Analogie zu der Formulierung Birnbaums zu sagen: zwischen den ‚Freunden der Gesinnungspolitik‘ einerseits und den ,Schwärmern für den reinen Machtgebrauch‘ andererseits. Weber ging hart ins Gericht mit jenen Gesinnungspolitikern und ihren Anhängern unter den Freistudenten, die sich „an romantischen Sensationen berauschen“
152
und sich Illusionen machen. Die wichtigste Illusion: daß es je ein ernsthaftes und wichtiges politisches Tun geben könne, das den Handelnden nicht in Machtverhängnisse verstrickte. Solchen Illusionismus sah er vornehmlich bei Pazifisten, Syndikalisten, auch bei Spartakisten am Werke, vor allem aber bei jenen politischen Literaten, die sich in Kurt Eisners Räteregierung versammelt hatten. (Eisner selbst soll ja von radikalen Mitgliedern der Freistudenten als Redner für „Politik als Beruf“ in Erwägung gezogen worden sein.)[39]„Politik als Beruf“, unten, S. 250.
153
All diese Gruppierungen neigten in Webers Augen dazu, entweder die unhintergehbare Realität aller Politik, die Gewalt und ihre Eigengesetzlichkeit, zu leugnen oder zur Gewalt aufzurufen, „zur letzten Gewalt, die dann den Zustand der Vernichtung aller Gewaltsamkeit bringen würde.“Vgl. dazu den Editorischen Bericht zu „Politik als Beruf“.
154
In diesem Glauben an die Gewalt aber kommen sie den ‚Schwärmern für den reinen Machtgebrauch‘ nahe, für die die Macht ein Wert an sich ist. Freilich sind diese „bloßen ,Machtpolitiker‘“ außerstande, sich an eine überpersönliche Sache zu binden. So wirken sie „ins Leere und Sinnlose“,„Politik als Beruf“, unten, S. 240.
155
während die illusionären Gesinnungspolitiker, zumindest die von der radikalen Linken, von der Hoffnung auf eine durch direkte Aktionen herbeizuführende Befreiung der Menschheit geleitet sind.Ebd., unten, S. 229.
156
Wenige Monate vor der Rede „Politik als Beruf“ hatte sich Weber bereits mit den illusionären und realistischen Strömungen des Sozialismus auseinandergesetzt, in seinem Vortrag „Der Sozialismus“ am 13. Juni 1918 in Wien, der kurz darauf als Broschüre erschienen war. Dort ging er auf Generalstreik und Terror als Mittel des Umsturzes und auf die damit verbundene „Romantik der revolutionären Hoffnung“ ein, die „diese Intellektuellen bezaubert“. Vgl. MWG I/15, S. 628. In seiner Rede am 4. November 1918 in München über „Deutschlands politische Neuordnung“ mußte er sich mit einer starken „chiliastisch-revolutionär bewegten Minderheit“ von Linksintellektuellen auseinandersetzen, darunter der Anarchist Erich Mühsam und der Bolschewist Max Lewien. Vgl. dazu MWG I/ 16, S. 359–369. Bei der Rede „Politik als Beruf“ am 28. Januar 1919 traf Weber in seinem Publikum außer auf Freistudenten auch auf Freideutsche und auf „eine Gruppe jüngerer dichterisch revolutionär gesinnter Studenten (Trummler, Roth usw.)“, vermutlich auch auf Ernst Toller. Webers Beziehung zu Erich Trummler und ErnstToller geht auf die Lauensteiner Kulturtagungen zurück. Zur Zusammensetzung des Publikums bei der Rede „Politik [40]als Beruf“ vgl. den Brief von Frithjof Noack an Marianne Weber vom 26. Okt. 1924, Bestand Max Weber-Schäfer, Deponat BSB München, Ana 446. Einer der Freideutschen könnte Knud Ahlborn gewesen sein, der der Akademischen Freischar angehörte, der proletarischen Jugendbewegung nahestand und gleichfalls an den Lauensteiner Kulturtagungen teilgenommen hatte.
[40]Wie die reinen Fachmenschen, so sind Weber auch die reinen Machtmenschen zuwider. Sie verkörpern all die Eigenschaften, die er in der Politik verachtet: Unsachlichkeit, Verantwortungslosigkeit, Eitelkeit. Sie gelten ihm als die Schauspieler der Politik, deren „innere Schwäche und Ohnmacht“ sich hinter einer „protzigen, aber gänzlich leeren Geste“ verberge.
157
Nicht so die Gesinnungspolitiker, die einer überpersönlichen Sache dienen. Sie suchen inneren Halt. Freilich ertragen sie nur allzu selten die Realitäten des Lebens. Das heißt aber nicht, daß sie immer zum Scheitern verurteilt sind. Wenn sie sich mit ihrer ,Sendung‘ objektiv bewähren und die Verstrickung in Machtverhängnisse ertragen, ist Weber bereit anzuerkennen, daß sie den Beruf zur Politik haben. Denn dann wissen sie um „die Tragik, in die alles Tun, zumal aber das politische Tun, in Wahrheit verflochten ist“.„Politik als Beruf“, unten, S. 229.
158
Dann wissen sie um seine Beschränktheit und darum, daß das politische Handeln von ihnen eine spezifische Art von Selbstbegrenzung fordert. Dieses Wissen um die Tragik des politischen Tuns ist auch für den Verantwortungspolitiker bestimmend. Aber er zieht daraus im Vergleich zum echten Gesinnungspolitiker eine weiterreichende Konsequenz. Er begnügt sich nicht damit, die Verantwortung für den Gesinnungswert seines politischen Handelns zu übernehmen, sondern weitet diese Verantwortung auf seine voraussehbaren Folgen aus. Dieser gesteigerten Verantwortung aber kann er nur gerecht werden, wenn er jene Tugenden besitzt, von denen Weber sagt, daß sie der Studierende von seinem Lehrer im Hörsaal lernen solle. Es sind jene Tugenden, die bereits zitiert wurden: sich mit der Erfüllung einer gegebenen Aufgabe zu bescheiden, auch persönlich unbequeme Tatsachen anzuerkennen und die eigene Person hinter die Sache zurückzustellen.Ebd.
159
Weber, Wertfreiheit, S. 44.
4. Der Grundgedanke der Vorträge „Wissenschaft als Beruf“ und „Politik als Beruf“
Weber vertrat also gegenüber den Münchener Freistudenten in seinen beiden Reden denselben Grundgedanken: daß man dem Beruf jeglichen Sinn nehme, „wenn man diejenige spezifische Art von Selbstbegrenzung, [41]die er verlangt, nicht vollzieht“.
160
Die Art dieser Selbstbegrenzung ist in Wissenschaft und Politik verschieden, die Selbstbegrenzung als solche aber ist es nicht. Webers Botschaft an die Freistudenten lautet: Geistige Arbeit als Beruf bedeutet entsagungsvolles, nicht versöhntes Leben, bedeutet „Beschränkung auf Facharbeit“, nicht „faustische Allseitigkeit“.[41]Ebd., S. 45.
161
Dieses Insistieren auf dem asketischen Grundmotiv wollten viele nicht hören. Auch die Rede über „Politik als Beruf“ löste, wie schon die über „Wissenschaft als Beruf“, bei vielen Freistudenten wohl eher ungute Gefühle aus. Dies sicherlich nicht allein deshalb, weil Weber, wie ein Teilnehmer berichtet, in „souveräner Nichtachtung“ etwa über Foerster, Eisner oder Arbeiter- und Soldatenräte urteilte,So am Ende der Studie über den asketischen Protestantismus. Vgl. Weber, Religionssoziologie I, S. 203.
162
sondern vor allem, weil er den Idealismus der Gesinnungspolitiker brutal mit der Machtverstrickung allen politischen Handelns konfrontierte und dadurch den Eindruck erweckte, als habe politisches Handeln nichts mit Werten zu tun. Daß Weber so nicht dachte, steht außer Frage. Aber man mußte unbefangen hinhören, um das komplexe Beziehungsgeflecht von Macht, Ethik und Wahrheit zu erfassen, in das er die von ihm zweifellos propagierte Verantwortungspolitik stellte. Vgl. Brief von Frithjof Noack an Marianne Weber vom 26. Okt. 1924, Bestand Max Weber-Schäfer, Deponat BSB München, Ana 446. Vgl. auch Webers Zeugenaussagen in den Prozessen gegen Ernst Toller und Otto Neurath, MWG I/16, S. 485–495. Julie Meyer-Frank berichtet, kurz nach Ende des Vortrags „Politik als Beruf“ hätten die Anwesenden den Vortragssaal verlassen müssen, weil Anhänger Eisners die Versammlung sprengen wollten. Weber habe Eisner kurz vor dem Vortrag den „Hanswursten des Blutigen Karnevals“ genannt. Dazu Meyer-Frank, Erinnerungen, S. 213–214.
Beruf und Selbstbegrenzung, Beruf als Selbstbegrenzung, dies also ist Webers Botschaft an die akademische Jugend. Wer mit geistiger Arbeit als Beruf für sich einen Sinn verbinden will, wer in ihr nicht, wie Schwab, einfach einen ökonomischen Zwang sieht, der muß in der Gegenwart den Wert dieses ‚asketischen Grundmotivs‘ bejahen. Nach Weber gehörte es bekanntlich zur bürgerlichen Lebensführung von Beginn an. Und es darf aus ihr auch nicht verschwinden, wenn diese nicht zur bloßen Lebenstechnik verblassen soll. Gewiß, der christliche Geist, der ihr einst inneren Halt gab, ist längst daraus gewichen. Das hatte Weber bereits in seinen Studien zum asketischen Protestantismus gezeigt. Deshalb kann der Wert dieses Motivs auch nicht mehr religiös, er muß vielmehr säkular fundiert werden. Dies genau geschieht in den beiden Reden, wobei Webers gesamtes Werk dafür den Hintergrund bildet.
Um diese Fundierung zu leisten, setzt Weber die beiden Begriffe Beruf und Selbstbegrenzung zu einem dritten in eine innere Beziehung: zu dem Begriff der Persönlichkeit. Aus ihm wird jeder ‚romantische‘ Bedeutungsge[42]halt gestrichen. Schon früh, in seiner Auseinandersetzung mit Knies und dem Irrationalitätsproblem, hatte er sich gegen jenen romantisch-naturalistischen Persönlichkeitsbegriff gewendet, der in dem „dumpfen, ungeschiedenen vegetativen ,Untergrund‘ des persönlichen Lebens […] das eigentliche Heiligtum des Persönlichen sucht“.
163
In den Reden wandte er sich gegen einen romantisch-ästhetischen Persönlichkeitsbegriff, der im Erleben oder gar in der Gestaltung des Lebens zum Kunstwerk dieses Heilige sieht.[42]Weber, Max, Roscher und Knies und die logischen Probleme der historischen Nationalökonomie. (Dritter Artikel) II. Knies und das Irrationalitätsproblem. (Fortsetzung.) In: Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft im Deutschen Reich, hg. von Gustav Schmoller, 30. Jg., 1906, 1. Heft, S. 81–120, hier S. 108 (hinfort: Weber, Roscher), demnächst MWG I/7.
164
Weder die naturalistische noch die ästhetizistische Variante erfaßt, worauf es Weber ankommt: auf das konstante innere Verhältnis, das eine Person „zu bestimmten letzten ,Werten‘ und Lebens-,Bedeutungen‘“Vgl. „Wissenschaft als Beruf“, unten, S. 84, wo Weber sagt, daß es sich „selbst bei einer Persönlichkeit vom Range Goethes gerächt“ habe, „daß er sich die Freiheit nahm: sein ,Leben‘ zum Kunstwerk machen zu wollen“.
165
in einem Bildungsprozeß gewinnt, der dadurch zum Schicksalsprozeß wird. Diesem Persönlichkeitsbegriff korrespondiert am ehesten ein asketischer humanistischer Individualismus: asketisch, weil methodisches Handeln im Dienst einer überpersönlichen Sache verlangt wird, humanistisch, weil diese Sache die konstante Bindung an letzte Werte voraussetzt, individualistisch, weil diese konstante Bindung durch eine Kette letzter Entscheidungen selbst gewählt werden muß. Wo diese Bedingungen erfüllt sind, ist eine Person, absichtslos, zur Persönlichkeit geworden. Sie hat, wie es am Ende von „Wissenschaft als Beruf“ heißt, ihren Dämon gefunden und gelernt, ihm zu gehorchen, indem sie der Forderung des Tages genügt, die er erhebt. Weber, Roscher, S. 108.
Es ist sicherlich kein Zufall, daß zwei der wichtigsten Texte Webers, die Studien zum asketischen Protestantismus und „Wissenschaft als Beruf“, mit Anspielungen auf Goethes Spätwerk enden. Dort ist jener Persönlichkeitsbegriff, den er wohl im Auge hatte, vorformuliert. Trotz mancher Tendenzen zu einem ästhetischen und kosmologischen Humanismus in Goethes Werk, denen Weber distanziert gegenüberstand, haben in seinen Augen „Wilhelm Meisters Wanderjahre oder Die Entsagenden“ und Faust II den Sinn des asketischen Grundmotivs auch jenseits christlicher Religion gültig entwickelt, und in den „Urworten“ ist am Zusammenspiel des Dämons, der Individualität, des Charakters, der Person, mit der ,Welt‘ deutlich gemacht, daß man der Gefahr, das Eigene an das Zufällige, das Innere an das Äußere zu verlieren, letztlich nur durch Selbstbegrenzung entgeht. Man [43]täte Weber sicherlich Unrecht, würde man die Übernahme dieses Begriffs des Dämons elitistisch interpretieren, wie dies zum Beispiel der Georgianer Friedrich Gundolf in seinem Goethebuch getan hat, demzufolge nur große Menschen, Genies, einen Dämon und damit ein eigenes Schicksal haben können, der gewöhnliche Mensch aber „bloße Eigenschaften, Meinungen, Beschäftigungen und Erfahrungen, die von außen bedingt, nicht von innen erbildet sind“.
166
Denn Weber will zwar Geistesaristokratie, aber keinen Elitismus.[43]Gundolf, Goethe, S. 4.
167
Jeder kann seinen Dämon finden, jeder zur Persönlichkeit werden, jeder ein selbstbestimmtes Leben führen, wenn er nur in rückhaltloser Hingabe einer selbstgewählten überpersönlichen Sache dient. Freilich setzt dies voraus, daß die Ideen, die Weltbilder, mit denen man sein Leben deutet, und die gesellschaftlichen Ordnungen, in denen man es leben muß, das asketische Grundmotiv nicht gänzlich obstruieren. Es setzt aber vor allem voraus, daß der heranwachsenden Generation der Zusammenhang von beruflichem Tun, äußerlich zugemuteter sowie innerlich bejahter Selbstbegrenzung und Persönlichkeitsbildung gerade in Zeiten der Krise, des Umbruchs und des dadurch ausgelösten Enthusiasmus ins Bewußtsein gerufen wird.Dies unterscheidet ihn eben nicht nur von den Georgianern, sondern auch von den Nietzscheanern.
168
Dem dienen letztlich beide Reden. Insofern sind sie in ihrem Kern ‚philosophische‘ Texte, geben Erkenntnis und Bekenntnis zugleich. Man denke nur an die Schlußpassagen von „Politik als Beruf“ mit dem Zitat aus Shakespeares 102. Sonett, unten, S. 251.
5. Die Datierung der Vorträge „Wissenschaft als Beruf“ und „Politik als Beruf“ in der bisherigen Forschung
Die Datierung des Vortrags „Wissenschaft als Beruf“ ist in der Forschung lange Zeit umstritten gewesen. Dabei haben die Erinnerungen von Zeitgenossen, denen zufolge Max Weber die beiden Vorträge „Wissenschaft als Beruf“ und „Politik als Beruf“ im Winter 1918/19, also in einem geringen zeitlichen Abstand, gehalten habe,
169
eine wichtige Rolle gespielt. Vermut[44]lieh sind diese Erinnerungen entscheidend von Marianne Weber beeinflußt worden, die in ihrer Biographie Max Webers mitteilte, sowohl „Wissenschaft als Beruf“ wie auch „Politik als Beruf“ seien im Jahre 1918 gehalten und 1919 veröffentlicht worden.Siehe dazu Löwith, Karl, Die Entzauberung der Welt durch Wissenschaft. Zu Max Webers 100. Geburtstag, in: Merkur. Deutsche Zeitschrift für europäisches Denken, 18. Jg., 1964, Heft 196, S. 501–519, hier S. 504; ders., Max Webers Stellung zur Wissenschaft, in: Vorträge und Abhandlungen. Zur Kritik der christlichen Überlieferung. – Stuttgart/Berlin/Köln/Mainz: W. Kohlhammer Verlag 1966, S. 228–252, hier S. 232, sowie Meyer-Frank, Erinnerungen, S. 212–216, hier S. 213 f. Wie unzuverlässig ihre Angaben sind, ergibt sich nicht zuletzt daraus, daß sich sowohl Karl Löwith als auch Julie Meyer-Frank schon hinsichtlich der Datierung des Vortrags „Politik als Beruf“, der unzweifelhaft [44]am 28. Januar 1919 stattgefunden hat (siehe den Editorischen Bericht zu „Politik als Beruf“, unten, S. 121), irren. Karl Löwith zufolge sollen beide Vorträge nach „der Ermordung K[urt] Eisners und G[ustav] Landauers“, also nach dem 2. Mai 1919, gehalten worden sein. Julie Meyer-Frank zufolge müßte der Vortrag „Politik als Beruf“ erst im Juni 1919 stattgefunden haben, da nach ihrer Erinnerung Max Weber in einer anschließenden Diskussion von seinen Ende Mai 1919 gemachten Erfahrungen als Mitglied der Friedensdelegation in Versailles berichtet haben soll.
170
Diese Angabe ist allerdings insofern verwunderlich, als Marianne Weber bei der Abfassung ihres Buches Frithjof Noack, ehemals Vorsitzender des Sozialwissenschaftlichen Vereins in München, eigens mit Recherchen zur Datierung beauftragt hatte und dabei erfuhr, daß ‚Wissenschaft als Beruf‘ „bereits Anfang Nov[ember] 1917“ und ‚Politik als Beruf‘ „11/2 Jahre später im Febr[uar] od[er] März 1919 gehalten“ worden sei.Weber, Marianne, Lebensbild1, S. 719.
171
Johannes Winckelmann übernahm Marianne Webers Datierung von „Wissenschaft als Beruf“ auf den Winter 1918/19 in dem von ihm veranstalteten Neuabdruck dieses Textes,Brief Frithjof Noacks an Marianne Weber vom 26. Okt. 1924, Bestand Max Weber-Schäfer, Deponat BSB München, Ana 446.
172
und auch Eduard Baumgarten hielt in seiner Veröffentlichung über Max Weber an der Vorstellung vom engen zeitlichen Zusammenhang der beiden Reden fest und datierte sie auf Januar/Februar 1919.Max Weber. Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, 2. Aufl., hg. von Johannes Winckelmann. – Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) 1951, S. 566.
173
In den folgenden Jahren entspann sich dann, ausgelöst durch eine Anfrage Winckelmanns,Baumgarten, Eduard, Max Weber. Werk und Person.-Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) 1964, S. 715.
174
eine Kontroverse zwischen Immanuel Birnbaum und Eduard Baumgarten. Während Birnbaum, der zu dieser Zeit Redakteur bei der Süddeutschen Zeitung war, sich an einen Abstand von „mehreren Monaten“ zwischen „Wissenschaft als Beruf“ und „Politik als Beruf“ erinnerte,Brief Johannes Winckelmanns an Immanuel Birnbaum vom 8. Juli 1970, Max Weber-Archiv, München.
175
meinte Baumgarten aufgrund seiner guten Kenntnis des Briefwerks und des privaten Umfeldes Webers seine Angaben dahingehend präzisieren zu können, daß „Wissenschaft als Beruf“ am 16. Januar 1919 und „Politik als Beruf“ am 28. Januar 1919 gehalten worden sei.Siehe Brief Immanuel Birnbaums an Johannes Winckelmann vom 15. Juli 1970, ebd.
176
Den Herausgebern dieses Bandes gelang es schließlich, die Datierung des Vortrags „Wissenschaft als Beruf“ anhand von Berichten in der Münchener [45]Tagespresse auf den November 1917 definitiv zu sichern.Siehe Baumgartens Ausführungen „Zur Frage der Datierung der Vorträge Webers: Wissenschaft als Beruf und Politik a. B.“, ebd.
177
Man schloß jedoch auch danach die Möglichkeit nicht aus, daß Weber „Wissenschaft als Beruf“ im Winter 1918/19 ein zweites Mal gehalten habe. Während Birnbaum, der zu diesem Thema im Jahre 1979 nochmals befragt wurde, dies als „höchst unwahrscheinlich“ bezeichnete,[45]Siehe Mommsen, Max Weber, S. 289 f., Anm. 292, sowie Schluchter, Wolfgang, Excursus: The Question of the Dating of „Science as a Vocation“ and „Politics as a Vocation“, in: Roth, Guenther and Schluchter, Wolfgang, Max Weber’s Vision of History. Ethics and Methods. – Berkeley/Los Angeles/London: University of California Press 1979, S. 113 ff., und ders., Rationalismus, S. 236 ff., Anm. 2. Darüber hinaus findet sich auf S. 17 des „Gästebuchs Steinicke“, das in der Münchner Stadtbibliothek, Handschriften-Abteilung, aufbewahrt wird, ein Hinweis, daß Prof. Max Weber am 7. November 1917 im Steinicke-Saal einen Vortrag gehalten hat.
178
gab ein 1986 erschienener, 1940 in Japan im Exil geschriebener Bericht Karl Löwiths, wonach er beide Vorträge im Winter 1918/19 gehört haben will,Brief Immanuel Birnbaums an Martin Riesebrodt vom 17. Jan. 1979, Max Weber-Archiv, München.
179
der alten Vorstellung eines engen zeitlichen Zusammenhangs von „Wissenschaft als Beruf“ und „Politik als Beruf“ bzw. der These, „Wissenschaft als Beruf“ sei ein zweites Mal gehalten worden, der wissenschaftlichen Öffentlichkeit erneut Anlaß zu Spekulationen. Allerdings sind Löwiths Zeitangaben auch in diesem Bericht äußerst vage. So hat er sein Studium in München bereits im Wintersemester 1917/18Löwith, Bericht, S. 16 f.
180
und nicht – wie es sich seinem Bericht entnehmen läßt –Auskunft des Universitätsarchivs München vom 5. Juli 1989.
181
im Sommersemester 1918 aufgenommen. Daraus folgt, daß er durchaus bei Webers Vortrag am 7. November 1917 anwesend sein konnte. Daß er tatsächlich anwesend war, ergibt sich aus seiner relativ korrekten Beschreibung des Ablaufs. So betont er, Weber habe frei geredet und seine Rede sei mitstenographiert worden.Löwith, Bericht, S. 13 ff.
182
Hätte Löwith die Rede nicht am 7. November 1917 gehört, so hätte Weber sie bei demselben Veranstalter, im selben Saal, vor demselben Publikum zweimal frei gehalten. Zweimal auch hätte man die freie Rede mitstenographiert. Für diese Annahme gibt es keine Stütze, weder in der Korrespondenz des Freistudentischen Bundes mit Max Weber oder dem Verlag Duncker & Humblot, bei dem die beiden Texte „Wissenschaft als Beruf“ und „Politik als Beruf“ veröffentlicht wurden, noch in den Erinnerungen Birnbaums.Ebd., S. 16.
183
Auch Baumgartens Angabe, er könne anhand der Korrespondenz Webers beweisen, daß der Vortrag „Wis[46]senschaft als Beruf“ am 16. Januar 1919 stattgefunden habe,Siehe dazu Birnbaum, Immanuel, Erinnerungen an Max Weber, in: König/Winckelmann (Hg.), Gedächtnis, S. 19–21, sowie ders., Achtzig Jahre, S. 79 ff.
184
hält einer Überprüfung nicht stand. Bei den von Weber in den Briefen erwähnten „Vorträgen vor Studenten“, auf die sich Baumgarten bezieht, handelt es sich nicht um Vorträge Webers vor dem Freistudentischen Bund, sondern um die Vorträge „Abendländisches Bürgertum“[46]Siehe oben, Anm. 176.
185
sowie „Student und Politik“,Siehe dazu Münchner Neueste Nachrichten, Nr. 112 vom 10. März 1919, Ab. BI., S. 2 (MWG I/16, S. 557 f.).
186
zu denen ihn der Sozialwissenschaftliche Verein der Universität München bzw. der Bund deutsch-nationaler Studenten eingeladen hatte und die nach mehrmaliger Verschiebung am 12. und 13. März 1919 stattfanden. Siehe dazu München-Augsburger Abendzeitung, Nr. 120 vom 14. März 1919, Ab. Bl., S. 3 (MWG I/16, S. 482–484).