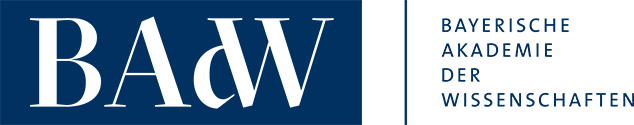[142][A 22]Die „Objektivität“ sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis.1) [142][A 22]Wo in Abschnitt I der nachstehenden Ausführungen3 Unten, S. 145–161. ausdrücklich im Namen der Herausgeber4 Edgar Jaffé, Werner Sombart und Max Weber. gesprochen wird oder dem Archiv5 Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik. Neue Folge des Archivs für soziale Gesetzgebung und Statistik. Aufgaben gestellt werden, handelt es sich natürlich nicht um Privatansichten des Verfassers, sondern sind die betreffenden Äußerungen von den Mitherausgebern ausdrücklich gebilligt. Für Abschnitt II trifft die Verantwortung für Form und Inhalt den Verfasser allein.
Daß das Archiv niemals in den Bann einer bestimmten Schulmeinung geraten wird, dafür bürgt der Umstand, daß der Standpunkt nicht nur seiner Mitarbeiter, sondern auch seiner Herausgeber, auch in methodischer Hinsicht, keineswegs schlechthin identisch ist.6 Wortgleich in Weber, Entwurf zur Übernahme des Archivs, oben, S. 106, Zeilen 1–3. Vgl. auch Jaffé, Sombart, Weber, Werbetext, oben, S. 115, Zeilen 17–18. Andererseits war natürlich eine Übereinstimmung in gewissen Grundanschauungen Voraussetzung der gemeinsamen Übernahme der Redaktion.7 Vgl. [Jaffé, Sombart, Weber,] Geleitwort, oben, S. 129, Zeilen 34–35. Diese Übereinstimmung besteht insbesondere bezüglich der Schätzung des Wertes theoretischer Erkenntnis unter „einseitigen“ Gesichtspunkten,8 Zur theoretischen Erkenntnis vgl. ebd., oben, S. 130 mit Anm. 21. Von Gesichtspunkten ist in diesem „Geleitwort“ mehrfach die Rede. sowie bezüglich der Forderung der Bildung scharfer Begriffe und der strengen Scheidung von Erfahrungswissen und Werturteil,9 Zur „Bildung klarer Begriffe“ vgl. [Jaffé, Sombart, Weber,] Geleitwort oben, S. 133 mit Anm. 31. Zu Werturteilen vgl. ebd., S. 128, sowie Weber, Entwurf zur Übernahme des Archivs, oben, S. 106 mit Anm. 8. wie sie hier – natürlich ohne den Anspruch, damit etwas „neues“ zu fordern – vertreten wird.
[143]Die vielen Breiten der Erörterung (sub II)13 Unten, S. 161–234. und die häufige Wiederholung desselben Gedankens dient dem ausschließlichen Zweck, das bei solchen Ausführungen mögliche Maximum von Gemeinverständlichkeit zu erzielen. Diesem Interesse ist viel – hoffentlich nicht zu viel – an Präzision des Ausdrucks geopfert, und ihm zu Liebe ist auch der Versuch[,] an Stelle der Aneinanderreihung einiger methodologischer Gesichtspunkte eine systematische Untersuchung treten zu lassen, hier [A 23]ganz unterlassen worden. Dies hätte das Hineinziehen einer Fülle von zum Teil noch weit tiefer liegenden erkenntnistheoretischen Problemen erfordert. Es soll hier nicht Logik getrieben, sondern es sollen bekannte Ergebnisse der modernen Logik für uns nutzbar gemacht, Probleme nicht gelöst, sondern dem Laien ihre Bedeutung veranschaulicht werden. Wer die Arbeiten der modernen Logiker kennt, – ich nenne nur Windelband, Simmel, und für unsere Zwecke speziell Heinrich Rickert –, wird sofort bemerken, daß in allem Wesentlichen lediglich an sie angeknüpft ist.14 In Weber, Roscher und Knies 1, oben, S. 45, 62, referiert Weber auf Windelband, Geschichte; Simmel, Geschichtsphilosophie1; Rickert, Grenzen; Rickert, Quatre modes.a[142]In A folgt: Von MAX WEBER.
Die erste Frage, mit der bei uns eine sozialwissenschaftliche und zumal eine sozialpolitische Zeitschrift bei ihrem Erscheinen oder bei ihrem Übergang in eine neue Redaktion begrüßt zu werden [A 23]pflegt, ist: welches ihre „Tendenz“ sei.1[142] Vgl. [Jaffé, Sombart, Weber,] Geleitwort, oben, S. 128 f. mit Anm. 17 und Anm. 18. Auch wir können uns einer Antwort auf diese Frage nicht entziehen, und es soll an dieser Stelle darauf im Anschluß an die Bemerkungen in unserem „Geleitwort“2 Vgl. ebd., oben, S. 129 ff. in etwas prinzipiellerer Fragestellung eingegangen werden. Es bietet sich dadurch Gelegenheit, die Eigenart der in unserem [143]Sinne „sozialwissenschaftlichen“ Arbeit überhaupt nach manchen Richtungen in ein Licht zu rücken, welches, wenn nicht für den Fachmann, so doch für manchen der Praxis der wissenschaftlichen Arbeit ferner stehenden Leser nützlich sein kann, obwohl oder vielmehr gerade weil es sich dabei um „Selbstverständlichkeiten“ handelt. –
Ausgesprochener Zweck des „Archivs“10[143] Gemeint ist das Braunsche „Archiv für soziale Gesetzgebung und Statistik“. war seit seinem Bestehen neben der Erweiterung unserer Erkenntnis der „gesellschaftlichen Zustände aller Länder“,11 Der Untertitel des Braunschen „Archivs“ lautete: „Vierteljahresschrift“ bzw. seit 1897 „Zeitschrift zur Erforschung der gesellschaftlichen Zustände aller Länder“. also der Tatsachen des sozialen Lebens, auch die Schulung des Urteils über praktische Probleme desselben und damit – in demjenigen, freilich sehr bescheidenen Maße, in dem ein solches Ziel von privaten Gelehrten gefördert werden kann – die Kritik an der sozialpolitischen Arbeit der Praxis, bis hinauf zu derjenigen der gesetzgebenden Faktoren.12 Vgl. Braun, Einführung (wie oben, S. 123, Anm. 24), S. 1: „Erforschung und Darstellung der Lage der Gesellschaft in Hinsicht ihres thatsächlichen Zustandes und Kritik der gesetzgeberischen Massnahmen zur Besserung dieser Lage in erster Linie vom Standpunkt der Thatsachen wird vornehmlich die Arbeit dieser Zeitschrift bilden.“ Vgl. auch [Jaffé, Sombart, Weber,] Geleitwort, oben, S. 128: „Das ‚Archiv‘ hatte nun als eines seiner vornehmsten Arbeitsgebiete von Anfang an, neben der rein wissenschaftlichen Erkenntnis der Tatsachen, sich die kritische Verfolgung des Ganges der Gesetzgebung zur Aufgabe gemacht.“ Trotzdem hat nun aber das Archiv von Anfang an daran festgehalten, eine [144]ausschließlich wissenschaftliche Zeitschrift sein zu wollen, nur mit den Mitteln wissenschaftlicher Forschung zu arbeiten,15[144] Für Braun, Einführung (wie oben, S. 123, Anm. 24), S. 5, sollte im „Archiv“ für „das Gebiet der sozialen Statistik und der sozialen Gesetzgebung eine Stätte freier und nach allen Seiten hin unabhängiger Forschung geschaffen werden, einer Forschung, die voraussetzungslos an ihr Objekt herantritt und nur einen einzigen Zweck verfolgt: die wissenschaftliche Wahrheit“. – und es entsteht zunächst die Frage: wie sich jener Zweck mit der Beschränkung auf diese Mittel prinzipiell vereinigen läßt. Wenn das Archiv in seinen Spalten Maßregeln der Gesetzgebung und Verwaltung oder praktische Vorschläge zu solchen beurteilen läßt – was bedeutet das? Welches sind die Normen für diese Urteile? Welches ist die Geltung der Werturteile,16 Vgl. [Jaffé, Sombart, Weber,] Geleitwort, oben, S. 128. die der Beurteilende seinerseits etwa äußert, oder welche ein Schriftsteller, der praktische Vorschläge macht, diesen zugrunde legt? In welchem Sinne befindet er sich dabei auf dem Boden wissenschaftlicher Erörterung, da doch das Merkmal wissenschaftlicher Erkenntnis in der „objektiven“ Geltung ihrer Ergebnisse als Wahrheit gefunden werden muß? Wir legen zunächst unseren Standpunkt zu dieser [A 24]Frage dar, um daran später die weitere zu schließen: in welchem Sinne gibt es „objektiv gültige Wahrheiten“ auf dem Boden der Wissenschaften vom Kulturleben17 Dieser Begriff findet sich häufig in Rickert, Grenzen, S. 309, 580 f., 585 f., 596, 600, 610, 620, 633, 703 f. überhaupt? – eine Frage, die angesichts des steten Wandels und erbitterten Kampfes18 Gemeint ist wahrscheinlich der Methodenstreit in der Nationalökonomie. Vgl. Einleitung, oben, S. 4 f. um die scheinbar elementarsten Probleme unserer Disziplin, die Methode ihrer Arbeit, die Art der Bildung ihrer Begriffe und deren Geltung, nicht umgangen werden kann. Nicht Lösungen bieten, sondern Probleme aufzeigen, wollen wir hier, – solche Probleme nämlich, denen unsere Zeitschrift, um ihrer bisherigen und zukünftigen Aufgabe gerecht zu werden, ihreb[144]A: ihrer Aufmerksamkeit wird zuwenden müssen. –
[145]I.
Wir alle wissen, daß unsere Wissenschaft, wie mit Ausnahme vielleicht der politischen Geschichte jede Wissenschaft, deren Objekt menschliche Kulturinstitutionen und Kulturvorgänge sind, geschichtlich zuerst von praktischen Gesichtspunkten ausging.19[145] Über Geschichte der Nationalökonomie hatte Weber im Sommersemester 1896 an der Universität Freiburg gelesen. Vgl. Weber, Geschichte der Nationalökonomie, MWG III/1, S. 666–702. Werturteile über bestimmte wirtschaftspolitischec[145]A: wirtschaftpolitische Maßnahmen des Staates zu produzieren, war ihr nächster und zunächst einziger Zweck. Sie war „Technik“ etwa in dem Sinne, in welchem es auch die klinischen Disziplinen der medizinischen Wissenschaften sind.20 Noch für Roscher, System I2, S. 23 (§ 15), kann die Nationalökonomie „von den bewährten Methoden der Medicin, dieser ältern Schwester unserer Wissenschaft, gar Manches zu lernen hoffen“. Es ist nun bekannt, wie diese Stellung sich allmählich veränderte, ohne daß doch eine prinzipielle Scheidung von Erkenntnis des „Seienden“ und des „Seinsollenden“ vollzogen wurde.21 Zur Unterscheidung von Sein und Sollen vgl. Rickert, Gegenstand (wie oben, S. 6, Anm. 35), S. 63 ff. Das „Archiv“ hatte von der 2. Aufl. dieser Studie, die 1904 erschien, ein Rezensionsexemplar erhalten. Vgl. [Jaffé, Sombart, Weber,] Geleitwort, oben, S. 133 f., Anm. 34. Gegen diese Scheidung wirkte zunächst die Meinung, daß unabänderlich gleiche Naturgesetze, sodann die andere, daß ein eindeutiges Entwicklungsprinzip die wirtschaftlichen Vorgänge beherrsche und daß also das Seinsollende entweder – im ersten Falle – mit dem unabänderlich Seienden, oder – im zweiten Falle – mit dem unvermeidlich Werdenden zusammenfalle. Mit dem Erwachen des historischen Sinnes gewann dann in unserer Wissenschaft eine Kombination von ethischem Evolutionismus und historischem Relativismus die Herrschaft, welche versuchte, die ethischen Normen ihres formalen Charakters zu entkleiden, durch Hineinbeziehung der Gesamtheit der Kulturwerte22 Zum Begriff des Kulturwerts vgl. Rickert, Kulturwissenschaft (wie oben, S. 10, Anm. 62), S. 21, 45, 47, 49, 52, 56, 58, 64, 66 f., und häufig im vierten und fünften Kapitel von Rickert, Grenzen, S. 577 ff., 596 ff. in den Bereich des „Sittlichen“ dies letztere inhaltlich zu bestimmen und so die Nationalökonomie zur Dignität einer „ethischen Wissenschaft“ auf empirischer Grund[146]lage zu erheben.23[146] Vgl. Schmoller, Gustav, Die Arbeiterfrage III, in: Preußische Jahrbücher, Band 15, 1865, S. 32–63, hier S. 63: „Der wahre Fortschritt auch im ökonomischen Leben hängt von seinem Zusammenhang mit den übrigen Lebensgebieten und Zwecken, von der gesammten ethischen Cultur ab, denn kein Zweck und kein Glied kann dauernd gedeihen, wenn der übrige Organismus leidet. Das ist die ethische Grundlage der Nationalökonomie.“ Indem man die Gesamtheit aller möglichen Kulturideale mit dem Stempel des „Sittlichen“ versah, verflüchtigte man die spezifische Dignität der ethischen Im[A 25]perative, ohne doch für die „Objektivität“ der Geltung jener Ideale irgend etwas zu gewinnen. Indessen kann und muß eine prinzipielle Auseinandersetzung damit hier beiseite bleiben:24 Zur Kritik an der ethischen Nationalökonomie vgl. Sombart, Ideale (wie oben, S. 106, Anm. 9), S. 15 ff. wir halten uns lediglich an die Tatsache, daß noch heute die unklare Ansicht nicht geschwunden, sondern besonders den Praktikern ganz begreiflicherweise geläufig ist, daß die Nationalökonomie Werturteile aus einer spezifisch „wirtschaftlichen Weltanschauung“ heraus produziere und zu produzieren habe. –
Unsere Zeitschrift als Vertreterin einer empirischen Fachdisziplin muß, wie wir gleich vorweg feststellen wollen, diese Ansicht grundsätzlich ablehnen, denn wir sind der Meinung, daß es niemals Aufgabe einer Erfahrungswissenschaft sein kann, bindende Normen und Ideale zu ermitteln, um daraus für die Praxis Rezepte ableiten zu können.
Was folgt aber aus diesem Satze? Keineswegs, daß Werturteile deshalb, weil sie in letzter Instanz auf bestimmten Idealen fußen und daher „subjektiven“ Ursprungs sind, der wissenschaftlichen Diskussion überhaupt entzogen seien. Die Praxis und der Zweck unserer Zeitschrift würde einen solchen Satz ja immer wieder desavouieren. Die Kritik macht vor den Werturteilen nicht Halt. Die Frage ist vielmehr: Was bedeutet und bezweckt wissenschaftliche Kritik von Idealen und Werturteilen?25 Vgl. Weber, Entwurf zur Übernahme des Archivs, oben, S. 106, Zeilen 5–6: „Werturteile und Ideale“. Sie erfordert eine etwas eingehendere Betrachtung.
Jede denkende Besinnung auf die letzten Elemente26 Menger, Untersuchungen, S. 41, spricht von den „einfachsten Elementen“. Zu Menger vgl. unten, S. 197 ff. sinnvollen menschlichen Handelns ist zunächst gebunden an die Kategorien: [147]„Zweck“ und „Mittel“. Wir wollen etwas in concreto entweder „um seines eigenen Wertes willen“ oder als Mittel im Dienste des in letzter Linie Gewollten. Der wissenschaftlichen Betrachtung zugänglich ist nun zunächst unbedingt die Frage der Geeignetheit der Mittel bei gegebenem Zwecke. Da wir (innerhalb der jeweiligen Grenzen unseres Wissens) gültig festzustellen vermögen, welche Mittel zu einem vorgestellten Zwecke zu führen geeignet oder ungeeignet sind, so können wir auf diesem Wege die Chancen,27[147] Zum Begriff „Chance“ vgl. Weber, Kritische Studien, unten, S. 472 mit Anm. 41. mit bestimmten zur Verfügung stehenden Mitteln einen bestimmten Zweck überhaupt zu erreichen, abwägen und mithin indirekt die Zwecksetzung selbst, auf Grund der jeweiligen historischen Situation, als praktisch sinnvoll oder aber als nach Lage der gegebenen Verhältnisse sinnlos kritisieren. Wir können weiter, wenn die Möglichkeit der Erreichung eines vorgestellten Zweckes gegeben erscheint, (natürlich immer innerhalb der Grenzen unseres jeweiligen [A 26]Wissens) die Folgen feststellen, welche die Anwendung der erforderlichen Mittel neben der eventuellen Erreichung des beabsichtigten Zweckes, infolge des Allzusammenhanges28 Gottl verwendet diesen Begriff häufiger. Vgl. z. B. Gottl, Herrschaft, S. 128. alles Geschehens, haben würde. Wir bieten alsdann dem Handelnden die Möglichkeit der Abwägung dieser ungewollten gegen die gewollten Folgen seines Handelns und damit die Antwort auf die Frage: was „kostet“ die Erreichung des gewollten Zweckes in Gestalt der voraussichtlich eintretenden Verletzung anderer Werte? Da in der großen Überzahl aller Fälle jeder erstrebte Zweck in diesem Sinne etwas „kostet“ oder doch kosten kann, so kann an der Abwägung von Zweck und Folgen des Handelns gegeneinander keine Selbstbesinnung verantwortlich handelnder Menschen vorbeigehen, und sie zu ermöglichen ist eine der wesentlichsten Funktionen der technischen Kritik, welche wir bisher betrachtet haben. Jene Abwägung selbst nun aber zur Entscheidung zu bringen ist freilich nicht mehr eine mögliche Aufgabe der Wissenschaft, sondern des wollenden Menschen: er wägt und wählt nach seinem eigenen Gewissen und seiner persönlichen Weltanschauung zwischen den Werten, um die es sich handelt. Die Wissenschaft kann ihm zu dem Bewußtsein verhelfen, daß alles Handeln, und natürlich auch, je nach den [148]Umständen, das Nicht-Handeln, in seinen Konsequenzen eine Parteinahme zugunsten bestimmter Werthe bedeutet, und damit – was heute so besonders gern verkannt wird – regelmäßig gegen andere. Die Wahl zu treffen, ist seine Sache.
Was wir ihm für diesen Entschluß nun noch weiter bieten können, ist: Kenntnis der Bedeutung des Gewollten selbst. Wir können ihn die Zwecke nach Zusammenhang und Bedeutung kennen lehren, die er will und zwischen denen er wählt, zunächst durch Aufzeigung und logisch zusammenhängende Entwicklung der „Ideen“,29[148] Weber referiert wahrscheinlich auf die historische Ideenlehre, die im 19. Jahrhundert vor allem Humboldt, Gervinus und Ranke vertreten haben. Vgl. Humboldt, Geschichtschreiber, S. 314, 318; Gervinus, Historik, S. 375, 382; Ranke, Epochen (wie oben, S. 72, Anm. 30), S. 18, sowie Lazarus, Moritz, Ueber die Ideen in der Geschichte, in: Zeitschrift für Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft, 3. Jg., 1865, S. 385-486. Vgl. dazu bereits Weber, Roscher und Knies 1, oben, S. 71 f. mit Anm. 25 und 30. die dem konkreten Zweck zugrunde liegen oder liegen können. Denn es ist selbstverständlich eine der wesentlichsten Aufgaben einer jeden Wissenschaft vom menschlichen Kulturleben, diese „Ideen“, für welche teils wirklich, teils vermeintlich gekämpft worden ist und gekämpft wird, dem geistigen Verständnis zu erschließen. Das überschreitet nicht die Grenzen einer Wissenschaft, welche „denkende Ordnung der empirischen Wirklichkeit“30 Als Zitat nicht belegt. Sinngemäße Formulierungen finden sich in Gervinus, Historik, S. 357 f., 366, 372, 383. Gervinus spricht vom „denkende[n] Historiker“ bzw. „Geschichtschreiber“ und trennt das spekulative Geschäft des Philosophen, dem die Dinge nach ihrer Notwendigkeit erscheinen, vom schöpferischen des Dichters, dem sie nach ihrer Möglichkeit erscheinen, und vom „ordnende[n] des Historikers“, dem sie „nach ihrer Wirklichkeit“ erscheinen. erstrebt, so wenig die Mittel, die dieser Deutung geistiger Werte dienen, „Induktionen“ im gewöhnlichen Sinne des Wortes sind.31 Vgl. z. B. Sigwart, Logik II (wie oben, S. 5, Anm. 31), S. 401, der das „Inductionsverfahren als Methode der Gewinnung allgemeiner Sätze aus einzelnen Wahrnehmungen“ bestimmt. Weber selbst bestimmt mit Bezug auf eine Formulierung Stammlers „Induktion“ im Sinne eines „Hinausgehens über die Einzelbeobachtung“. Vgl. Weber, Stammler, unten, S. 504, mit Bezug auf Stammler, Wirtschaft2, S. 4. Allerdings fällt diese Aufgabe wenigstens teilweise aus dem Rahmen der ökonomischen Fachdisziplin in ihrer üblichen arbeitsteiligen Spezialisation heraus;32 Zur wissenschaftlichen Arbeitsteilung oder Spezialisierung der Nationalökonomie und ihrer Überwindung durch Einbeziehung von Nachbardisziplinen vgl. Weber, Entwurf zur Übernahme des Archivs, oben, S. 108 f., Jaffé, Sombart, Weber, Werbetext, oben, S. 117 f., und [Jaffé, Sombart, Weber,] Geleitwort, oben, S. 130 f. [A 27]es handelt sich um Aufgaben der [149]Sozialphilosophie. Allein die historische Macht der Ideen ist für die Entwicklung des Soziallebens eine so gewaltige gewesen und ist es noch, daß unsere Zeitschrift sich dieser Aufgabe niemals entziehen, deren Pflege vielmehr in den Kreis ihrer wichtigsten Pflichten einbeziehen wird.33[149] Im nächsten Band des „Archivs“ publizierte Weber den ersten Teil seiner Protestantismus-Studie, an dessen Ende er schreibt, daß die folgenden Teile zur „Veranschaulichung der Art, in der überhaupt die ‚Ideen‘ in der Geschichte wirksam werden“, beitragen können. Vgl. Weber, Die protestantische Ethik und der „Geist“ des Kapitalismus. I. Das Problem, MWG I/9, S. 97–215, hier S. 214.
Aber die wissenschaftliche Behandlung der Werturteile möchte nun weiter die gewollten Zwecke und die ihnen zugrunde liegenden Ideale nicht nur verstehen und nacherleben lassen, sondern vor allem auch kritisch „beurteilen“ lehren. Diese Kritik freilich kann nur dialektischen Charakter haben, d. h. sie kann nur eine formallogische Beurteilung des in den geschichtlich gegebenen Werturteilen und Ideen vorliegenden Materials, eine Prüfung der Ideale an dem Postulat der inneren Widerspruchslosigkeit des Gewollten sein. Sie kann, indem sie sich diesen Zweck setzt, dem Wollenden verhelfen zur Selbstbesinnung auf diejenigen letzten Axiome, welche dem Inhalt seines Wollens zugrunde liegen, auf die letzten Wertmaßstäbe, von denen er unbewußt ausgeht oder – um konsequent zu sein – ausgehen müßte. Diese letzten Maßstäbe, welche sich in dem konkreten Werturteile manifestieren, zum Bewußtsein zu bringen, ist nun allerdings das letzte, was sie, ohne den Boden der Spekulation zu betreten, leisten kann. Ob sich das urteilende Subjekt zu diesen letzten Maßstäben bekennen soll, ist seine persönlichste Angelegenheit und eine Frage seines Wollens und Gewissens, nicht des Erfahrungswissens.
Eine empirische Wissenschaft vermag niemanden zu lehren, was er soll, sondern nur was er kann und – unter Umständen – was er will. Richtig ist, daß die persönlichen Weltanschauungen auf dem Gebiet unserer Wissenschaften unausgesetzt hineinzuspielen pflegen auch in die wissenschaftliche Argumentation, sie immer wieder trüben, das Gewicht wissenschaftlicher Argumente auch auf dem Gebiet der Ermittlung einfacher kausaler Zusammenhänge von Tatsachen verschieden einschätzen lassen, je nachdem das Resultat die Chancen der persönlichen Ideale: die Möglichkeit, etwas Bestimmtes zu wollen, mindert oder steigert. Auch die Herausge[150]ber und Mitarbeiter unserer Zeitschrift werden in dieser Hinsicht sicher lieh „nichts Menschliches von sich fern glauben“.d[150]A: glauben.“34[150] Vgl. Publius Terentius Afer, Der Selbstpeiniger, in: Des Publius Terentius Lustspiele, Band 5. Deutsch von Johannes Herbst. – Stuttgart: Hoffmann 1855, S. 8: „Ich bin ein Mensch; nichts Menschliches liegt meiner Theilnahme fern.“ Aber von diesem Bekenntnis menschlicher Schwäche ist es ein weiter Weg bis zu dem Glauben an eine „ethische“ Wissenschaft der Nationalökonomie, welche aus ihrem Stoff Ideale oder durch Anwendung allgemeiner ethischer Imperative auf ihren [A 28]Stoff konkrete Normen zu produzieren hätte. – Richtig ist noch etwas Weiteres: gerade jene innersten Elemente der „Persönlichkeit“,35 In Weber, Roscher und Knies 3, unten, S. 369 ff., findet sich eine eingehende Auseinandersetzung mit diesem Begriff. die höchsten und letzten Werturteile, die unser Handeln bestimmen und unserem Leben Sinn und Bedeutung geben, werden von uns als etwas „objektiv“ Wertvolles empfunden. Wir können sie ja nur vertreten, wenn sie uns als geltend, als aus unseren höchsten Lebenswerten fließend, sich darstellen und so, im Kampfe gegen die Widerstände des Lebens, entwickelt werden. Und sicherlich liegt die Würde der „Persönlichkeit“ darin beschlossen, daß es für sie Werte gibt, auf die sie ihr eigenes Leben bezieht, – und lägen diese Werte auch im einzelnen Falle ausschließlich innerhalb der Sphäre der eigenen Individualität: dann gilt ihr eben das „Sichausleben“36 Für Rickert, Grenzen, S. 717, gibt es einen „ethische[n] Imperativ“, demzufolge jeder Mensch ein „teleologisches In-dividuum“ werden soll, das „in dem grossen teleologischen Zusammenhange der Wirklichkeit“ seine „individuelle Bestimmung“ findet; dieser Imperativ beläßt jedem seine „Individualität“, solange sie „im Dienste der Verwirklichung allgemeiner Werthe“ steht: „Das ziel- und planlose sogenannte ‚Sichausleben‘ jedes beliebigen Stückchens individueller Wirklichkeit, das keine teleologische Einheit besitzt, ist freilich sittlich verwerflich, und für bedeutungslose individuelle Launen hat die geschichtlich orientirte individualistische Ethik keinen Platz.“ in denjenigen ihrer Interessen, für welche sie die Geltung als Werte beansprucht, als die Idee, auf welche sie sich bezieht. Nur unter der Voraussetzung des Glaubens an Werte jedenfalls hat der Versuch Sinn, Werturteile nach außen zu vertreten. Aber: die Geltung solcher Werte zu beurteilen, ist Sache des Glaubens, daneben vielleicht eine Aufgabe spekulativer Betrachtung und Deutung des Lebens und der Welt auf ihren Sinn hin, sicherlich aber nicht Gegenstand einer Erfahrungswissenschaft in dem Sinne, in wel[151]chem sie an dieser Stelle gepflegt werden soll. Für diese Scheidung fällt nicht – wie oft geglaubt wird – entscheidend ins Gewicht die empirisch erweisliche Tatsache, daß jene letzten Ziele historisch wandelbar und streitig sind. Denn auch die Erkenntnis der sichersten Sätze unseres theoretischen – etwa des exakt naturwissenschaftlichen oder mathematischen – Wissens ist, ebenso wie die Schärfung und Verfeinerung des Gewissens, erst Produkt der Kultur. Allein wenn wir speziell an die praktischen Probleme der Wirtschafts- und Sozialpolitik (im üblichen Wortsinn) denken, so zeigt sich zwar, daß es zahlreiche, ja unzählige praktische Einzelfragen gibt, bei deren Erörterung man in allseitiger Übereinstimmung von gewissen Zwecken als selbstverständlich gegeben ausgeht – man denke etwa an Notstandskredite, an konkrete Aufgaben der sozialen Hygiene, der Armenpflege, an Maßregeln wie die Fabrikinspektionen, die Gewerbegerichte, die Arbeitsnachweise, große Teile der Arbeiterschutzgesetzgebung, – bei denen also, wenigstens scheinbar, nur nach den Mitteln zur Erreichung des Zweckes gefragt wird. Aber selbst wenn wir hier – was die Wissenschaft niemals ungestraft tun würde – den Schein der Selbstverständlichkeit für Wahrheit nehmen und die [A 29]Konflikte, in welche der Versuch der praktischen Durchführung alsbald hinein führt, für rein technische Fragen der Zweckmäßigkeit ansehen wollten, – was recht oft irrig wäre –, so müßten wir doch bemerken, daß auch dieser Schein der Selbstverständlichkeit der regulativen Wertmaßstäbe sofort verschwindet, wenn wir von den konkreten Problemen karitativ-polizeilicher Wohlfahrts- und Wirtschaftspflege aufsteigen zu den Fragen der Wirtschafts- und Sozialpolitik. Das Kennzeichen des sozialpolitischen Charakters eines Problems ist es ja geradezu, daß es nicht auf Grund bloß technischer Erwägungen aus feststehenden Zwecken heraus zu erledigen ist, daß um die regulativen Wertmaßstäbe selbst gestritten werden kann und muß, weil das Problem in die Region der allgemeinen Kulturfragen hineinragt. Und es wird gestritten nicht nur, wie wir heute so gerne glauben, zwischen „Klasseninteressen“,37[151] Dieser Begriff findet sich z. B. in Marx, Karl, Der Achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte. – Hamburg: Otto Meißner 1885, S. 15 f., und in Marx, Karl, Das Elend der Philosophie. Antwort auf Proudhon’s „Philosophie des Elends“. Mit Vorwort und Noten von Friedrich Engels. – Stuttgart: J.H.W. Dietz 1892, S. 162. sondern auch zwischen Weltanschauungen, [152]– wobei die Wahrheit natürlich vollkommen bestehen bleibt, daß dafür, welche Weltanschauung der einzelne vertritt, neben manchem anderen auch und sicherlich in ganz hervorragendem Maße der Grad von Wahlverwandtschaft38[152] Mit diesem von Joseph Black und Torbern Bergman geprägten Begriff wird eine besondere Anziehung zwischen chemischen Elementen bezeichnet, derart, daß sich ein Element aus einer bestehenden Verbindung löst, wenn sich ein bestimmtes anderes Element, das ihm affin ist, nähert, so daß eine neue Verbindung entsteht. Goethe macht diesen Mechanismus zur Grundlage eines Romans. Vgl. Goethe, Johann Wolfgang, Die Wahlverwandtschaften, in: ders., Sämtliche Werke. Jubiläumsausgabe in 40 Bänden, Band 21, hg. von Eduard von der Hellen. – Stuttgart und Berlin: J. G. Cotta Nachf. o. J. entscheidend zu werden pflegt, der sie mit seinem „Klasseninteresse“ – wenn wir diesen nur scheinbar eindeutigen Begriff hier einmal akzeptieren – verbindet. Sicher ist unter allen Umständen Eines: je „allgemeiner“ das Problem ist, um das es sich handelt, d. h. aber hier: je weittragender seine Kulturbedeutung,39 Vgl. [Jaffé, Sombart, Weber,] Geleitwort, oben, S. 126 mit Anm. 8. desto weniger ist es einer eindeutigen Beantwortung aus dem Material des Erfahrungswissens heraus zugänglich, desto mehr spielen die letzten höchst persönlichen Axiome des Glaubens und der Wertideen40 Rickert spricht nicht von Wertideen, sondern nur von „Werthen“ bzw. „Kulturwerthen“. Möglicherweise bezieht sich Weber auch auf die historische Ideenlehre. Vgl. oben, S. 148 mit Anm. 29. hinein. Es ist einfach eine Naivität, wenn auch von Fachmännern gelegentlich immer noch geglaubt wird, es gelte, für die praktische Sozialwissenschaft vor allem „ein Prinzip“ aufzustellen und wissenschaftlich als gültig zu erhärten, aus welchem alsdann die Normen für die Lösung der praktischen Einzelprobleme eindeutig deduzierbar seien.41 Möglicherweise referiert Weber auf Stammler, Wirtschaft1, S. 6: „Die Frage nach der obersten Gesetzmäßigkeit, unter der das soziale Leben in Abhängigkeit zu erkennen ist, mündet praktisch in die grundsätzliche Auffassung über das Verhältnis des einzelnen zur Gemeinschaft sofort aus; und von jener ersten prinzipiellen Einsicht hängt die Ergreifung und Lösung der Aufgabe von der Weiterbildung, der Umwandlung und der Vervollkommnung unserer sozialen Ordnungen ab.“ So sehr „prinzipielle“ Erörterungen praktischer Probleme, d. h. die Zurückführung der unreflektiert sich aufdrängenden Werturteile auf ihren Ideengehalt, in der Sozialwissenschaft vonnöten sind, und so sehr unsere Zeitschrift speziell sich gerade auch ihnen zu widmen beabsichtigt, – die Schaffung eines praktischen Generalnenners für unsere Probleme in Gestalt allgemein gültiger letzter Ideale kann sicherlich weder ihre Aufgabe noch überhaupt die irgend einer [153]Erfahrungswissenschaft sein: sie wäre als solche nicht etwa nur [A 30]praktisch unlösbar, sondern in sich widersinnig. Und wie immer Grund und Art der Verbindlichkeit ethischer Imperative gedeutet werden mag, sicher ist, daß aus ihnen, als aus Normen für das konkret bedingte Handeln des Einzelnen, nicht Kulturinhalte als gesollt eindeutig deduzierbar sind, und zwar umsoweniger, je umfassender die Inhalte sind, um die es sich handelt. Nur positive Religionen, – präziser ausgedrückt: dogmatisch gebundene Sekten – vermögen dem Inhalt von Kulturwerten die Dignität unbedingt gültiger ethischer Gebote zu verleihen. Außerhalb ihrer sind Kulturideale, die der einzelne verwirklichen will, und ethische Pflichten, die er erfüllen soll, von prinzipiell verschiedener Dignität. Das Schicksal einer Kulturepoche, die vom Baum der Erkenntnis42[153] Genesis (1. Mose) 2,16–17. gegessen hat, ist es, wissen zu müssen, daß wir den Sinn des Weltgeschehens nicht aus dem noch so sehr vervollkommneten Ergebnis seiner Durchforschung ablesen können, sondern ihn selbst zu schaffen im stande sein müssen, daß „Weltanschauungen“ niemals Produkt fortschreitenden Erfahrungswissens sein können, und daß also die höchsten Ideale, die uns am mächtigsten bewegen, für alle Zeit nur im Kampf mit anderen Idealen sich auswirken, die anderen eben so heilig sind, wie uns die unseren.
Nur ein optimistischer Synkretismus, wie er zuweilen das Ergebnis des entwicklungsgeschichtlichen Relativismus ist, kann sich über den gewaltigen Ernst dieser Sachlage entweder theoretisch hinwegtäuschen oder ihren Konsequenzen praktisch ausweichen. Es kann selbstverständlich subjektiv im einzelnen Falle genau ebenso pflichtgemäß für den praktischen Politiker sein, zwischen vorhandenen Gegensätzen der Meinungen zu vermitteln, als für eine von ihnen Partei zu ergreifen. Aber mit wissenschaftlicher „Objektivität“43 Im 19. Jahrhundert galt außerhalb der Naturwissenschaften Ranke als der Protagonist wissenschaftlicher Objektivität. Rickert, Kulturwissenschaft (wie oben, S. 10, Anm. 62), S. 48 f., 51, 68, kritisiert Rankes Überzeugung, „dass Objektivität in einer blossen Wiedergabe der Thatsachen ohne ein leitendes Prinzip der Auswahl“ bestehe, denn wem es gelänge, „sein Selbst auszulöschen“, für den gäbe es „keine Geschichte mehr, sondern nur ein sinnloses Gewimmel von individuellen Gestaltungen, die alle gleich bedeutungsvoll oder bedeutungslos wären“. Rickert ist nicht nur der Meinung, daß wir bei der Auswahl „von Werthen geleitet“ werden, sondern „dass Kul[154]turvorgänge auch immer mehr als willkürlich gewerthet werden, denn die ‚Objektivität‘ der Geschichte ist in der That nur durch die Allgemeingültigkeit der Kulturwerthe zu erreichen, die ihre Begriffsbildung leiten“. An solche „objektive[n] Werte“, „deren Geltung die Voraussetzung […] für die Arbeit in den Kulturwissenschaften selbst bildet, glauben wir im Grunde Alle“. Rickert, Grenzen, S. 502, trennt denn auch zwischen „Werthurteile[n]“, die „jede wissenschaftliche Objektivität“ stören, und „Werthbeziehung“ als Prinzip der Auswahl, das Objektivität durch die Allgemeingültigkeit der auf die Wirklichkeit bezogenen Kulturwerte ermöglicht. hat das nicht das Allermindeste zu tun. Die „mitt[154]lere Linie“ ist um kein Haarbreit mehr wissenschaftliche Wahrheit, als die extremsten Parteiideale von rechts oder links. Nirgends ist das Interesse der Wissenschaft auf die Dauer schlechter aufgehoben als da, wo man unbequeme Tatsachen und die Realitäten des Lebens in ihrer Härte nicht sehen will. Das Archiv wird die schwere Selbsttäuschung, man könne durch Synthese von mehreren oder auf der Diagonale zwischen mehreren Parteiansichten praktische Normen von wissenschaftlicher Gültigkeit gewinnen, unbedingt bekämpfen, denn sie ist, weil sie ihre eigenen Wertmaßstäbe relativistisch zu verhüllen liebt, weit gefährlicher für die Unbefangenheit44 Zu „Unbefangenheit“ vgl. Weber, Entwurf zur Übernahme des Archivs, oben, S. 106, und Jaffé, Sombart, Weber, Werbetext, oben, S. 115. Vgl. auch Braun, Abschiedswort (wie oben, S. 125, Anm. 1), S. V. der Forschung [A 31]als der alte naive Glaube der Parteien an die wissenschaftliche „Beweisbarkeit“ ihrer Dogmen. Die Fähigkeit der Unterscheidung zwischen Erkennen und Beurteilen und die Erfüllung sowohl der wissenschaftlichen Pflicht, die Wahrheit der Tatsachen zu sehen, als der praktischen, für die eigenen Ideale einzutreten, ist das, woran wir uns wieder stärker gewöhnen wollen.
Es ist und bleibt – darauf kommt es für uns an – für alle Zeit ein unüberbrückbarer Unterschied, ob eine Argumentation sich an unser Gefühl und unsere Fähigkeit[,] für konkrete praktische Ziele oder für Kulturformen und Kulturinhalte uns zu begeistern[,] wendet, oder, wo einmal die Geltung ethischer Normen in Frage steht, an unser Gewissen, oder endlich an unser Vermögen und Bedürfnis, die empirische Wirklichkeit in einer Weise denkend zu ordnen,45 Vgl. oben, S. 148 mit Anm. 30. welche den Anspruch auf Geltung als Erfahrungswahrheit erhebt. Und dieser Satz bleibt richtig, trotzdem, wie sich noch zeigen wird,46 Unten, S. 214 ff. jene höchsten „Werte“ des praktischen Interesses für die Richtung, welche die ordnende Tätigkeit des Denkens auf dem [155]Gebiete der Kulturwissenschaften jeweils einschlägt, von entscheidender Bedeutung sind und immer bleiben werden. Denn es ist und bleibt wahr, daß eine methodisch korrekte wissenschaftliche Beweisführung auf dem Gebiete der Sozialwissenschaften, wenn sie ihren Zweck erreicht haben will, auch von einem Chinesen als richtig anerkannt werden muß oder – richtiger gesagt – daß sie dieses, vielleicht wegen Materialmangels nicht voll erreichbare, Ziel jedenfalls erstreben muß, daß ferner auch die logische Analyse eines Ideals auf seinen Gehalt und auf seine letzten Axiome hin und die Aufzeigung der aus seiner Verfolgung sich logischer und praktischer Weise ergebenden Konsequenzen, wenn sie als gelungen gelten soll, auch für ihn gültig sein muß, – während ihm für unsere ethischen Imperative das „Gehör“47[155] In Nietzsche, Friedrich, Zur Genealogie der Moral. Eine Streitschrift, 2. Aufl. – Leipzig: C. G. Naumann 1892, S. VI, ist die Rede von einem „räthselhafte[n] ,kategorische[n] Imperativ‘, dem ich inzwischen immer mehr Gehör und nicht nur Gehör geschenkt habe“. fehlen kann, und während er das Ideal selbst und die daraus fließenden konkreten Wertungen ablehnen kann und sicherlich oft ablehnen wird, ohne dadurch dem wissenschaftlichen Wert jener denkenden Analyse irgend zu nahe zu treten. Sicherlich wird unsere Zeitschrift die immer und unvermeidlich sich wiederholenden Versuche, den Sinn des Kulturlebens eindeutig zu bestimmen, nicht etwa ignorieren. Im Gegenteil: sie gehören ja selbst zu den wichtigsten Erzeugnissen eben dieses Kulturlebens und unter Umständen auch zu seinen mächtigsten treibenden Kräften. Wir werden daher den Verlauf auch der in diesem Sinne „sozialphilosophischen“ Erörterungen jederzeit sorg[A 32]sam verfolgen. Ja, noch mehr: es liegt hier das Vorurteil durchaus fern, als ob Betrachtungen des Kulturlebens, die über die denkende Ordnung des empirisch Gegebenen hinausgehend die Welt metaphysisch zu deuten versuchen, etwa schon um dieses ihres Charakters willen keine Aufgabe im Dienste der Erkenntnis erfüllen könnten. Wo diese Aufgaben etwa liegen würden, ist freilich ein Problem zunächst der Erkenntnislehre, dessen Beantwortung hier für unsere Zwecke dahingestellt bleiben muß und auch kann. Denn eines halten wir für unsere Arbeit fest: eine sozialwissenschaftliche Zeitschrift in unserem Sinne soll, soweit sie Wissenschaft treibt, ein Ort sein, wo Wahrheit gesucht wird, die – um im [156]Beispiel zu bleiben – auch für den Chinesen die Geltung einer denkenden Ordnung der empirischen Wirklichkeit beansprucht. –
Freilich können die Herausgeber weder sich selbst noch ihren Mitarbeitern ein für allemal verbieten, die Ideale, die sie beseelen, auch in Werturteilen zum Ausdruck zu bringen. Nur erwachsen daraus zwei wichtige Pflichten. Zunächst die: in jedem Augenblick den Lesern und sich selbst scharf zum Bewußtsein zu bringen, welches die Maßstäbe sind, an denen die Wirklichkeit gemessen und aus denen das Werturteil abgeleitet wird, anstatt, wie es nur allzu oft geschieht, durch unpräzises Ineinanderschieben von Werten verschiedenster Art sich um die Konflikte zwischen den Idealen herumzutäuschen und „jedem etwas bieten“48[156] Vgl. Goethe, Faust I, S. 7: „Wer vieles bringt, wird manchem etwas bringen; Und jeder geht zufrieden aus dem Haus.“ zu wollen. Wird dieser Pflicht streng genügt, dann kann die praktisch urteilende Stellungnahme im rein wissenschaftlichen Interesse nicht nur unschädlich, sondern direkt nützlich, ja, geboten sein: in der wissenschaftlichen Kritik von gesetzgeberischen und anderen praktischen Vorschlägen ist die Aufklärung der Motive des Gesetzgebers49 Vgl. Jaffé, Sombart, Weber, Werbetext, oben, S. 115. und der Ideale des kritisierten Schriftstellers in ihrere[156]A: ihre Tragweite sehr oft gar nicht anders in anschaulich-verständliche Form zu bringen, als durch Konfrontierung der von ihnen zugrunde gelegten Wertmaßstäbe mit anderen, und dann natürlich am besten: mit den eigenen. Jede sinnvolle Wertung fremden Wollens kann nur Kritik aus einer eigenen „Weltanschauung“ heraus, Bekämpfung des fremden Ideals vom Boden eines eigenen Ideals aus sein. Soll also im einzelnen Fall das letzte Wertaxiom, welches einem praktischen Wollen zugrunde liegt, nicht nur festgestellt und wissenschaftlich analysiert, sondern in seinen Beziehungen zu anderen Wertaxiomen veranschaulicht werden, so ist eben „positive“ Kritik durch zusammenhängende Darlegung der letzteren unvermeidlich. |
[A 33]Es wird also in den Spalten der Zeitschrift – speziell bei der Besprechung von Gesetzen – neben der Sozialwissenschaft – der denkenden Ordnung der Tatsachen – unvermeidlich auch die Sozialpolitik – die Darlegung von Idealen – zu Worte kommen. Aber: wir denken nicht daran, derartige Auseinandersetzungen für „Wis[157]senschaft“ auszugeben und werden uns nach besten Kräften hüten, sie damit vermischen und verwechseln zu lassen. Die Wissenschaft ist es dann nicht mehr, welche spricht, und das zweite fundamentale Gebot wissenschaftlicher Unbefangenheit ist es deshalb: in solchen Fällen, den Lesern (und – sagen wir wiederum – vor allem sich selbst!) jederzeit deutlich zu machen, daß und wo der denkende Forscher aufhört und der wollende Mensch anfängt zu sprechen, wo die Argumente sich an den Verstand und wo sie sich an das Gefühl wenden. Die stete Vermischung wissenschaftlicher Erörterung der Tatsachen und wertender Raisonnements ist eine der zwar noch immer verbreitetsten, aber auch schädlichsten Eigenarten von Arbeiten unseres Faches. Gegen diese Vermischung, nicht etwa gegen das Eintreten für die eigenen Ideale richten sich die vorstehenden Ausführungen: Gesinnungslosigkeit und wissenschaftliche „Objektivität“ haben keinerlei innere Verwandtschaft. – Das Archiv ist, wenigstens seiner Absicht nach, niemals ein Ort gewesen und soll es auch nicht werden, an welchem Polemik gegen bestimmte politische oder sozialpolitische Parteien getrieben wird, ebensowenig eine Stelle, an der für oder gegen politische oder sozialpolitische Ideale geworben wird; dafür gibt es andere Organe. Die Eigenart der Zeitschrift hat vielmehr von Anfang an gerade darin bestanden und soll, soviel an den Herausgebern liegt, auch fernerhin darin bestehen, daß in ihr scharfe politische Gegner sich zu wissenschaftlicher Arbeit zusammenfinden.50[157] Vgl. Braun, Einführung (wie oben, S. 123, Anm. 24), S. 5 f.: „Jedermann, der an das Programm wissenschaftlicher Behandlung sich zu halten gewillt ist, wird, mag er welcher Richtung immer huldigen, im Kreis der Mitarbeiter des Archivs willkommen sein.“ In ihrem „Geleitwort“ bezeichnen die Herausgeber das Braunsche „Archiv“ als „interfraktionell“, weil es seine Mitarbeiter „aus aller Parteien Lager“ rekrutierte. Vgl. [Jaffé, Sombart, Weber,] Geleitwort, oben, S. 128 mit Anm. 14. Sie war bisher kein „sozialistisches“ und wird künftig kein „bürgerliches“ Organ sein. Sie schließt von ihrem Mitarbeiterkreise niemand aus, der sich auf den Boden wissenschaftlicher Diskussion stellen will. Sie kann kein Tummelplatz von „Erwiderungen“, Repliken und Dupliken sein, aber sie schützt niemand, auch nicht ihre Mitarbeiter und ebensowenig ihre Herausgeber dagegen, in ihren Spalten der denkbar schärfsten sachlich-wissenschaftlichen Kritik ausgesetzt zu sein. Wer das nicht ertragen kann, oder wer auf dem Standpunkt steht, mit Leuten, die im Dienste anderer Ideale arbeiten als er selbst, [158]auch im Dienste wissenschaftlicher [A 34]Erkenntnis nicht zusammenwirken zu wollen, der mag ihr fern bleiben.
Nun ist aber freilich – wir wollen uns darüber nicht täuschen – mit diesem letzten Satze praktisch zurzeit leider mehr gesagt, als es auf den ersten Blick scheint. Zunächst hat, wie schon angedeutet, die Möglichkeit[,] mit politischen Gegnern sich auf neutralem Boden – geselligem oder ideellem – unbefangen zusammenzufinden, leider erfahrungsgemäß überall und zumal unter unsern deutschen Verhältnissen ihre psychologischen Schranken. An sich als ein Zeichen parteifanatischer Beschränktheit und unentwickelter politischer Kultur unbedingt bekämpfenswert, gewinnt dieses Moment für eine Zeitschrift wie die unsrige eine ganz wesentliche Verstärkung durch den Umstand, daß auf dem Gebiet der Sozialwissenschaften der Anstoß zur Aufrollung wissenschaftlicher Probleme erfahrungsgemäß regelmäßig durch praktische „Fragen“ gegeben wird, so daß die bloße Anerkennung des Bestehens eines wissenschaftlichen Problems in Personalunion steht mit einem bestimmt gerichteten Wollen lebendiger Menschen. In den Spalten einer Zeitschrift, welche unter dem Einflusse des allgemeinen Interesses für ein konkretes Problem ins Leben tritt, werden sich daher als Mitarbeiter regelmäßig Menschen zusammenfinden, die ihr persönliches Interesse diesem Problem deshalb zuwenden, weil bestimmte konkrete Zustände ihnen im Widerspruch mit idealen Werten, an die sie glauben, zu stehen, jene Werte zu gefährden scheinen. Die Wahlverwandtschaft51[158] Vgl. dazu die Erläuterung oben, S. 152, Anm. 38. ähnlicher Ideale wird alsdann diesen Mitarbeiterkreis zusammenhalten und sich neu rekrutieren lassen, und dies wird der Zeitschrift wenigstens bei der Behandlung praktisch-sozialpolitischer Probleme einen bestimmten „Charakter“ aufprägen, wie er die unvermeidliche Begleiterscheinung jedes Zusammenwirkens lebendig empfindender Menschen ist, deren wertende Stellungnahme zu den Problemen auch bei der rein theoretischen Arbeit nicht immer ganz unterdrückt wird und bei der Kritik praktischer Vorschläge und Maßnahmen auch – unter den oben erörterten Voraussetzungen52 Oben, S. 151 ff. – ganz legitimerweise zum Ausdruck kommt. Das Archiv nun trat in einem Zeitpunkte ins [159]Leben,53[159] Vgl. [Jaffé, Sombart, Weber,] Geleitwort, oben, S. 125 mit Anm. 1. als bestimmte praktische Probleme der „Arbeiterfrage“ im überkommenen Sinne des Wortes, im Vordergrund der sozialwissenschaftlichen Erörterungen standen.54 Vgl. ebd., oben, S. 126 mit Anm. 7. Diejenigen Persönlichkeiten, für welche mit den Problemen, die es behandeln wollte, die höchsten und entscheidenden Wertideen sich verknüpften, [A 35]und welche deshalb seine regelmäßigsten Mitarbeiter wurden, waren eben daher zugleich auch Vertreter einer durch jene Wertideen gleich oder doch ähnlich gefärbten Kulturauffassung.55 Gemessen an der Zahl der Beiträge waren die regelmäßigsten Mitarbeiter des Braunschen „Archivs“ Werner Sombart (14), Heinrich Rauchberg (9), Fridolin Schuler (9), Ernst Lange (6) und Ernst Mischler (6). Jedermann weiß denn auch, daß, wenn die Zeitschrift den Gedanken, eine „Tendenz“ zu verfolgen,56 Vgl. oben, S. 142 mit Anm. 1. durch die ausdrückliche Beschränkung auf „wissenschaftliche“ Erörterungen und durch die ausdrückliche Einladung an „Angehörige aller politischen Lager“ bestimmt ablehnte, sie trotzdem sicherlich einen „Charakter“ im obigen Sinn besaß. Er wurde durch den Kreis ihrer regelmäßigen Mitarbeiter geschaffen. Es waren im allgemeinen Männer, denen, bei aller sonstigen Verschiedenheit der Ansichten, der Schutz der physischen Gesundheit der Arbeitermassen und die Ermöglichung steigender Anteilnahme an den materiellen und geistigen Gütern unserer Kultur für sie, als Ziel – als Mittel aber die Verbindung staatlichen Eingreifens in die materielle Interessensphäre mit freiheitlicher Fortentwicklung der bestehenden Staats- und Rechtsordnung vorschwebten, und die – welches immer ihre Ansicht über die Gestaltung der Gesellschaftsordnung in der ferneren Zukunft sein mochte – für die Gegenwart die kapitalistische Entwicklung bejahten, nicht weil sie ihnen, gegenüber den älteren Formen gesellschaftlicher Gliederung als die bessere, sondern weil sie ihnen als praktisch unvermeidlich und der Versuch grundsätzlichen Kampfes gegen sie, nicht als Förderung, sondern als Hemmung des Emporsteigens der Arbeiterklasse an das Licht der Kultur erschien. Unter den in Deutschland heute bestehenden Verhältnissen – sie bedürfen hier nicht der näheren Klarlegung – war dies und wäre es auch heute nicht zu vermeiden. Ja, es kam im tatsächlichen Erfolg der Allsei[160]tigkeit der Beteiligung an der wissenschaftlichen Diskussion direkt zugute und war für die Zeitschrift eher ein Moment der Stärke, ja – unter den gegebenen Verhältnissen – sogar vielleicht einer der Titel ihrer Existenzberechtigung.
Unzweifelhaft ist es nun, daß die Entwicklung eines „Charakters“ in diesem Sinne bei einer wissenschaftlichen Zeitschrift eine Gefahr für die Unbefangenheit der wissenschaftlichen Arbeit bedeuten kann und dann wirklich bedeuten müßte, wenn die Auswahl der Mitarbeiter eine planvoll einseitige würde: in diesem Falle bedeutete die Züchtung jenes „Charakters“ praktisch dasselbe wie das Bestehen einer „Tendenz“. Die Herausgeber sind sich der Verantwortung, die ihnen diese Sachlage auferlegt, durchaus bewußt. Sie beabsichtigen weder, den Charakter [A 36]des Archivs planvoll zu ändern, noch etwa[,] ihn durch geflissentliche Beschränkung des Mitarbeiterkreises auf Gelehrte mit bestimmten Parteimeinungenf[160]A: Parteimeinungen, künstlich zu konservieren. Sie nehmen ihn als gegeben hin und warten seine weitere „Entwicklung“ ab. Wie er sich in Zukunft gestaltet und vielleicht, infolge der unvermeidlichen Erweiterung unseres Mitarbeiterkreises, umgestaltet, das wird zunächst von der Eigenart derjenigen Persönlichkeiten abhängen, die mit der Absicht, wissenschaftlicher Arbeit zu dienen, in diesen Kreis eintreten und in den Spalten der Zeitschrift heimisch werden oder bleiben. Und es wird weiter durch die Erweiterung der Probleme bedingt sein, deren Förderung sich die Zeitschrift zum Ziel setzt.
Mit dieser Bemerkung gelangen wir zu der bisher noch nicht erörterten Frage der sachlichen Abgrenzung unseres Arbeitsgebietes. Hierauf kann aber eine Antwort nicht gegeben werden, ohne auch hier die Frage nach der Natur des Zieles sozialwissenschaftlicher Erkenntnis überhaupt aufzurollen. Wir haben bisher, indem wir „Werturteile“ und „Erfahrungswissen“ prinzipiell schieden,57[160] Vgl. oben, S. 142, Fn. 1. vorausgesetzt, daß es eine unbedingt gültige Art der Erkenntnis, d. h. der denkenden Ordnung der empirischen Wirklichkeit[,] auf dem Gebiet der Sozialwissenschaften tatsächlich gebe. Diese Annahme wird jetzt insofern zum Problem, als wir erörtern müssen, was objektive „Geltung“ der Wahrheit, die wir erstreben, auf unse[161]rem Gebiet bedeuten kann. Daß das Problem als solches besteht und hier nicht spintisierend geschaffen wird, kann niemandemg[161]A: niemanden entgehen, der den Kampf um Methode, „Grundbegriffe“ und Voraussetzungen, den steten Wechsel der „Gesichtspunkte“ und die stete Neubestimmung der „Begriffe“, die verwendet werden, beobachtet und sieht, wie theoretische und historische Betrachtungsform noch immer durch eine scheinbar unüberbrückbare Kluft getrennt sind: „zwei Nationalökonomien“, wie ein verzweifelnder Wiener Examinand seinerzeit jammernd klagte.58[161] Als Zitat nicht belegt. Vgl. aber Seager, H. R., Economics at Berlin and Vienna, in: Journal of Political Economy, Band 1, 1893, S. 236–262, der 1891/92 in Berlin und 1892/93 in Wien studierte und unter Berücksichtigung des Methodenstreits über Studiengänge und Lehrkräfte informierte. Was heißt hier Objektivität? Lediglich diese Frage wollen die nachfolgenden Ausführungen erörtern.
II.2)[161][A 36] Vgl. die Anmerkung zum Titel.61 Zur Einteilung dieses Artikels vgl. oben, S. 142, Fn. 1.
Die Zeitschrift hat von Anfang an die Gegenstände, mit denen sie sich befaßte, als sozial-ökonomische59 Möglicherweise hat Weber die Bezeichnung übernommen von Dietzel, Heinrich, Theoretische Sozialökonomik, Band 1: Einleitung. Allgemeiner Theil, Buch I. – Leipzig: C. F. Winter 1895. behandelt. So [A 37]wenig Sinn es nun hätte, hier Begriffsbestimmungen und Abgrenzungen von Wissenschaften vorzunehmen, so müssen wir uns doch darüber summarisch ins klare setzen, was das bedeutet.
Daß unsere physische Existenz ebenso wie die Befriedigung unserer idealsten Bedürfnisse überall auf die quantitative Begrenztheit und qualitative Unzulänglichkeit der dafür benötigten äußeren Mittel stößt, daß es zu ihrer Befriedigung der planvollen Vorsorge und der Arbeit, des Kampfes mit der Natur und der Vergesellschaftung60 Der Begriff war seit dem 17. Jahrhundert im Gebrauch. Simmel machte ihn zum Grundbegriff seiner Soziologie. Vgl. Simmel, Georg, Das Problem der Sociologie, in: Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft im Deutschen Reich, 18. Jg., 1894, S. 1301–1307. mit Menschen bedarf, – das ist, möglichst unprä[162]zis ausgedrückt, der grundlegende Tatbestand, an den sich alle jene Erscheinungen knüpfen, die wir im weitesten Sinne als „sozial-ökonomische“ bezeichnen. Die Qualität eines Vorganges als „sozial-ökonomischer“ Erscheinung ist nun nicht etwas, was ihm als solchem „objektiv“ anhaftet. Sie ist vielmehr bedingt durch die Richtung unseres Erkenntnisinteresses, wie sie sich aus der spezifischen Kulturbedeutung ergibt, die wir dem betreffenden Vorgange im einzelnen Fall beilegen. Wo immer ein Vorgang des Kulturlebens in denjenigen Teilen seiner Eigenart, in welchen für uns seine spezifische Bedeutung beruht, direkt oder in noch so vermittelter Weise an jenem Tatbestand verankert ist, da enthält er oder kann er wenigstens, so weit dies der Fall, ein sozialwissenschaftliches Problem enthalten, d. h. eine Aufgabe für eine Disziplin, welche die Aufklärung der Tragweite jenes grundlegenden Tatbestandes zu ihrem Gegenstande macht.62[162] Vgl. unten, S. 166: „konkrete Gegenwartsprobleme“.
Wir können nun innerhalb der sozialökonomischen Probleme unterscheiden: Vorgänge und Komplexe von solchen, Normen, Institutionen usw., deren Kulturbedeutung für uns wesentlich in ihrer ökonomischen Seite beruht, die uns – wie z. B. etwa Vorgänge des Börsen- und Banklebens – zunächst wesentlich nur unter diesem Gesichtspunkt interessieren. Dies wird regelmäßig (aber nicht etwa ausschließlich) dann der Fall sein, wenn es sich um Institutionen handelt, welche bewußt zu ökonomischen Zwecken geschaffen wurden oder benutzt werden. Solche Objekte unseres Erkennens können wir i.e.S. „wirtschaftliche“ Vorgänge bez[iehungsweise] Institutionen nennen. Dazu treten andere, die – wie z. B. etwa Vorgänge des religiösen Lebens – uns nicht oder doch sicherlich nicht in erster Linie unter dem Gesichtspunkt ihrer ökonomischen Bedeutung und um dieser willen interessieren, die aber unter Umständen unter diesem Gesichtspunkt Bedeutung gewinnen, weil von ihnen Wirkungen ausgehen, die uns unter ökonomischen Gesichtspunkten interessieren: [A 38]„ökonomisch relevante“ Erscheinungen. Und endlich gibt es unter den nicht in unserem Sinne „wirtschaftlichen“ Erscheinungen solche, deren ökonomische Wirkungen für uns von keinem oder doch nicht erheblichem Interesse sind: etwa die Richtung des künstlerischen Geschmacks einer Zeit, – die aber ihrerseits im Einzelfalle in gewissen bedeutsamen Seiten [163]ihrer Eigenart durch ökonomische Motive, also z. B. in unserem Falle etwa durch die Art der sozialen Gliederung des künstlerisch interessierten Publikums[,] mehr oder minder stark mit beeinflußt sind: ökonomisch bedingte Erscheinungen.63[163] Zur „ökonomischen Bedingtheit der Kulturerscheinungen“ vgl. [Jaffé, Sombart, Weber,] Geleitwort, oben, S. 131. Jener Komplex menschlicher Beziehungen, Normen und normbestimmter Verhältnisse, denh[163]A: die wir „Staat“ nennen, ist beispielsweise bezüglich der staatlichen Finanzwirtschaft eine „wirtschaftliche“ Erscheinung; – insofern er gesetzgeberisch oder sonst auf das Wirtschaftsleben einwirkt (und zwar auch da, wo ganz andere als ökonomische Gesichtspunkte sein Verhalten bewußt bestimmen)[,] ist er „ökonomisch relevant“; – sofern endlich sein Verhalten und seine Eigenart auch in anderen als in seinen „wirtschaftlichen“ Beziehungen durch ökonomische Motive mitbestimmt wird, ist er „ökonomisch bedingt“. Es versteht sich nach dem Gesagten von selbst, daß einerseits der Umkreis der „wirtschaftlichen“ Erscheinungen ein flüssiger und nicht scharf abzugrenzender ist, und daß andererseits natürlich keineswegs etwa die „wirtschaftlichen“ Seiten einer Erscheinung nur „wirtschaftlich bedingt“ oder nur „wirtschaftlich wirksam“ sind, und daß eine Erscheinung überhaupt die Qualität einer „wirtschaftlichen“ nur in soweit und nur so lange behält, als unser Interesse sich der Bedeutung, die sie für den materiellen Kampf ums Dasein64 Die Formulierung geht zurück auf Darwin, Charles, Über die Entstehung der Arten im Thier- und Pflanzen-Reich durch natürliche Züchtung, oder Erhaltung der vervollkommneten Rassen im Kampfe um’s Daseyn. Nach der zweiten Aufl. mit einer geschichtlichen Vorrede und andern Zusätzen des Verfassers für diese deutsche Ausgabe aus dem Englischen übersetzt und mit Anmerkungen versehen von H. G. Bronn. – Stuttgart: E. Schweizerbart 1860 (hinfort: Darwin, Entstehung), S. 65 ff. besitzt, ausschließlich zuwendet.
Unsere Zeitschrift nun befaßt sich wie die sozialökonomische Wissenschaft seit Marx und Roscher nicht nur mit „wirtschaftlichen“[,] sondern auch mit „wirtschaftlich relevanten“ und „wirtschaftlich bedingten“ Erscheinungen. Der Umkreis derartiger Objekte erstreckt sich natürlich, – flüssig, wie er je nach der jeweiligen Richtung unseres Interesses ist, – offenbar durch die Gesamtheit aller Kulturvorgänge. Spezifisch ökonomische Motive – d. h. Motive, die in ihrer für uns bedeutsamen Eigenart an jenem grund[164]legenden Tatbestand verankert sind – werden überall da wirksam, wo die Befriedigung eines noch so immateriellen Bedürfnisses an die Verwendung begrenzter äußerer Mittel gebunden ist. Ihre Wucht hat deshalb überall nicht nur die Form der Befriedigung, sondern auch den Inhalt von Kulturbedürfnissen [Α 39]auch der innerlichsten Art mitbestimmt und umgestaltet. Der indirekte Einflußi[164]A: Einfluß, der unter dem Drucke „materieller“ Interessen stehenden sozialen Beziehungen, Institutionen und Gruppierungen der MenschenjA: Menschen, erstreckt sich (oft unbewußt) auf alle Kulturgebiete ohne Ausnahme, bis in die feinsten Nuancierungen des ästhetischen und religiösen Empfindens hinein. Die Vorgänge des alltäglichen Lebens nicht minder wie die „historischen“ Ereignisse der hohen Politik, Kollektiv- und Massenerscheinungen ebenso wie „singuläre“ Handlungen von Staatsmännern oder individuelle literarische und künstlerische Leistungen sind durch sie mitbeeinflußt, – „ökonomisch bedingt“. Andererseits wirkt die Gesamtheit aller Lebenserscheinungen und Lebensbedingungen einer historisch gegebenen Kultur auf die Gestaltung der materiellen Bedürfnisse, auf die Art ihrer Befriedigung, auf die Bildung der materiellen Interessengruppen und auf die Art ihrer Machtmittel und damit auf die Art des Verlaufes der „ökonomischen Entwicklung“ ein, – wird „ökonomisch relevant“. Soweit unsere Wissenschaft wirtschaftliche Kulturerscheinungen im kausalen Regressus65[164] Weber meint die Zurückführung von Wirkungen auf ihre Ursachen. Vgl. unten, S. 170, wo er von „kausale[r] Zurückführung“ spricht, und Weber, Roscher und Knies 2, unten, S. 263, wo von der „Form des kausalen Regressus (von der Wirkung zur Ursache)“ die Rede ist. Vgl. dazu Einleitung, oben, S. 18 mit Anm. 28. individuellen Ursachen – ökonomischen oder nicht ökonomischen Charakters – zurechnet, erstrebt sie „historische“ Erkenntnis. Soweit sie ein spezifisches Element der Kulturerscheinungen: das ökonomische, in seiner Kulturbedeutung durch die verschiedensten Kulturzusammenhänge hindurch verfolgt, erstrebt sie Geschichtsinterpretation unter einem spezifischen Gesichtspunkt und bietet ein Teilbild, eine Vorarbeit für die volle historische Kulturerkenntnis.
Wenn nun auch nicht überall, wo ein Hineinspielen ökonomischer Momente als Folge oder Ursache stattfindet, ein sozial-ökonomisches Problem vorliegt – denn ein solches entsteht nur da, wo [165]die Bedeutung jener Faktoren eben problematisch und nur durch die Anwendung der Methoden der sozial-ökonomischen Wissenschaft sicher feststellbar ist – so ergibt sich doch der schier unübersehbare Umkreis des Arbeitsgebietes der sozial-ökonomischen Betrachtungsweise.
Unsere Zeitschrift hat nun schon bisher in wohlerwogener Selbstbeschränkung auf die Pflege einer ganzen Reihe höchst wichtiger Spezialgebiete unserer Disziplin, wie namentlich der deskriptiven Wirtschaftskunde, der Wirtschaftsgeschichte im engeren Sinne und der Statistik, im allgemeinen verzichtet. Ebenso hat sie die Erörterung der finanztechnischen Fragen und die technisch-ökonomischen Probleme der Markt- und Preisbildung in der modernen [A 40]Tauschwirtschaft anderen Organen überlassen.66[165] Mit diesen „anderen Organen“ sind möglicherweise gemeint die „Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik“ (1863 ff.) und die „Zeitschrift für Volkswirtschaft, Sozialpolitik und Verwaltung“ (1892 ff.). Ihr Arbeitsgebiet waren gewisse Interessenkonstellationen und Konflikte, welche durch die führende Rolle des Verwertung suchenden Kapitals in der Wirtschaft der modernen Kulturländer67 Vgl. [Jaffé, Sombart, Weber,] Geleitwort, oben, S. 132. entstanden sind, in ihrer heutigen Bedeutung und ihrem geschichtlichen Gewordensein. Sie hat sich dabei nicht auf die im engsten Sinne „soziale Frage“ genannten praktischen und entwicklungsgeschichtlichen Probleme: die Beziehungen der modernen Lohnarbeiterklasse zu der bestehenden Gesellschaftsordnung, beschränkt. Freilich mußte die wissenschaftliche Vertiefung des im Laufe der 80er Jahre bei uns sich verbreitenden Interesses gerade an dieser Spezialfragek[165]A: Spezialfrage, zunächst eine ihrer wesentlichsten Aufgaben sein.68 Vgl. ebd., oben, S. 126 mit Anm. 7. Allein je mehr die praktische Behandlung der Arbeiterverhältnisse auch bei uns dauernder Gegenstand der gesetzgebenden Tätigkeit und der öffentlichen Erörterung geworden ist, um so mehr mußte der Schwerpunkt der wissenschaftlichen Arbeit sich auf die Feststellung der universelleren Zusammenhänge, in welche diese Probleme hineingehören, verschieben und damit in die Aufgabe einer Analyse aller, durch die Eigenart der ökonomischen Grundlagen unserer Kultur geschaffenen und insofern spezifisch modernen Kultur[166]probleme ausmünden. Die Zeitschrift hat denn auch schon sehr bald die verschiedensten, teils „ökonomisch relevanten“, teils „ökonomisch bedingten“ Lebensverhältnisse auch der übrigen großen Klassen der modernen Kulturnationen und deren Beziehungen zueinander historisch, statistisch und theoretisch zu behandeln begonnen. Wir ziehen nur die Konsequenzen dieses Verhaltens, wenn wir jetzt als eigenstes Arbeitsgebiet unserer Zeitschrift die wissenschaftliche Erforschung der allgemeinen Kulturbedeutung der sozialökonomischen Struktur des menschlichen Gemeinschaftslebens und seiner historischen Organisationsformen bezeichnen. – Dies und nichts anderes meinen wir, wenn wir unsere Zeitschrift „Archiv für Sozialwissenschaft“ genannt haben. Das Wort soll hier die geschichtliche und theoretische69[166] Vgl. ebd., S. 130 mit Anm. 21. Beschäftigung mit den gleichen Problemen umfassen, deren praktische Lösung Gegenstand der „Sozialpolitik“ im weitesten Sinne dieses Wortes ist. Wir machen dabei von dem Rechte Gebrauch, den Ausdruck „sozial“ in seiner durch konkrete Gegenwartsprobleme bestimmten Bedeutung zu verwenden.70 Vgl. ebd., S. 126. Will man solche Disziplinen, welche die Vorgänge des menschlichen Lebens unter dem Gesichtspunkt ihrer Kulturbedeutung betrachten, „Kulturwissenschaften“71 Rickert, Kulturwissenschaft (wie oben, S. 10, Anm. 62), unterscheidet zwischen Natur- und Kulturwissenschaften. Dieser Unterscheidung liegt ein „materialer Gegensatz der Objekte“ insofern zugrunde, „als sich aus der Gesammtwirklichkeit eine Anzahl von Dingen und Vorgängen heraushebt, die für uns eine besondere Bedeutung besitzen, und in denen wir daher noch etwas anderes sehen als blosse Natur“; an sie haben wir „ganz andere Fragen“ zu stellen, die sich „vor Allem auf die Objekte“ beziehen, die wir „unter dem Namen Kultur zusammenfassen“ (ebd., S. 17). Weil „in allen Kulturvorgängen irgend ein vom Menschen anerkannter Werth verkörpert ist“ (ebd., S. 20), ist „Kultur“ die „Gesammtheit der allgemein gewertheten Objekte“ (ebd., S. 27). Dieser materialen, „auf die besondere Bedeutung der Kulturobjekte gestützten Eintheilung in Natur- und Kulturwissenschaften“ (ebd., S. 17) entspricht eine „formale“, weil „derselbe Begriff der Kultur, mit Hülfe dessen wir die beiden Gruppen von Objekten der Wissenschaften gegen einander abgrenzen konnten, zugleich auch das Prinzip der historischen Begriffsbildung bestimmt“ (ebd., S. 44). Es sind „Kulturwerthe“, die dieser Begriffsbildung das „Prinzip der Auswahl“ liefern (ebd., S. 47). Rickert, Grenzen, S. 363 ff., prägt dafür den Begriff „Werthbeziehung“ und stellt klar, daß „der Inhalt der Werthe, welche die historische Begriffsbildung leiten und zugleich bestimmen, was Objekt der Geschichte wird, durchweg dem Kulturleben entnommen ist“ (ebd., S. 309 f.). nennen, so gehört die Sozial[A 41]wissenschaft in unserem Sinne in diese Kategorie [167]hinein. Wir werden bald sehen,72[167] Unten, S. 174 ff. welche prinzipiellen Konsequenzen das hat.
Unzweifelhaft bedeutet die Heraushebung der sozialökonomischen Seite des Kulturlebens eine sehr fühlbare Begrenzung unserer Themata. Man wird sagen, daß der ökonomische oder, wie man unpräzis gesagt hat, der „materialistische“73 Vgl. Engels, Anti-Dühring (wie oben, S. 108, Anm. 14), S. 286: Der „materialistische[n] Anschauung der Geschichte“ zufolge sind „die letzten Ursachen aller gesellschaftlichen Veränderungen […] nicht in den Köpfen der Menschen“ zu suchen, sondern „in Veränderungen der Produktions- und Austauschweise; sie sind zu suchen nicht in der Philosophie, sondern in der Ökonomie der betreffenden Epoche“. Gesichtspunkt, von dem aus das Kulturleben hier betrachtet wird, „einseitig“ sei. Sicherlich, und diese Einseitigkeit ist beabsichtigt. Der Glaube, es sei die Aufgabe fortschreitender wissenschaftlicher Arbeit, die „Einseitigkeit“74 Zum Vorwurf der „Einseitigkeit“ des Materialismus vgl. z. B. Schmoller, Gustav, Volkswirtschaft, Volkswirtschaftslehre und -methode, in: HdStW2, Band 7, 1901, S. 543–580 (hinfort: Schmoller, Art. Volkswirtschaft), hier S. 553 f. der ökonomischen Betrachtungsweise dadurch zu heilen, daß sie zu einer allgemeinen Sozialwissenschaft erweitert werde, krankt zunächst an dem Fehler, daß der Gesichtspunkt des „Sozialen“,75 Vgl. [Jaffé, Sombart, Weber,] Geleitwort, oben, S. 127. also der Beziehung zwischen Menschen, nur dann irgend welche zur Abgrenzung wissenschaftlicher Probleme ausreichende Bestimmtheit besitzt, wenn er mit irgend einem speziellen inhaltlichen Prädikat versehen ist. Sonst umfaßte er, als Objekt einer Wissenschaft gedacht, natürlich z. B. die Philologie ebensowohl wie die Kirchengeschichte und namentlich alle jene Disziplinen, die mit dem wichtigsten konstitutiven Elemente jedes Kulturlebens: dem Staat, und mit der wichtigsten Form seiner normativen Regelung: dem Recht, sich beschäftigen. Daß die Sozialökonomik sich mit „sozialen“ Beziehungen befaßt[,] ist so wenig ein Grund, sie als notwendigen Vorläufer einer „allgemeinen Sozialwissenschaft“ zu denken, wie etwa der Umstand, daß sie sich mit Lebenserscheinungen befaßt, dazu nötigt, sie als Teil der Biologie, oder der andere, daß sie es mit Vorgängen auf einem Himmelskörper zu tun hat, dazu, sie als Teil einer künftigen vermehrten und verbesserten Astronomie anzusehen. Nicht die „sachlichen“ Zusammenhänge der „Dinge“, sondern die gedanklichen Zusammenhänge der Pro[168]bleme liegen den Arbeitsgebieten der Wissenschaften zugrunde: wo mit neuer Methode einem neuen Problem nachgegangen wird und dadurch Wahrheiten entdeckt werden, welche neue bedeutsame Gesichtspunkte eröffnen, da entsteht eine neue „Wissenschaft“. –
Es ist nun kein Zufall, daß der Begriff des „Sozialen“, der einen ganz allgemeinen Sinn zu haben scheint, sobald man ihn auf seine Verwendung hin kontrolliert,76[168] Vgl. ebd. stets eine durchaus besondere, spezifisch gefärbte, wenn auch meist unbestimmte, Bedeutung an sich trägt; das „allgemeine“ beruht bei ihm tatsächlich in nichts anderem als eben in seiner Unbestimmtheit. Er bietet eben, wenn man ihn in seiner „allgemeinen“ Bedeutung nimmt, keinerlei spezifische Gesichts[A 42]punkte, unter denen man die Bedeutung bestimmter Kulturelemente beleuchten könnte.
Frei von dem veralteten Glauben, daß die Gesamtheit der Kulturerscheinungen sich als Produkt oder als Funktion „materieller“ Interessenkonstellationenl[168]A: Interessekonstellationen deduzieren lasse, glauben wir unsrerseits doch, daß die Analyse der sozialen Erscheinungen und Kulturvorgänge unter dem speziellen Gesichtspunkte ihrer ökonomischen Bedingtheit und Tragweite ein wissenschaftliches Prinzip von schöpferischer Fruchtbarkeit war und, bei umsichtiger Anwendung und Freiheit von dogmatischer Befangenheit, auch in aller absehbarer Zeit noch bleiben wird.77 Vgl. oben, S. 163 mit Anm. 63. Die sogenannte „materialistische Geschichtsauffassung“78 Vgl. Engels, Friedrich, Über historischen Materialismus, in: Die neue Zeit, 11. Jg., Band 1, 1893, S. 15–20, 42–51, hier S. 19 f. als „Weltanschauung“ oder als Generalnenner kausaler Erklärung der historischen Wirklichkeit ist auf das Bestimmteste abzulehnen, – die Pflege der ökonomischen Geschichtsinterpretation ist einer der wesentlichsten Zwecke unserer Zeitschrift. Das bedarf der näheren Erläuterung.
Die sogenannte „materialistische Geschichtsauffassung“ in dem alten genial-primitiven Sinne etwa des kommunistischen Manifests79 Vgl. Marx/Engels, Manifest. beherrscht heute wohl nur noch die Köpfe von Laien und Dilettanten. Bei ihnen findet sich allerdings noch immer die eigen[169]tümliche Erscheinung verbreitet, daß ihrem Kausalbedürfnis80[169] Die in der Philosophie und den Wissenschaften des 19. Jahrhunderts verbreiteten Begriffe Kausalbedürfnis bzw. Kausaltrieb bezeichnen ein ursprüngliches Verlangen, die Ursachen von Ereignissen in Erfahrung zu bringen. Vgl. z. B. Sigwart, Logik I (wie oben, S. 5, Anm. 30), S. 408: „Es ist das natürliche Causalitätsbedürfnis gewesen, was die Menschen trieb, die Ursachen der Ereignisse in der Macht von Dämonen oder in der Stellung der Gestirne zu suchen“. Vgl. auch Du Bois-Reymond, Grenzen (wie oben, S. 3, Anm. 16), S. 106, 111, 121; Du Bois-Reymond, Welträthsel (wie oben, S. 3, Anm. 18), S. 385 f.; Rickert, Grenzen, S. 475; Meyer, Theorie, S. 44. bei der Erklärung einer historischen Erscheinung so lange nicht Genüge geschehen ist, als nicht irgendwie und irgendwo ökonomische Ursachen als mitspielend nachgewiesen sind (oder zu sein scheinen): ist dies aber der Fall, dann begnügen sie sich wiederum mit der fadenscheinigsten Hypothese und den allgemeinsten Redewendungen, weil nunmehr ihrem dogmatischen Bedürfnis, daß die ökonomischen „Triebkräfte“ die „eigentlichen“, einzig „wahren“, in „letzter Instanz überall Ausschlag gebenden“ seien, Genüge geschehen ist.81 Engels, Anti-Dühring (wie oben, S. 108, Anm. 14), S. 12, vertritt die These, daß „die jedesmalige ökonomische Struktur der Gesellschaft die reale Grundlage bildet, aus der der gesammte Ueberbau der rechtlichen und politischen Einrichtungen, sowie der religiösen, philosophischen und sonstigen Vorstellungsweise eines jeden geschichtlichen Zeitabschnittes in letzter Instanz zu erklären“ ist. Die Erscheinung ist ja nichts Einzigartiges. Es haben fast alle Wissenschaften, von der Philologie bis zur Biologie, gelegentlich den Anspruch erhoben, Produzenten nicht nur von Fachwissen, sondern auch von „Weltanschauungen“ zu sein. Und unter dem Eindruck der gewaltigen Kulturbedeutung der modernen ökonomischen Umwälzungen und speziell der überragenden Tragweite der „Arbeiterfrage“ glitt der unausrottbare monistische82 Für Rickert, Grenzen, S. 652, ist der Monismus eine Position, „die nur ein Prinzip kennt“. Es handelt sich um eine in der Philosophie und in den Wissenschaften verbreitete Haltung, alles entweder auf eine materialistische Grundlage zurückführen oder aus einer idealistischen Wesenhaftigkeit abzuleiten. Im Anschluß an Charles Darwins Abstammungslehre sollte Ernst Haeckel 1906 den Monistenbund gründen. Zug jedes gegen sich selbst unkritischen Erkennens naturgemäß auf diesen Weg. Der gleiche Zug kommt jetzt, wo in zunehmender Schärfe der politische und handelspolitische Kampf der Nationen untereinander um die Welt gekämpft wird,83 Vgl. z. B. Schmoller, Gustav, Die Wandlungen der europäischen Handelspolitik im 19. Jahrhundert. Eine Säkularbetrachtung, in: Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft im Deutschen Reich, Band 24, 1900, S. 373–382. der Anthro[170]pologie zugute: ist doch [A 43]der Glaube weit verbreitet, daß „in letzter Linie“ alles historische Geschehen Ausfluß des Spiels angeborener „Rassenqualitäten“ gegeneinander sei.84[170] Vgl. den Abschnitt „Biologische und anthropologische Grundlagen der Gesellschaft“ in: Weber, Allgemeine („theoretische“) Nationalökonomie, MWG III/1, S. 345–362, u. a. mit Bezug (S. 351) auf Ammon, Otto, Die natürliche Auslese beim Menschen. Auf Grund der Ergebnisse der anthropologischen Untersuchungen der Wehrpflichtigen in Baden und anderer Materialien dargestellt. – Jena: Gustav Fischer 1893, sowie (S. 356) auf Seeck, Otto, Geschichte des Untergangs der antiken Welt, Band 1. – Berlin: Siemenroth & Worms 1895, S. 257 ff. An die Stelle der kritiklosen bloßen Beschreibung von „Volkscharakteren“ trat die noch kritiklosere Aufstellung von eigenen „Gesellschaftstheorien“ auf „naturwissenschaftlicher“ Grundlage.85 Möglicherweise sind hier die Werke von Gumplowicz und Ratzenhofer gemeint. Vgl. z. B. Gumplowicz, Ludwig, Grundriß der Sociologie. – Wien: Manz 1885; Ratzenhofer, Gustav, Die sociologische Erkenntnis. Positive Philosophie des socialen Lebens. – Leipzig: F. A. Brockhaus 1898. Wir werden in unserer Zeitschrift die Entwicklung der anthropologischen Forschung, soweit sie für unsere Gesichtspunkte Bedeutung gewinnt, sorgsam verfolgen.86 Vgl. Jaffé, Sombart, Weber, Werbetext, oben, S. 118, und [Jaffé, Sombart, Weber,] Geleitwort, oben, S. 131. Es steht zu hoffen, daß der Zustand, in welchem die kausale Zurückführung von Kulturvorgängen auf die „Rasse“ lediglich unser Nichtwissen dokumentierte, – ähnlich wie etwa die Bezugnahme auf das „Milieu“87 Der Begriff „Milieu“ ist die französische Übersetzung des lateinischen Begriffs „medium“, mit dem Isaac Newton u. a. den Äther bezeichnete, der Körper umgibt und Kräfte zwischen ihnen überträgt. Man findet ihn im 19. Jahrhundert in vielen Disziplinen, um den Einfluß der Umwelt auf Lebewesen zu bezeichnen. Vgl. z. B. Taine, Hippolyte, Histoire de la Littérature Anglaise, Band 1, 2., durchgesehene und verbesserte Aufl. – Paris: Hachette 1866, S. XXIII ff., der „la race, le milieu et le moment“ als „les trois forces primordiales“ bezeichnete. Weber, Allgemeine („theoretische“) Nationalökonomie, MWG III/1, S. 204, hat den Begriff durchaus benutzt. Für Rickert, Grenzen, S. 426, ist er nur ein leeres „Schlagwort“. oder, früher, auf die „Zeitumstände“,88 Vgl. z. B. Herder, Johann Gottfried, Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit. Dritter Theil. – Riga und Leipzig: Johann Friedrich Hartknoch 1790, S. 347, 370 f., der den „Charakter“ der Römer „als Folge ihrer Zeitumstände“ betrachtet und von der „großen Übermacht der Zeitumstände“ spricht. – allmählich durch methodisch geschulte Arbeit überwunden wird. Wenn etwas dieser Forschung bisher geschadet hat, so ist es die Vorstellung eifriger Dilettanten, daß sie für die Erkenntnis der Kultur etwas spezifisch Anderes und Erheblicheres leisten könnte, als die Erweiterung der Möglichkeit sicherer Zurechnung89 Vgl. unten, S. 184 ff. [171]einzelner konkreter Kulturvorgänge der historischen Wirklichkeit zu konkreten historisch gegebenen Ursachen90[171] Zu dieser „historische[n] Kausalität“ vgl. Rickert, Grenzen, S. 412 ff. durch Gewinnung exakten, unter spezifischen Gesichtspunkten erhobenen Beobachtungsmaterials. Ausschließlich soweit sie uns dies zu bieten vermögen, haben ihre Ergebnisse für uns Interesse und qualifizieren sie die „Rassenbiologie“91 Seit Januar 1904 erscheint unter der Herausgeberschaft von Alfred Ploetz das „Archiv für Rassen- und Gesellschafts-Biologie einschließlich Rassen- und Gesellschafts-Hygiene“, das den Untertitel trägt „Zeitschrift für die Erforschung des Wesens von Rasse und Gesellschaft und ihres gegenseitigen Verhältnisses, für die biologischen Bedingungen ihrer Erhaltung und Entwicklung, sowie für die grundlegenden Probleme der Entwicklungslehre“. Vgl. Ploetz, Alfred, Die Begriffe Rasse und Gesellschaft und die davon abgeleiteten Disziplinen. Einige Worte der Einführung, in: ebd., Band 1, 1904, S. 2–26. als etwas mehr als ein Produkt des modernen wissenschaftlichen Gründungsfiebers.
Nicht anders steht es um die Bedeutung der ökonomischen Interpretation des Geschichtlichen. Wenn nach einer Periode grenzenloser Überschätzung heute beinahe die Gefahr besteht, daß sie in ihrer wissenschaftlichen Leistungsfähigkeit unterwertet werde, so ist das die Folge der beispiellosen Unkritik, mit welcher die ökonomische Deutung der Wirklichkeit als „universelle“ Methode in dem Sinne einer Deduktion aller Kulturerscheinungen – d. h. alles an ihnen für uns Wesentlichen, – als in letzter Instanz ökonomisch bedingt verwendet wurde. Heute ist die logische Form, in der sie auftritt, nicht ganz einheitlich. Wo für die rein ökonomische Erklärung sich Schwierigkeiten ergeben, stehen verschiedene Mittel zur Verfügung, um ihre Allgemeingültigkeit als entscheidendes ursächliches Moment aufrecht zu erhalten. Entweder man behandelt alles das, was in der historischen Wirklichkeit nicht aus ökonomischen Motiven deduzierbar ist, als eben deshalb wissenschaftlich bedeutungslose „Zufälligkeit“.92 Zum Begriff „Zufall“ vgl. Rickert, Grenzen, S. 323 f., 416 ff. In seiner Kritik an Eduard Meyer referiert Weber auf Windelbands Dissertation „Die Lehren vom Zufall“ und auf die Zufalls-Spiele der Wahrscheinlichkeitstheorie. Vgl. Weber, Kritische Studien, unten, S. 389 ff. Zu der auf Johannes von Kries zurückgehenden Unterscheidung von zufälliger und adäquater Verursachung vgl. unten, S. 186 f. mit Anm. 43. Oder man dehnt den Begriff des Ökonomischen bis zur Unkenntlichkeit, so daß alle mensch[A 44]lichen Interessen, welche irgend wie an äußere Mittel gebunden sind, in jenen Begriff einbezogen werden. Steht historisch fest, daß auf [172]zwei in ökonomischer Hinsicht gleiche Situationen dennoch verschieden reagiert wurde, – infolge der Differenzen der politischen und religiösen, klimatischen und der zahllosen anderen nicht ökonomischen Determinanten –, dann degradiert man, um die Suprematie des Ökonomischen zu erhalten, alle diese Momente zu den historisch zufälligen „Bedingungen“, unter denen die ökonomischen Motive als „Ursachen“ wirken. Es versteht sich aber, daß alle jene für die ökonomische Betrachtung „zufälligen“ Momente ganz in demselben Sinne wie die ökonomischen je ihren eigenen Gesetzen folgen, und daß für eine Betrachtungsweise, welche ihre spezifische Bedeutung verfolgt, die jeweiligen ökonomischen „Bedingungen“ ganz in dem gleichen Sinne „historisch zufällig“ sind, wie umgekehrt. Ein beliebter Versuch, demgegenüber die überragende Bedeutung des Ökonomischen zu retten, besteht endlich darin, daß man das konstante Mit- und Aufeinanderwirken der einzelnen Elemente des Kulturlebens in eine kausale oder funktionelle Abhängigkeit des einen von den anderen oder vielmehr aller übrigen von einem: dem ökonomischen, deutet. Wo eine bestimmte einzelne nicht wirtschaftliche Institution historisch auch eine bestimmte „Funktion“93[172] Diesen Begriff hat Spencer im Anschluß an die Naturphilosophie Friedrich Wilhelm Joseph Schellings in die Sozialwissenschaften eingeführt, wobei er die Gesellschaft in Analogie zu einem Lebewesen als differenzierten Organismus konzipiert, dessen Teile verschiedene, sich wechselseitig ergänzende Funktionen ausüben. Vgl. Spencer, Herbert, The Principies of Sociology. In Three Volumes, Vol. I. – New York: D. Appleton and Company 1897, S. 447 ff. im Dienste von ökonomischen Klasseninteressen versehen hat, d. h. diesen dienstbar geworden ist, wo z. B. etwa bestimmte religiöse Institutionen als „schwarze Polizei“94 So hat man seit dem 18. Jahrhundert in Preußen protestantische Geistliche bezeichnet, die von der Kanzel Verordnungen des Landesherrn verkündeten und deren Befolgung zusammen mit der Polizei überwachten. sich verwenden lassen und verwendet werden, wird dann die ganze Institution entweder als für diese Funktion geschaffen oder, – ganz metaphysisch, – als durch eine vom Ökonomischen ausgehende „Entwicklungstendenz“95 Zur Kritik dieses Begriffs vgl. Rickert, Grenzen, S. 526. Weber hat ihn allerdings selbst verwendet. Dasselbe gilt für Sombart. Vgl. Weber, Entwickelungstendenzen in der Lage der ostelbischen Landarbeiter, MWG I/4, S. 362–462; Sombart, Moderner Kapitalismus I (wie oben, S. 14, Anm. 94), S. 485, 554, 559, 584 f. geprägt, vorgestellt.
[173]Es bedarf heute für keinen Fachmann mehr der Ausführung, daß diese Deutung des Zweckes der ökonomischen Kulturanalyse der Ausfluß teils einer bestimmten geschichtlichen Konstellation, die das wissenschaftliche Interesse bestimmten ökonomisch bedingten Kulturproblemen zuwendete, teils eines rabiaten wissenschaftlichen Ressortpatriotismus war und daß sie heute mindestens veraltet ist. Die Reduktion auf ökonomische Ursachen allein ist auf keinem Gebiete der Kulturerscheinungen je in irgend einem Sinn erschöpfend, auch nicht auf demjenigen der „wirtschaftlichen“ Vorgänge. Prinzipiell ist eine Bankgeschichte irgend eines Volkes, die nur die ökonomischen Motive zur Erklärung heranziehen wollte, natürlich ganz ebenso unmöglich, wie etwa eine „Erklärung“ der Sixtinischen [A 45]Madonna aus den sozial-ökonomischen Grundlagen des Kulturlebens zur Zeit ihrer Entstehung sein würde, und sie ist in keiner Weise prinzipiell erschöpfender[,] als es etwa die Ableitung des Kapitalismus aus gewissen Umgestaltungen religiöser Bewußtseinsinhalte, die bei der Genesis des kapitalistischen Geistes96[173] Vgl. Weber, Roscher und Knies 1, oben, S. 87, Fn. 80 mit Anm. 4. mitspielten, oder etwa irgend eines politischen Gebildes aus geographischen Bedingungen sein würden. In allen diesen Fällen ist für das Maß der Bedeutung, die wir ökonomischen Bedingungen beizumessen haben, entscheidend, welcher Klasse von Ursachen diejenigen spezifischen Elemente der betreffenden Erscheinung, denen wir im einzelnen Falle Bedeutung beilegen, auf die es uns ankommt, zuzurechnen sind. Das Recht der einseitigen Analyse der Kulturwirklichkeit unter spezifischen „Gesichtspunkten“ aber, – in unserem Falle dem ihrer ökonomischen Bedingtheit, – ergibt sich zunächst rein methodisch aus dem Umstande, daß die Einschulung des Auges auf die Beobachtung der Wirkung qualitativ gleichartiger Ursachenkategorien und die stete Verwendung des gleichen begrifflich-methodischen Apparates alle Vorteile der Arbeitsteilung bietet. Sie ist so lange nicht „willkürlich“, als der Erfolg für sie spricht, d. h. als sie Erkenntnis von Zusammenhängen liefert, welche für die kausale Zurechnung konkreter historischer Vorgänge sich wertvoll erweistm[173]A: erweisen. Aber: die „Einseitigkeit“ und Unwirklichkeit der rein ökonomischen Interpretation des Geschichtlichen ist über[174]haupt nur ein Spezialfall eines ganz allgemein für die wissenschaftliche Erkenntnis der Kulturwirklichkeit geltenden Prinzips. Dies in seinen logischen Grundlagen und in seinen allgemeinen methodischen Konsequenzen uns zu verdeutlichen ist der wesentliche Zweck der weiteren Auseinandersetzungen.
Es gibt keine schlechthin „objektive“ wissenschaftliche Analyse des Kulturlebens oder, – was vielleicht etwas Engeres, für unsern Zweck aber sicher nichts wesentlich anderes bedeutet, – der „sozialen Erscheinungen“ unabhängig von speziellen und „einseitigen“ Gesichtspunkten, nach denen sie – ausdrücklich oder stillschweigend, bewußt oder unbewußt – als Forschungsobjekt ausgewählt, analysiert und darstellend gegliedert werden. Der Grund liegt in der Eigenart des Erkenntnisziels einer jeden sozialwissenschaftlichen Arbeit, die über eine rein formale Betrachtung der Normen – rechtlichen oder konventionellen – des sozialen Beieinanderseins hinausgehen will.
[A 46]Die Sozialwissenschaft, die wir treiben wollen, ist eine Wirklichkeitswissenschaft.97[174] Vgl. Weber, Roscher und Knies 1, oben, S. 44 f. mit Anm. 25. Für Rickert, Grenzen, S. 369, ist eine historische Wissenschaft eine „Wirklichkeitswissenschaft, insofern sie es mit einmaligen individuellen Wirklichkeiten als solchen zu thun hat, sie ist Wirklichkeitswissenschaft, insofern sie einen für Alle gültigen Standpunkt der blossen Betrachtung einnimmt und daher nur die durch Beziehung auf einen allgemeinen Werth bedeutungsvollen individuellen Wirklichkeiten oder die historischen In-dividuen zum Objekt der Darstellung macht“. Vgl. sinngemäß bereits Simmel, Geschichtsphilosophie1, S. 43. Wir wollen die uns umgebende Wirklichkeit des Lebens, in welches wir hineingestellt sind, in ihrer Eigenart verstehen – den Zusammenhang und die Kulturbedeutung ihrer einzelnen Erscheinungen in ihrer heutigen Gestaltung einerseits, die Gründe ihres geschichtlichen So-und-nicht-anders-Gewordenseins andererseits.98 Möglicherweise Anspielung auf Menger, Untersuchungen, S. 14: „Wir verstehen eine concrete Erscheinung in specifisch historischer Weise (durch ihre Geschichte), indem wir ihren individuellen Werdeprocess erforschen d. i. indem wir uns die concreten Verhältnisse zum Bewusstsein bringen, unter welchen sie geworden, und zwar so, wie sie ist, in ihrer besonderen Eigenart, geworden.“ Nun bietet uns das Leben, sobald wir uns auf die Art, in der es uns unmittelbar entgegentritt, zu besinnen suchen, eine schlechthin unendliche Mannigfaltigkeit von nach- und nebeneinander auftauchenden und vergehenden Vorgängen, „in“ uns [175]und „außer“ uns.99[175] Zu diesem neukantianischen Wirklichkeitsbegriff vgl. Rickert, Kulturwissenschaft (wie oben, S. 10, Anm. 62), S. 29 f., und Rickert, Grenzen, S. 32 ff. Und die absolute Unendlichkeit dieser Mannigfaltigkeit bleibt intensiv durchaus ungemindert auch dann bestehen, wenn wir ein einzelnes „Objekt“ – etwa einen konkreten Tauschakt – isoliert ins Auge fassen, – sobald wir nämlich ernstlich versuchen wollen, dies „Einzelne“ erschöpfend in allen seinen individuellen Bestandteilen auch nur zu beschreiben, geschweige denn es in seiner kausalen Bedingtheit zu erfassen.1 Die Unterscheidung von Beschreibung und kausaler Erklärung hat Kirchhoff, Physik (wie oben, S. 4, Anm. 19), S. V thematisiert, für den die „Aufgabe der Mechanik“ darin besteht, „die in der Natur vor sich gehenden Bewegungen zu beschreiben, und zwar vollständig und auf die einfachste Weise“; d. h. es gehe nur darum „anzugeben, welches die Erscheinungen sind, die stattfinden, nicht aber darum, ihre Ursachen zu ermitteln“. Kirchhoff hat in den Natur- und Geisteswissenschaften Gehör gefunden (Ernst Mach, Wilhelm Dilthey). Rickert, Grenzen, S. 123 ff., beharrt hingegen auf kausaler Erklärung: der Anspruch einer „vollständigen Beschreibung“ scheint ihm wegen der „intensiven und extensiven Unendlichkeit der Dinge“ ohnehin nicht durchführbar. Weber kommt 1909 auf Kirchhoffs „‚einfachste Beschreibung‘ empirischer Tatsachen“ zu sprechen. Vgl. Weber, Rezension von Adolf Weber, Die Aufgaben der Volkswirtschaftslehre als Wissenschaft, MWG I/12, S. 183–200, hier S. 198. Alle denkende Erkenntnis der unendlichen Wirklichkeit durch den endlichen Menschengeist beruht daher auf der stillschweigenden Voraussetzung, daß jeweils nur ein endlicher Teil derselben den Gegenstand wissenschaftlicher Erfassung bilden, daß nur er „wesentlich“ im Sinne von „wissenswert“ sein solle. Nach welchen Prinzipien aber wird dieser Teil ausgesondert? Immer wieder hat man geglaubt, das entscheidende Merkmal auch in den Kulturwissenschaften in letzter Linie in der „gesetzmäßigen“ Wiederkehr bestimmter ursächlicher Verknüpfungen finden zu können.2 Möglicherweise Anspielung auf Lamprecht, Kulturgeschichte. Das, was die „Gesetze“, die wir in dem unübersehbar mannigfaltigen Ablauf der Erscheinungen zu erkennen vermögen, in sich enthalten, muß, – nach dieser Auffassung, – das allein wissenschaftlich „Wesentliche“ in ihnen sein: sobald wir die „Gesetzlichkeit“ einer ursächlichen Verknüpfung, sei es mit den Mitteln umfassender historischer Induktion als ausnahmslos geltend nachgewiesen, sei es für die innere Erfahrung zur unmittelbaren anschaulichen Existenz gebracht haben, ordnet sich ja jeder so gefundenen Formel jede noch so groß gedachte Zahl gleichartiger Fälle unter. Was nach dieser Heraushebung des „Gesetzmäßigen“ jeweils von der individuellen Wirklichkeit unbe[176]griffen verbleibt, gilt entweder als wissenschaftlich noch unverarbeiteter Rückstand, der durch immer weitere Vervollkommnung des „Gesetzes“-Systems in dieses hineinzuarbeiten sei, oder aber es bleibt als „zufällig“ und eben deshalb wissenschaft[Α 47]lich unwesentlich überhaupt beiseite, eben weil es nicht „gesetzlich begreifbar“ ist, also nicht zum „Typus“ des Vorgangs gehört und daher nur Gegenstand „müßiger Neugier“3[176] Diese Formulierung hat Weber möglicherweise von Fichte übernommen. Vgl. Fichte, Johann Gottlieb, Der geschloßne Handelsstaat. Ein philosophischer Entwurf als Anhang zur Rechtslehre und Probe einer künftig zu liefernden Politik. – Tübingen: J. G. Cotta 1800, S. 275: „Zu reisen hat aus einem geschloßnen Handelsstaate nur der Gelehrte und der höhere Künstler: der müßigen Neugier und Zerstreuungssucht soll es nicht länger erlaubt werden, ihre Langeweile durch alle Länder herumzutragen.“ sein kann. Immer wieder taucht demgemäß – selbst bei Vertretern der historischen Schule4 Gemeint sind Roscher, Knies und Hildebrand als Vertreter der älteren Historischen Schule der Nationalökonomie. Vgl. Weber, Roscher und Knies 1, oben, S. 42. Schmoller gilt als Oberhaupt der jüngeren historischen Schule. Weber hatte sich in seiner Freiburger Antrittsvorlesung als „Jünger“ der historischen Schule bezeichnet. Vgl. Weber, Der Nationalstaat und die Volkswirtschaftspolitik, MWG I/4, S. 535–574, hier S. 563. – die Vorstellung auf, das Ideal, dem alle, also auch die Kulturerkenntnis[,] zustrebe und, wenn auch für eine ferne Zukunft, zustreben könne, sei ein System von Lehrsätzen, aus dem die Wirklichkeit „deduziert“ werden könnte. Ein Führer der Naturwissenschaft5 Du Bois-Reymond hat man als einen der „Führer und Häupter der Naturwissenschaft“ bezeichnet. Vgl. Ulrici, Hermann, [Rez.] Ueber die Gränzen des Naturerkennens. Ein Vortrag in der zweiten öffentlichen Sitzung der 45. Versammlung der Naturforscher und Aerzte gehalten von Emil du Bois-Reymond. Leipzig, Veit, 1872, in: Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik, Band 63, 1873, S. 68–79, hier S. 69. hat bekanntlich geglaubt, als das (faktisch unerreichbare) ideale Ziel einer solchen Verarbeitung der Kulturwirklichkeit eine „astronomische“ Erkenntnis6 In seiner Rede „Die sieben Welträthsel“ verteidigt Du Bois-Reymond sein Konzept „astronomische[r] Kenntniss“. Vgl. Du Bois-Reymond, Welträthsel (wie oben, S. 3, Anm. 18), S. 385 f. Vom Erkenntnisideal des Laplaceschen Dämons ausgehend, formuliert er dieses Konzept in seiner Rede „Ueber die Grenzen des Naturerkennens“ für materielle Systeme, zu denen er noch das Gehirn, aber nicht mehr das Bewußtsein, zählt: „Ich nenne astronomische Kenntniss eines materiellen Systemes solche Kenntniss aller seiner Theile, ihrer gegenseitigen Lage und ihrer Bewegung, dass ihre Lage und Bewegung zu irgend einer vergangenen und zukünftigen Zeit mit derselben Sicherheit berechnet werden kann, wie Lage und Bewegung der Himmelskörper“, wozu man die jeweiligen Gesetze und Anfangsbedingungen kennen muß. Vgl. Du Bois-Reymond, Grenzen (wie oben, S. 3, Anm. 16), S. 120. der Lebensvorgänge bezeichnen zu können. [177]Lassen wir uns, so oft diese Dinge nun auch schon erörtert sind,7 [177]Vgl. z. B. Rickert, Grenzen, S. 445, 508 ff., mit Bezug auf Laplace und Du Bois-Reymond. die Mühe nicht verdrießen[,] auch unsererseits hier etwas näher zuzusehen. Zunächst fällt in die Augen, daß diejenige „astronomische“ Erkenntnis[,] an welche dabei gedacht wird, keine Erkenntnis von Gesetzen ist, sondern vielmehr die „Gesetze“, mit denen sie arbeitet, als Voraussetzungen ihrer Arbeit anderen Disziplinen, wie der Mechanik, entnimmt.8 Laplace, Wahrscheinlichkeiten (wie oben, S. 2, Anm. 8), S. 4, weist auf die „Entdeckungen auf dem Gebiete der Mechanik und Geometrie“ hin, die, verbunden mit der „Entdeckung der allgemeinen Schwere“, den Menschen befähigten, durch „dieselben analytischen Ausdrücke“ die vergangenen und zukünftigen Zustände des Weltsystems zu umfassen. Sie selbst aber interessiert sich für die Frage: welches individuelle Ergebnis die Wirkung jener Gesetze auf eine individuell gestaltete Konstellation erzeugt,9 Der Begriff „Konstellation“ entstammt der Astronomie und findet sich in Himmelskarten zur Bezeichnung der Gruppierung von Sternen. Vgl. z. B. Messer, Jacob, Stern-Atlas für Himmelsbeobachtungen, 2., verbesserte und ergänzte Aufl. – Leipzig und St. Petersburg: K. L. Richter 1902, S. 25, 73, 108, 121, 129, 134. Laplace hat ihn in seiner Darstellung des Weltsystems verwendet. Vgl. Laplace, Pierre-Simon, Exposition du système du monde, 2 tomes. – Paris: l’Imprimerie du Cercle-Social L’an IV de la République Française [1795/96], tome 1, S. 90: „on a partagé le ciel en divers groupes d’étoiles, nommés constellations“; vgl. ebd., S. 88 und tome 2, S. 202 f., 211, 309. In Du Bois-Reymonds Reden taucht der Begriff ebensowenig auf wie in Rickerts „Grenzen“, dafür in Meyer, Theorie, S. 28: „Die Naturwissenschaft kann berechnen und voraussehen, wie die Constellation der Planeten in einem bestimmten Moment sein wird“. da diese individuellen Konstellationen für uns Bedeutung haben. Jede individuelle Konstellation, die sie uns „erklärt“ oder voraussagt, ist natürlich kausal nur erklärbar als Folge einer anderen[,] gleich individuellen[,] ihr vorhergehenden, und soweit wir zurückgreifen in den grauen Nebel der fernsten Vergangenheit – stets bleibt die Wirklichkeit, für welche die Gesetze gelten, gleich individuell, gleich wenig aus den Gesetzen deduzierbar.10 Weber folgt hier Windelband, Geschichte, S. 24 ff. Vgl. dazu Einleitung, oben, S. 6 ff. Vgl. auch Weber, Roscher und Knies 1, oben, S. 62 f. Ein kosmischer „Urzustand“, der einen nicht oder weniger individuellen Charakter an sich trüge[,] als die kosmische Wirklichkeit der Gegenwart ist, wäre natürlich ein sinnloser Gedanke: – aber spukt nicht ein Rest ähnlicher Vorstellungen auf unserm Gebiet in jenen bald naturrechtlich erschlossenen, bald durch Beobachtung an „Naturvölkern“ verifizierten Annahmen ökonomisch-sozialer „Urzustände“ ohne histo[178]rische „Zufälligkeiten“, – so des „primitiven Agrarkommunismus“,11 [178]Vgl. Laveleye, Emile de, Das Ureigentum. Autorisierte deutsche Ausgabe, hg. und vervollständigt von Karl Bücher. – Leipzig: F. A. Brockhaus 1879, bes. S. 4 f. der sexuellen „Promiscuität“12 Vgl. Bachofen, Johann Jakob, Das Mutterrecht. Eine Untersuchung über die Gynaikokratie der alten Welt nach ihrer religiösen und rechtlichen Natur, 2., unveränderte Aufl. – Basel: Benno Schwabe 1897, S. 10 ff., 20 ff. (§ 7 und § 8). usw., aus denen heraus alsdann durch eine Art von Sündenfall ins Konkrete die individuelle historische Entwicklung entsteht?
Ausgangspunkt des sozialwissenschaftlichen Interesses ist nun zweifellos die wirkliche, also individuelle Gestaltung13 Vgl. Weber, Roscher und Knies 1, oben, S. 47. des uns umgebenden sozialen Kulturlebens in seinem universellen, aber [A 48]deshalb natürlich nicht minder individuell gestalteten Zusammenhange und in seinem Gewordensein aus anderen, selbstverständlich wiederum individuell gearteten, sozialen Kulturzuständen heraus. Offenbar liegt hier der Sachverhalt, den wir eben an der Astronomie als einem (auch von den Logikern14 Vgl. z. B. Rickert, Grenzen, S. 285, 300, 444 ff., 508. regelmäßig zum gleichen Behufe herangezogenen) Grenzfalle erläuterten, in spezifisch gesteigertem Maße vor. Während für die Astronomie die Weltkörper nur in ihren quantitativen, exakter Messung zugänglichen Beziehungen für unser Interesse in Betracht kommen, ist die qualitative Färbung der Vorgänge das, worauf es uns in der Sozialwissenschaft ankommt.15 Zur Unterscheidung von „quantitativ“ und „qualitativ“ vgl. Weber, Roscher und Knies 1, oben, S. 44 ff. Dazu tritt, daß es sich in den Sozialwissenschaften um die Mitwirkung geistiger Vorgänge handelt, welche nacherlebend zu „verstehen“ natürlich eine Aufgabe spezifisch anderer Art ist, als sie die Formeln der exakten Naturerkenntnis überhaupt lösen können oder wollen.16 Mit Bezug auf Dilthey konstatiert Rickert, Grenzen, S. 540, daß sich das „nacherlebende Verstehen“ und die „Unterordnung unter ein System allgemeiner Begriffe“ ausschließen. Vgl. auch ebd., S. 388, 477. Immerhin sind diese Unterschiede nicht an sich derart prinzipielle, wie es auf den ersten Blick scheint. Ohne Qualitäten kommen – von der reinen Mechanik abgesehen – auch die exakten Naturwissenschaften nicht aus;17 Zu den „historischen Bestandteilen in den Naturwissenschaften“ vgl. Rickert, Grenzen, S. 264 ff. wir stoßen ferner auf unserem Spezialgebiet auf die – freilich schiefe – Meinung, daß wenigstens die für unsere Kultur fundamentale [179]Erscheinung des geldwirtschaftlichen Verkehrs quantifizierbar und eben deshalb „gesetzlich“ erfaßbar sei;18[179] Über die Anschauung, „man müsse speciell diejenigen durch Ursachen erklärbaren Regelmässigkeiten als Gesetze bezeichnen, bei welchen es sich im Resultate um messbare und zählbare Quantitäten handele“, vgl. Schmoller, Art. Volkswirtschaft (wie oben, S. 167, Anm. 74), S. 575. und endlich hängt es von der engeren oder weiteren Fassung des Begriffs „Gesetz“ ab,19 In Weber, Grundriß zu den Vorlesungen über Allgemeine („theoretische“) Nationalökonomie, MWG III/1, S. 95, wird zur Klärung des „Begriff[s] des Gesetzes in der Nationalökonomie“ auf Werke von Gustav Rümelin, Gustav Schmoller, Georg Friedrich Knapp, Richmond Mayo-Smith, Friedrich Julius Neumann und Wilhelm Lexis verwiesen. ob man auch Regelmäßigkeiten, die, weil nicht quantifizierbar, keiner zahlenmäßigen Erfassung zugänglich sind, darunter verstehen will. Was speziell die Mitwirkung „geistiger“ Motive anlangt, so schließt sie jedenfalls die Aufstellung von Regeln20 Vgl. Weber, Stammler, unten, S. 530 ff. rationalen Handelns nicht aus, und vor allem ist die Ansicht noch heute nicht ganz verschwunden, daß es eben die Aufgabe der Psychologie sei, eine der Mathematik vergleichbare Rolle für die einzelnen „Geisteswissenschaften“ zu spielen,21 Für Dilthey, Ideen, S. 1363, soll die beschreibende und zergliedernde Psychologie „die Grundlage der Geisteswissenschaften werden, wie die Mathematik die der Naturwissenschaften ist“. Windelband, Geschichte, S. 23, spricht der „Psychologie“ die Funktion zu, für die Geschichtswissenschaft die „Gesetze des Seelenlebens“ zu formulieren. indem sie die komplizierten Erscheinungen des Soziallebens auf ihre psychischen Bedingungen und Wirkungen hin zu zergliedern, diese auf möglichst einfache psychische Faktoren zurückzuführen, letztere wieder gattungsmäßig zu klassifizieren und in ihren funktioneilen Zusammenhängen zu untersuchen habe. Damit wäre dann, wenn auch keine „Mechanik“, so doch eine Art von „Chemie“ des Soziallebens in seinen psychischen Grundlagen geschaffen. Ob derartige Untersuchungen jemals wertvolle und – was davon verschieden ist – für die Kulturwissenschaften brauch[A 49]bare Einzelergebnisse liefern würden, können wir hier nicht entscheiden wollen. Für die Frage aber, ob das Ziel sozialökonomischer Erkenntnis in unserem Sinn: Erkenntnis der Wirklichkeit in ihrer Kulturbedeutung und ihrem kausalen Zusammenhang durch die Aufsuchung des sich gesetzmäßig Wiederholenden erreicht werden kann, wäre dies ohne allen Belang. Gesetzt den Fall, es gelänge einmal, sei es mittels der Psychologie, [180]sei es auf anderem Wege, alle jemals beobachteten und weiterhin auch alle in irgend einer Zukunft denkbaren ursächlichen Verknüpfungen von Vorgängen des menschlichen Zusammenlebens auf irgend welche einfache letzte „Faktoren“ hin zu analysieren, und dann in einer ungeheuren Kasuistik von Begriffen und streng gesetzlich geltenden Regeln erschöpfend zu erfassen – was würde das Resultat für die Erkenntnis der geschichtlich gegebenen Kulturwelt, oder auch nur irgend einer Einzelerscheinung daraus, – etwa des Kapitalismus in seinem Gewordensein und seiner Kulturbedeutung, – besagen? Als Erkenntnismittel ebensoviel und ebensowenig wie etwa ein Lexikon der organischen chemischen Verbindungen für die biogenetische Erkenntnis der Tier- und Pflanzenwelt. Im einen Falle wie im andern würde eine sicherlich wichtige und nützliche Vorarbeit geleistet sein. Im einen Fall so wenig wie im andern ließe sich aber aus jenen „Gesetzen“ und „Faktoren“ die Wirklichkeit des Lebens jemals deduzieren – nicht etwa deshalb nicht, weil noch irgend welche höhere und geheimnisvolle „Kräfte“22 [180]Unter dem Einfluß der Naturphilosophie Friedrich Wilhelm Joseph Schellings verbreitete sich seit dem Ende des 18. Jahrhunderts in den Naturwissenschaften bei Alexander von Humboldt, Johannes Müller, Justus von Liebig u. a. die als Vitalismus bezeichnete Vorstellung von einer nicht an die Gesetze der Physik und Chemie gebundenen „Lebenskraft“. Vgl. Hüfner, Carl Gustav, Ueber die Entwicklung des Begriffs Lebenskraft und seine Stellung zur heutigen Chemie. Academische Antrittsrede. – Tübingen: Fues 1873; Bütschli, Otto, Mechanismus und Vitalismus. – Leipzig: W. Engelmann 1901. Auf den Vitalismus folgte um die Wende zum 20. Jahrhundert der Neo-Vitalismus von Hans Driesch, Henri Bergson u. a. („Dominanten“,23 Vgl. Weber, Roscher und Knies 1, oben, S. 92 f., Fn. 87 mit Anm. 31. „Entelechien“24 Entelechie ist die Eigenschaft, sein Ziel oder seinen Zweck in sich zu haben. Für Aristoteles ist sie die Form, die sich im Stoff verwirklicht. Vgl. Aristoteles, Metaphysik. Uebersetzt von Hermann Bonitz. Aus dem Nachlass hg. von Eduard Wellmann. – Berlin: Georg Reimer 1890, S. 190 (9. Buch, Kap. 8). oder wie man sie sonst genannt hat) in den Lebenserscheinungen stecken müßten – das ist eine Frage ganz für sich –[,] sondern schon einfach deswegen, weil es uns für die Erkenntnis der Wirklichkeit auf die Konstellation ankommt, in der sich jene (hypothetischen!) „Faktoren“, zu einer geschichtlich für uns bedeutsamen Kulturerscheinung gruppiert, vorfinden, und weil, wenn wir nun diese individuelle Gruppierung „kausal erklären“ wollen, wir immer auf andere, ganz ebenso individuelle Gruppierungen zurückgreifen müßten, aus [181]denen wir sie, natürlich unter Benutzung jener (hypothetischen!) „Gesetzes“-Begriffe „erklären“ würden.25 [181]Vgl. oben, S. 177. Windelband, Geschichte, S. 23, betont, daß die „idiographischen Wissenschaften auf Schritt und Tritt der allgemeinen Sätze“ bedürfen, „welche sie in völlig korrekter Begründung nur den nomothetischen Disciplinen entlehnen können. Jede Causalerklärung irgend eines geschichtlichen Vorganges setzt allgemeine Vorstellungen vom Verlauf der Dinge überhaupt voraus; und wenn man historische Beweise auf ihre rein logische Form bringen will, so erhalten sie stets als oberste Prämissen Naturgesetze des Geschehens, insbesondere des seelischen Geschehens“. Jene (hypothetischen) „Gesetze“ und „Faktoren“ festzustellen, wäre für uns also jedenfalls nur die erste der mehreren Arbeiten, die zu der von uns erstrebten Erkenntnis führen würden. Die Analyse und ordnende Darstellung der jeweils historisch gegebenen, individuellen Gruppierung jener „Faktoren“ und ihres dadurch bedingten konkreten, in seiner Art bedeut[A 50]samen Zusammenwirkens und vor allemn[181]A: allen die Verständlichmachung des Grundes und der Art dieser Bedeutsamkeit, wäre die nächste, zwar unter Verwendung jener Vorarbeit zu lösende, aber ihr gegenüber völlig neue und selbständige Aufgabe. Die Zurückverfolgung der einzelnen, für die Gegenwart bedeutsamen, individuellen Eigentümlichkeiten dieser Gruppierungen in ihrem Gewordensein soweit in die Vergangenheit als möglich und ihre historische Erklärung aus früheren[,] wiederum individuellen Konstellationen wäre die dritte, – die Abschätzung möglicher Zukunftskonstellationen endlich eine denkbare vierte Aufgabe.
Für alle diese Zwecke wäre das Vorhandensein klarer Begriffe26 Vgl. [Jaffé, Sombart, Weber,] Geleitwort, oben, S. 133 mit Anm. 31. und die Kenntnis jener (hypothetischen) „Gesetze“ offenbar als Erkenntnismittel – aber auch nur als solches – von großem Werte, ja sie wäre zu diesem Zwecke schlechthin unentbehrlich. Aber selbst in dieser Funktion zeigt sich an einem entscheidenden Punkte sofort die Grenze ihrer Tragweite, und mit deren Feststellung gelangen wir zu der entscheidenden Eigenart kulturwissenschaftlicher Betrachtungsweise. Wir haben als „Kulturwissenschaften“ solche Disziplinen bezeichnet, welche die Lebenserscheinungen in ihrer Kulturbedeutung zu erkennen strebten.27 Oben, S. 166 mit Anm. 71. Die Bedeutung der Gestaltung einer Kulturerscheinung und der Grund dieser Bedeu[182]tung kann aber aus keinem noch so vollkommenen System von Gesetzesbegriffen entnommen, begründet und verständlich gemacht werden, denn sie setzt die Beziehung der Kulturerscheinungen auf Wertideen28 [182]Vgl. oben, S. 152 mit Anm. 40. voraus. Der Begriff der Kultur ist ein Wertbegriff.29 Rickert, Kulturwissenschaft (wie oben, S. 10, Anm. 62), S. 26 f., spricht vom „Begriff der Kultur als der Gesammtheit der allgemein gewertheten Objekte“. Die empirische Wirklichkeit ist für uns „Kultur“, weil und sofern wir sie mit Wertideen in Beziehung setzen, sie umfaßt diejenigen Bestandteile der Wirklichkeit, welche durch jene Beziehung für uns bedeutsam werden, und nur diese.30 Vgl. oben, S. 166 mit Anm. 71. Ein winziger Teil der jeweils betrachteten individuellen Wirklichkeit wird von unserm durch jene Wertideen bedingten Interesse gefärbt, er allein hat Bedeutung für uns, er hat sie, weil er Beziehungen aufweist, die für uns infolge ihrer Verknüpfung mit Wertideen wichtig sind; nur weil und soweit dies der Fall, ist er in seiner individuellen Eigenart für uns wissenswert. Was aber für uns Bedeutung hat, das ist natürlich durch keine „voraussetzungslose“31 Vgl. Weber, Roscher und Knies 1, oben, S. 100 mit Anm. 67. Untersuchung des empirisch Gegebenen zu erschließen, sondern seine Feststellung ist Voraussetzung dafür, daß etwas Gegenstand der Untersuchung wird. Das Bedeutsame koinzidiert natürlich auch als solches mit keinem Gesetze als solchem, und zwar um so weniger, je allgemein[A 51]gültiger jenes Gesetz ist. Denn die spezifische Bedeutung, die ein Bestandteil der Wirklichkeit für uns hat, findet sich natürlich gerade nicht in denjenigen seiner Beziehungen, die er mit möglichst vielen anderen teilt.32 Windelband, Geschichte, S. 21, hatte postuliert, „dass sich alles Interesse und Beurteilen, alle Wertbestimmung des Menschen auf das Einzelne und das Einmalige bezieht“, und er hatte zu bedenken gegeben, „wie schnell sich unser Gefühl abstumpft, sobald sich sein Gegenstand vervielfältigt oder als ein Fall unter tausend gleichartigen erweist. ,Sie ist die erste nicht‘ – heisst es an einer der grausamsten Stellen des Faust. In der Einmaligkeit, der Unvergleichlichkeit des Gegenstandes wurzeln alle unsere Wertgefühle.“ Entsprechend sollte für Rickert, Kulturwissenschaft (wie oben, S. 10, Anm. 62), S. 52, „die „Bedeutung eines Kulturvorganges gerade auf der Eigenart beruhen, die ihn von andern unterscheidet, während das, was ihm mit andern gemeinsam ist, also sein naturwissenschaftliches Wesen, der historischen Kulturwissenschaft unwesentlich sein muss“. Die Beziehung der Wirklichkeit auf Wertideen, die ihr Bedeutung verleihen[,] undo[182]A: und, die Heraushebung und Ordnung [183]der dadurch gefärbten Bestandteile des Wirklichen unter dem Gesichtspunkt ihrer Kulturbedeutung sindp[183]A: ist ein gänzlich heterogener und disparater Gesichtspunkt gegenüber der Analyse der Wirklichkeit auf Gesetze und ihrer Ordnung in generellen Begriffen. Beide Arten der denkenden Ordnung des Wirklichen haben keinerlei notwendige logische Beziehungen zueinander. Sie können in einem Einzelfall einmal koinzidieren, aber es ist von den verhängnisvollsten Folgen, wenn dies zufällige Zusammentreffen über ihr prinzipielles Auseinanderfallen täuscht. Es kann die Kulturbedeutung einer Erscheinung, z. B. des geldwirtschaftlichen Tausches, darin bestehen, daß er als Massenerscheinung auftritt, wie dies eine fundamentale Komponente des heutigen Kulturlebens ist. Alsdann ist aber eben die historische Tatsache, daß er diese Rolle spielt, das, was in seiner Kulturbedeutung verständlich zu machen, in seiner historischen Entstehung kausal zu erklären ist. Die Untersuchung des generellen Wesens des Tausches und der Technik des Marktverkehrs ist eine – höchst wichtige und unentbehrliche! – Vorarbeit. Aber nicht nur ist damit die Frage nicht beantwortet, wie denn historisch der Tausch zu seiner heutigen fundamentalen Bedeutung gekommen ist, sondern vor allen Dingen: das, worauf es uns in letzter Linie doch ankommt: die Kulturbedeutung der Geldwirtschaft, um derentwillen wir uns für jene Schilderung der Verkehrstechnik ja allein interessieren, um derentwillen allein es heute eine Wissenschaft gibt, welche sich mit jener Technik befaßt, – sie folgt aus keinem jener „Gesetze“. Die gattungsmäßigen Merkmale des Tausches, Kaufs etc. interessieren den Juristen, – was uns angeht, ist die Aufgabe, eben jene Kulturbedeutung der historischen Tatsache, daß der Tausch heute Massenerscheinung ist, zu analysieren. Wo sie erklärt werden soll, wo wir verstehen wollen, was unsere sozialökonomische Kultur etwa von der des Altertums, in welcher der Tausch ja genau die gleichen gattungsmäßigen Qualitäten aufwies wie heute, unterscheidet, worin also die Bedeutung der „Geldwirtschaft“ liegt, da ragen logische Prinzipien durchaus heterogener Herkunft in die Untersuchung hinein: wir werden jene Begriffe, welche die [A 52]Untersuchung der gattungsmäßigen Elemente der ökonomischen Massenerscheinungen uns liefern, zwar, soweit in ihnen bedeutungsvolle Bestandteile unserer Kultur enthalten sind, [184]als Darstellungsmittel verwenden: – nicht nur aber ist das Ziel unserer Arbeit durch die noch so genaue Darstellung jener Begriffe und Gesetze nicht erreicht, sondern die Frage, was zum Gegenstand der gattungsmäßigen Begriffsbildung gemacht werden soll, ist gar nicht „voraussetzungslos“, sondern eben im Hinblick auf die Bedeutung entschieden worden, welche bestimmte Bestandteile jener unendlichen Mannigfaltigkeit, die wir „Verkehr“ nennen, für die Kultur besitzen. Wir erstreben eben die Erkenntnis einer historischen, d. h. einer in ihrer Eigenart bedeutungsvollen, Erscheinung. Und das entscheidende dabei ist: nur durch die Voraussetzung, daß ein endlicher Teil der unendlichen Fülle der Erscheinungen allein bedeutungsvoll sei, wird der Gedanke einer Erkenntnis individueller Erscheinungen überhaupt logisch sinnvoll. Wir ständen, selbst mit der denkbar umfassendsten Kenntnis aller „Gesetze“ des Geschehens, ratlos vor der Frage: wie ist kausale Erklärung einer individuellen Tatsache überhaupt möglich, – da schon eine Beschreibung selbst des kleinsten Ausschnittes der Wirklichkeit ja niemals erschöpfend denkbar ist?33 [184]Vgl. oben, S. 174 f. mit Anm. 99. Die Zahl und Art der Ursachen, die irgend ein individuelles Ereignis bestimmt haben, ist ja stets unendlich,34 Vgl. Rickert, Grenzen, S. 477: „Wollte man […] mit dem Gedanken Ernst machen, dass für jedes historische Faktum alle Ursachen dargestellt werden müssen, von dem seine individuelle Gestaltung abhängt, so würde uns diese Aufgabe wieder in die ganze unübersehbare Mannigfaltigkeit des Weltalls hineinführen“. und es gibt keinerlei in den Dingen selbst hegendes Merkmal, einen Teil von ihnen[,] als allein in Betracht kommend, auszusondern. Ein Chaos von „Existenzialurteilen“35 Rickert, Grenzen, S. 327 ff. über unzählige einzelne Wahrnehmungen wäre das einzige, was der Versuch eines ernstlich „voraussetzungslosen“ Erkennens der Wirklichkeit erzielen würde. Und selbst dieses Ergebnis wäre nur scheinbar möglich, denn die Wirklichkeit jeder einzelnen Wahrnehmung zeigt bei näherem Zusehen ja stets unendlich viele einzelne Bestandteile, die nie erschöpfend in Wahrnehmungsurteilen ausgesprochen werden können. In dieses Chaos bringt nur der Umstand Ordnung, daß in jedem Fall nur ein Teil der individuellen Wirklichkeit für uns Interesse und Bedeutung hat, weil nur er in Beziehung steht zu den Kulturwertideen, mit welchen wir an die Wirklichkeit herantreten. Nur bestimmte Seiten der stets unendlich mannigfaltigen Einzeler[185]scheinungen: diejenigen, welchen wir eine allgemeine Kulturbedeutung beimessen – sind daher wissenswert, sie allein sind Gegenstand der kausalen Erklärung. Auch diese kausale Er[A 53]klärung selbst weist dann wiederum die gleiche Erscheinung auf: ein erschöpfender kausaler Regressus36 [185]Vgl. oben, S. 164 mit Anm. 65. von irgend einer konkreten Erscheinung in ihrer vollen Wirklichkeit37 Zu dieser Formulierung vgl. Weber, Roscher und Knies 1, oben, S. 44 mit Anm. 17. aus ist nicht nur praktisch unmöglich[,] sondern einfach ein Unding. Nur diejenigen Ursachen, welchen die im Einzelfalle „wesentlichen“ Bestandteile eines Geschehens zuzurechnen sind, greifen wir heraus: die Kausalfrage ist, wo es sich um die Individualität einer Erscheinung handelt, nicht eine Frage nach Gesetzen, sondern nach konkreten kausalen Zusammenhängen,38 Vgl. Weber, Entwurf zur Übernahme des Archivs, oben, S. 107. nicht eine Frage, welcher Formel die Erscheinung als Exemplar unterzuordnen, sondern die Frage, welcher individuellen Konstellation sie als Ergebnis zuzurechnen ist: sie ist Zurechnungsfrage.39 Der Begriff findet sich in der zeitgenössischen Jurisprudenz. Vgl. z. B. Radbruch, Verursachung, S. 2. Er stammt von Pufendorf, demzufolge „Zurechnung“ (imputatio actualis) besagt, „daß die Würckung einer willkührlichen Action demjenigen, der sie begehet, als eine ihn angehende Sache zugeschrieben werden mag“. Vgl. Pufendorf, Samuel von, Acht Bücher vom Natur- und Völcker-Rechte. – Franckfurt am Mayn: Friedrich Knochen 1711, S. 110 (Buch I, Cap. V, § III). Wo immer die kausale Erklärung einer „Kulturerscheinung“ – eines „historischen Individuums“,40 Für Rickert, Grenzen, S. 368, ist das „historische Individuum“ die „Wirklichkeit“, die „sich durch Beziehung auf einen allgemeinen Werth zu einer einzigartigen und einheitlichen Mannigfaltigkeit für Jeden zusammenschliessen muss, und die dann so, wie sie unter dem Gesichtspunkt dieser bloss theoretischen Betrachtung in wesentliche und unwesentliche Bestandtheile zerfällt, dargestellt werden kann“. wie wir im Anschluß an einen in der Methodologie unserer Disziplin schon gelegentlich gebrauchten und jetzt in der Logik in präziser Formulierung üblich werdenden Ausdruck sagen wollen – in Betracht kommt, da kann die Kenntnis von Gesetzen der Verursachung nicht Zweck, sondern nur Mittel der Untersuchung sein. Sie erleichtert und ermöglicht uns die kausale Zurechnung der in ihrer Individualität kulturbedeutsamen Bestandteile der Erscheinungen zu ihren konkreten Ursachen. Soweit, und nur soweit, als sie dies leistet, ist sie für die Erkenntnis individueller Zusammenhänge wertvoll. Und je „allgemeiner“, d. h. abstrakter, die Gesetze, desto weniger leisten sie für [186]die Bedürfnisse der kausalen Zurechnung individueller Erscheinungen und damit indirekt für das Verständnis der Bedeutung der Kulturvorgänge.
Was folgt nun aus alledem?
Natürlich nicht etwa, daß auf dem Gebiet der Kulturwissenschaften die Erkenntnis des Generellen, die Bildung abstrakter Gattungsbegriffe, die Erkenntnis von Regelmäßigkeiten und der Versuch der Formulierung von „gesetzlichen“ Zusammenhängen keine wissenschaftliche Berechtigung hättenq[186]A: hätte. Im geraden Gegenteil: wenn die kausale Erkenntnis des Historikers Zurechnung konkreter Erfolge zu konkreten Ursachen ist, so ist eine gültige Zurechnung irgend eines individuellen Erfolges ohne die Verwendung „nomologischer“ Kenntnis – Kenntnis der Regelmäßigkeiten der kausalen Zusammenhänge – überhaupt nicht möglich.41 [186]Weber referiert hier auf Johannes von Kries. Für Kries, Principien, S. 85 f., ist Wissen entweder „nomologisch“, d. h. Kenntnis von Gesetzen, oder „ontologisch“, d. h. Kenntnis der (Anfangs-)Bedingungen. Vgl. Einleitung, oben, S. 19 f. Ob einem einzelnen individuellen Bestandteil eines Zusammenhanges in der Wirklichkeit in concreto kausale Bedeutung für den Erfolg, um dessen kausale Erklärung es sich handelt, beizumessen ist, kann ja im [A 54]Zweifelsfalle nur durch Abschätzung der Einwirkungen, welche wir von ihm und den anderen für die Erklärung mit in Betracht kommenden Bestandteilen des gleichen Komplexes42 Für Kries, Möglichkeit, S. 20 [195], kann „nur der ganze Complex von Bedingungen, der einen Erfolg factisch herbeiführte, die Ursache desselben heissen“. generell zu erwarten pflegen: welche „adäquate“ Wirkungen43 Zur Unterscheidung von zufälliger und adäquater Verursachung vgl. Einleitung, oben, S. 23. Die Vorstellung adäquater Verursachung geht zurück auf Spinoza, Baruch de, Die Ethik. Neu übersetzt und mit einem einleitenden Vorwort versehen von Jakob Stern. – Leipzig: Philipp Reclam jun. 1887, S. 151. Vgl. auch mit Bezug auf die Jurisprudenz Radbruch, Verursachung. der betreffenden ursächlichen Elemente sind, bestimmt werden. Inwieweit der Historiker (im weitesten Sinne des Wortes) mit seiner aus der persönlichen Lebenserfahrung gespeisten und methodisch geschulten Phantasie44 Die deutsche Geschichtswissenschaft des 19. Jahrhunderts geht von einer Verwandtschaft von Geschichtsschreibung und schöner Literatur aus, worauf Windel[187]band, Geschichte, S. 16 f., hinweist. Entsprechend kommt der „Phantasie“ bzw. „Einbildungskraft“ eine wichtige Darstellungsfunktion zu. Vgl. Humboldt, Geschichtschreiber, S. 306, 310; Gervinus, Historik, S. 358 f. Für Rickert, Grenzen, S. 384, bedarf eine „Wirklichkeitswissenschaft“ der „Phantasie“, wenn ihre Darstellungen „sowohl in Folge des Materialmangels hinter dem teleologisch Nothwendigen zurück bleiben als auch in Folge des Bedürfnisses nach Anschaulichkeit darüber hinaus gehen müssen“. Zur Bedeutung der Phantasie vgl. den Brief Max Webers an Helene Weber vom 12. April 1902, MWG II/3, S. 828–831, in dem er Rom als „grundhäßliches Nest“ bezeichnet, wo er gleichwohl „lebenslang leben“ könnte: „Die historische Phantasie ist die Hauptsache, wer sie nicht hat, soll dort nicht hingehen. Das ist bei Dir doch ein Verdienst von Gervinus u. der alten Heidelberger Luft.“ (ebd., S. 830 f.). Vgl. auch unten, S. 205. diese Zurechnung sicher vollziehen kann und inwieweit er auf die Hilfe spezieller Wissenschaften angewiesen ist, wel[187]che sie ihm ermöglichen, das hängt vom Einzelfalle ab. Überall aber und so auch auf dem Gebiet komplizierter wirtschaftlicher Vorgänge ist die Sicherheit der Zurechnung um so größer, je gesicherter und umfassender unsere generelle Erkenntnis ist. Daß es sich dabei stets, auch bei allen sog. „wirtschafthchen Gesetzen“ ohne Ausnahme, nicht um im engeren, exakt naturwissenschaftlichen Sinne „gesetzliche“, sondern um in Regeln ausgedrückte adäquate ursächliche Zusammenhänge, um eine hier nicht näher zu analysierende Anwendung der Kategorie der „objektiven Möglichkeit“45 Vgl. Einleitung, oben, S. 19 ff. handelt, tut diesem Satz nicht den mindesten Eintrag. Nur ist eben die Aufstellung solcher Regelmäßigkeiten nicht Ziel, sondern Mittel der Erkenntnis, und ob es Sinn hat, eine aus der Alltagserfahrung bekannte Regelmäßigkeit ursächlicher Verknüpfung als „Gesetz“ in eine Formel zu bringen, ist in jedem einzelnen Fall eine Zweckmäßigkeitsfrage. Für die exakte Naturwissenschaft sind die „Gesetze“ um so wichtiger und wertvoller, je allgemeingültiger sie sind, für die Erkenntnis der historischen Erscheinungen in ihrer konkreten Voraussetzung sind die allgemeinsten Gesetze, weil die inhaltsleersten, regelmäßig auch die wertlosesten. Denn je umfassender die Geltung eines Gattungsbegriffes – sein Umfang – ist, desto mehr führt er uns von der Fülle der Wirklichkeit ab, da er ja, um das Gemeinsame möglichst vieler Erscheinungen zu enthalten, möglichst abstrakt, also inhaltsarm sein muß. Die Erkenntnis des Generellen ist uns in den Kulturwissenschaften nie um ihrer selbst willen wertvoll.
Was sich uns als Resultat des bisher Gesagten ergibt, ist, daß eine „objektive“ Behandlung der Kulturvorgänge in dem Sinne, [188]daß als idealer Zweck der wissenschaftlichen Arbeit die Reduktion des Empirischen auf „Gesetze“ zu gelten hätte, sinnlos ist. Sie ist dies nicht etwa, wie oft behauptet worden ist,46 [188]Vgl. z. B. Stieve, Maximilian, S. 41, für den die Annahme notwendiger gesetzlicher Abläufe in der Geschichte „durch die Thatsache der menschlichen Willensthätigkeit ausgeschlossen“ ist. Vgl. auch Rümelin, Gustav, Ueber Gesetze der Geschichte [1878], in: ders., Reden und Aufsätze. Neue Folge. – Freiburg und Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) 1881, S. 118–146, bes. S. 119 f. deshalb[,] weil die Kulturvorgänge oder etwa die geistigen Vorgänge „objektiv“ weniger [A 55]gesetzlich abliefen, sondern weil 1) Erkenntnis von sozialen Gesetzen keine Erkenntnis des sozial Wirklichen ist, sondern nur eins von den verschiedenen Hilfsmitteln, die unser Denken zu diesem Behufe braucht, und weil 2) keine Erkenntnis von Kulturvorgängen anders denkbar ist, als auf der Grundlage der Bedeutung, welche die stets individuell geartete Wirklichkeit des Lebens in bestimmten einzelnen Beziehungen für uns hat. In welchem Sinn und in welchen Beziehungen dies der Fall ist, enthüllt uns aber kein Gesetz, denn das entscheidet sich nach den Wertideen, unter denen wir die „Kultur“ jeweils im einzelnen Falle betrachten. „Kultur“ ist ein vom Standpunkt des Menschen aus mit Sinn und Bedeutung bedachter endlicher Ausschnitt aus der sinnlosen Unendlichkeit des Weltgeschehens.47 Rickert, Kulturwissenschaft (wie oben, S. 10, Anm. 62), S. 17. Für Rickert existiert „Kultur“ insofern, als „sich aus der Gesammtwirklichkeit eine Anzahl von Dingen und Vorgängen heraushebt, die für uns eine besondere Bedeutung besitzen“. Sie ist es für den Menschen auch dann, wenn er einer konkreten Kultur als Todfeind sich entgegenstellt und „Rückkehr zur Natur“48 Vgl. Feuerbach, Ludwig, Kritik der Hegel’schen Philosophie, in: ders., Sämmtliche Werke, Band 2: Philosophische Kritiken und Grundsätze. – Leipzig: Otto Wigand 1846, S. 185–232, hier S. 231: „Die Rückkehr zur Natur ist allein die Quelle des Heils.“ verlangt. Denn auch zu dieser Stellungnahme kann er nur gelangen, indem er die konkrete Kultur auf seine Wertideen bezieht und „zu leicht“ befindet.49 Das biblische Buch Daniel 5,27: „Tekel, das ist: man hat dich in einer Waage gewogen und zu leicht gefunden.“ Dieser rein logisch-formale Tatbestand ist gemeint, wenn hier von der logisch notwendigen Verankerung aller historischen Individuen an „Wertideen“ gesprochen wird. Transzendentale Voraussetzung jeder Kulturwissenschaft ist nicht etwa, daß wir eine bestimmte oder überhaupt irgend eine „Kultur“ wertvoll finden, sondern daß wir [189]Kulturmenschen50 [189]Vgl. Rickert, Kulturwissenschaft (wie oben, S. 10, Anm. 62), S. 21, und Rickert, Grenzen, S. 468, 588, 620 f., 725. Vgl. auch Münsterberg, Psychologie, S. 463 f., 474, 479 f., 482. sind, begabt mit der Fähigkeit und dem Willen, bewußt zur Welt Stellung zu nehmen51 Für Rickert, Grenzen, S. 353 f., ist der „wirkliche Mensch“ ein „stellungnehmender Mensch“. Vgl. Münsterberg, Psychologie, S. 24 ff., 50, über das „stellungnehmende Ich“ und die „stellungnehmende Aktualität“. und ihr einen Sinn zu verleihen. Welches immer dieser Sinn sein mag, er wird dazu führen, daß wir im Leben bestimmte Erscheinungen des menschlichen Zusammenseins aus ihm heraus beurteilen, zu ihnen als bedeutsam (positiv oder negativ) Stellung nehmen. Welches immer der Inhalt dieser Stellungnahme sei, – diese Erscheinungen haben für uns Kulturbedeutung, auf dieser Bedeutung beruht allein ihr wissenschaftliches Interesse. Wenn also hier im Anschluß an den Sprachgebrauch moderner Logiker von der Bedingtheit der Kulturerkenntnis durch Wertideen gesprochen wird,52 Weber meint sehr wahrscheinlich Rickerts „Werthbeziehung“, wenngleich Rickert nicht von Wertideen spricht. Vgl. oben, S. 166 mit Anm. 71, und oben, S. 182. so ist das hoffentlich Mißverständnissen so grober Art, wie der Meinung, Kulturbedeutung solle nur wertvollen Erscheinungen zugesprochen werden, nicht ausgesetzt. Eine Kulturerscheinung ist die Prostitution so gut wie die Religion oder das Geld, alle drei deshalb und nur deshalb und nur soweit, als ihre Existenz und die Form, die sie historisch annehmen, unsere Kulturinteressen direkt oder indirekt berühren, als sie unseren [A 56]Erkenntnistrieb unter Gesichtspunkten erregen, die hergeleitet sind aus den Wertideen, welche das Stück Wirklichkeit, welches in jenen Begriffen gedacht wird, für uns bedeutsam machen.
Alle Erkenntnis der Kulturwirklichkeit ist, wie sich daraus ergibt, stets eine Erkenntnis unter spezifisch besonderten Gesichtspunkten.53 In Rickert, Kulturwissenschaft (wie oben, S. 10, Anm. 62), S. 84, und Rickert, Grenzen, S. 356, ist die Rede von „Werthgesichtspunkten“: „Wir werden genau feststellen, worin die blosse Betrachtung unter Werthgesichtspunkten oder das theoretische ,Beziehen‘ auf Werthe im Gegensatz zum Wollen und zum direkten Werthen besteht.“ Wenn wir von dem Historiker und Sozialforscher als elementare Voraussetzungen verlangen, daß er Wichtiges von Unwichtigem unterscheiden könne, und daß er für diese Unterscheidung die [190]erforderlichen „Gesichtspunkte“ habe,54 [190]Zum Beispiel haben für den Historiker Gervinus „Ideen“ die Funktion solcher Gesichtspunkte: Der „Geschichtschreiber“ gruppiert „aus der Fülle der Thatsachen das, was jene Ideen und ihren Verlauf anschaulich zu machen dient, was aus diesem Gesichtspuncte als charakteristisch, als wichtig erscheint“. Vgl. Gervinus, Historik, S. 385. so heißt das lediglich, daß er verstehen müsse, die Vorgänge der Wirklichkeit, – bewußt oder unbewußt – auf universelle „Kulturwerte“55 Tatsächlich kann für Rickert, Kulturwissenschaft (wie oben, S. 10, Anm. 62), S. 62, vom „universalhistorischen Standpunkt“ aus von „empirisch allgemeinen und überall anerkannten Werthen doch nicht mehr die Rede sein“. zu beziehen und danach die Zusammenhänge herauszuheben, welche für uns bedeutsam sind. Wenn immer wieder die Meinung auftritt, jene Gesichtspunkte könnten dem „Stoff selbst entnommen“ werden, so entspringt das der naiven Selbsttäuschung des Fachgelehrten,56 Für Gervinus, Historik, S. 385, „trägt“ der Geschichtschreiber die „Idee“ „nicht […] in seinen Stoff hinein, sondern indem er sich unbefangen in die Natur seines Gegenstandes verliert, ihn mit rein historischem Sinne betrachtet, geht sie aus diesem selbst hervor und trägt sich in seinen betrachtenden Geist über“. Für Gottl, Herrschaft, S. 136, „entspringen“ die Gesichtspunkte „aus dem Stoffe selber“. der nicht beachtet, daß er von vornherein kraft der Wertideen, mit denen er unbewußt an den Stoff herangegangen ist, aus einer absoluten Unendlichkeit einen winzigen Bestandteil als das herausgehoben hat, auf dessen Betrachtung es ihm allein ankommt.57 Tatsächlich werden auch für Rickert die Kulturwerte jenem Stoff selbst entnommen. Vgl. Rickert, Grenzen, S. 309 f.: „Die Objekte, mit denen es die Geschichtswissenschaften zu thun haben, sind […] unter den Begriff der Kultur zu bringen, weil der Inhalt der Werthe, welche die historische Begriffsbildung leiten und zugleich bestimmen, was Objekt der Geschichte wird, durchweg dem Kulturleben entnommen ist.“ Vgl. oben, S. 166 mit Anm. 71. In dieser immer und überall bewußt oder unbewußt erfolgenden Auswahl einzelner spezieller „Seiten“ des Geschehens waltet auch dasjenige Element kulturwissenschaftlicher Arbeit, welches jener oft gehörten Behauptung zugrunde liegt, daß das „Persönliche“ eines wissenschaftlichen Werkes das eigentlich Wertvolle an ihm sei, daß sich in jedem Werk, solle es anders zu existieren wert sein, „eine Persönlichkeit“ aussprechen müsse.58 So meint z. B. Meyer, Geschichte I, S. 19, daß sich in historischen Werken „die Zeit des Historikers und seine eigene Individualität“ widerspiegeln müsse, sonst wären sie nicht mehr als eine „trockne Aneinanderreihung von Begebenheiten“. Gewiß: ohne Wertideen des Forschers gäbe es kein Prinzip der Stoffauswahl und keine sinnvolle Erkenntnis des individuell Wirklichen, und wie ohne den [191]Glauben59 [191]Vgl. oben, S. 150; unten, S. 232 mit Anm. 80. des Forschers an die Bedeutung irgendwelcher Kulturinhalte jede Arbeit an der Erkenntnis der individuellen Wirklichkeit schlechthin sinnlos ist, so wird die Richtung seines persönlichen Glaubens, die Farbenbrechung der Werte im Spiegel seiner Seele,60 Die Formulierung „Farbenbrechung der Seele“ findet sich in Meyer, Conrad Ferdinand, Angela Borgia. Novelle, 2. Aufl. – Leipzig: H. Haeffel 1891, S. 101. seiner Arbeit die Richtung weisen. Und die Werte, auf welche der wissenschaftliche Genius die Objekte seiner Forschung bezieht, werden die „Auffassung“ einer ganzen Epoche zu bestimmen, d. h. entscheidend zu sein vermögen nicht nur für das, was als „wertvoll“, sondern auch für das, was als bedeutsam oder bedeutungslos, als „wichtig“ und „unwichtig“ an den Erscheinungen gilt.
Die kulturwissenschaftliche Erkenntnis in unserem Sinn ist also insofern an „subjektive“ Voraussetzungen gebunden, als sie sich [A 57]nur um diejenigen Bestandteile der Wirklichkeit kümmert, welche irgend eine – noch so indirekte – Beziehung zu Vorgängen haben, denen wir Kulturbedeutung beilegen. Sie ist trotzdem natürlich rein kausale Erkenntnis genau in dem gleichen Sinn wie die Erkenntnis bedeutsamer individueller Naturvorgänge, welche qualitativen Charakter haben.61 Für Julius Robert Mayer haben „Auslösungen“ wie z. B. ein Funke bei einer Explosion einen qualitativen Charakter, der nicht quantifizierbar ist und folglich auch nicht in eine Kausalgleichung eingeht. Vgl. Einleitung, oben, S. 18 f. Auf Auslösungen kommt Weber in seiner Kritik an Knies kurz nach seinem Hinweis auf den Einbruch des Dollart als einem individuellen Naturvorgang zu sprechen. Vgl. Weber, Roscher und Knies 2, unten, S. 260 mit Anm. 72, und S. 265 mit Anm. 90. Weber, Soziologische Grundbegriffe, MWG I/23, S. 153, wird dann formulieren: „Der Einbruch des Dollart Anfang des 12. Jahrhunderts hat (vielleicht!) ,historische‘ Bedeutung als Auslösung gewisser Umsiedelungsvorgänge von beträchtlicher geschichtlicher Tragweite.“ Neben die mancherlei Verirrungen, welche das Hinübergreifen formal-juristischen Denkens in die Sphäre der Kulturwissenschaften gezeitigt hat, ist neuerdings u.a. der Versuch getreten, die „materialistische Geschichtsauffassung“ durch eine Reihe geistreicher Trugschlüsse prinzipiell zu „widerlegen“,62 Möglicherweise bezieht sich Weber auf Stammler, Wirtschaft1. indem ausgeführt wurde, daß, da alles Wirtschaftsleben sich in rechtlich oder konventionell geregelten Formen abspielen müsse, alle ökonomische „Entwicklung“ die Form von Bestrebungen zur Schaffung neuer Rechtsformen annehmen müsse, also nur aus sittlichen Maximen verständlich und aus diesem Grunde von jeder [192]„natürlichen“ Entwicklung dem Wesen nach verschieden sei. Die Erkenntnis der wirtschaftlichen Entwicklung sei daher „teleologischen“ Charakters. Ohne hier die Bedeutung des vieldeutigeren Begriffs der „Entwicklung“63 [192]Rickert, Grenzen, S. 436 ff., bes. S. 472 f., unterscheidet sieben Begriffe von Entwicklung, die von der bloßen Veränderung bis hin zur Teleologie der Geschichtsphilosophie reichen. für die Sozialwissenschaft oder auch den logisch nicht minder vieldeutigen Begriff des „Teleologischen“64 Vgl. Rickert, Kulturwissenschaft (wie oben, S. 10, Anm. 62), S. 49 f., 53 ff.; Rickert, Grenzen, S. 307 f., 371 ff., 436 ff. Für Rickert, ebd., S. 50, ist „das methodische Prinzip der Auswahl in der Geschichte von einer Werth- oder Zwecksetzung abhängig“, daher ist die Begriffsbildung eine „teleologische“. erörtern zu wollen, sei demgegenüber hier nur festgestellt, daß sie jedenfalls nicht in dem Sinn „teleologisch“ zu sein genötigt ist, wie diese Ansicht voraussetzt. Bei völliger formaler Identität der geltenden Rechtsnormen kann die Kulturbedeutung der normierten Rechtsverhältnisse und damit auch der Normen selbst sich grundstürzend ändern. Ja, will man sich denn einmal in Zukunftsphantasien spintisierend vertiefen, so könnte jemand sich z. B. eine „Vergesellschaftung der Produktionsmittel“65 Vgl. z. B. Engels, Friedrich, Internationales aus dem Volksstaat (1871–75). – Berlin: Verlag der Expedition des „Vorwärts“ Berliner Volksblatt 1894, S. 6. theoretisch als vollzogen denken, ohne daß irgend eine auf diesen Erfolg bewußt abzielende „Bestrebung“ entstanden wäre und ohne daß irgend ein Paragraph unserer Gesetzgebung verschwände oder neu hinzuträte: das statistische Vorkommen der einzelnen rechtlich normierten Beziehungen freilich wäre von Grund aus geändert, bei vielen auf Null gesunken, ein großer Teil der Rechtsnormen praktisch bedeutungslos, ihre ganze Kulturbedeutung bis zur Unkenntlichkeit verändert. Erörterungen de lege ferenda66 Lat.: von einem zu erlassenden Gesetz aus, vom künftigen Recht. konnte daher die „materialistische“ Geschichtstheorie mit Recht ausscheiden, denn ihr zentraler Gesichtspunkt war gerade der unvermeidliche Bedeutungswandel der Rechtsinstitutionen. Wem die schlichte Arbeit kausalen Verständnisses der historischen Wirklichkeit subaltern erscheint, der mag sie meiden, – sie durch [A 58]irgend eine „Teleologie“ zu ersetzen ist unmöglich. „Zweck“ ist für unsere Betrachtung die Vorstellung eines Erfolges, welche Ursache einer Handlung wird; wie jede Ursache, welche zu einem bedeutungsvollen Erfolg [193]beiträgt oder beitragen kann, so berücksichtigen wir auch diese. Und ihre spezifische Bedeutung beruht nur darauf, daß wir menschliches Handeln nicht nur konstatieren, sondern verstehen können und wollen. –
Ohne alle Frage sind nun jene Wertideen „subjektiv“. Zwischen dem „historischen“ Interesse an einer Familienchronik und demjenigen an der Entwicklung der denkbar größten Kulturerscheinungen, welche einer Nation oder der Menschheit in langen Epochen gemeinsam waren und sind, besteht eine unendliche Stufenleiter der „Bedeutungen“, deren Staffeln für jeden einzelnen von uns eine andere Reihenfolge haben werden. Und ebenso sind sie natürlich historisch wandelbar mit dem Charakter der Kultur und der die Menschen beherrschenden Gedanken selbst. Daraus folgt nun aber selbstverständlich nicht, daß auch die kulturwissenschaftliche Forschung nur Ergebnisse haben könne, die „subjektiv“ in dem Sinne seien, daß sie für den einen gelten und für den andern nicht. Was wechselt[,] ist vielmehr der Grad, in dem sie den einen interessieren und den andern nicht. Mit anderen Worten: was Gegenstand der Untersuchung wird, und wie weit diese Untersuchung sich in die Unendlichkeit der Kausalzusammenhänge erstreckt, das bestimmen die den Forscher und seine Zeit beherrschenden Wertideen; – im Wie?, inr[193]A: In der Methode der Forschung[,] ist der leitende „Gesichtspunkt“ zwar – wie wir noch sehen werden67 [193]Unten, S. 203–204. – für die Bildung der begrifflichen Hilfsmittel, die er verwendet, bestimmend, in der Art ihrer Verwendung aber ist der Forscher selbstverständlich hier wie überall an die Normen unseres Denkens gebunden. Denn wissenschaftliche Wahrheit ist nur, was für alle gelten will, die Wahrheit wollen.
Aber allerdings folgt daraus eins: Die Sinnlosigkeit des selbst die Historiker unseres Faches gelegentlich beherrschenden Gedankens, daß es das, wenn auch noch so ferne, Ziel der Kulturwissenschaften sein könne, ein geschlossenes System von Begriffen zu bilden, in dem die Wirklichkeit in einer in irgend einem Sinne endgültigen Gliederung zusammengefaßt und aus dem heraus sie dann wieder deduziert werden könnte.68 Vgl. oben, S. 177 mit Anm. 10. Endlos wälzt sich der Strom des [194]unermeßlichen Geschehens der Ewigkeit entgegen.69 [194]Für Dilthey, Einleitung, S. 45, fließt der „Strom des Geschehens“ in der geschichtlich-gesellschaftlichen Wirklichkeit „unaufhaltsam voran, während die einzelnen Individuen, aus denen er besteht, auf dem Schauplatz des Lebens erscheinen und von ihm wieder abtreten“. Immer neu und anders gefärbt bilden sich die Kulturprobleme, welche die [A 59]Menschen bewegen, flüssig bleibt damit der Umkreis dessen, was aus jenem stets gleich unendlichen Strome des Individuellen Sinn und Bedeutung für uns erhält, „historisches Individuum“70 Vgl. oben, S. 185 mit Anm. 40. wird. Es wechseln die Gedankenzusammenhänge, unter denen es betrachtet und wissenschaftlich erfaßt wird. Die Ausgangspunkte der Kulturwissenschaften bleiben damit wandelbar in die grenzenlose Zukunft hinein, solange nicht chinesische Erstarrung71 In einer Rezension von Alexis de Tocquevilles Werk über die Demokratie in Amerika sprach Mill von „Chinese stationariness“. Vgl. Mill, John Stuart, Μ. de Tocqueville on Democracy in America, in: ders., Dissertations and Discussions. Political, Philosophical, and Historical. Reprinted chiefly from the Edinburgh and Westminster Review, Vol. 2. – London: John W. Parker and Son 1859, S. 1–83, hier S. 56. In Weber, Die protestantische Ethik und der „Geist“ des Protestantismus. II. Die Berufsidee des asketischen Protestantismus, MWG I/9, S. 222–425, hier S. 423, findet sich die Formulierung „,chinesische‘ Versteinerung“. des Geisteslebens die Menschheit entwöhnt, neue Fragen an das immer gleich unerschöpfliche Leben zu stellen. Ein System der Kulturwissenschaften auch nur in dem Sinne einer definitiven, objektiv gültigen, systematisierenden Fixierung der Fragen und Gebiete, von denen sie zu handeln berufen sein sollen, wäre ein Unsinn in sich: stets kann bei einem solchen Versuch nur eine Aneinanderreihung von mehreren, spezifisch besonderten, untereinander vielfach heterogenen und disparaten Gesichtspunkten herauskommen, unter denen die Wirklichkeit für uns jeweils „Kultur“, d. h. in ihrer Eigenart bedeutungsvoll war oder ist. –
Nach diesen langwierigen Auseinandersetzungen können wir uns nun endlich der Frage zuwenden, die uns bei der Betrachtung der „Objektivität“ der Kulturerkenntnis methodisch interessiert: welches ist die logische Funktion und Struktur der Begriffe, mit der unsere, wie jede, Wissenschaft arbeitet, oder spezieller mit Rücksicht auf das entscheidende Problem gewendet: welches ist die Bedeutung der Theorie und der theoretischen Begriffsbildung für die Erkenntnis der Kulturwirklichkeit?
[195]Die Nationalökonomie war, – wir sahen es schon72 [195]Oben, S. 145. – ursprünglich wenigstens dem Schwerpunkt ihrer Erörterungen nach[,] „Technik“, d. h. sie betrachtete die Erscheinungen der Wirklichkeit von einem, wenigstens scheinbar, eindeutigen, feststehenden praktischen Wertgesichtspunkt aus: dem der Vermehrung des „Reichtums“ der Staatsangehörigen.73 Das kommt zum Ausdruck im Titel von Smith, Inquiry (wie oben, S. 88, Anm. 8). Sie war andererseits von Anfang an nicht nur „Technik“, denn sie wurde eingegliedert in die mächtige Einheit der naturrechtlichen und rationalistischen Weltanschauung des achtzehnten Jahrhunderts. Aber die Eigenart jener Weltanschauung mit ihrem optimistischen Glauben an die theoretische und praktische Rationalisierbarkeit des Wirklichen wirkte wesentlich insofern, als sie hinderte, daß der problematische Charakter jenes als selbstverständlich vorausgesetzten Gesichtspunktes entdeckt wurde. Wie die rationale Betrachtung der sozialen Wirklichkeit im engen Zusammenhalt mit der modernen Entwicklung [A 60]der Naturwissenschaft entstanden war, so blieb sie in der ganzen Art ihrer Betrachtung ihr verwandt. In den naturwissenschaftlichen Disziplinen nun war der praktische Wertgesichtspunkt des unmittelbar technisch Nützlichen von Anfang an mit der als Erbteil der Antike überkommenen und weiter entwickelten Hoffnung eng verbunden, auf dem Wege der generalisierenden Abstraktion74 Vgl. Einleitung, oben, S. 16 f. und der Analyse des Empirischen auf gesetzliche Zusammenhänge hin zu einer rein „objektiven“, d. h. hier: von allen Werten losgelösten, und zugleich durchaus rationalen, d. h. von allen individuellen „Zufälligkeiten“ befreiten monistischen Erkenntnis der gesamten Wirklichkeit in Gestalt eines Begriffssystems von metaphysischer Geltung und von mathematischer Form zu gelangen. Die an Wertgesichtspunkte geketteten naturwissenschaftlichen Disziplinen, wie die klinische Medizin und noch mehr die gewöhnlich sogenannte „Technologie“, wurden rein praktische „Kunstlehren“. Die Werte, denen sie zu dienen hatten: Gesundheit des Patienten, technische Vervollkommnung eines konkreten Produktionsprozesses etc.[,] standen für jede von ihnen jeweils fest. Die Mittel, die sie anwendeten, waren und konnten nur sein die Verwertung der durch die [196]theoretischen Disziplinen gefundenen Gesetzesbegriffe. Jeder prinzipielle Fortschritt in der Bildung dieser war oder konnte doch sein auch ein Fortschritt der praktischen Disziplin. Bei feststehendem Zweck war ja die fortschreitende Reduktion der einzelnen praktischen Fragen (eines Krankheitsfalles, eines technischen Problems) als Spezialfall auf generell geltende Gesetze, also die Erweiterung des theoretischen Erkennens, unmittelbar mit der Ausweitung der technisch-praktischen Möglichkeiten verknüpft und identisch. Als dann die moderne Biologie auch diejenigen Bestandteile der Wirklichkeit, die uns historisch, d. h. in der Art ihres So-und-nicht-anders-geworden-seins interessieren, unter den Begriff eines allgemeingültigen Entwicklungsprinzips gebracht hatte,75 [196]Vgl. Darwin, Entstehung (wie oben, S. 163, Anm. 64). Vgl. Rickert, Grenzen, S. 281 ff., zum „historischen Charakter der Biologie“. welches wenigstens dem Anschein nach – aber freilich nicht in Wahrheit – alles an jenen Objekten Wesenthche in ein Schema generell geltender Gesetze einzuordnen gestattete, da schien die Götterdämmerung76 Bei Nietzsche ist von einer „Götterdämmerung der alten Moral“ die Rede. Vgl. Nietzsche, Friedrich, Der Fall Wagner. Ein Musikanten-Problem, 2. Aufl. – Leipzig: C. G. Naumann 1892, S. 11. aller Wertgesichtspunkte in allen Wissenschaften heraufzuziehen. Denn da ja doch auch das sogenannte historische Geschehen ein Teil der gesamten Wirklichkeit war, und da das Kausalprinzip,77 Vgl. Weber, Roscher und Knies 1, oben, S. 52 f. mit Anm. 59. die Voraussetzung aller wissenschaftlichen Arbeit, die Auflösung alles Geschehens in generell geltende „Gesetze“ zu fordern schien, da endlich der ungeheure Erfolg der Naturwissenschaften, die mit diesem [A 61]Gedanken ernst gemacht hatten, zutage lag, so schien ein anderer Sinn des wissenschaftlichen Arbeitens als die Auffindung der Gesetze des Geschehens überhaupt nicht vorstellbar. Nur das „Gesetzmäßige“ konnte das wissenschaftlich Wesentliche an den Erscheinungen sein, „individuelle“ Vorgänge nur als „Typen“, d. h. hier: als illustrative Repräsentanten der Gesetze[,] in Betracht kommen; ein Interesse an ihnen um ihrer selbst willen schien „kein wissenschaftliches“ Interesse.
Die mächtigen Rückwirkungen dieser glaubensfrohen Stimmung des naturalistischen Monismus auf die ökonomischen Disziplinen hier zu verfolgen, ist unmöglich. Als die sozialistische Kritik [197]und die Arbeit der Historiker die ursprünglichen Wertgesichtspunkte in Probleme zu verwandeln begannen, hielt die mächtige Entwicklung der biologischen Forschung auf der einen Seite, der Einfluß des Hegel’schen Panlogismus78 [197]Vgl. Weber, Roscher und Knies 1, oben, S. 70 mit Anm. 24. auf der anderen Seite die Nationalökonomie davon ab, das Verhältnis von Begriff und Wirklichkeit in vollem Umfang deutlich zu erkennen. Das Resultat, soweit es uns hier interessiert, ist, daß trotz des gewaltigen Dammes, welchen die deutsche idealistische Philosophie seit Fichte, die Leistungen der deutschen historischen Rechtsschule79 Vgl. ebd., S. 52 f. und die Arbeit der historischen Schule der deutschen Nationalökonomie,80 Vgl. ebd., S. 42. dem Eindringen naturalistischer Dogmen entgegenbaute, dennoch und zum Teil infolge dieser Arbeit an entscheidenden Stellen die Gesichtspunkte des Naturalismus noch immer unüberwunden sind. Dahin gehört insbesondere das noch immer problematisch gebliebene Verhältnis zwischen „theoretischer“ und „historischer“ Arbeit in unserem Fache.81 Vgl. oben, S. 161.
In unvermittelter und anscheinend unüberbrückbarer Schroffheit steht noch heute die „abstrakt“-theoretische Methode der empirisch-historischen Forschung gegenüber.82 Mit „abstrakt“-theoretischer Methode ist die Tradition der klassischen Nationalökonomie gemeint, in der Carl Menger stand. Wie David Ricardo löst Menger die doppelte Einheit von Theorie und Empirie (Geschichte) sowie Theorie und Praxis (Politik) auf. Menger, Untersuchungen, S. 8 f., verweist die Praxis an die „praktischen Wissenschaften von der Volkswirthschaft“, d. h. an die „Volkswirthschaftspolitik“ und „Finanzwissenschaft“, die er als „Kunstlehren“ bezeichnet (ebd., S. 7), während er die Empirie an die „historischen Wissenschaften“ der Volkswirtschaft, d. h. an die „Geschichte“ und „Statistik“ (ebd., S. 8 f.), sowie an die „realistisch-empirische Richtung“ der theoretischen Nationalökonomie delegiert (ebd., S. 34), deren andere, „exacte“ Richtung dafür „von der vollen empirischen Wirklichkeit abstrahirt“, um „exakte Gesetze“ zu formulieren (ebd., S. 38, 44). Dazu hat sie die „Phänomene auf ihre einfachsten Elemente zurück zu führen und den Process zu erforschen, durch welchen die ersteren sich aus den letzteren gesetzmässig aufbauen“ (ebd., S. 52). Menger bezeichnete seine Methode nicht nur als „exakt“, sondern auch als „analytisch-synthetisch“ und „analytisch-compositiv“. Vgl. Einleitung, oben, S. 15 f. Sie erkennt durchaus richtig die methodische Unmöglichkeit, durch Formulierung von „Gesetzen“ die geschichtliche Erkenntnis der Wirklichkeit zu ersetzen oder umgekehrt durch bloßes Aneinanderreihen historischer Beobachtungen zu „Gesetzen“ im strengen Sinne zu gelan[198]gen.83 [198]Vgl. Menger, Untersuchungen, S. 13, 28 f. Für Menger sind die „historische“ und die „theoretische Nationalökonomie“ gleichberechtigt. Jene erforscht das „individuelle Wesen und den individuellen Zusammenhang“ volkswirtschaftlicher Erscheinungen, diese das „generelle Wesen und den generellen Zusammenhang (die Gesetze)“ solcher Erscheinungen (ebd., S. 8 f.). Menger sieht das generelle Wesen in den „Erscheinungsformen“, die er „Typen“ nennt (z. B. Preis, Angebot), den generellen Zusammenhang als „typische Relationen“ von „Typen“ (z. B. das Sinken des Preises durch Vermehrung des Angebots) (ebd., S. 4 f.). Die „empirisch-realistische“ Richtung der theoretischen Nationalökonomie gelangt nur zu „Realtypen“, d. h. zu „Grundformen der realen Erscheinungen“ mit einem „Spielraum für Besonderheiten“, und zu „empirische[n] Gesetze[n]“, d. h. zu „theoretische[n] Erkenntnisse[n]“, welche die „factischen (indess keineswegs verbürgt ausnahmslosen) Regelmässigkeiten in der Aufeinanderfolge und in der Coexistenz der realen Phänomene“ darstellen (ebd., S. 34, 36). Um nun solche zu gewinnen, – denn daß dies die Wissenschaft als höchstes Ziel zu erstreben habe, steht ihr fest –,84 Vgl. ebd., S. 38. geht sie von der Tatsache aus, daß wir die Zusammenhänge menschlichen Handelns beständig selbst in ihrer Realität unmittelbar erleben, daher – so meint sie – ihren Ablauf mit axiomatischer Evidenz direkt verständlich85 Menger, ebd., S. 14, unterscheidet „Erkenntniss“ und „Verständniss“: „Wir haben eine Erscheinung erkannt, wenn das geistige Abbild derselben zu unserem Bewusstsein gelangt ist, wir verstehen dagegen dieselbe, wenn wir den Grund ihrer Existenz und ihrer eigenthümlichen Beschaffenheit (den Grund ihres Seins und ihres So-Seins) erkannt haben.“ In diesem Sinne „verstehen“ wir „eine concrete Erscheinung in specifisch historischer Weise (durch ihre Geschichte), indem wir ihren individuellen Werdeprocess erforschen“ (ebd., S. 14); wir „verstehen“ sie „in theoretischer Weise“, indem wir sie „als einen speciellen Fall einer gewissen Regelmässigkeit (Gesetzmässigkeit) in der Aufeinanderfolge, oder in der Coexistenz der Erscheinungen erkennen“ (ebd., S. 17). machen und so in seinen „Gesetzen“ erschließen können. Die einzig exakte Form der Erkenntnis, die Formu[A 62]lierung unmittelbar anschaulich evidenter Gesetze,86 Für Menger, ebd., S. 40 ff., besteht die einzig exakte Form der Erkenntnis in der Formulierung exakter Typen und exakter Gesetze. sei abers[198]A: aber, zugleich die einzige, welche den Schluß auf die nicht unmittelbar beobachteten Vorgänge zulasse,87 Für Menger, ebd., S. 50, ist „eine über die unmittelbare Erfahrung hinausreichende Erkenntniss […] sowohl durch die Ergebnisse der exacten, als auch durch jene der realistischen Richtung der theoretischen Forschung“ möglich. daher sei mindestens für die fundamentalen Phänomene des wirtschaftlichen Lebens88 Für Menger, ebd., S. 45, sind die „ursprünglichsten Factoren der menschlichen Wirthschaft“ einerseits die „den Menschen unmittelbar von der Natur dargebotenen Güter“, andererseits die „Bedürfnisse“ der Menschen und ihr „Streben nach möglichst [199]vollständiger Befriedigung der Bedürfnisse (nach möglichst vollständiger Deckung des Güterbedarfes)“. die Aufstel[199]lung eines Systems von abstrakten und – infolgedessen – rein formalen Lehrsätzen nach Analogie derjenigen der exakten Naturwissenschaften89 Vgl. ebd., S. 44. das einzige Mittel geistiger Beherrschung90 Vgl. ebd., S. 33. der gesellschaftlichen Mannigfaltigkeit. Trotz der prinzipiellen methodischen Scheidung gesetzlicher und historischer Erkenntnis, welche der Schöpfer der Theorie als Erster und Einziger vollzogen hatte,91 Vgl. Einleitung, oben, S. 8. wird nun aber für die Lehrsätze der abstrakten Theorie von ihm empirische Geltung im Sinne der Deduzierbarkeit der Wirklichkeit aus den „Gesetzen“92 Vgl. oben, S. 177 mit Anm. 10. in Anspruch genommen. Zwar nicht im Sinne der empirischen Geltung der abstrakten ökonomischen Lehrsätze für sich allein, sondern in der Art, daß, wenn man entsprechende „exakte“ Theorien von allen übrigen in Betracht kommenden Faktoren gebildet haben werde, diese sämtlichen abstrakten Theorien zusammen dann die wahre Realität der Dinge – d. h.: das, was von der Wirklichkeit wissenswert sei – in sich enthalten müßten.93 Für Menger, Untersuchungen, S. 49 ff., sind auch die Erkenntnisse der realistisch-empirischen Richtung der theoretischen Nationalökonomie sowie die der historischen und praktischen Wissenschaften von der Volkswirtschaft wissenswert. Die exakte ökonomische Theorie stelle die Wirkung eines psychischen Motivs fest,94 Gemeint ist das „Streben nach möglichst vollständiger Befriedigung der Bedürfnisse (nach möglichst vollständiger Deckung des Güterbedarfes)“: vgl. ebd., S. 45. In der Literatur ist diesbezüglich von „Eigennutz“ die Rede. Vgl. z. B. Wundt, Logik II1 (wie oben, S. 16, Anm. 13), S. 588: „Dieses Motiv ist der Eigennutz.“ andere Theorien hätten die Aufgabe, alle übrigen Motive in ähnlicher Art in Lehrsätzen von hypothetischer Geltung zu entwickeln. Für das Ergebnis der theoretischen Arbeit, die abstrakten Preisbildungs-, Zins-, Renten- etc. -Theorien, wurde demgemäß hie und da phantastischerweise in Anspruch genommen: sie könnten, nach – angeblicher – Analogie physikalischer Lehrsätze, dazu verwendet werden, aus gegebenen realen Prämissen quantitativ bestimmte Resultate – also Gesetze im strengsten Sinne – mit Gültigkeit für die Wirklichkeit des Lebens zut[199]Fehlt in A; zu sinngemäß ergänzt. deduzieren, da die Wirtschaft des Menschen bei gegebenem [200]Zweck in bezug auf die Mittel eindeutig „determiniert“ sei.95 [200]Vgl. Menger, Untersuchungen, S. 45, 262 ff. Für Menger sind des Menschen „unmittelbarer Bedarf“ sowie die ihm „unmittelbar verfügbaren Güter“ der menschlichen „Willkür“ entrückt: „der Ausgangspunkt und der Zielpunkt jeder concreten menschlichen Wirthschaft ist somit in letzter Linie durch die jeweilige ökonomische Sachlage streng determinirt“ (ebd., S. 263). Es wurde nicht beachtet, daß, um dies Resultat in irgend einem noch so einfachen Falle erzielen zu können, die Gesamtheit der jeweiligen historischen Wirklichkeit einschließlich aller ihrer kausalen Zusammenhänge als „gegeben“ gesetzt und als bekannt vorausgesetzt werden müßte und daß, wenn dem endlichen Geist diese Kenntnis zugänglich würde, irgend ein Erkenntniswert einer abstrakten Theorie nicht vorstellbar wäre. Das naturalistische Vorurteil, daßu[200]A: das in jenen Begriffen etwas den exakten Naturwissenschaften Verwandtes geschaffen werden solle, hatte [A 63]eben dahin geführt, daß man den Sinn dieser theoretischen Gedankengebilde falsch verstand. Man glaubte, es handele sich um die psychologische Isolierung eines spezifischen „Triebes“, des Erwerbstriebes, im Menschen, oder aber um die isolierte Beobachtung einer spezifischen Maxime menschlichen Handelns, des sogenannten wirtschaftlichen Prinzipes.96 Menger, ebd., S. 41 f., betreibt Analyse im Sinne einer „vollständigen Isolirung“ der „einfachsten Elemente“ von „allen sonstigen Einflüssen“, ohne Rücksicht, ob sie „in der Wirklichkeit als selbständige Erscheinungen vorhanden“, oder „ob sie in ihrer vollen Reinheit überhaupt selbständig darstellbar sind“. Wie „absolut-reiner Sauerstoff, eben solcher Alkohol, eben solches Gold“ durch Analyse abstrahiert wird, wird der Mensch in seinem Streben nach Bedürfnisbefriedigung „überempirisch“ als „ein absolut nur wirthschaftliche Zwecke verfolgender Mensch“ dargestellt. Zu dieser isolierenden Abstraktion vgl. Einleitung, oben, S. 16. Die abstrakte Theorie meinte, sich auf psychologische Axiome stützen zu können und die Folge war, daß die Historiker nach einer empirischen Psychologie riefen, um die Nichtgeltung jener Axiome beweisen und den Verlauf der wirtschaftlichen Vorgänge psychologisch ableiten zu können.97 Schmoller, Methodologie, S. 979, hat in seiner Kritik an Menger festgestellt, daß der „Erwerbstrieb“, wenn er „ein letztes Element im streng wissenschaftlich brauchbaren Sinne“ wäre, von einer „wissenschaftlichen Psychologie“ klar „abgegrenzt gegen andere parallele Seelenkräfte“ nachgewiesen worden wäre. Davon sei aber keine Rede und „eben deshalb haben alle tieferen wissenschaftlichen Anläufe seit 50 Jahren, der Sozialismus so gut wie die historische Schule und die Dogmatiker Rau und Hermann, nach einer verbesserten psychologischen Grundlage der Nationalökonomie gesucht“. Wir wollen nun an die[201]ser Stelle den Glauben an die Bedeutung einer – erst zu schaffenden – systematischen Wissenschaft der „Sozialpsychologie“ als künftiger Grundlage der Kulturwissenschaften, speziell der Sozialökonomik, nicht eingehend kritisieren. Gerade die bisher vorliegenden, zum Teil glänzenden Ansätze psychologischer Interpretation ökonomischer Erscheinungen zeigen jedenfalls, daß nicht von der Analyse psychologischer Qualitäten des Menschen zur Analyse der gesellschaftlichen Institutionen fortgeschritten wird, sondern gerade umgekehrt die Aufhellung der psychologischen Voraussetzungen und Wirkungen der Institutionen die genaue Bekanntschaft mit diesen letzteren und die wissenschaftliche Analyse ihrer Zusammenhänge voraussetzt. Die psychologische Analyse bedeutet alsdann lediglich eine im konkreten Fall höchst wertvolle Vertiefung der Erkenntnis ihrer historischen Kulturbedingtheit und Kulturbedeutung. Das, was uns an dem psychischen Verhalten des Menschen in seinen sozialen Beziehungen interessiert, ist eben in jedem Falle je nach der spezifischen Kulturbedeutung der Beziehung, um die es sich handelt, spezifisch besondert. Es handelt sich dabei um untereinander höchst heterogene und höchst konkret komponierte psychische Motive und Einflüsse. Die sozial-psychologische Forschung bedeutet eine Durchmusterung verschiedener einzelner, untereinander vielfach disparater Gattungen von Kulturelementen auf ihre Deutungsfähigkeit für unser nacherlebendes Verständnis hin. Wir werden durch sie, von der Kenntnis der einzelnen Institutionen ausgehend, deren Kulturbedingtheit und Kulturbedeutung in steigendem Maße geistig verstehen lernen, nicht aber die Institutionen aus psychologischen Gesetzen deduzieren oder aus psychologischen Elementarerscheinungen erklären wollen.
So ist denn auch die weitschichtige Polemik, welche sich um die Frage der psychologischen Berechtigung der abstrakt theore[A 64]tischen Aufstellungen, um die Tragweite des „Erwerbstriebes“ und des „wirtschaftlichen Prinzips“ etc. gedreht hat, wenig fruchtbar gewesen. –
Es handelt sich bei den Aufstellungen der abstrakten Theorie nur scheinbar um „Deduktionen“ aus psychologischen Grundmotiven, in Wahrheit vielmehr um einen Spezialfall einer Form der Begriffsbildung, welche den Wissenschaften von der menschlichen Kultur eigentümlich und in gewissem Umfange unentbehrlich ist. Es lohnt sich, sie an dieser Stelle etwas eingehender zu charakteri[202]sieren, da wir dadurch der prinzipiellen Frage nach der Bedeutung der Theorie für die sozialwissenschaftliche Erkenntnis näher kommen. Dabei lassen wir es ein für allemal unerörtert, ob die theoretischen Gebilde, welche wir als Beispiele heranziehen, oder auf die wir anspielen, so wie sie sind, dem Zwecke entsprechen, dem sie dienen wollen, ob sie also sachlich zweckmäßig gebildet sind. Die Frage, wie weit z. B. die heutige „abstrakte Theorie“ noch ausgesponnen werden soll, ist schließlich auch eine Frage der Ökonomie der wissenschaftlichen Arbeit,98 [202]Möglicherweise Anspielung auf die „Denkökonomie“. Vgl. Mach, Ernst, Die ökonomische Natur der physikalischen Forschung. Vortrag, gehalten in der feierlichen Sitzung der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zu Wien am 25. Mai 1882, in: ders., Populärwissenschaftliche Vorlesungen. – Leipzig: Barth 1896, S. 203–230. deren doch auch andere Probleme harren. Auch die „Grenznutztheorie“ untersteht dem „Gesetz des Grenznutzens“.99 Inspiriert von Hermann Heinrich Gossen, William Stanley Jevons und Carl Menger, formulierte Friedrich von Wieser 1884 dieses Gesetz. Bei postulierter Knappheit und der daraus folgenden Notwendigkeit wirtschaftlichen Handelns ist der Grenznutzen der geringste Nutzen, den ein einzelnes Gut noch haben darf, um verwendet zu werden. Der Grenznutzen steigt mit dem Bedarf und sinkt mit dem Vorrat. Ist der Bedarf gestillt oder der Vorrat groß, ist der zusätzliche Nutzen pro Einheit gering. Vgl. Wieser, Friedrich von, Über den Ursprung und die Hauptgesetze des wirthschaftlichen Werthes. – Wien: Alfred Hölder 1884 (hinfort: Wieser, Hauptgesetze), S. 126 ff., 146 ff. Vgl. auch Weber, Erstes Buch. Die begrifflichen Grundlagen der Volkswirtschaftslehre, MWG III/1, S. 118–154, hier S. 127 ff., und Weber, Allgemeine („theoretische“) Nationalökonomie, ebd., S. 234 ff., sowie Weber, Die Grenznutzlehre und das „psychophysische Grundgesetz“, MWG I/12, S. 111–133. –
Wir haben in der abstrakten Wirtschaftstheorie ein Beispiel jener Synthesen1 Zur Unterscheidung von Analyse und Synthese vgl. die Einleitung, oben, S. 16 f. vor uns, welche man als „Ideen“ historischer Erscheinungen zu bezeichnen pflegt.2 Wahrscheinlich bezieht sich Weber auf die historische Ideenlehre, die Humboldt, Gervinus, Ranke u. a. vertraten. Vgl. Weber, Roscher und Knies 1, oben, S. 71 f. mit Anm. 30. Sie bietet uns ein Idealbild3 Diesen im Folgenden mehrfach gebrauchten Begriff hat Weber wahrscheinlich dem Roman „Der eiserne Rittmeister“ von Hans Hoffmann entnommen, auf den er in seiner Kritik an Knies zu sprechen kommt. Vgl. Weber, Roscher und Knies 2, unten, S. 322 mit Anm. 2. der Vorgänge auf dem Gütermarkt bei tauschwirtschaftlicher Gesellschaftsorganisation, freier Konkurrenz und streng rationalem Handeln. Dieses Gedankenbild vereinigt bestimmte Beziehungen und Vorgänge des historischen Lebens zu einem in sich widerspruchslosen Kosmos gedachter Zusammenhänge. Inhaltlich trägt diese Kon[203]struktion den Charakter einer Utopie an sich, die durch gedankliche Steigerung bestimmter Elemente der Wirklichkeit gewonnen ist. Ihr Verhältnis zu denv[203]A: dem empirisch gegebenen Tatsachen des Lebens besteht lediglich darin, daß da, wo Zusammenhänge der in jener Konstruktion abstrakt dargestellten Art, also vom „Markt“ abhängige Vorgänge, in der Wirklichkeit als in irgend einem Grade wirksam festgestellt sind oder vermutet werden, wir uns die Eigenart dieses Zusammenhangs an einem Idealtypus4[203] Zur hier gemeinten Bedeutung dieses Konzepts vgl. Einleitung, oben, S. 24 ff. Zur Bedeutung dieses Konzepts im Sinne von Mittelwert, wie sie sich bei Francis Galton findet, vgl. unten, S. 203 f. mit Anm. 8. Zur normativen Bedeutung dieses Konzepts, wie sie sich bei Georg Jellinek und Friedrich Nietzsche findet, vgl. unten, S. 205 mit Anm. 11. pragmatisch veranschaulichen und verständlich machen können. Diese Möglichkeit kann sowohl heuristisch, wie für die Darstellung von Wert, ja unentbehrlich sein. Für die Forschung will der idealtypische Begriff das Zurechnungsurteil5 Vgl. oben, S. 185 mit Anm. 39. schulen: er ist keine „Hypo[A 65]these“, aber er will der Hypothesenbildung die Richtung weisen. Er ist nicht eine Darstellung des Wirklichen, aber er will der Darstellung eindeutige Ausdrucksmittel verleihen. Es ist also die „Idee“ der historisch gegebenen modernen verkehrswirtschaftlichen Organisation der Gesellschaft, die uns da nach ganz denselben logischen Prinzipien entwickelt wird, wie man z. B. die Idee derwA: der, „Stadtwirtschaft“ des Mittelalters als „genetischen“6 Logiker sprechen von einer „genetischen Definition“, d. h. einer solchen, „welche die Vorstellung ihres Objects aus ihren Elementen entstehen lassen kann“; sie entspricht also einer „Synthese“. Vgl. Sigwart, Logik I (wie oben, S. 5, Anm. 30), S. 375. Vgl. auch unten, S. 207 mit Anm. 15. Begriff konstruiert hat.7 Wahrscheinlich orientiert sich Weber an Karl Büchers Stufenmodell. Für Bücher, Entstehung, S. 15, folgt auf die „Hauswirtschaft“ im Sinne reiner Eigenproduktion ohne Tausch die „Stadtwirtschaft“, für die Kundenproduktion und direkter Tausch typisch sind; auf diese wiederum folgt die „Volkswirtschaft“ mit Warenproduktion und Güterumlauf. Vgl. zur Stadtwirtschaft ausführlich ebd., S. 57 f. Tut man dies, so bildet man den Begriff „Stadtwirtschaft“ nicht etwa als einen Durchschnitt der in sämtlichen beobachteten Städten tatsächlich bestehenden Wirtschaftsprinzipien, sondern ebenfalls als einen Idealtypus.8 Vgl. Bücher, ebd., S., 15: „Wir wollen […] diese drei Wirtschaftsstufen zu kennzeichnen versuchen und zwar so, daß wir jede in ihrer typischen Reinheit zu erfassen stre[204]ben, ohne uns durch das zufällige Auftreten von Uebergangsbildungen oder von einzelnen Erscheinungen beirren zu lassen, die als Nachbleibsel früherer oder Vorläufer späterer Zustände in eine Periode hineinragen“. Im Sinne von Mittelwert hat man „ideal type“ in der Kompositivphotographie und Biometrie verwendet. Vgl. Galton, Francis, Inquiries into Human Faculty and its Development. – London: Macmillan 1883, S. 14, 361 ff. Er wird gewonnen durch einseitige Steigerung eines [204]oder einiger Gesichtspunkte und durch Zusammenschluß einer Fülle von diffus und diskret, hier mehr, dort weniger, stellenweise gar nicht, vorhandenen Einzelerscheinungen, die sich jenen einseitig herausgehobenen Gesichtspunkten fügen, zu einem in sich einheitlichen Gedankenbilde. In seiner begrifflichen Reinheit ist dieses Gedankenbild nirgends in der Wirklichkeit empirisch vorfindbar, es ist eine Utopie, und für die historische Arbeit erwächst die Aufgabe, in jedem einzelnen Falle festzustellen, wie nahe oder wie fern die Wirklichkeit jenem Idealbilde steht, inwieweit also der ökonomische Charakter der Verhältnisse einer bestimmten Stadt als „stadtwirtschaftlich“ im begrifflichen Sinn anzusprechen ist. Für den Zweck der Erforschung und Veranschaulichung aber leistet jener Begriff, vorsichtig angewendet[,] seine spezifischen Dienste. – Ganz in der gleichen Art kann man, um noch ein weiteres Beispiel zu analysieren, die „Idee“ des „Handwerks“ in einer Utopie zeichnen, indem man bestimmte Züge, die sich diffus bei Gewerbetreibenden der verschiedensten Zeiten und Länder vorfinden, einseitig in ihren Konsequenzen gesteigert[,] zu einem in sich widerspruchslosen Idealbilde zusammenfügt und auf einen Gedankenausdruck bezieht, den man darin manifestiert findet. Man kann dann ferner den Versuch machen, eine Gesellschaft zu zeichnen, in der alle Zweige wirtschaftlicher, ja selbst geistiger Tätigkeit von Maximen beherrscht werden, die uns als Anwendung des gleichen Prinzips erscheinen, welches dem zum Idealtypus erhobenen „Handwerk“ charakteristisch ist. Man kann nun weiter jenem Idealtypus des Handwerks als Antithese einen entsprechenden Idealtypus einer kapitalistischen Gewerbeverfassung, aus gewissen Zügen der modernen Großindustrie abstrahiert, entgegensetzen und daran anschließend den Versuch machen, die Utopie einer „kapitalistischen“[,] [A 66]d. h. allein durch das Verwertungsinteresse privater Kapitalien beherrschten Kultur zu zeichnen. Sie hätte einzelne diffus vorhandene Züge des modernen materiellen und geistigen Kulturlebens in ihrer Eigenart gesteigert zu einem für unsere Betrachtung [205]widerspruchslosen Idealbilde zusammenzuschließen. Das wäre dann ein Versuch der Zeichnung einer „Idee“ der kapitalistischen Kultur – ob und wie er etwa gelingen könnte, müssen wir hier ganz dahingestellt sein lassen. Nun ist es möglich, oder vielmehr es muß als sicher angesehen werden, daß mehrere, ja sicher jeweils sehr zahlreiche Utopien dieser Art sich entwerfen lassen, von denen keine der anderen gleicht, von denen erst recht keine in der empirischen Wirklichkeit als tatsächlich geltende Ordnung der gesellschaftlichen Zustände zu beobachten ist, von denen aber doch jede den Anspruch erhebt, eine Darstellung der „Idee“ der kapitalistischen Kultur zu sein, und von denen auch jede diesen Anspruch insofern erheben kann, als jede tatsächlich gewisse, in ihrer Eigenart bedeutungsvolle Züge unserer Kultur der Wirklichkeit entnommen und in ein einheitliches Idealbild gebracht hat. Denn diejenigen Phänomene, die uns als Kulturerscheinungen interessieren, leiten regelmäßig dies unser Interesse – ihre „Kulturbedeutung“ – aus sehr verschiedenen Wertideen ab, zu denen wir sie in Beziehung setzen können.9[205] Vgl. oben, S. 182. Wie es deshalb die verschiedensten „Gesichtspunkte“10 Vgl. oben, S. 189 ff. gibt, unter denen wir sie als für uns bedeutsam betrachten können, so lassen sich die allerverschiedensten Prinzipien der Auswahl der in einen Idealtypus einer bestimmten Kultur aufzunehmenden Zusammenhänge zur Anwendung bringen.
Was ist nun aber die Bedeutung solcher idealtypischen Begriffe für eine Erfahrungswissenschaft, wie wir sie treiben wollen? Vorweg sei hervorgehoben, daß der Gedanke des Seinsollenden, „Vorbildlichen“ von diesen in rein logischem Sinn „idealen“ Gedankengebilden, die wir besprechen, hier zunächst sorgsam fernzuhalten ist.11 In dieser normativen Bedeutung findet sich das Konzept des Idealtypus bei Jellinek. Staatslehre (wie oben, S. 91, Anm. 26). S. 32 f., und Nietzsche, Friedrich, Nachgelassene Werke. Der Wille zur Macht. Versuch einer Umwerthung aller Werthe. (Studien und Fragmente) (Nietzsche’s Werke. Zweite Abtheilung, Band XV). – Leipzig: C. G. Naumann 1901. S. 174. Es handelt sich um die Konstruktion von Zusammenhängen, welche unserer Phantasie12 Vgl. oben, S. 186 f. mit Anm. 44. als zulänglich motiviert und also „objektiv möglich“, unserem nomologischen Wissen als adäquat erscheinen.13 Vgl. oben, S. 187 mit Anm. 45.
[206]Wer auf dem Standpunkt steht, daß die Erkenntnis der historischen Wirklichkeit „voraussetzungslose“ Abbildung „objektiverx[206]A: „objektiver“ Tatsachen“ sein solle oder könne, wird ihnen jeden Wert absprechen. Und selbst wer erkannt hat, daß es eine „Voraussetzungslosigkeit“ im logischen Sinn auf dem Boden der Wirklichkeit nicht [A 67]gibt und auch das einfachste Aktenexzerpt oder Urkundenregest nur durch Bezugnahme auf „Bedeutungen“, und damit auf Wertideen als letzte Instanz, irgend welchen wissenschaftlichen Sinn haben kann, wird doch die Konstruktion irgend welcher historischer „Utopien“ als ein für die Unbefangenheit der historischen Arbeit gefährliches Veranschaulichungsmittel, überwiegend aber einfach als Spielerei ansehen. Und in der Tat: ob es sich um reines Gedankenspiel oder um eine wissenschaftlich fruchtbare Begriffsbildung handelt, kann a priori niemals entschieden werden: es gibt auch hier nur einen Maßstab: den des Erfolges für die Erkenntnis konkreter Kulturerscheinungen in ihrem Zusammenhang, ihrer ursächlichen Bedingtheit und ihrer Bedeutung. Nicht als Ziel, sondern als Mittel kommt mithin die Bildung abstrakter Idealtypen in Betracht. Jede aufmerksame Beobachtung der begrifflichen Elemente historischer Darstellung zeigt nun aber, daß der Historiker, sobald er den Versuch unternimmt, über das bloße Konstatieren konkreter Zusammenhänge hinaus die Kulturbedeutung eines noch so einfachen individuellen Vorgangs festzustellen, ihn zu „charakterisieren“, mit Begriffen arbeitet und arbeiten muß, welche regelmäßig nur in Idealtypen scharf und eindeutig bestimmbar sind. Oder sind Begriffe wie etwa: „Individualismus“, „Imperialismus“, „Feudalismus“yA: Feudalismus“, „Merkantilismus“[,] „konventionell“ und die zahllosen Begriffsbildungen ähnlicher Art, mittels deren wir uns der Wirklichkeit denkend und verstehend zu bemächtigen suchen, ihrem Inhalt nach durch „voraussetzungslose“ Beschreibung irgend einer konkreten Erscheinung oder aber durch abstrahierende Zusammenfassung dessen, was mehreren konkreten Erscheinungen gemeinsam ist,14 [206]Zur generalisierenden Abstraktion vgl. Einleitung, oben, S. 16 f. zu bestimmen? Die Sprache, die der Historiker spricht, enthält in hunderten von Worten solche unbestimmten, dem unreflektiert waltenden Bedürfnis des Ausdrucks entnomme[207]nen Gedankenbilder, deren Bedeutung zunächst nur anschaulich empfunden, nicht klar gedacht wird. In unendlich vielen Fällen, zumal auf dem Gebiet der darstellenden politischen Geschichte, tut nun die Unbestimmtheit ihres Inhaltes der Klarheit der Darstellung sicherlich keinen Eintrag. Es genügt dann, daß im einzelnen Falle empfunden wird, was dem Historiker vorschwebt, oder aber man kann sich damit begnügen, daß eine partikuläre Bestimmtheit des Begriffsinhaltes von relativer Bedeutung für den einzelnen Fall als gedacht vorschwebt. Je schärfer aber die Bedeutsamkeit einer Kulturerscheinung zum klaren [A 68]Bewußtsein gebracht werden soll, desto unabweislicher wird das Bedürfnis, mit klaren und nicht nur partikulär, sondern allseitig bestimmten Begriffen zu arbeiten. Eine „Definition“ jener Synthesen des historischen Denkens nach dem Schema: genus proximum und differentia specifica15 [207]Die Gegenüberstellung von Definitionen nach genus proximum und genetischen Definitionen, die Weber auf dieser Seite formuliert, hat Riehl erläutert. Vgl. Riehl, Alois, Beiträge zur Logik (Erster Artikel), in: Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche Philosophie, 16. Jg., 1892, S. 1–19, hier S. 9 f.: „Die Logik des Alterthums kannte nur Eine Methode des Definirens: die classificirende, durch Angabe des genus und der specifischen Differenz. […] Sie setzt voraus, dass wir uns im Besitze eines vollständigen und überdies wohlgeordneten Systemes von Begriffen befinden, eine Annahme, die nur dort zutrifft, wo wir, wie in der Geometrie, die Gattungen der Objecte selbst erzeugen. Die neuere Logik dagegen kennt und bevorzugt die genetische, den Begriff aus seinen Elementen entwickelnde Definition. Eine besonders instructive Art des genetischen Definirens wollen wir als die historische Definition bezeichnen. Sie geht von der Geschichte des Begriffes aus, indem sie zu den Aufgaben und Erkenntnissbedürfnissen zurückgreift, die zur Aussonderung des fraglichen Begriffes führten.“ ist natürlich ein Unding: man mache doch die Probe. Eine solche Form der Feststellung der Wortbedeutung gibt es nur auf dem Boden dogmatischer Disziplinen, welche mit Syllogismen arbeiten.16 Windelband zufolge folgt auch jede „Causalbetrachtung“ dem logischen Schema des Syllogismus. Vgl. Einleitung, oben, S. 6. Eine einfach „schildernde Auflösung“17 Für Gottl, Herrschaft, S. 189, soll bei „Juristen“ die „worterklärende Definition“ eines Begriffs wie „Börse“ etwas leisten, „dem doch nur die schildernde Auflösung recht gewachsen bleibt“. jener Begriffe in ihre Bestandteile gibt es jedenfalls nicht oder nur scheinbar, denn es kommt eben darauf an, welche dieser Bestandteile denn als wesentlich gelten sollen. Es bleibt, wenn eine genetische Definition18 Vgl. oben, S. 203 mit Anm. 6. des Begriffsinhaltes versucht werden soll, nur die Form des Idealtypus im oben [208]fixierten Sinn.19 [208]Oben, S. 203 ff. Er ist ein Gedankenbild, welches nicht die historische Wirklichkeit oder gar die „eigentliche“ Wirklichkeit ist, welches noch viel weniger dazu da ist, als ein Schema zu dienen, in welches die Wirklichkeit als Exemplar eingeordnet werden sollte, sondern welches die Bedeutung eines rein idealen Grenzbegriffes hat, an welchem die Wirklichkeit zur Verdeutlichung bestimmter bedeutsamer Bestandteile ihres empirischen Gehaltes gemessen, mit dem sie verglichen wird. Solche Begriffe sind Gebilde, in welchen wir Zusammenhänge unter Verwendung der Kategorie der objektiven Möglichkeit konstruieren, welche unsere, an der Wirklichkeit orientierte und geschulte Phantasie als adäquat beurteilt.20 Vgl. oben, S. 205.
Der Idealtypus ist in dieser Funktion insbesondere der Versuch, historische Individuen21 Vgl. oben, S. 185 mit Anm. 40. oder deren Einzelbestandteile in genetische Begriffe zu fassen. Man nehme etwa die Begriffe: „Kirche“ und „Sekte“. Sie lassen sich rein klassifizierend in Merkmalskomplexe auflösen, wobei dann nicht nur die Grenze zwischen beiden, sondern auch der Begriffsinhalt stets flüssig bleiben muß. Will ich aber den Begriff der „Sekte“ genetisch, z. B. inz[208]A: im bezug auf gewisse wichtige Kulturbedeutungen, die der „Sektengeist“ für die moderne Kultur gehabt hat, erfassen, so werden bestimmte Merkmale beider wesentlich, weil sie in adäquater ursächlicher Beziehung zu jenen Wirkungen stehen. Die Begriffe werden aber alsdann zugleich idealtypisch, d. h. in voller begrifflicher Reinheit sind sie nicht oder nur vereinzelt vertreten. Hier wie überall führt eben jeder nicht rein klassifikatorische Begriff von der Wirklichkeit ab. Aber die diskursive Natur unseres Erkennens:22 Vgl. Weber, Roscher und Knies 1, oben, S. 63 mit Anm. 98. der Umstand, daß wir die Wirklichkeit nur durch eine Kette von Vorstellungsveränderungen [A 69]hindurch erfassen, postuliert eine solche Begriffsstenographie.23 Diese Bezeichnung ist im Deutschen nicht belegt. Wahrscheinlich steht sie im Zusammenhang mit Mills Logik. Für Mill war „Induction“ kein „Schluss“, der sich in einer „Wiederholung der Prämissen“ erschöpft, sondern einer, der „vom Bekannten zum Unbekannten“ führt: Wenn man z. B. nach der Beobachtung jedes einzelnen Apostels sagt, die Apostel waren Juden, so wird dies zwar eine „vollkommene Induction“ genannt, stellt aber keine „Induction“ im Sinne Mills dar, denn „es ist kein Schliessen von [209]bekannten Thatsachen auf unbekannte, sondern ein Verzeichniss in einer Geschwindschrift von bekannten Thatsachen“. Vgl. Mill, John Stuart, System der deductiven und inductiven Logik. Eine Darlegung der Principien wissenschaftlicher Forschung, insbesondere der Naturforschung. In’s Deutsche übertragen von J. Schiel, 2. deutsche, nach der 5. des Originals erweiterte Aufl. in zwei Theilen, Erster Theil. – Braunschweig: Friedrich Vieweg 1862, S. 340 f. Mills „Verzeichniß in einer Geschwindschrift“ (ein anderer zeitgenössischer Ausdruck ist „Stenographie“) hat Windelband, Zufall, S. 43, aufgegriffen. – Weber, Kritische Studien, unten, S. 389 mit Anm. 14, referiert auf dieses Werk. – Den Zusammenhang zwischen der „diskursive[n] Natur unseres Erkennens“ und der „Begriffsstenographie“ erhellt Sigwart in einer Auseinandersetzung mit Mill. Vgl. Sigwart, Logik I (wie oben, S. 5, Anm. 30), S. 467. Zum englischen Sprachgebrauch vgl. Pearson, Karl, The Grammar of Science. Second Edition, Revised and Enlarged. – London: Adam and Charles Black 1900, S. 353: „Knowledge is the description in conceptual shorthand of the various phases of our perceptual experience”. Pearson konzipiert auch Naturgesetze als „conceptual shorthand“-Beschreibungen. Vgl. ebd., S. vii, 99, 115, 194, 261, 275, 332. [209]Unsere Phantasie kann ihre ausdrückliche begriffliche Formulierung sicherlich oft als Mittel der Forschung entbehren, – für die Darstellung ist, soweit sie eindeutig sein will, ihre Verwendung auf dem Boden der Kulturanalyse in zahlreichen Fällen ganz unvermeidlich. Wer sie grundsätzlich verwirft, muß sich auf die formale, etwa die rechtshistorische Seite der Kulturerscheinungen beschränken. Der Kosmos der rechtlichen Normen ist natürlich zugleich begrifflich klar bestimmbar und (im rechtlichen Sinn!) für die historische Wirklichkeit geltend. Aber ihre praktische Bedeutung ist es, mit der die Arbeit der Sozialwissenschaft in unserem Sinn zu tun hat. Diese Bedeutung aber ist sehr oft nur durch Beziehung des empirisch Gegebenen auf einena[209]A: einem idealen Grenzfall eindeutig zum Bewußtsein zu bringen. Lehnt der Historiker (im weitesten Sinne des Wortes) einen Formulierungsversuch eines solchen Idealtypus als „theoretische Konstruktion“, d. h. als für seinen konkreten Erkenntniszweck nicht tauglich oder entbehrlich, ab, so ist die Folge regelmäßig entweder, daß er, bewußt oder unbewußt, andere ähnliche ohne sprachliche Formulierung und logische Bearbeitung verwendet, oder daß er im Gebiet des unbestimmt „Empfundenen“ stecken bleibt.
Nichts aber ist allerdings gefährlicher, als die, naturalistischen Vorurteilen entstammende, Vermischung von Theorie und Geschichte, sei es in der Form, daß man glaubt, in jenen theoretischen Begriffsbildern den „eigentlichen“ Gehalt, das „Wesen“ der [210]geschichtlichen Wirklichkeit fixiert zu haben, oder daß man sie als ein Prokrustesbett benutzt, in welches die Geschichte hineingezwängt werden soll, oder daß man gar die „Ideen“ als eine hinter der Flucht der Erscheinungen stehende „eigentliche“ Wirklichkeit, als reale „Kräfte“ hypostasiert, die sich in der Geschichte auswirkten.
Speziell diese letztere Gefahr liegt nun um so näher, als wir unter „Ideen“ einer Epoche auch und sogar in erster Linie Gedanken oder Ideale zu verstehen gewohnt sind, welche die Masse oder einen geschichtlich ins Gewicht fallenden Teil der Menschen jener Epoche selbst beherrscht haben und dadurch für deren Kultureigenart als Komponenten bedeutsam gewesen sind.24 [210]Vgl. oben, S. 148. Und es kommt noch zweierlei hinzu: Zunächst der Umstand, daß zwischen der „Idee“ im Sinn von praktischer oder theoretischer Gedankenrichtung und der „Idee“ im Sinn eines von uns als begriffliches Hilfsmittel konstruierten Idealtypus einer Epoche regelmäßig be[A 70]stimmte Beziehungen bestehen. Ein Idealtypus bestimmter gesellschaftlicher Zustände, welcher sich aus gewissen charakteristischen sozialen Erscheinungen einer Epoche abstrahieren läßt, kann – und dies ist sogar recht häufig der Fall – den Zeitgenossen selbst als praktisch zu erstrebendes Ideal oder doch als Maxime für die Regelung bestimmter sozialer Beziehungen vorgeschwebt haben. So steht es schon mit der „Idee“ des „Nahrungsschutzes“25 Für Sombart, Moderner Kapitalismus I (wie oben, S. 14, Anm. 94), S. XXXI f., 187, ist die „Idee der Nahrung“ konstitutiv für die vorkapitalistische Wirtschaft. Der „Grundgedanke“, sich „durch eigene, zunächst nur gewerbliche Arbeit für andere“ die „standesgemäße, traditionelle ,Nahrung‘ zu sichern“, wurde zur „Leitidee“ für das „gesamte Wirtschaftsleben“, gemäß dessen „handwerksmäßige[r] Organisation“ man forderte, „daß jedem Genossen, der in der Väter Weise seine Arbeit verrichtet, ein Auskommen gesichert, also ,Nahrung‘ garantiert sein solle“. und manchen Theorien der Kanonisten, speziell des heiligen Thomas,26 Vgl. Weber, Geschichte der Nationalökonomie, MWG III/1, S. 682–685. im Verhältnis zu dem heute verwendeten idealtypischen Begriff der „Stadtwirtschaft“ des Mittelalters, den wir oben besprachen.27 Oben, S. 203 f. Erst recht steht es so mit dem berüchtigten „Grundbegriff“ der Nationalökonomie: dem des „wirtschaftlichen Werts“.28 Möglicherweise referiert Weber auf Böhm-Bawerk, für den die Lehre vom Wert „eine der unklarsten, verworrensten und strittigsten Partien“ der Nationalökonomie ist. [211]Vgl. Böhm-Bawerk, Eugen von, Grundzüge der Theorie des wirtschaftlichen Güterwertes, in: Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, N. F. Band 13, 1886, S. 1–82, hier S. 3. Von der [211]Scholastik an bis in die Marxsche Theorie hinein verquickt sich hier der Gedanke von etwas „objektiv“ Geltendem, d. h. also: Seinsollendemb[211]A: Seinsollenden, mit einer Abstraktion aus dem empirischen Verlauf der Preisbildung. Und jener Gedanke, daß der „Wert“ der Güter nach bestimmten (naturrechtlichen) Prinzipien reguliert sein solle, hat unermeßliche Bedeutung für die Kulturentwicklung – und zwar nicht nur des Mittelalters – gehabt und hat sie noch. Und er hat speziell auch die empirische Preisbildung intensiv beeinflußt. Was aber unter jenem theoretischen Begriff gedacht wird und gedacht werden kann, das ist nur durch scharfe, das heißt idealtypische Begriffsbildung wirklich eindeutig klar zu machen, – das sollte der Spott über die „Robinsonaden“29 Marx hatte 1857 der klassischen Nationalökonomie bescheinigt, mit „Robinsonaden“ zu arbeiten. Vgl. Marx, Karl, Einleitung zu einer Kritik der politischen Ökonomie, in: Die neue Zeit, 21. Jg., Band 1, 1903, S. 710–718, hier S. 710. Schmoller schrieb 1873 über Menger: „Klarheit in der abstracten Theorie ist sein Ziel; sehr eingehende […] Besprechung von Beispielen, die meist mehr an die Robinsonade als an heutige wirthschaftliche Zustände anknüpfen, ist das Mittel, mit dem er operiert.“ Vgl. Schmoller, Gustav, [Rez.:] Menger, Carl, Grundsätze der Volkswirthschaftslehre, in: Literarisches Centralblatt, Nr. 5 vom 1. Febr. 1873, S. 142 f., hier S. 143. Später bezeichnete Schmoller Mengers Abstraktionen als „schemenhafte Phantome, geträumte Robinsonaden“. Vgl. Schmoller, Methodologie, S. 980. Funktional betrachtet, sind Robinsonaden „Gedankenexperimente“ auf der Basis von Abstraktionen. der abstrakten Theorie jedenfalls so lange bedenken, als er nichts besseres, d. h. hier: Klareres[,] an die Stelle zu setzen vermag.
Das Kausalverhältnis zwischen der historisch konstatierbaren, die Menschen beherrschenden, Idee und denjenigen Bestandteilen der historischen Wirklichkeit, aus welchen der ihr korrespondierende Idealtypus sich abstrahieren läßt, kann dabei natürlich höchst verschieden gestaltet sein. Festzuhalten ist prinzipiell nur, daß beides selbstverständlich grundverschiedene Dinge sind. Nun aber tritt noch etwas weiteres hinzu: Jene die Menschen einer Epoche beherrschenden, d. h. diffus in ihnen wirksamen „Ideen“ selbst können wir, sobald es sich dabei um irgend kompliziertere Gedankengebilde handelt, mit begrifflicher Schärfe wiederum nur in Gestalt eines Idealtypus erfassen, weil sie empirisch ja in den Köpfen einer [212]unbestimmten und wechselnden Vielzahl von Individuen leben und in ihnen die mannigfachsten Abschattierungen nach Form und Inhalt, Klarheit und Sinn erfahren. Diejenigen Be[A 71]standteile des Geisteslebens der einzelnen Individuen in einer bestimmten Epoche des Mittelalters z. B., die wir als „das Christentum“ der betreffenden Individuen ansprechen dürfen, würden, wenn wir sie vollständig zur Darstellung zu bringen vermöchten, natürlich ein Chaos unendlich differenzierter und höchst widerspruchsvoller Gedanken- und Gefühlszusammenhänge aller Art sein, trotzdem die Kirche des Mittelalters die Einheit des Glaubens und der Sitten sicherlich in besonders hohem Maße durchzusetzen vermocht hat. Wirft man nun die Frage auf, was denn in diesem Chaos das „Christentum“ des Mittelalters, mit dem man doch fortwährend als mit einem feststehenden Begriff operieren muß, gewesen sei, worin das „Christliche“, welches wir in den Institutionen des Mittelalters finden, denn liege, so zeigt sich alsbald, daß auch hier in jedem einzelnen Fall ein von uns geschaffenes reines Gedankengebilde verwendet wird. Es ist eine Verbindung von Glaubenssätzen, Kirchenrechts- und sittlichen Normen, Maximen der Lebensführung und zahllosen Einzelzusammenhängen, die wir zu einer „Idee“ verbinden: eine Synthese, zu der wir ohne die Verwendung idealtypischerc[212]A: idealtypischen Begriffe gar nicht widerspruchslos zu gelangen vermöchten.
Die logische Struktur der Begriffssysteme, in denen wir solche „Ideen“ zur Darstellung bringen, und ihr Verhältnis zu dem, was uns in der empirischen Wirklichkeit unmittelbar gegeben ist, sind nun natürlich höchst verschieden. Verhältnismäßig einfach gestaltet sich die Sache noch, wenn es sich um Fälle handelt, in denen ein oder einige wenige leicht in Formeln zu fassende theoretische Leitsätze – etwa der Prädestinationsglaube Calvins30 [212]Vgl. Weber, Roscher und Knies 1, oben, S. 74, Fn. 57 mit Anm. 45. – oder klar formulierbare sittliche Postulate es sind, welche sich der Menschen bemächtigt und historische Wirkungen erzeugt haben, so daß wir die „Idee“ in einer Hierarchie von Gedanken gliedern können, welche logisch aus jenen Leitsätzen sich entwickeln. Schon dann wird freilich leicht übersehen, daß, so gewaltig die Bedeutung auch der rein logisch zwingenden Macht des Gedankens in der [213]Geschichte gewesen ist, – der Marxismus ist ein hervorragendes Beispiel dafür – doch der empirisch-historische Vorgang in den Köpfen der Menschen regelmäßig als ein psychologisch, nicht als ein logisch bedingter verstanden werden muß. Deutlicher noch zeigt sich der idealtypische Charakter solcher Synthesen von historisch wirksamen Ideen dann, wenn jene grundlegenden Leitsätze und Postulate gar nicht oder nicht mehr in den Köpfen derjenigen Einzelnen leben, die von den [A 72]aus ihnen logisch folgenden oder von ihnen durch Assoziation ausgelösten Gedanken beherrscht sind, weil die historisch ursprünglich zugrunde liegende „Idee“ entweder abgestorben ist, oder überhaupt nur in ihren Konsequenzen in die Breite gedrungen war. Und noch entschiedener tritt der Charakter der Synthese als einer „Idee“, die wir schaffen, dann hervor, wenn jene grundlegenden Leitsätze von Anfang an nur unvollkommen oder gar nicht zum deutlichen Bewußtsein gekommen sind oder wenigstens nicht die Form klarer Gedankenzusammenhänge angenommen haben. Wenn alsdann diese Prozedur von uns vorgenommen wird, wie es unendlich oft geschieht und auch geschehen muß, so handelt es sich bei dieser „Idee“ – etwa des „Liberalismus“ einer bestimmten Periode oder des „Methodismus“ oder irgend einer gedanklich unentwickelten Spielart des „Sozialismus“, – um einen reinen Idealtypus ganz des gleichen Charakters wie die Synthesen von „Prinzipien“ einer Wirtschaftsepoche, von denen wir ausgingen. Je umfassender die Zusammenhänge sind, um deren Darstellung es sich handelt, und je vielseitiger ihre Kulturbedeutung gewesen ist, desto mehr nähert sich ihre zusammenfassende systematische Darstellung in einem Begriffs- und Gedankensystem dem Charakter des Idealtypus, desto weniger ist es möglich, mit einem derartigen Begriffe auszukommen, desto natürlicher und unumgänglicher daher die immer wiederholten Versuche, immer neue Seiten der Bedeutsamkeit durch neue Bildung idealtypischer Begriffe zum Bewußtsein zu bringen. Alle Darstellungen eines „Wesens“ des Christentums31 [213]Vgl. Feuerbach, Ludwig, Das Wesen des Christentums. – Leipzig: Otto Wigand 1841; Harnack, Adolf, Das Wesen des Christentums. Sechzehn Vorlesungen vor Studierenden aller Facultäten im Wintersemester 1899/1900 an der Universität Berlin gehalten. – Leipzig: J. C. Hinrichs 1900. z. B. sind Idealtypen von stets und notwendig nur sehr relativer und problematischer Gültigkeit, wenn [214]sie als historische Darstellung des empirisch Vorhandenen angesehen sein wollen, dagegen von hohem heuristischen Wert für die Forschung und hohem systematischen Wert für die Darstellung, wenn sie lediglich als begriffliche Mittel zur Vergleichung und Messung der Wirklichkeit an ihnen verwendet werden.32 [214]Vgl. oben, S. 208. In dieser Funktion sind sie geradezu unentbehrlich. Nun aber haftet solchen idealtypischen Darstellungen regelmäßig noch ein anderes, ihre Bedeutung noch weiter komplizierendes Moment an. Sie wollen sein, oder sind unbewußt, regelmäßig Idealtypen nicht nur im logischen, sondern auch im praktischen Sinne: vorbildliche Typen, welche – in unserem Beispiel – das enthalten, was das Christentum nach der Ansicht des Darstellers sein soll, was an ihm das für ihn „Wesentliche“, weil dauernd Wertvolle ist. Ist dies aber bewußt oder – häu[A 73]figer – unbewußt der Fall, dann enthalten sie Ideale, auf welche der Darsteller das Christentum wertend bezieht: Aufgaben und Ziele, auf die hin er seine „Idee“ des Christentums ausrichtet und welche natürlich von den Werten, auf welche die Zeitgenossen, etwa die Urchristen, das Christentum bezogen, höchst verschieden sein können, ja zweifellos immer sein werden. In dieser Bedeutung sind die „Ideen“ dann aber natürlich nicht mehr rein logische Hilfsmittel, nicht mehr Begriffe, an welchen die Wirklichkeit vergleichend gemessen, sondern Ideale, aus denen sie wertend beurteilt wird. Es handelt sich hier nicht mehr um den rein theoretischen Vorgang der Beziehung des Empirischen auf Werte, sondern um Werturteile, welche in den „Begriff“ des Christentums aufgenommen sind. Weil hier der Idealtypus empirische Geltung beansprucht, ragt er in die Region der wertenden Deutung des Christentums hinein: der Boden der Erfahrungswissenschaft ist verlassen: es liegt ein persönliches Bekenntnis vor, nicht eine ideal-typische Begriffsbildung.33 In diesem normativen Sinne ist der „Idealtypus“ für Jellinek, Staatslehre (wie oben, S. 91, Anm. 26), S. 32, „kein Seiendes, sondern ein Seinsollendes“ und von daher ein „Beurteilungsmassstab des Gegebenen“. So prinzipiell dieser Unterschied ist, so tritt die Vermischung jener beiden grundverschiedenen Bedeutungen der „Idee“ im Verlauf der historischen Arbeit doch außerordentlich häufig ein. Sie liegt immer sehr nahe, sobald der darstellende Historiker seine „Auffassung“ einer Persönlichkeit oder Epoche zu entwickeln [215]beginnt. Im Gegensatz zu den konstant bleibenden ethischen Maßstäben, die Schlosser im Geiste des Rationalismus verwendete,34 [215]Zu Friedrich Christoph Schlosser vgl. Lorenz, Ottokar, Die Geschichtswissenschaft in Hauptrichtungen und Aufgaben. – Berlin: Wilhelm Hertz 1886, S. 65 f. hat der moderne relativistisch eingeschulte Historiker, der die Epoche, von der er spricht, einerseits „aus ihr selbst verstehen“, andererseits doch auch „beurteilen“ will, das Bedürfnis, die Maßstäbe seines Urteils „dem Stoff“ zu entnehmen, d. h. die „Idee“ im Sinne des Ideals aus der „Idee“ im Sinne des „Idealtypus“ herauswachsen zu lassen. Und das ästhetischd[215]A: ästhetische Reizvolle eines solchen Verfahrens verlockt ihn fortwährend dazu, die Linie, wo beide sich scheiden, zu verwischen – eine Halbheit, welche einerseits das wertende Urteilen nicht lassen kann, andererseits die Verantwortung für ihre Urteile von sich abzulehnen trachtet. Demgegenüber ist es aber eine elementare Pflicht der wissenschaftlichen Selbstkontrolle und das einzige Mittel zur Verhütung von Erschleichungen,35 Erschleichung oder Subreption entstammt dem Römischen Recht. In der Logik wird damit ein Schluß bezeichnet, der zwar formal korrekt ist, aber auf falschen Prämissen beruht und damit zu falschen Ergebnissen führt. Prominent ist Kants Auffassung, derzufolge das „vitium subreptionis“ dann unterlaufe, wenn man Eigenschaften, die Erscheinungen zukommen, den Dingen an sich zurechnet. Vgl. Kant, Immanuel, De mundi sensibilis atque intelligibilis forma et principiis. Nebst einer Verdeutlichung dieser Abhandlung, in: ders., Vermischte Schriften, Band 2. – Halle: Renger 1799, S. 435–566, hier S. 476 ff., 551 f. Der Begriff findet sich auch in Weber, Marianne, Fichte’s Sozialismus (wie oben, S. 33, Anm. 1), S. 122: „Der Terminus ,Wert‘ ist auch in der Nationalökonomie unentbehrlich, allein er sollte nie ohne nähere Bestimmung seines Inhalts gebraucht werden, anderfalls ist er (innerhalb wie ausserhalb der N.Ö.) die Quelle zahlloser Erschleichungen.“ die logisch-vergleichende Beziehung der Wirklichkeit auf Idealtypen im logischen Sinne von der wertenden Beurteilung der Wirklichkeit aus Idealen heraus scharf zu scheiden. Ein „Idealtypus“ in unserem Sinne ist, wie noch einmal wiederholt sein mag, etwas gegenüber der wertenden Beurteilung [A 74]völlig indifferentes, er hat mit irgend einer anderen als einer rein logischen „Vollkommenheit“ nichts zu tun. Es gibt Idealtypen von Bordellen so gut wie von Religionen, und es gibt von den ersteren sowohl Idealtypen von solchen, die vom Standpunkt der heutigen Polizeiethik aus technisch „zweckmäßig“ erscheinen würden, wie von solchen, bei denen das gerade Gegenteil der Fall ist.
[216]Notgedrungen muß hier die eingehende Erörterung des weitaus kompliziertesten und interessantesten Falles: die Frage der logischen Struktur des Staatsbegriffes, beiseite bleiben. Nur folgendes sei dazu bemerkt: Wenn wir fragen, was in der empirischen Wirklichkeit dem Gedanken „Staat“ entspricht, so finden wir eine Unendlichkeit diffuser und diskreter menschlicher Handlungen und Duldungen, faktischer und rechtlich geordneter Beziehungen, teils einmaligen[,] teils regelmäßig wiederkehrenden Charakters, zusammengehalten durch eine Idee, den Glauben an tatsächlich geltende oder gelten sollende Normen und Herrschaftsverhältnisse von Menschen über Menschen. Dieser Glaube ist teils gedanklich entwickelter geistiger Besitz, teils dunkel empfunden, teils passiv hingenommen und auf das mannigfaltigste abschattiert in den Köpfen der einzelnen vorhanden, welche, wenn sie die „Idee“ wirklich selbst klar als solche dächten, ja nicht erst der „allgemeinen Staatslehre“36 [216]Möglicherweise Anspielung auf Jellinek, Staatslehre (wie oben, S. 91, Anm. 26). bedürften, die sie entwickeln will. Der wissenschaftliche Staatsbegriff, wie immer er formuliert werde, ist nun natürlich stets eine Synthese, die wir zu bestimmten Erkenntniszwecken vornehmen. Aber er ist andererseits auch abstrahiert aus den unklaren Synthesen, welche in den Köpfen der historischen Menschen vorgefunden werden. Der konkrete Inhalt aber, den der historische „Staat“ in jenen Synthesen der Zeitgenossen annimmt, kann wiederum nur durch Orientierung an idealtypischen Begriffen zur Anschauung gebracht werden. Und ferner unterliegt es nicht dem mindesten Zweifel, daß die Art, wie jene Synthesen, in logisch stets unvollkommener Form, von den Zeitgenossen vollzogen werden, die „Ideen“[,] die sie sich vom Staat machen, – die deutsche „organische“ Staatsmetaphysik37 Vgl. Krieken, Albert Theodor van, Ueber die sogenannte organische Staatstheorie. Ein Beitrag zur Geschichte des Staatsbegriffs. – Leipzig: Duncker & Humblot 1873, sowie als aktuell: Gierke, Verbände. Vgl. dazu Weber, Roscher und Knies 1, oben, S. 91, Fn. 86. z. B. im Gegensatz zu der „geschäftlichen“ amerikanischen Auffassung,38 Möglicherweise Bezug auf Bryce, James, The American Commonwealth, 3 Volumes. – London and New York: Macmillan 1888. – von eminenter praktischer Bedeutung ist, daß mit anderen Worten auch hier die als geltensollend oder geltend geglaubte praktische Idee und [217]der zu Erkenntniszwecken konstruierte theoretische Idealtypus nebeneinander herlaufen und die stete Neigung zeigen, ineinander überzugehen. –
Wir hatten oben39 [217]Oben, S. 202 ff. absichtlich den „Idealtypus“ wesentlich – [A 75]wenn auch nicht ausschließlich – als gedankliche Konstruktion zur Messung und systematischen Charakterisierung von individuellen, d. h. in ihrer Einzigartigkeit bedeutsamen Zusammenhängen – wie Christentum, Kapitalismus usw. – betrachtet. Dies geschah, um die landläufige Vorstellung zu beseitigen, als ob auf dem Gebiet der Kulturerscheinungen das abstrakt Typische mit dem abstrakt Gattungsmäßigen identisch sei. Das ist nicht der Fall. Ohne den viel erörterten40 Vgl. Rickert, Grenzen, S. 360 ff., 487 f., 529 f. und durch Mißbrauch stark diskreditierten Begriff des „Typischen“e[217]A: „typischen“ hier prinzipiell analysieren zu können, entnehmen wir doch schon unserer bisherigen Erörterung, daß die Bildung von Typenbegriffen im Sinn der Ausscheidung des „Zufälligen“41 Auf den „idealen Typus“ bezogen, betonen die Ausscheidung des Zufälligen z. B. Gervinus, Historik, S. 382, und Helmholtz, Malerei (wie oben, S. 25, Anm. 79), S. 135. Für Hoffmann, Rittmeister II, S. 236, ist das „fehlerhafte Pferd“ gleichfalls ein „von keiner zufälligen Einzelheit getrübtes Idealbild“. Auch Bücher, Entstehung, S. 15, möchte „jede“ der Wirtschaftsstufen „in ihrer typischen Reinheit“ erfassen, ohne sich „durch das zufällige Auftreten von Uebergangsbildungen oder von einzelnen Erscheinungen“ beirren zu lassen. auch und gerade bei historischen Individuen42 Vgl. oben, S. 185 mit Anm. 40. ihre Stätte findet.43 Für Rickert, Grenzen, S. 363, ist „der Begriff des Typus ganz unbrauchbar“, will man „einen wirklich umfassenden Begriff des historischen Individuums erhalten“. Den Begriff des Idealtypus gebraucht er gar nicht. Vgl. auch den Brief von Max Weber an Heinrich Rickert vom 14. Juni 1904, MWG II/4, S. 230 f., hier S. 230: „Ihre Zustimmung zu dem Gedanken des ,Idealtypus‘ erfreut mich sehr. In der That halte ich eine ähnliche Kategorie für notwendig, um ,werthendes‘ und ,werthbeziehendes‘ Urteil scheiden zu können. Wie man sie nennt[,] ist ja Nebensache. Ich nannte sie so, weil der Sprachgebrauch von ,idealem Grenzfall‘, ,idealer Reinheit‘ eines typischen Vorgangs, ,idealer Construktion‘ etc. spricht, ohne damit ein Sein-sollendes zu meinen, ferner weil das, was Jellinek (Allg[emeine] Staatslehre) ,Idealtypus‘ nennt, als nur im logischen Sinn perfekt gedacht ist, nicht als Vorbild.“ Nun aber können natürlich auch diejenigen Gattungsbegriffe, die wir fortwährend als Bestandteile historischer Darstellungen und konkreter historischer Begriffe finden, durch Abstraktion und Steigerung bestimmter ihnen begriffswesentlicher Elemente als Idealty[218]pen geformt werden. Dies ist sogar ein praktisch besonders häufiger und wichtiger Anwendungsfall der idealtypischen Begriffe, und jeder individuelle Idealtypus setzt sich aus begrifflichen Elementen zusammen, die gattungsmäßig sind und als Idealtypen geformt worden sind. Auch in diesem Falle zeigt sich aber die spezifische logische Funktion der idealtypischen Begriffe. Ein einfacher Gattungsbegriff im Sinne eines Komplexes von Merkmalen, die an mehreren Erscheinungen gemeinsam sich vorfinden, ist z. B. der Begriff des „Tausches“, so lange ich von der Bedeutung der Begriffsbestandteile absehe, also einfach den Sprachgebrauch des Alltags analysiere. Setze ich diesen Begriff nun aber etwa zu dem „Grenznutzgesetz“44 [218]Vgl. oben, S. 202 mit Anm. 99. in Beziehung und bilde denf[218]A: der Begriff des „ökonomischen Tausches“ als eines ökonomisch rationalen Vorgangs, dann enthält dieser, wie jeder logisch voll entwickelte, Begriff ein Urteil über die „typischen“ Bedingungen des Tausches in sich. Er nimmt genetischen45 Vgl. oben, S. 203 mit Anm. 6, und S. 207 mit Anm. 15. Charakter an und wird damit zugleich im logischen Sinn idealtypisch, d. h. er entfernt sich von der empirischen Wirklichkeit, die nur mit ihm verglichen, auf ihn bezogen werden kann. Ähnliches gilt von allen sogenannten „Grundbegriffen“ der Nationalökonomie:46 Vgl. oben, S. 210 mit Anm. 28. sie sind in genetischer Form nur als Idealtypen zu entwickeln. Der Gegensatz zwischen einfachen Gattungsbegriffen, welche lediglich das empirischen Erscheinungen Gemeinsame zusammenfassen, und gattungsmäßigen Idealtypen – wie etwa eines ideal[A 76]typischen Begriffs des „Wesens“ des Handwerks – ist natürlich im einzelnen flüssig. Aber kein Gattungsbegriff hat als solcher „typischen“ Charakter, und einen reinen gattungsmäßigen „Durchschnitts“-Typus gibt es nicht. Wo immer wir – z. B. in der Statistik – von „typischen“ Größen reden, liegt mehr als ein bloßer Durchschnitt vor.47 So hat z. B. Lexis zwischen Durchschnitt und typischem Mittel unterschieden: „Hat man eine grössere Anzahl von Bestimmungen gleichartiger Grössen, so sind diese Einzelwerthe als typisch, d. h. als Näherungswerthe eines festen Grössentypus anzusehen, wenn sie sich nach dem durch die Function Fu gegebenen Wahrscheinlichkeitsgesetze des Zufalls um ihren Mittelwerth vertheilen. Der letztere stellt in diesem Falle die wahrscheinlichste Grösse des festen Grundwerthes dar und er besitzt daher [219]als ‚typisches Mittel‘ eine weit grössere sachliche Bedeutung als das arithmetische Mittel oder der Durchschnitt aus Grössen, welchen die obige Beziehung zu einem festen Werthe fehlt.“ Vgl. Lexis, Wilhelm, Theorie der Massenerscheinungen in der menschlichen Gesellschaft. Programm zur Uebernahme des Lehrstuhls der cameralistischen Fächer an der Grossherzoglich Badischen Universität Freiburg. – Freiburg i. Br.: Fr. Wagner 1877 (hinfort: Lexis, Massenerscheinungen), S. 34. Je mehr es sich um einfache Klassifikation von [219]Vorgängen handelt, die als Massenerscheinungen in der Wirklichkeit auftreten, desto mehr handelt es sich um Gattungsbegriffe, je mehr dagegen komplizierte historische Zusammenhänge in denjenigen ihrer Bestandteile, auf welchen ihre spezifische Kulturbedeutung ruht, begrifflich geformt werden, desto mehr wird der Begriff – oder das Begriffssystem – den Charakter des Idealtypus an sich tragen. Denn Zweck der idealtypischen Begriffsbildung ist es überall, nicht das Gattungsmäßige, sondern umgekehrt die Eigenart von Kulturerscheinungen scharf zum Bewußtsein zu bringen.
Die Tatsache, daß Idealtypen auch gattungsmäßigg[219]A: gattungsmäßige verwendet werden können und verwendet werden, bietet methodisches Interesse erst im Zusammenhang mit einem anderen Tatbestand.
Bisher haben wir die Idealtypen wesentlich nur als abstrakte Begriffe von Zusammenhängen kennen gelernt, welche als im Fluß des Geschehens verharrend, als historische Individuen, an denen sich Entwicklungen vollziehen, von uns vorgestellt werden. Nun aber tritt eine Komplikation ein, welche das naturalistische Vorurteil, daß das Ziel der Sozialwissenschaften die Reduktion der Wirklichkeit auf „Gesetze“ sein müsse, mit Hilfe des Begriffes des „Typischen“ außerordentlich leicht wieder hereinpraktiziert. Auch Entwicklungen lassen sich nämlich als Idealtypen konstruieren, und diese Konstruktionen können ganz erheblichen heuristischen Wert haben. Aber es entsteht dabei in ganz besonders hohem Maße die Gefahr, daß Idealtypus und Wirklichkeit ineinander geschoben werden. Man kann z. B. zu dem theoretischen Ergebnis gelangen, daß in einer streng „handwerksmäßig“ organisierten Gesellschaft die einzige Quelle der Kapitalakkumulation die Grundrente sein könne. Daraus kann man dann vielleicht – denn die Richtigkeit der Konstruktion wäre hier nicht zu untersuchen – ein rein durch bestimmte einfache Faktoren: – begrenzter Boden, steigende Volkszahl, Edelmetallzufluß, Rationalisierung der Lebensführung, – [220]bedingtes Idealbild einer Umbildung der handwerksmäßigen in die kapitalistische Wirtschaftsform konstruieren. Ob der empirisch-[A 77]historische Verlauf der Entwicklung tatsächlich der konstruierte gewesen ist, wäre nun erst mit Hilfe dieser Konstruktion als heuristischem Mittel zu untersuchen im Wege der Vergleichung zwischen Idealtypus und „Tatsachen“. War der Idealtypus „richtig“ konstruiert und entspricht der tatsächliche Verlauf dem idealtypischen nicht, so wäre damit der Beweis geliefert, daß die mittelalterliche Gesellschaft eben in bestimmten Beziehungen keine streng „handwerksmäßige“ war. Und wenn der Idealtypus in heuristisch „idealer“ Weise konstruiert war, – ob und wie dies in unserem Beispiel der Fall sein könnte, bleibt hier gänzlich außer Betracht, – dann wird er zugleich die Forschung auf den Weg lenken, der zu einer schärferen Erfassung jener nicht handwerksmäßigen Bestandteile der mittelalterlichen Gesellschaft in ihrer Eigenart und historischen Bedeutung führt. Er hat, wenn er zu diesem Ergebnis führt, seinen logischen Zweck erfüllt, gerade indem er seine eigene Unwirklichkeit manifestierte. Er war – in diesem Fall – die Erprobung einer Hypothese. Der Vorgang bietet keinerlei methodologische Bedenken, so lange man sich stets gegenwärtig hält, daß idealtypische Entwicklungskonstruktion und Geschichte zwei streng zu scheidende Dinge sind und daß die Konstruktion hier lediglich das Mittel war, planvoll die gültige Zurechnung48 [220]Vgl. oben, S. 185 mit Anm. 39. eines historischen Vorganges zu seinen wirklichen Ursachen aus dem Kreise der nach Lage unserer Erkenntnis möglichen zu vollziehen.49 Vgl. oben, S. 187 mit Anm. 45.
Diese Scheidung streng aufrecht zu erhalten wird nun erfahrungsgemäß durch einen Umstand oft ungemein erschwert. Im Interesse der anschaulichen Demonstration des Idealtypus oder der idealtypischen Entwicklung wird man sie durch Anschauungsmaterial aus der empirisch-historischen Wirklichkeit zu verdeutlichen suchen. Die Gefahr dieses an sich ganz legitimen Verfahrens liegt darin, daß das geschichtlicheh[220]A: geschichtlich Wissen hier einmal als Diener der Theorie erscheint statt umgekehrt. Die Versuchung liegt für den Theoretiker recht nahe, dieses Verhältnis entweder als das nor[221]male anzusehen, oder, was schlimmer ist, Theorie und Geschichte ineinander zu schieben und geradezu miteinander zu verwechseln. In noch gesteigertem Maße liegt dieser Fall dann vor, wenn die Idealkonstruktion einer Entwicklung mit der begrifflichen Klassifikation von Idealtypen bestimmter Kulturgebilde (z. B. der gewerblichen Betriebsformen von der „geschlossenen Hauswirtschaft“50[221] Für Bücher, Entstehung, S. 15, beginnt die volkswirtschaftliche Entwicklung mit der „geschlossenen Hauswirtschaft“. Vgl. oben, S. 203 mit Anm. 7. ausgehend, oder etwa der religiösen Begriffe, von den „Augenblicksgöttern“51 Vgl. Usener, Hermann, Götternamen. Versuch einer Lehre von der religiösen Begriffsbildung. – Bonn: Friedrich Cohen 1896, S. 279. anfangend), zu einer genetischen Klassifikation ineinander [A 78]gearbeitet wird. Die nach den gewählten Begriffsmerkmalen sich ergebende Reihenfolge der Typen erscheint dann als eine gesetzlich notwendige historische Aufeinanderfolge derselben. Logische Ordnung der Begriffe einerseits und empirische Anordnung des Begriffenen in Raum, Zeit und ursächlicher Verknüpfung andererseits erscheinen dann so miteinander verkittet, daß die Versuchung, der Wirklichkeit Gewalt anzutun, um die reale Geltung der Konstruktion in der Wirklichkeit zu erhärten, fast unwiderstehlich wird.
Absichtlich ist es vermieden worden, an dem für uns weitaus wichtigsten Fall idealtypischer Konstruktionen zu demonstrieren: an Marx. Es geschah, um die Darstellung nicht durch Hineinziehen von Marx-Interpretationen noch zu komplizieren und um den Erörterungen in unserer Zeitschrift, welche die Literatur, die über und im Anschluß an den großen Denker erwächst, zum regelmäßigen Gegenstand kritischer Analyse machen wird,52 Vgl. z. B. Schmidt, Conrad, Neuere Schriften von und über Karl Marx, in: AfSSp, Band 20, Heft 2, 1905, S. 386–412, sowie die Zusammenstellung des Schrifttums von Sombart, Werner, Ein Beitrag zur Bibliographie des Marxismus, ebd., S. 413–430. nicht vorzugreifen. Daher sei hier nur konstatiert, daß natürlich alle spezifisch-marxistischen „Gesetze“53 Etwa das „Gesetz des tendentiellen Falls der Profitrate“. Vgl. Marx, Karl, Das Kapital. Kritik der politischen Oekonomie, Band 3, Teil 1, Buch III: Der Gesammtprocess der kapitalistischen Produktion. Kapitel I bis XXVIII, hg. von Friedrich Engels. – Hamburg: Otto Meissner 1894, S. 191–249. und Entwicklungskonstruktionen ‒ soweit sie theoretisch fehlerfrei sind – idealtypischen Charakter haben. Die eminente, ja einzigartige heuristische Bedeutung dieser Idealtypen, wenn man sie zur Vergleichung der Wirklichkeit mit [222]ihnen benutzt und ebenso ihre Gefährlichkeit, sobald sie als empirisch geltend oder gar als reale (d. h. in Wahrheit metaphysische) „wirkende Kräfte“, „Tendenzen“ usw. vorgestellt werden, kennt jeder, der je mit marxistischen Begriffen gearbeitet hat.
Gattungsbegriffe – Idealtypen – idealtypische Gattungsbegriffe, ‒ Ideen im Sinne von empirisch in historischen Menschen wirksamen Gedankenverbindungen – Idealtypen solcher Ideen – Ideale, welche historische Menschen beherrschen – Idealtypen solcher Ideale – Ideale, auf welche der Historiker die Geschichte bezieht; ‒ theoretische Konstruktionen unter illustrativer Benutzung des Empirischen – geschichtliche Untersuchung unter Benutzung der theoretischen Begriffe als idealer Grenzfälle, – dazu dann die verschiedenen möglichen Komplikationen, die hier nur angedeutet werden konnten: lauter gedankliche Bildungen, deren Verhältnis zur empirischen Wirklichkeit des unmittelbar Gegebenen in jedem einzelnen Fall problematisch ist: – diese Musterkarte allein zeigt schon die unendliche Verschlungenheit der begrifflich-methodischen Probleme, welche auf dem Gebiet der Kulturwissenschaften fortwährend lebendig bleiben. Und wir mußten uns schlechthin versagen, auf die praktisch methodologischen Fragen hier, wo die Pro[A 79]bleme nur gezeigt werden sollten, ernstlich einzugehen, die Beziehungen der idealtypischen zur „gesetzlichen“ Erkenntnis, der idealtypischen Begriffe zu den Kollektivbegriffen usw. eingehender zu erörtern. ‒
Der Historiker wird nach allen diesen Auseinandersetzungen doch immer wieder darauf beharren, daß die Herrschaft der idealtypischen Form der Begriffsbildung und Konstruktion spezifische Symptome der Jugendlichkeit einer Disziplin seien. Und darin ist ihm in gewissem Sinne recht zu geben, freilich mit anderen Konsequenzen, als er sie ziehen wird. Nehmen wir ein paar Beispiele aus anderen Disziplinen. Es ist gewiß wahr: der geplagte Quartaner ebenso wie der primitive Philologe stellt sich zunächst eine Sprache „organisch“,54[222] Zur Vorstellung von Sprache als Organismus vgl. auch Humboldt, Wilhelm von, Ueber das vergleichende Sprachstudium in Beziehung auf die verschiedenen Epochen der Sprachentwicklung, in: ders., Gesammelte Werke, Band 3. – Berlin: G. Reimer 1843, S. 241–268, hier S. 241, 243; Humboldt, Wilhelm von, Ueber die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und ihren Einfluß auf die geistige Entwickelung [223]des Menschengeschlechts, in: ders., Gesammelte Werke, Band 6, ebd. 1848, S. 1–425, hier S. 2 f. Vgl. auch Becker, Karl Ferdinand, Organism der Sprache, 2., neubearbeitete Aufl. – Frankfurt am Main: G. F. Kettembeil 1841; Schleicher, August, Die deutsche Sprache. – Stuttgart: J. G. Cotta 1860, S. 33 ff. d. h. als ein von Normen beherrschtes überempiri[223]sches Ganzes vor, die Aufgabe der Wissenschaft aber als die: festzustellen, was – als Sprachregel – gelten solle. Die „Schriftsprache“ logisch zu bearbeiten wie etwa die Crusca55 Die Accademia della Crusca, 1583 in Florenz gegründet, gilt als älteste Sprachgesellschaft. es tat, ihren Gehalt auf Regeln zu reduzieren, ist die normalerweise erste Aufgabe, welche sich eine „Philologie“ stellt. Und wenn demgegenüber heute ein führender Philologe das „Sprechen jedes einzelnen“ als Objekt der Philologie proklamiert,56 Für Hermann Paul sind „das wahre object für den sprachforscher […] sämmtliche äusserungen der sprachthätigkeit an sämmtlichen individuen in ihrer wechselwirkung auf einander. Alle lautcomplexe, die irgend ein einzelner je gesprochen, gehört oder vorgestellt hat mit den damit associierten vorstellungen, deren symbole sie gewesen sind, alle die mannigfachen beziehungen, welche die sprachelemente in den seelen der einzelnen eingegangen sind, fallen in die sprachgeschichte, müssten eigentlich alle bekannt sein, um ein vollständiges verständnis der entwickelung zu ermöglichen.“ Vgl. Paul, Hermann, Principien der Sprachgeschichte. – Halle: Max Niemeyer 1880, S. 28 f. Zu Pauls Begriff der Kulturwissenschaft vgl. Rickert, Kulturwissenschaft (wie oben, S. 10, Anm. 62), S. 12, 22 ff. so ist selbst die Aufstellung eines solchen Programms nur möglich, nachdem in der Schriftsprache ein relativ fester Idealtypus vorliegt, mit welchem die sonst gänzlich orientierungs- und uferlose Durchforschung der unendlichen Mannigfaltigkeit des Sprechens (mindestens stillschweigend) operieren kann. ‒ Und nicht anders funktionierten die Konstruktionen der naturrechtlichen und der organischen Staatstheorien, oder etwa – um an einen Idealtypus in unserm Sinn zu erinnern – die Benjamin Constantsche Theorie des antiken Staats,57 Vgl. Constant, Benjamin, De la liberté des anciens comparée à celle des modernes. Discours prononcé à l’Athénée de Paris, in: Œuvres Politiques de Benjamin Constant, avec introduction, notes et index par Charles Louandre. – Paris: Charpentier et Cie 1874, S. 259–286. Constant spricht der antiken Demokratie, die den Bürgern keine individuelle Freiheit eingeräumt habe, ihren Vorbildcharakter ab. gewissermaßen als Nothäfen, bis man gelernt hatte, sich auf dem ungeheueren Meere der empirischen Tatsachen zurechtzufinden. Die reif werdende Wissenschaft bedeutet also in der Tat immer Überwindung des Idealtypus, sofern er als empirisch geltend oder als Gattungsbegriff gedacht wird. Allein nicht nur ist z. B. die Benutzung der geistvollen Constantschen Konstruktion zur Demonstration gewisser Seiten und [224]historischer Eigenarten antiken Staatslebens noch heute ganz legitim, sobald man sorgsam ihren idealtypischen Charakter festhält.58[224] Vgl. allerdings Jellinek, Staatslehre (wie oben, S. 91, Anm. 26), S. 267 f., 281 f., hier S. 281: „möge die namentlich aus dem dorischen Idealtypus und Plato zusammengestümperte Constant-Stahl-Mohl’sche Lehre von der Nichtanerkennung der individuellen Persönlichkeit in Hellas endlich aus der Literatur verschwinden. Der Grieche war Rechtssubjekt nicht nur um des Staates, sondern auch um seinetwillen“. Sondern vor allem: es gibt Wissenschaften, denen ewige Jugendlichkeit59 Ewige Jugend war um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert ein literarischer Topos u.a. bei Johannes Kessler, Leopold von Sacher-Masoch und Oscar Wilde sowie ein Leitthema der Jugend- und Lebensreformbewegung. beschieden ist, und das sind alle historischen Disziplinen, alle die, denen der ewig fortschreitende Fluß der Kultur stets neue [A 80]Problemstellungen zuführt. Bei ihnen liegt die Vergänglichkeit aller, aber zugleich die Unvermeidlichkeit immer neuer idealtypischer Konstruktionen im Wesen der Aufgabe.
Stets wiederholen sich die Versuche, den „eigentlichen“, „wahren“ Sinn historischer Begriffe festzustellen, und niemals gelangen sie zu Ende. Ganz regelmäßig bleiben infolgedessen die Synthesen, mit denen die Geschichte fortwährend arbeitet, entweder nur relativ bestimmte Begriffe, oder, sobald Eindeutigkeit des Begriffsinhaltes erzwungen werden soll, wird der Begriff zum abstrakten Idealtypus und enthüllt sich damit als ein theoretischer, also „einseitiger“ Gesichtspunkt, unter dem die Wirklichkeit beleuchtet, auf den sie bezogen werden kann, der aber zum Schema, in das sie restlos eingeordnet werden könnte, sich selbstverständlich als ungeeignet erweist. Denn keines jener Gedankensysteme, deren wir zur Erfassung der jeweils bedeutsamen Bestandteile der Wirklichkeit nicht entraten können, kann ja ihren unendlichen Reichtum erschöpfen. Keins ist etwas anderes als der Versuch, auf Grund des jeweiligen Standes unseres Wissens und der uns jeweils zur Verfügung stehenden begrifflichen Gebilde, Ordnung in das Chaos derjenigen Tatsachen zu bringen, welche wir in den Kreis unseres Interesses jeweils eingezogen haben. Der Gedankenapparat, welchen die Vergangenheit durch denkende Bearbeitung, das heißt aber in Wahrheit: denkende Umbildung60 Für Rickert impliziert wissenschaftliche Erkenntnis die „Umbildung“ oder „Umformung“ der Wirklichkeit. Vgl. Rickert, Grenzen, S. 229, 246, 249, 253, 602, 628, 642 f., 645, 657 f. der unmittelbar gegebe[225]nen Wirklichkeit und durch Einordnung in diejenigen Begriffe, die dem Stande ihrer Erkenntnis und der Richtung ihres Interesses entsprachen, entwickelt hat, steht in steter Auseinandersetzung mit dem, was wir an neuer Erkenntnis aus der Wirklichkeit gewinnen können und wollen. In diesem Kampf vollzieht sich der Fortschritt der kulturwissenschaftlichen Arbeit. Ihr Ergebnis ist ein steter Umbildungsprozeß jener Begriffe, in denen wir die Wirklichkeit zu erfassen suchen. Die Geschichte der Wissenschaften vom sozialen Leben ist und bleibt daher ein steter Wechsel zwischen dem Versuch, durch Begriffsbildung Tatsachen gedanklich zu ordnen,61[225] Vgl. oben, S. 148 mit Anm. 30. ‒ der Auflösung der so gewonnenen Gedankenbilder durch Erweiterung und Verschiebung des wissenschaftlichen Horizontes, – und der Neubildung von Begriffen auf der so veränderten Grundlage. Nicht etwa das Fehlerhafte des Versuchs, Begriffssysteme überhaupt zu bilden, spricht sich darin aus: – eine jede Wissenschaft, auch die einfach darstellende Geschichte, arbeitet mit dem Begriffsvorrat ihrer Zeit –[,] sondern der Umstand kommt [A 81]darin zum Ausdruck, daß in den Wissenschaften von der menschlichen Kultur die Bildung der Begriffe von der Stellung der Probleme abhängt, und daß diese letztere wandelbar ist mit dem Inhalt der Kultur selbst. Das Verhältnis von Begriff und Begriffenemi[225]A: Begriffenen in den Kulturwissenschaften bringt die Vergänglichkeit jeder solchen Synthese mit sich. Große begriffliche Konstruktionsversuche haben auf dem Gebiet unserer Wissenschaft ihren Wert regelmäßig gerade darin gehabt, daß sie die Schranken der Bedeutung desjenigen Gesichtspunktes, der ihnen zugrunde lag, enthüllten. Die weittragendsten Fortschritte auf dem Gebiet der Sozialwissenschaften knüpfen sich sachlich an die Verschiebung der praktischen Kulturprobleme und kleiden sich in die Form einer Kritik der Begriffsbildung. Es wird zu den vornehmsten Aufgaben unserer Zeitschrift gehören, dem Zweck dieser Kritik und damit der Untersuchung der Prinzipien der Synthese auf dem Gebiet der Sozialwissenschaft zu dienen. ‒
Bei den Konsequenzen, die aus dem Gesagten zu ziehen sind, gelangen wir nun an einen Punkt, wo unsere Ansichten sich vielleicht hier und da von denen mancher, auch hervorragender, Ver[226]treter der historischen Schule, zu deren Kindern wir ja selbst gehören, scheiden. Diese letzteren nämlich verharren vielfach ausdrücklich oder stillschweigend in der Meinung, es sei das Endziel, der Zweck, jeder Wissenschaft, ihren Stoff in einem System von Begriffen zu ordnen, deren Inhalt durch Beobachtung empirischer Regelmäßigkeiten, Hypothesenbildung und Verifikation derselben zu gewinnen und langsam zu vervollkommnen sei, bis irgend wann eine „vollendete“ und deshalb deduktive Wissenschaft daraus entstanden sei.62[226] Vgl. Schmoller, Methodologie, S. 979: „alle vollendete Wissenschaft ist deduktiv“. Vgl. Weber, Roscher und Knies 1, oben, S. 60, Fn. 26. Für dieses Ziel sei die historisch-induktive Arbeit der Gegenwart eine durch die Unvollkommenheit unserer Disziplin bedingte Vorarbeit: nichts muß naturgemäß vom Standpunkt dieser Betrachtungsweise aus bedenklicher erscheinen, als die Bildung und Verwendung scharfer Begriffe, die ja jenes Ziel einer fernen Zukunft voreilig vorweg zu nehmen trachten müßte. ‒ Prinzipiell unanfechtbar wäre diese Auffassung auf dem Boden der antik-scholastischen Erkenntnislehre, welche denn auch der Masse der Spezialarbeiter der historischen Schule noch tief im Blute steckt: Als Zweck der Begriffe wird vorausgesetzt, vorstellungsmäßige Abbilder der „objektiven“ Wirklichkeit zu sein: daher der immer wiederkehrende Hinweis auf die Unwirklichkeit aller scharfen Begriffe. Wer den Grundgedanken der auf Kant zurückgehenden modernen Erkenntnis[A 82]lehre: daß die Begriffe vielmehr gedankliche Mittel zum Zweck der geistigen Beherrschung des empirisch Gegebenen sind und allein sein können,63 Vgl. Kant, Kritik, S. 21 ff. (B XVI ff.). Mit einer Anstreichung im Handexemplar (Max Weber-Arbeitsstelle, BAdW München). zu Ende denkt, dem wird der Umstand, daß scharfe genetische Begriffe notwendig Idealtypen sind, nicht gegen die Bildung von solchen sprechen können. Ihm kehrt sich das Verhältnis von Begriff und historischer Arbeit um: Jenes Endziel erscheint ihm logisch unmöglich, die Begriffe nicht Ziel, sondern Mittel zum Zweck der Erkenntnis der unter individuellen Gesichtspunkten bedeutsamen Zusammenhänge: gerade weil die Inhalte der historischen Begriffe notwendig wandelbar sind, müssen sie jeweils notwendig scharf formuliert werden. Er wird nur das Verlangen stellen, daß bei ihrer Verwendung stets ihr Charakter als idealer Gedankengebilde sorgsam fest[227]gehalten, Idealtypus und Geschichte nicht verwechselt werde. Er wird, da wirklich definitive historische Begriffe bei dem unvermeidlichen Wechsel der leitenden Wertideen als generelles Endziel nicht in Betracht kommen, glauben, daß eben dadurch, daß für den einzelnen, jeweils leitenden Gesichtspunkt, scharfe und eindeutige Begriffe gebildet werden, die Möglichkeit gegeben sei, die Schranken ihrer Geltung jeweils klar im Bewußtsein zu behalten.
Man wird nun darauf hinweisen, und wir haben es selbst zugegeben,64[227] Oben, S. 206 ff. daß ein konkreter historischer Zusammenhang65 Vgl. Rickert, Grenzen, S. 392 ff. im einzelnen Fall sehr wohl in seinem Ablauf anschaulich gemacht werden könne, ohne daß er fortwährend mit definierten Begriffen in Beziehung gesetzt werde. Und man wird demgemäß für den Historiker unserer Disziplin in Anspruch nehmen, daß er ebenso, wie man dies von dem politischen Historiker gesagt hat, die „Sprache des Lebens“ reden dürfe.66 Theodor Mommsen formuliert mit Bezug auf den „Rhetor und Romanschreiber“ Hegesias von Magnesia und seine Anhänger, die sich gegen den „orthodoxen Atticismus“ auflehnten: „Sie forderten das Bürgerrecht für die Sprache des Lebens, ohne Unterschied, ob das Wort und die Wendung in Attica entstanden sei oder in Karien und Phrygien; sie selber sprachen und schrieben nicht für den Geschmack der gelehrten Cliquen, sondern für den des großen Publicums.“ Vgl. Mommsen, Theodor, Römische Geschichte, Band 3: Von Sullas Tode bis zur Schlacht von Thapsus, 2. Aufl. ‒ Berlin: Weidmann 1857, S. 557. Gewiß! Nur ist dazu zu sagen, daß es bei diesem Verfahren bis zu einem oft sehr hohen Grade notwendig Zufall bleibt, ob der Gesichtspunkt, unter welchem der behandelte Vorgang Bedeutung gewinnt, zu klarem Bewußtsein gelangt. Wir sind im allgemeinen nicht in der günstigen Lage des politischen Historikers, bei welchem die Kulturinhalte, auf die er seine Darstellung bezieht, regelmäßig eindeutig sind – oder zu sein scheinen. Jeder nur anschaulichen Schilderung haftet die Eigenart der Bedeutung künstlerischer Darstellung67 Für Rickert, Grenzen, S. 387, macht die „Anschaulichkeit der Wirklichkeit“ die „künstlerische Schilderung unentbehrlich“, wodurch die Wissenschaft aber nicht zur Kunst wird, ist doch „für den Künstler die anschauliche Darstellung Zweck, für den Historiker dagegen nur Mittel“. Auch Gervinus, Historik, S. 366, betont, daß ein „denkender Historiker“ weder ein „historischer Poet“ noch ein „poetischer Historiker“, sondern „bloß ein sinnvoll ordnender und künstlerisch darstellender Historiker werden will“. Zur Funktion der Phantasie vgl. oben, S. 186 f. mit Anm. 44. an: „Ein jeder sieht, was er im Herzen trägt,“68 Vgl. Goethe, Faust I, S. 9. – gültige Urteile setzen überall die logische [228]Bearbeitung des Anschaulichen, das heißt die Verwendung von Begriffen voraus, und es ist zwar möglich und oft ästhetisch reizvoll, diese in petto69[228] Ital.: im Herzen, im Sinn. zu behalten, aber es gefährdet [A 83]stets die Sicherheit der Orientierung des Lesers, oft die des Schriftstellers selbst, über Inhalt und Tragweite seiner Urteile.
Ganz hervorragend gefährlich aber kann nun die Unterlassung scharfer Begriffsbildung für praktische, wirtschafts- und sozialpolitische Erörterungen werden. Was hier z. B. die Verwendung des Terminus „Wert“ – jenes Schmerzenskindes unserer Disziplin,70 Vgl. oben, S. 210 mit Anm. 28. welchem eben nur idealtypisch irgend ein eindeutiger Sinn gegeben werden kann –, oder Worte wie „produktiv“, „vom volkswirtschaftlichen Standpunkt“ usw., die überhaupt keiner begrifflich klaren Analyse standhalten, für Verwirrung gestiftet haben, ist für den Außenstehenden geradezu unglaublich. Und zwar sind es hier vornehmlich die der Sprache des Lebens entnommenen Kollektivbegriffe, welche Unsegen stiften.71 Vgl. Sigwart, Logik II (wie oben, S. 5, Anm. 31), S. 258 ff. Den Forschungsstand zum Kollektivbegriff hat Kistiakowski rekonstruiert, ein Schüler Wilhelm Windelbands und Georg Simmels, zu dem Weber Anfang 1905 in Kontakt tritt. Vgl. das Kapitel „Kollektivbegriffe und Kollektivwesen“ in: Kistiakowski, Theodor, Gesellschaft und Einzelwesen. Eine methodologische Studie. – Berlin: Otto Liebmann 1899 (hinfort: Kistiakowski, Gesellschaft), hier S. 111 ff. Man nehme, um ein für den Laien möglichst durchsichtiges Schulbeispiel herauszugreifen, den Begriff „Landwirtschaft“, wie er in der Wortverbindung „Interessen der Landwirtschaft“ auftritt. Nehmen wir zunächst die „Interessen der Landwirtschaft“ als die empirisch konstatierbaren mehr oder minder klaren subjektiven Vorstellungen der einzelnen wirtschaftenden Individuen von ihren Interessen, und sehen wir dabei ganz und gar von den unzähligen Konflikten der Interessen viehzüchtender, viehmästender, kornbauender, kornverfütternder, schnapsdestillierender etc. Landwirte hier ab, so kennt zwar nicht jeder Laie, aber doch jeder Fachmann den gewaltigen Knäuel von durch- und gegeneinander laufenden Wertbeziehungen,72 Vgl. oben, S. 153 f. mit Anm. 43, S. 166 mit Anm. 71, und S. 189 mit Anm. 53. der darunter unklar vorgestellt wird. Wir wollen hier nur einige wenige aufzählen: Interessen von Landwirten, welche ihr Gut verkaufen wollen und deshalb lediglich an einer schnellen Hausse des Bodenpreises [229]interessiert sind; das gerade entgegengesetzte Interesse von solchen, die sich ankaufen, arrondieren oder pachten wollen; das Interesse derjenigen, die ein bestimmtes Gut ihren Nachfahren um sozialer Vorteile willen zu erhalten wünschen und deshalb an Stabilität des Bodenbesitzes interessiert sind; – das entgegengesetzte Interesse solcher, die in ihrem und ihrer Kinder Interesse Bewegung des Bodens in der Richtung zum besten Wirt oder – was nicht ohne weiteres dasselbe ist – zum kapitalkräftigsten Käufer wünschen; – das rein ökonomische Interesse der im privatwirtschaftlichen Sinne „tüchtigsten Wirte“73[229] Die „Bewegung des Besitzes zu dem tüchtigsten Wirthe“ bzw. des „Bodens zum besten Wirth“ war eine unter Nationalökonomen verbreitete Formulierung. Vgl. z. B. Buchenberger, Adolf, Agrarwesen und Agrarpolitik, Band 2. – Leipzig: C. F. Winter 1893, S. 272 f. an ökonomischer Bewegungsfreiheit; – das damit im Konflikt stehende Interesse bestimmter herrschender Schichten an der Erhaltung der überkommenen sozialen und politischen Position des eigenen „Standes“ und damit der eigenen Nachkommen; – das soziale der [A 84]nicht herrschenden Schichten der Landwirte am Wegfall jener oberen, ihre eigene Position drückenden Schichten; – ihr unter Umständen damit kollidierendes Interesse, in jenen politische Führer zur Wahrung ihrer Erwerbsinteressen zu besitzen; – die Liste könnte noch gewaltig vermehrt werden, ohne ein Ende zu finden, obwohl wir so summarisch und unpräzis wie nur möglich verfahren sind. Daß sich mit den mehr „egoistischen“ Interessen dieser Art die verschiedensten rein idealen Werte mischen, verbinden, sie hemmen und ablenken können, übergehen wir, um uns vor allem zu erinnern, daß, wenn wir von „Interessen der Landwirtschaft“ reden, wir regelmäßig nicht nur an jene materiellen und idealen Werte denken, auf welche die jeweiligen Landwirte selbst ihre „Interessen“ beziehen, sondern daneben an die zum Teil ganz heterogenen Wertideen, auf welche wir die Landwirtschaft beziehen können, – beispielsweise: Produktionsinteressen, hergeleitet aus dem Interesse billiger und dem damit nicht immer zusammenfallenden Interesse qualitativ guter Ernährung der Bevölkerung, wobei die Interessen von Stadt und Land in den mannigfachsten Kollisionen liegen können, und wobei das Interesse der gegenwärtigen Generation mit den wahrscheinlichen Interessen künftiger Generationen keineswegs iden[230]tisch sein muß; – populationistische Interessen: insbesondere Interesse an einer zahlreichen Landbevölkerung, hergeleitet, sei es aus Interessen „des Staates“, machtpolitischen oder innerpolitischen, oder aus anderen ideellen Interessen von unter sich verschiedener Art, z. B. an dem erwarteten Einfluß einer zahlreichen Landbevölkerung auf die Kultureigenart eines Landes; – dies populationistische Interesse kann mit den verschiedensten privatwirtschaftlichen Interessen aller Teile der Landbevölkerung, ja denkbarerweise mit allen Gegenwartsinteressen der Masse der Landbevölkerung kollidieren. Oder etwa das Interesse an einer bestimmten Art der sozialen Gliederung der Landbevölkerung wegen der Art der politischen oder Kultureinflüsse, die sich daraus ergeben: dies Interesse kann je nach seiner Richtung mit allen denkbaren, auch den dringlichsten Gegenwarts- und Zukunftsinteressen der einzelnen Landwirte sowohl wie „des Staates“ kollidieren. Und – dies kompliziert die Sache weiter – der „Staat“, auf dessen „Interesse“ wir solche und zahlreiche andere ähnliche Einzelinteressen gern beziehen, ist uns dabei ja oft nur Deckadresse für ein in sich höchst verschlungenes Knäuel von Wertideen, auf die er seinerseits von uns im einzelnen Falle bezogen wird: rein militärische [A 85]Sicherung nach außen; Sicherung der Herrscherstellung einer Dynastie oder bestimmter Klassen nach innen; Interesse an der Erhaltung und Erweiterung der formal-staatlichen Einheit der Nation, um ihrer selbst willen oder im Interesse der Erhaltung bestimmter objektiver, unter sich wieder sehr verschiedener Kulturwerte, die wir als staatlich geeintes Volk zu vertreten glauben; Umgestaltung des sozialen Charakters des Staates im Sinne bestimmter, wiederum sehr verschiedener Kulturideale – es würde zu weit führen, auch nur anzudeuten, was alles unter dem Sammelnamen „staatlicher Interessen“ läuft, auf die wir „die Landwirtschaft“ beziehen können. Das hier gewählte Beispiel und noch mehr unsere summarische Analyse sind plump und einfach. Der Laie möge sich nun einmal etwa den Begriff „Klasseninteresse der Arbeiter“ ähnlich (und gründlicher) analysieren, um zu sehen, welch widerspruchsvoller Knäuel teils von Interessen und Idealen der Arbeiter, teils von Idealen, unter denen wir die Arbeiter betrachten, dahinter steckt. Es ist unmöglich, die Schlagworte des Interessenkampfes durch rein empiristische Betonung ihrer „Relativität“ zu überwinden: klare, scharfe, begriffliche Feststellung der verschiedenen möglichen Gesichtspunkte ist der [231]einzige Weg, der hier über die Unklarheit der Phrase hinausführt. Das „Freihandelsargument“74[231] Das Freihandelsargument richtete sich gegen die Einführung von Schutzzöllen, die in den Worten Lujo Brentanos, eines Befürworters des Freihandels, „im Sonderinteresse bestimmter Kreise die Benutzung eines Fortschrittes verhindert, welcher der nationalen Arbeit größere Erträge abwerfen würde“. Vgl. Brentano, Lujo, Das Freihandelsargument. – Berlin-Schöneberg: Buchverlag der Hilfe 1901, S. 7 f. Zur Freihandelsschule vgl. Weber, Roscher und Knies 2, unten, S. 244 mit Anm. 7. als Weltanschauung oder gültige Norm ist eine Lächerlichkeit, aber schweren Schaden hat es für unsere handelspolitischen Erörterungen mit sich gebracht – und zwar ganz gleichgültig, welche handelspolitischen Ideale der einzelne vertreten will –[,] daß wir die in solchen idealtypischen Formeln niedergelegte alte Lebensweisheit der größten Kaufleute der Erde in ihrem heuristischen Wert unterschätzt haben.75 Möglicherweise Anspielung auf Ricardo, der selbst ein Vermögen an der Börse gemacht hatte und zu den reichsten Briten seiner Zeit zählte, besonders auf dessen Theorem der komparativen Kostenvorteile, mit dem er den Freihandel begründete. Vgl. Ricardo, Principles (wie oben, S. 4, Anm. 26), S. 146 ff. Nur durch idealtypische Begriffsformeln werden die Gesichtspunkte, die im Einzelfalle in Betracht kommen, in ihrer Eigenart im Wege der Konfrontierung des Empirischen mit dem Idealtypus wirklich deutlich. Der Gebrauch der undifferenzierten Kollektivbegriffe, mit denen die Sprache des Alltags arbeitet, ist stets Deckmantel von Unklarheiten des Denkens oder Wollens, oft genug das Werkzeug bedenklicher Erschleichungen,76 Vgl. oben, S. 215 mit Anm. 35. immer aber ein Mittel, die Entwicklung der richtigen Problemstellung zu hemmen.
Wir sind am Ende dieser Ausführungen, die lediglich den Zweck verfolgten, die oft haarfeine Linie, welche Wissenschaft und Glauben scheidet, hervortreten und den Sinn sozialökonomischen Erkenntnisstrebens erkennen zu lassen. Die objektive Gültigkeit alles [A 86]Erfahrungswissens beruht darauf und nur darauf, daß die gegebene Wirklichkeit nach Kategorien geordnet wird, welche in einem spezifischen Sinn subjektiv, nämlich die Voraussetzung unserer Erkenntnis darstellend, und an die Voraussetzung des Wertes derjenigen Wahrheit gebunden sind, die das Erfahrungswissen allein uns zu geben vermag. Wem diese Wahrheit nicht wertvoll ist, – und der Glaube an den Wert wissenschaftlicher Wahrheit ist Produkt bestimmter Kulturen und nichts Naturgegebenes – dem haben wir mit den Mitteln unserer Wissenschaft nichts zu bieten. Freilich [232]wird er vergeblich nach einer anderen Wahrheit suchen, die ihm die Wissenschaft in demjenigen ersetzt, was sie allein leisten kann: Begriffe und Urteile, die nicht die empirische Wirklichkeit sind, auch nicht sie abbilden, aber sie in gültiger Weise denkend ordnen lassen.77[232] Vgl. oben, S. 148 mit Anm. 30. Auf dem Gebiet der empirischen sozialen Kulturwissenschaften ist, so sahen wir,78 Oben, S. 189 ff. die Möglichkeit sinnvoller Erkenntnis des für uns Wesentlichen in der unendlichen Fülle des Geschehens gebunden an die unausgesetzte Verwendung von Gesichtspunkten spezifisch besonderten Charakters, welche alle in letzter Instanz ausgerichtet sind auf Wertideen, die ihrerseits zwar empirisch als Elemente alles sinnvollen menschlichen Handelns konstatierbar und erlebbar, nicht aber aus dem empirischen Stoff als geltend begründbar sind. Die „Objektivität“79 Vgl. oben, S. 153 f. mit Anm. 43. sozialwissenschaftlicher Erkenntnis hängt vielmehr davon ab, daß das empirisch Gegebene zwar stets auf jene Wertideen, die ihr allein Erkenntniswert verleihen, ausgerichtet, in ihrer Bedeutung aus ihnen verstanden, dennoch aber niemals zum Piedestal für den empirisch unmöglichen Nachweis ihrer Geltung gemacht wird. Und der uns allen in irgend einer Form innewohnende Glaube an die überempirische Geltung letzter und höchster Wertideen, an denen wir den Sinn unseres Daseins verankern,80 Vgl. Rickert, Kulturwissenschaft (wie oben, S. 10, Anm. 62), S. 68: „An objektive Werthe aber, deren Geltung die Voraussetzung […] für die Arbeit in den Kulturwissenschaften selbst bildet, glauben wir im Grunde Alle“. Rickert bekräftigt diesen Glauben mit den „schönen Worte[n]“, die Riehl am Ende einer Nietzsche-Studie gefunden hat: „Immer wird der Mensch an das Uebermenschliche glauben, mag er es nun das Göttliche nennen, oder das Ideale. Ohne ein Ideal über sich zu haben, kann der Mensch im geistigen Sinne des Wortes nicht aufrecht gehen. Dieses Uebermenschliche, Vorbildliche ist die Welt der geistigen Werte; – auch der Grösste hat diese Welt noch über sich, wie er sie zugleich in sich trägt. Diese Werte aber, die das Handeln der Menschen leiten und seine Gesinnung beseelen, werden nicht erfunden, oder durch Umwertung neu geprägt; sie werden entdeckt und gleichwie die Sterne am Himmel treten sie nach und nach mit dem Fortschritte der Kultur in den Gesichtskreis der Menschen. Es sind nicht alte Werte, nicht neue Werte, es sind die Werte.“ Vgl. Riehl, Alois, Friedrich Nietzsche. Der Künstler und der Denker. – Stuttgart: Fr. Frommann (E. Hauff) 1897, S. 132. Webers Handexemplar dieses Werks befindet sich in der Max Weber-Arbeitsstelle, BAdW München. schließt die unausgesetzte Wandelbarkeit der konkreten Gesichtspunkte, unter denen die empirische Wirklichkeit Bedeutung erhält, nicht etwa aus, sondern ein: das Leben in [233]seiner irrationalen Wirklichkeit, und sein Gehalt an möglichen Bedeutungen sind unausschöpfbar, die konkrete Gestaltung der Wertbeziehung bleibt daher fließend, dem Wandel unterworfen in die dunkle Zukunft der menschlichen Kultur hinein. Das Licht, welches jene höchsten Wertideen spenden, fällt jeweilig auf einen stets wechselnden endlichen Teil des ungeheuren chaotischen Stromes von Geschehnissen,81[233] Vgl. oben, S. 193 f. mit Anm. 69. der sich durch die Zeit dahinwälzt. ‒
Das alles möge nun nicht dahin mißverstanden werden, daß [A 87]die eigentliche Aufgabe der Sozialwissenschaft eine stete Hetzjagd nach neuen Gesichtspunkten und begrifflichen Konstruktionen sein solle. Im Gegenteil: nichts sollte hier schärfer betont werden als der Satz, daß der Dienst an der Erkenntnis der Kulturbedeutung konkreter historischer Zusammenhänge ausschließlich und allein das letzte Ziel ist, dem, neben anderen Mitteln, auch die begriffsbildende und begriffskritische Arbeit dienen will. – Es gibt, um mit F[riedrich] Th[eodor] Vischer zu reden, auch auf unserem Gebiete „Stoffhuber“ und „Sinnhuber“.82 Vischer hat unter dem Pseudonym Deutobold Symbolizetti Allegoriowitsch Mystifizinsky den zweiten Teil des „Faust“ parodiert und die Interpreten, die sich an Goethes Alterswerk zu Tode deuteten, in Stoff- und Sinnhuber eingeteilt. Vgl. [Vischer, Friedrich Theodor,] Faust. Der Tragödie dritter Theil. Treu im Geiste des zweiten Theils des Götheschen Faust gedichtet, 2., umgearbeitete und vermehrte Aufl. – Tübingen: Laupp 1886, S. 161 ff. Der tatsachengierige Schlund der ersteren ist nur durch Aktenmaterial, statistische Folianten und Enqueten zu stopfen, für die Feinheit des neuen Gedankens ist er unempfindlich. Die Gourmandise der letzteren verdirbt sich den Geschmack an den Tatsachen durch immer neue Gedankendestillate. Jene echte Künstlerschaft, wie sie z. B. unter den Historikern Ranke in so grandiosem Maße besaß, pflegt sich darin gerade zu manifestieren, daß sie durch Beziehung bekannter Tatsachen auf bekannte Gesichtspunkte dennoch ein Neues zu schaffen weiß.
Alle kulturwissenschaftliche Arbeit in einer Zeit der Spezialisierung wird, nachdem sie durch bestimmte Problemstellungen einmal auf einen bestimmten Stoff hin ausgerichtet ist und sich ihre methodischen Prinzipien geschaffen hat, die Bearbeitung dieses Stoffes als Selbstzweck betrachten, ohne den Erkenntniswert der einzelnen Tatsachen stets bewußt an den letzten Wertideen zu kontrollieren, ja ohne sich ihrer Verankerung an diesen Wertideen [234]überhaupt bewußt zu bleiben. Und es ist gut so. Aber irgendwann wechselt die Farbe: die Bedeutung der unreflektiert verwerteten Gesichtspunkte wird unsicher, der Weg verliert sich in die Dämmerung. Das Licht der großen Kulturprobleme ist weiter gezogen. Dann rüstet sich auch die Wissenschaft, ihren Standort und ihren Begriffsapparat zu wechseln und aus der Höhe des Gedankens auf den Strom des Geschehens zu blicken. Sie zieht jenen Gestirnen nach, welche allein ihrer Arbeit Sinn und Richtung zu weisen vermögen:
„… der neue Trieb erwacht,
Ich eile fort, ihr ew’ges Licht zu trinken,
Vor mir den Tag und hinter mir die Nacht,
Den Himmel über mir und unter mir dieWellen.“j[234]Petitdruck in A. 83[234] Goethe, Faust I, S. 45.